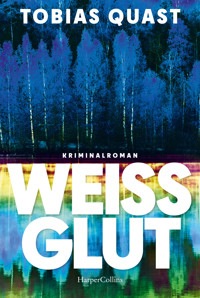4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein düsteres Schloss im Moor, ein grausames Geheimnis und ein Albtraum, aus dem es kein Erwachen gibt: Gekonnt lässt Tobias Quast in seinem Horror-Thriller »Raubtieraugen« die anfängliche leise Beunruhigung zu wahrem Grauen anwachsen. In London scheint der Münchner Julius am Ziel seiner Träume angekommen – doch dann steht er plötzlich ohne Job und ohne Wohnung da, und das ausgerechnet, als seine 6-jährige Tochter Emilia zu Besuch ist. Ein glücklicher Zufall beschert den beiden eine Einladung auf Wargrave Castle, den Familiensitz der Hardings in den North York Moors. In dem düsteren Schloss verschwindet jedoch nicht nur Juliusʼ Handy spurlos und er hört Schritte, wo niemand ist: Die Hardings sind so begeistert von Emilia, dass Julius seine Tochter kaum noch zu Gesicht bekommt. Was dann geschieht, übersteigt selbst seine finstersten Albträume … Der Horror-Thriller punktet nicht nur mit der unheimlichen Atmosphäre eines alten englischen Schlosses, in dessen zugigen Gemäuern sich mehr als ein Geheimnis verbirgt – er überrascht am Ende auch gekonnt mit einem echten Twist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 553
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Tobias Quast
Raubtieraugen
Horrorthriller
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Ein düsteres Schloss im Moor, ein grausames Geheimnis und ein Albtraum, aus dem es kein Erwachen gibt:
In London scheint der Münchner Julius am Ziel seiner Träume angekommen – doch dann steht er plötzlich ohne Job und ohne Wohnung da, und das ausgerechnet, als seine 6-jährige Tochter Emilia zu Besuch ist. Ein glücklicher Zufall beschert den beiden eine Einladung auf Wargrave Castle, den Familiensitz der Hardings in den North York Moors.
In dem düsteren Schloss verschwindet jedoch nicht nur Juliusʼ Handy spurlos und er hört Schritte, wo niemand ist: Die Hardings sind so begeistert von Emilia, dass Julius seine Tochter kaum noch zu Gesicht bekommt. Was dann geschieht, übersteigt selbst seine finstersten Albträume …
Inhaltsübersicht
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Einundzwanzigstes Kapitel
Zweiundzwanzigstes Kapitel
Dreiundzwanzigstes Kapitel
Vierundzwanzigstes Kapitel
Fünfundzwanzigstes Kapitel
Sechsundzwanzigstes Kapitel
Siebenundzwanzigstes Kapitel
Achtundzwanzigstes Kapitel
Neunundzwanzigstes Kapitel
Dreißigstes Kapitel
Einunddreißigstes Kapitel
Zweiunddreißigstes Kapitel
Dreiunddreißigstes Kapitel
Erstes Kapitel
München, 1945
Der Viktualienmarkt liegt immer noch in Trümmern. Natürlich tut er das. Sie weiß gar nicht, warum sie für einen Augenblick überrascht ist. Die aufgehende Sonne taucht den Platz in ein friedliches, ja schönes Licht, das so gar nicht zu der Szenerie der Zerstörung passen will. Aus Gewohnheit lässt sie ihren Blick prüfend über den Himmel schweifen, heute noch, vier Monate nach Kriegsende. Auch nachts meint sie weiterhin, die Sirenen zu hören. Die heranfliegenden Maschinen. Die Explosionen. Die Schreie. All dies hört sie jede Nacht, egal, ob sie schläft oder wach ist. Eine Stimme in ihr bemerkt voller Überzeugung, vielleicht sogar mit einer Spur Hohn, dass dieser Zustand für den Rest ihres Lebens fortbestehen wird. Wie ein Geschwür hat der Krieg sich in ihr festgesetzt. Das Grauen. Es wird niemals wieder verschwinden.
Mit einer schmutzigen Hand wischt sie sich über die Stirn. Seit Tagen fühlt sie sich unwohl, fiebrig. Sie verbirgt es vor den anderen. Vor ihrem Kind vor allem. Helmut ist bereits verstört genug. Sie kann ihn kaum bei ihrer Schwester Helene lassen. Wenn sie sich nur drei Schritte von ihm entfernt, fängt er haltlos an zu schreien und zu weinen – sechs Jahre ist er schon alt, doch für sie immer noch der Kleine. Dabei haben sie so viel Glück gehabt. Helenes Wohnung platzt aus allen Nähten, doch sie sind bei ihr untergekommen und haben ein Dach über dem Kopf. Natürlich, von Franz hat sie noch nichts gehört, weiß nicht, ob er überhaupt noch am Leben ist. Wenn sie aufrichtig ist, ist das im Augenblick ihre geringste Sorge. Etwas Essbares aufzutreiben, das ist ihr Anliegen. Deshalb ist sie bereits so früh in der zerbombten Stadt unterwegs. Schreitet mit einem leichten Humpeln durch die Berge aus Schutt, umrundet trostlose Häuserskelette. Eine steinerne Wüste.
Erstaunlich ruhig ist es an diesem Morgen. Kaum jemand ist unterwegs. Auch Armeefahrzeuge sind nur selten zu sehen. Vorsichtig tritt sie in ihren löchrigen Schuhen über einen Haufen von Betongeröll.
Sie stockt, bleibt am Rande der Überreste eines zerstörten Hauses stehen. Mühsam bückt sie sich. Die Kopfschmerzen schwellen zu einem heftigen Pochen an. Leise stöhnt sie auf, kämpft gegen den Schwindel. Sie richtet sich wieder auf und betrachtet den Gegenstand, den sie auf der flachen Hand hält. Ein Haargummi. Ein wunderschönes Haargummi, mit einem großen Marienkäfer darauf. Die Punkte sind aus winzigen Steinen, und sie funkeln im Sonnenlicht. Sie lächelt versonnen, hält das Schmuckstück mal in diesem Winkel, mal in jenem gegen den strahlend blauen Himmel. Dann hört sie etwas Dumpfes. Wie ein Schlag gegen eine geschlossene Tür. Sie spitzt die Ohren, runzelt die Stirn, schaut sich um. Niemand ist zu sehen, sie steht alleine in der unwirklichen Wüste aus Zerstörung. Da, abermals das Geräusch. Lauter diesmal, und es kommt von unten. Ihr Blick sucht den Boden ab. Sie macht zwei Schritte in die Ruine hinein, bleibt stehen. Einige Meter entfernt sieht sie ein Loch klaffen. Der Eingang zu einem Keller. Regungslos verharrt sie im Morgenlicht und starrt auf das Loch, konzentriert sich. Es bleibt still. Lediglich ein Vogel tschilpt irgendwo in der Nähe, als ob er sie auslacht.
Vielleicht sind es Ratten gewesen, denkt sie. Ratten scheinen die einzigen Lebewesen zu sein, denen der Krieg nichts angehabt hat. Sie dreht sich gerade um, da ertönt ein Schrei. Voller Todesangst. Gefolgt von einem weiteren Ruf, leiser diesmal. Wie erstickt. Der Schrei einer Frau?
Ihr stellen sich die Nackenhaare auf. Wie versteinert blickt sie auf das schwarze Loch, aus dem die dumpfen Schreie zu ihr dringen. Nun wollen sie gar nicht mehr abreißen. Der schwarze Schlund. Ihr wird übel. Doch sie kann sich nicht bewegen. Es klingt, als kämpfe jemand um sein Leben. Sie hört ein Reißen, ein Schmatzen. Als werde jemand von einem wilden Tier verschlungen. Gefressen, bei lebendigem Leib.
Sie löst sich aus der Starre, macht einen winzigen, halben Schritt auf das Maul zu. Es zieht sie an, will, dass sie hinabsteigt. Ihrer Brust entweicht ein Schluchzen. Sie möchte nur weglaufen. Doch der Schlund entlässt sie nicht, der Sog lässt nicht nach. Noch ein Schritt.
Da schießt ihr der Gedanke an Helmut in den Kopf. Wie er an Helenes Rockzipfel hängt und einem Schlosshund gleich heult. Sie löst sich aus dem Bann und dreht sich abrupt um. Es kostet sie all ihre Kraft, doch sie dreht sich weg. Sobald der dunkle Einstieg nicht mehr in ihrem Blickwinkel liegt, geht es einfacher. Sie entfernt sich von der Hausruine. Nach vier schweren Schritten kann sie die Schreie bereits kaum noch hören. Etwas Ähnliches wie Erleichterung macht sich in ihr breit. Sie geht immer weiter. Egal, wohin. Nur weg von dem schwarzen Loch.
Erst, als sie nach einigen Minuten am Marienplatz ankommt, als sie die Menschen um sich herum wahrnimmt – auch einige Amerikaner in ihren Uniformen –, schaut sie an sich hinab. Betrachtet die rissige Hand, als gehöre sie einer Fremden. Mit weißen Knöcheln umklammert sie das Haargummi. Der Marienkäfer drückt ihr schmerzend ins Fleisch.
Zögernd lockert sie den Griff, bis die Hand kaum mehr schmerzt. Es kostet sie abermals eine geradezu unnatürliche Kraftanstrengung, bis die Hand gänzlich geöffnet ist. Sie blinzelt. Doch ihre Unentschlossenheit währt nur wenige Sekunden. Dann steckt sie das funkelnde Etwas in die Tasche ihres Rockes. Ganz tief hinein schiebt sie es. Das Ding, das vielleicht vom Himmel gefallen ist. Oder aus der Hölle hervorgekrochen kam. Für einen Augenblick hält sie es fest, dort in ihrer Tasche. Eine Frau empört sich, dass sie da so verloren auf der Straße rumsteht, doch es kümmert sie nicht. Sie überlegt, welche Lebensmittel sie wohl im Tausch für das wunderschöne Fundstück erhalten wird. Der Schweiß läuft ihr die Stirn herunter, sie muss ihn sich aus den Augen wischen. Langsam setzt sie sich wieder in Bewegung, hebt den Kopf, konzentriert sich auf den Marienplatz, stockt abermals. Marienplatz. Marienkäfer. Heilige Mutter Gottes! Der Schwindel wird stärker. Sie bemüht sich, die Schreie, die plötzlich tief in ihrem Kopf nachhallen, zu unterdrücken. Fahrig bekreuzigt sie sich. Schüttelt den schmerzenden Kopf, um die Schreie zum Schweigen zu bringen. Atmet tief ein. Einmal. Zweimal.
Ratten! Es waren Ratten in einem Kellerloch! Die Plagegeister sind überall in der Stadt unterwegs. Man könnte meinen, sie seien die einzigen Lebewesen, denen der Krieg nichts anhaben konnte. Heilige Mutter Gottes! Eine Träne läuft über ihre verschmierte Wange, mischt sich mit dem Schweiß.
Ihr Hinken ist jetzt noch ausgeprägter. Sie humpelt durch die zerstörte Stadt, auf der Suche nach etwas Essbarem. Denkt an Helmut, dem fraglos der Rotz aus der Nase läuft, während er sich die Seele aus dem Leib heult. Es ist ein geradezu tröstlicher Gedanke. Sie humpelt schneller, wie auf der Flucht. Immer wieder schweift ihr Blick über den blauen Himmel. Stehen bleiben will sie nicht. Weiter, nur weiter.
Bei jedem ihrer Schritte spürt sie das Haargummi in der Rocktasche gegen ihre knochige Hüfte drücken. Wie ein glühendes Stück Kohle spürt sie es. Ein Stück Kohle, das ihre Haut versengt.
Das Grauen. Sie weiß, es wird niemals wieder verschwinden.
Zweites Kapitel
London, 2016
Kaum hatte Julius das Gespräch per Knopfdruck beendet, klopfte jemand auf seine Schulter. Ruckartig drehte er sich um und blickte in das angespannte Gesicht von Janet. Innerlich stöhnte er auf, zwang sich aber zu einem Lächeln. Was wollte sie denn nun schon wieder?
»Kommst du mal kurz mit, Julius«, sagte Janet. Sie wartete nicht auf eine Antwort, sondern machte sich sofort auf den Weg zu ihrem kleinen Zimmer am anderen Ende des Großraumbüros.
Julius nahm das Headset vom Kopf und legte es auf den Schreibtisch. Er signalisierte Beth, die vom nächsten Schreibtisch aus mit gerunzelter Stirn das Geschehen verfolgte, mit einem Schulterzucken seine Ahnungslosigkeit. Dann folgte er Janet, die mittlerweile in ihrem Büro verschwunden war.
Seine Quoten waren letzte Woche in Ordnung gewesen, das hatte Janet ihm am Dienstag noch gesagt. Er war bei der Anzahl erfolgreicher Abschlüsse im November sogar unter den Top Five des Teams gelandet. Schlechte Performance konnte also nicht der Grund für ein Gespräch sein. Hatte er vielleicht seinen schmutzigen Kaffeebecher in der Küche stehen lassen? Oder heute zu lange für die Dokumentation gebraucht?
Als er sich zwischen den Schreibtischen hindurchschlängelte, schüttelte Julius unmerklich den Kopf. Er hasste das Telemarketing. Jeder Satz wurde choreografiert, jedes Gespräch wurde vermessen. Doch die Bezahlung war erstaunlich gut, da konnte er nicht meckern. Er betreute hauptsächlich deutsche Kunden. Einige in der Schweiz. Wichtige Märkte für viele britische Firmen. Wenige deutsche Muttersprachler, die Lust auf den Job hatten. Gut für ihn. So kam er finanziell gerade über die Runden. London war ein teuflisch teures Pflaster. Mal ganz abgesehen von dem Unterhalt, den er jeden Monat nach Deutschland überwies.
»Setz dich, bitte.« Janets Stimme klang gequetscht.
Julius zog den einzigen Besucherstuhl aus einer Ecke und setzte sich seiner Vorgesetzten genau gegenüber. Er verschränkte die Arme vor der Brust und ließ seinen Blick durch den Raum schweifen. Sollte Janet doch einfach sagen, was sie von ihm wollte. Obwohl ein Schreibtisch, ein Aktenschrank und eine schiefe Garderobe die einzigen Einrichtungsgegenstände waren, wirkte das Büro gnadenlos überfüllt. Janet arbeitet in einem Schuhkarton, schoss es Julius in den Kopf. Er unterdrückte ein Grinsen.
Mit einem missbilligenden Ton räusperte sich Janet, als habe sie Julius’ Gedanken gelesen. »Ich muss etwas mit dir besprechen.« Sie starrte auf einen Punkt an der Wand hinter ihm und räusperte sich erneut. »Wir beenden unsere Zusammenarbeit mit dir zum Ende des Monats.«
»Wie bitte?« Julius schnellte in seinem Stuhl nach vorne. Er musste sich verhört haben.
»Bitte räum gleich deine Sachen zusammen, heute ist dein letzter Tag.« Erstmals blickte sie Julius ins Gesicht. »Natürlich bekommst du den Gehaltsscheck noch für den ganzen Monat.« Sie schluckte, beinahe entschuldigend.
»Ich verstehe nicht! Meine Zahlen … du hast doch vorgestern noch gesagt, alles sei in Ordnung. Wie kannst du … bis zum Ende des Monats …?«
Abwehrend hob Janet eine Hand. »Es tut mir leid, Julius. Es war nicht meine Entscheidung. Aber es ist jetzt nun einmal so.«
»Warum?« Mit der flachen Hand schlug sich Julius vor die Stirn. »Ich verstehe es nicht.«
Janet schwieg. Ihr Blick wanderte wieder an die Wand.
»Zumindest möchte ich wissen, warum!« Er erkannte seine eigene Stimme kaum.
»Es … gab wohl Beschwerden. Das ist alles, was ich weiß.«
»Beschwerden?« Erstaunt ließ Julius sich in seinem Stuhl zurückfallen. »Was denn für Beschwerden, um Himmels willen? Und von wem? Das ist doch albern!«
»Mehr kann ich nicht sagen. Bitte räum jetzt deine Sachen zusammen. Den Scheck schicken wir dir mit der Post. Alles andere kommt von der Personalabteilung.« Ihr Blick verließ für keine Sekunde den Punkt an der Wand.
Wütend sprang Julius auf. Als er aus der Tür hinausstürmte, stieß er ein deutlich vernehmbares »Arschlöcher!« hervor. Auf Deutsch.
Zuerst nahm Julius an, das ungute Gefühl sei ein Resultat seiner Anspannung, seiner maßlosen Enttäuschung. Er war unterwegs zum Bahnhof und teilte sich den Bürgersteig mit deutlich weniger Menschen als gewöhnlich. Was wohl daran lag, dass die Uhr erst elf Uhr vormittags zeigte. Normalerweise verließ er den trostlosen Bürokomplex in Lewisham am späten Nachmittag, gemeinsam mit all den anderen Angestellten, die sich dann zu dem Bahnhof schoben, der den Stadtteil nordwärts mit der Londoner City und Richtung Süden mit den Vorstädten verband. Heute kam er zum ersten Mal ohne die Kollegen hier an. Und zum letzten Mal.
Säuerlich verzog Julius die Miene, griff den Henkel des Jutebeutels, den Beth ihm geliehen hatte, fester. Nein, geschenkt, nicht geliehen. Mit mitleidigem Blick geschenkt. Weil ja klar war, dass Julius nicht wiederkommen würde. In dem Beutel schaukelten nun die paar Dinge, die er von seinem Schreibtisch zusammengeklaubt hatte. Eine Autozeitschrift, die er sich noch am Morgen für eine der kurzen Arbeitspausen besorgt hatte. Ein Lineal mit den touristischen Wahrzeichen Münchens darauf. Ein ziemlich kitschiges Ding. Doch von Zeit zu Zeit schaute er es sich gerne an, strich mit dem Finger über den Viktualienmarkt, die Frauenkirche, den Marienplatz. Auch wenn er Deutschland den Rücken gekehrt hatte, blieb München seine Heimat. Außerdem maß das Lineal in Zentimetern. Nicht in Inches. Warum auch immer – das gefiel ihm.
Julius hörte, wie beim Gehen das Lineal gegen den Bilderrahmen stieß. Der einzige weitere Gegenstand, den er eingepackt hatte. Das Bild von Emilia war bereits zwei Jahre alt. Darauf waren ihre Haare noch weißblond, im Gegensatz zu dem dunklen Blond heute. Ein Stich durchfuhr seine Brust. Es dauerte nur noch etwas mehr als eine Woche, bis seine Tochter nach London kam, um die Weihnachtsferien bei ihm zu verbringen. Und er war ohne Job. Wenigstens bezahlten sie ihn noch für den gesamten Dezember. Für den Januar brauchte er etwas Neues, ganz klar. Das bisschen Arbeitslosengeld, das er beantragen konnte, war ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber wenigstens hatte er Geld, solange seine Tochter bei ihm war. Danach würde sich schon etwas finden. Und wenn er bei einer der Burger-Ketten arbeiten musste. Übergangsweise. Hauptsache, er konnte in London bleiben.
Eigentlich war alles ausgesprochen gut gelaufen in der letzten Zeit. Der Job war leidlich gut bezahlt gewesen. Er hatte vor ein paar Wochen auf einer Party Claire kennengelernt. Vor allem aber hatte Sandra unerwartet zugestimmt, Emilia für die Dauer der Weihnachtsferien zu ihm zu schicken. Alles, wirklich alles war super gelaufen. Bis heute. Diese Arschlöcher! In das Gefühl von Anspannung und Enttäuschung mischte sich Wut.
Plötzlich wurde das ungute Gefühl stärker. Julius geriet für einen Moment aus dem Tritt, runzelte die Stirn. Das Gefühl saß zwischen seinen Schulterblättern und zog von dort durch den Körper in die Magengegend. Ein eisiges Ziehen, das ihn frösteln ließ und schließlich im Magen glühend heiß wurde. Abrupt blieb Julius stehen, sah sich um. Ein alter Mann blinzelte ihn im Vorübergehen erstaunt an. Eine Mutter warf ihm einen irritierten Blick zu. Sie wich Julius ungelenk mit dem Kinderwagen im letzten Moment aus, während sie mit einer Hand ihr Mobiltelefon ans Ohr presste.
Mit zusammengekniffenen Augen blickte Julius sich um. Musterte die übrigen Passanten, schaute in die vorbeifahrenden Autos, ließ den Blick an den Häuserfronten entlanggleiten. Es fiel ihm nichts Ungewöhnliches auf. Allmählich entspannte er sich. Atmete mit einem lauten Schnaufen aus – es war ihm gar nicht bewusst gewesen, dass er die Luft angehalten hatte. Verwirrt wischte er sich über die Stirn. Sie war feucht. Er musste sich über sich selbst wundern. Es war wegen der Kündigung, sicherlich, deshalb lagen seine Nerven blank. Vermutlich hatte er sich deswegen plötzlich wie verfolgt gefühlt.
Julius setzte gerade seinen Weg in Richtung Lewisham Station fort, da vibrierte das Mobiltelefon in seiner Jackentasche. Als er es herauszog, wurde Coldplays Song Midnight lauter. Bereits beim dritten Klingeln nahm er das Gespräch an. »Wie gut, dass du anrufst, Schatz«, sprach er sogleich ins Telefon. »Du kannst dir nicht vorstellen, was eben passiert ist. Janet, die alte Zicke, hat mich in ihr Büro …«
»Julius, warte mal!«
Etwas in Claires Stimme ließ ihn innehalten.
»Also …«, sprach Claire weiter, »ich dachte du arbeitest und kannst nicht ans Telefon gehen.« Sie klang merkwürdig tonlos. »Ich hatte eigentlich vor, dir auf die Mailbox zu sprechen.« Es mischte sich etwas in ihre Stimme, das beleidigt wirkte. »Du brauchst jetzt nichts zu sagen.« Sie machte eine Pause.
Julius war sprachlos. Es bedurfte von seiner Seite in diesem Augenblick nicht viel, Claires Aufforderung nachzukommen. Für einen Moment herrschte Stille in der Leitung, während Julius einfach weiterging, ohne zu registrieren, wo er eigentlich gerade war. Er fühlte sich auf seltsame Weise aus seinem Körper herausgelöst, als schwebte er neben sich und schaute sich selber zu. Bei einem absurden Telefongespräch. Mit einer bösen Vorahnung.
»Ich sag es jetzt also einfach«, fuhr Claire nach ein paar Sekunden fort. »Ich …« Eine weitere Pause. Dann, im Stakkato fast: »Ich mache das so nicht mit, mein Lieber. Verarsch doch eine andere, die blöder ist als ich. Ich habe die Nachricht von dieser Kathrin gefunden. Du bist aber auch so was von dämlich. Dämlich! Dann wünsche ich euch beiden alles Gute.« Ein ersticktes, höhnisches Lachen. »Du bist echt ein Schwein, Julius. Ein richtig dämliches Schwein! Melde dich nie wieder bei mir, hörst du!« Die nächsten Worte schrie sie ins Telefon. »Nie wieder!« Dann legte sie auf.
Julius lief einfach weiter. Er nahm nichts um sich herum wahr, nicht die Passanten, nicht den Straßenverkehr. Er presste immer noch das Telefon ans Ohr, als schon lange nur noch ein Tuten aus der Leitung ertönte. Schließlich blinzelte er, steckte das Gerät zurück in die Jacke. Fragte sich, ob er wirklich wach war oder in einem Albtraum gefangen. Während er sich Letzteres wünschte, brach die Erkenntnis über ihn herein, dass Claire gerade mit ihm Schluss gemacht hatte. Am Telefon. Eigentlich auf der Mailbox.
Mit zitternden Fingern fischte Julius das Telefon wieder aus der Tasche. Wählte eine Ziffer. Wartete, bis das Gespräch angenommen wurde. »Ich bin’s.«
»Hi, Julius. Was ist los? Hab gerade einen Berg Arbeit vor mir, Junge.«
»Hast du heute Abend Zeit, Marc? Es ist wichtig.«
»Geht auch ein anderer Tag? Ich zerreiße mich gerade zwischen Job und zu Hause. Michelle wird nicht begeistert sein, wenn ich heute noch mal rausgehe.«
»Ja, ich weiß. Aber es ist wirklich wichtig.«
»Mein Guter, ich versuche eine Stunde rauszuhauen. Hört sich ja echt nach einem Notfall an.«
»Du bist klasse, danke! Sag einfach, wie es dir am besten passt.«
»Um neun in unserem Stamm-Pub?«
»Großartig, Marc! Dann bis heute Abend im Queen’s Head.« Julius ließ das Telefon in den Jutebeutel gleiten. Dort stieß es mit dem Bilderrahmen zusammen.
Er bog um eine Ecke. Am Ende der Straße sah Julius bereits den Bahnhof. Er wich einem Bettler aus, der mit seinen Krücken an einer Hauswand lehnte und ihm einen Pappbecher für Kleingeld entgegenstreckte. Eine alte Frau trat ein paar Schritte weiter aus einem Kiosk. Beinahe wäre Julius in sie hineingelaufen.
Mit einem eisigen Prickeln zogen sich von einer Sekunde auf die nächste seine Schulterblätter zusammen. Er atmete scharf ein. Das Gefühl, beobachtet zu werden, durchflutete ihn aufs Neue. Nein, es war kein Gefühl. Es war ein Wissen.
Ohne sich umzudrehen, rannte Julius los. Erst als er ein paar Minuten später im halb leeren Zug saß, als sich die Türen geschlossen hatten und der Zug sich in Bewegung setzte, ließ die Anspannung ein wenig nach. Schwer atmend starrte Julius aus dem Fenster, während erst Bürogebäude und dann ein kahler Baumgürtel, zwischen dem Reihenhaussiedlungen hindurchblitzten, an ihm vorbeizogen. In seinem Kopf wiederholte sich ein einziger Satz, wieder und wieder: Das kann doch alles nicht wahr sein. Das kann doch alles nicht wahr sein. Das kann doch alles nicht wahr sein. Am liebsten hätte er einfach losgeheult.
Drittes Kapitel
Julius kam um einiges zu früh im Queen’s Head an. Zu Hause hatte er es nicht mehr ausgehalten, war in dem kleinen Apartment wie ein Tiger immer im Kreis gelaufen. Bis es selbst Christie zu viel geworden war. Die Katze des Vermieters, ein regelmäßiger Gast bei Julius, hatte das Apartment mit einem vorwurfsvollen Blick durch das geöffnete Fenster verlassen.
Der Pub war gut besucht. Julius erwischte aber einen kleinen Tisch in einer Ecke, legte seine Jacke über einen Stuhl und bestellte sich am Tresen ein Bier. Dann setzte er sich und nahm einen kräftigen Schluck. Kurz schloss er die Augen. Sofort erschien Claires Gesicht vor ihm. Wie ein böser Geist. Schnell riss er die Augen wieder auf.
An der gegenüberliegenden Wand flimmerte ein Bildschirm. Wo normalerweise Sportevents übertragen wurden, liefen am heutigen Abend Nachrichten in Dauerschleife. Landauf, landab sah es in den Pubs wohl ähnlich aus. Es gab derzeit überall nur ein Thema: der anstehende Austritt der Briten aus der Europäischen Union. Das Undenkbare war im Sommer Realität geworden – beim Referendum hatte eine knappe Mehrheit dafür gestimmt, der EU den dicken Finger zu zeigen. Julius’ anfängliche Sorge hatte sich aber schnell gelegt. Als Deutscher sollte er nichts zu befürchten haben. Vier Jahre lebte er nun bereits in London. Eine Aufenthaltsgenehmigung dürfte kein Problem sein. Sicher, es hatte sich etwas verändert. In der Stimmung. Selbst hier in London waren die Klagen lauter geworden, dass alle Welt nach Großbritannien strömte. Den Briten die Arbeit wegnahm, die Häuserpreise in die Höhe schießen ließ und Sozialleistungen abgriff. Die Feindseligkeiten richteten sich jedoch in erster Linie gegen Osteuropäer. Die Briten würden schon nicht so blöd sein, die Deutschen aus dem Land zu schmeißen. Julius hatte jedenfalls nicht vor, Großbritannien den Rücken zu kehren. Komme, was wolle.
»Ich bin früher weggekommen«, sagte Marc atemlos, warf seine Jacke auf den freien Stuhl und schlug in Julius’ Hand ein. »Alter, du klangst ja ganz schön fertig vorhin. Ich hole mir mal ein Bier. Du trinkst auch noch eins, oder? Okay.« Er stützte sich mit beiden Händen auf die Tischplatte. »Ich habe eine knappe Stunde. Michelle war echt sauer, dass ich sie mit dem Kleinen allein gelassen habe. Der bekommt Zähne. Brüllt den ganzen Tag wie am Spieß. Und die ganze Nacht.« Marc zog eine Grimasse. Er drehte sich um und schlängelte sich zum Tresen durch.
Zwei Minuten später stellte er ein Pint Lager neben Julius’ halb volles Glas. »Hier. Siehst aus, als könntest du es gebrauchen.« Prüfend musterte er seinen Freund. »Alles in Ordnung? Du siehst scheiße aus.«
»Nichts ist in Ordnung. Claire hat heute mit mir Schluss gemacht«, brach es aus Julius heraus.
»Die Kleine aus Wimbledon? Echt? Ich hatte gedacht, bei euch läuft es gerade richtig gut.« Verdutzt hielt Marc inne, stellte sein Glas ab. »Tut mir leid zu hören, Mann.«
»Ich verstehe das nicht. Sie rief an, redete irgendetwas von einer Kathrin und einer Nachricht. Und das war’s!«
»Wer ist Kathrin?«
Julius zuckte mit den Schultern. »Ich habe keine Ahnung.«
»Das hört sich verdammt nach einem Missverständnis an.« Marc nickte. »Hast du Claire mal angerufen? Kannst die Sache sicher aufklären.«
»Sie geht nicht ran. Auch keine Mailbox. Ich habe es vorhin schon dreimal probiert.«
»Gesperrt.« Marc schnalzte mit der Zunge. »Sie hat dich in ihrem Phone gesperrt, ganz klar.« Er nahm einen Schluck. »Tja, Scheiße, Mann.«
Julius umschlang sein Glas mit beiden Händen und starrte auf die Tischplatte. »Das ist auch noch nicht alles. Die haben mich beim Job heute rausgeschmissen.«
Sprachlos blinzelte Marc. »Was?«, stieß er schließlich hervor. »Sag das noch mal.«
Julius nickte nur.
»Was ist passiert? Ich dachte, die fahren voll auf dein Deutsch ab. Weil du den Tröten auf dem Kontinent das ganze Zeug verkaufst. Verstehe ich jetzt nicht.«
»Irgendwer hat sich über mich beschwert. Das ist alles, was mir Janet gesagt hat. Keine Ahnung, worum es ging. Die bezahlen mir jetzt noch diesen Monat, danach ist Ende. Hin muss ich nicht mehr. Freigestellt.«
»Oh, verdammt. Ist ja echt nicht dein Glückstag heute. Leider ist bei uns in der Buchhaltung nichts frei. Sonst hättest du da übergangsweise was machen können. Dateneingabe oder so.« Über den Tisch hinweg legte Marc eine Hand auf Julius’ Schulter, drückte sie aufmunternd. Er dachte nach, schüttelte dann den Kopf und zog den Arm zurück. »Da ist im Moment nichts. Aber ich drücke dir die Daumen, dass du schnell etwas Neues findest.« Marc nippte an seinem Bier, zögerte. »Der Markt soll im Moment nicht so toll sein. Wegen der Verunsicherung. Brexit und so. Und die ganzen Leute von drüben, die hier einen Job wollen.«
Julius runzelte die Stirn.
Schnell fügte Marc hinzu: »Aber du kriegst sicher schnell was, Mann. Bestimmt!«
»Zur Not gehe ich zu so einem Fleischklops-Brater.« Bedrückt zog Julius sein Mobiltelefon aus der Tasche und starrte auf das dunkle Display. Keine Nachricht. Kein verpasster Anruf. Er seufzte. »Da ist noch etwas«, wandte er sich wieder Marc zu. »Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich verfolgt werde. Beobachtet.«
»Was?« Marc brauchte einen Moment, um die Mitteilung zu verdauen. »Wer sollte dich denn verfolgen? Und wieso?« Die Ungläubigkeit in seiner Stimme war nicht zu überhören.
Im Grunde hatte Julius mit einer solchen Reaktion gerechnet. Sie traf ihn dennoch härter als gedacht. Er setzte sich gerade in seinem Stuhl auf und faltete die Hände konzentriert auf der Tischplatte. »Ich habe keine Ahnung, wer es ist. Oder warum. Aber irgendwer ist mir heute nach der Arbeit gefolgt. Ich habe es genau gespürt.«
»Aha.« Marc kratzte sich am Kopf. »Gespürt, verstehe. Aber du hast niemanden gesehen?«
Hörte Marc ihm nicht zu? »Das ist richtig.«
»Aha.«
Für ein paar Sekunden sahen die beiden sich schweigend an. Im Hintergrund war über die Gespräche der anderen Pub-Besucher die Stimme des Fernsehmoderators zu hören. Er fragte eine junge Schottin nach ihrer Meinung zum Brexit. Es sprudelte geradezu aus ihr heraus.
»Du weißt noch, was du mir einmal erzählt hast?«, fragte Marc schließlich vorsichtig.
»Was meinst du?« Julius wusste ganz genau, was sein Freund meinte.
»Also … das mit München. Wie schlecht es dir damals ging. Dass du da wegwolltest, um mit dem ganzen Stress abzuschließen.« Marc stockte.
München. Julius hätte Marc nicht davon erzählen sollen. Doch wenn der Alkohol einmal die Zunge gelockert hatte … Irgendwann kam im Nachgang immer der Zeitpunkt, an dem alles, was man von sich preisgab, gegen einen verwendet wurde. Das uralte Gesetz. Er sah Marc schweigend an.
»Du hast doch Medikamente bekommen. Weil du so durch den Wind warst. Und glaubtest du nicht auch, verfolgt zu werden? Ich meine nur, wenn du damals … Und heute die Kündigung. Dann das mit Claire. Da würde ich bestimmt auch verrü... Ich meine, das haut einen ja um, ist doch ganz klar.« Schnell griff Marc zu seinem Bierglas und nahm einen langen Schluck.
»Das war etwas ganz anderes. Heute ist wirklich jemand da gewesen. Ich weiß es.« Julius zwang sich dazu, ruhig zu sprechen. Doch in ihm kämpften die Emotionen um Oberhand. »Glaub mir, ich weiß es ganz genau.«
Doch was, wenn Marc recht hatte? Was, wenn die alte Erkrankung nur in ihm geschlummert hatte, um ihn wieder einzuholen, sobald sich die Gelegenheit dazu ergab? Eine leichte primäre Psychose. Die nach ein paar Wochen medikamentöser Behandlung als ausgeheilt gegolten hatte. Um nach beinahe fünf Jahren einfach so zurückzukehren? Nein, das konnte nicht sein. »Das war etwas ganz anderes«, wiederholte Julius. Diesmal sagte er es mehr zu sich selbst als zu Marc.
»Das war es sicherlich. Aber dass du damals in München richtig fertig warst, das stimmt doch. Weil so einiges bei dir schieflief.« Marc klang beharrlich.
»Ich hatte ziemlichen Zoff mit meiner damaligen Freundin. Wir haben eine gemeinsame Tochter, das weißt du ja. Emilia. Sandra hat die Kleine ständig als Druckmittel verwendet. Auch als wir schon getrennt waren. Und dann war mein erster Job nach der Uni der blanke Horror. Marketing in einem Konzern. Ein einziges Haifischbecken. Ich habe schon vorher gewusst, dass das nichts ist. Aber irgendwie habe ich das Bauchgefühl ausgeblendet. Mit Sandra war es das Gleiche. Das hat schlicht nicht gepasst.« Er strich sich kopfschüttelnd eine Haarsträhne hinters Ohr. »Ist so ein Muster bei mir gewesen, glaube ich. Ich habe wieder und wieder in die Scheiße gegriffen, obwohl ich es hätte besser wissen müssen. Als dann meine Mutter an Krebs starb, war es einfach zu viel. Papa, von dem sie sich hatte scheiden lassen, litt damals schon an Alzheimer. Von der Seite war also auch keine Hilfe zu erwarten. Ja, es ging mir echt schlecht. Depressionen. Verfolgungswahn. Nenn es, wie du möchtest. Der Arzt hat es jedenfalls schnell in den Griff bekommen. Ich musste danach einfach raus aus München, wie gesagt. Da habe ich die Reißleine gezogen und bin hierher. Seitdem geht es mir blendend.« Julius zog das zweite, volle Glas zu sich heran. »Vorhin, auf dem Weg zum Bahnhof, das war etwas ganz anderes als damals. Natürlich nimmt mich Claires Anruf mit, natürlich ärgere ich mich über den Rauswurf. Aber da war heute jemand, der mich verfolgt hat. Ganz eindeutig.« Er nahm einen tiefen Schluck. »Und glaube mir: Das hat sich nicht gut angefühlt.«
»Das verstehe ich. Ich will ja auch nicht sagen, dass …« Marc brach ab und zog sein vibrierendes Mobiltelefon hervor. Nach einem Blick auf das Display verdrehte er die Augen. »Michelle«, raunte er. Nach einem tiefen Seufzer nahm er das Gespräch an. »Hallo, Schatz, ich … Ja, das weiß ich … Nein … Julius … Habe ich dir doch …« Er zog eine Grimasse und schüttelte genervt den Kopf. »Natürlich, Schatz. … Wenn der Kleine … okay … natürlich, Schatz … ja, ja … das sage ich ja … okay!« Er beendete das Gespräch und stand gleichzeitig auf. »Ich muss los, tut mir leid, Mann. Aber Michelles Nerven liegen so was von blank.« Gehetzt kippte er den Rest seines Bieres hinunter, dann zog er die Jacke über. »Wir sprechen uns, okay? Wird schon werden. Du kennst ja den Spruch: Wo sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere.« Er beugte sich vor und klopfte Julius auf die Schulter. »Kopf hoch. Und du weißt: Zur Not steigst du durch das Fenster ein.« Er lachte halbherzig. Damit drehte er sich um und ging zur Tür. Beim Hinausgehen nickte er noch ein, zwei Leuten zu, die er kannte. Dann nahm ihn die Dunkelheit auf wie einen Freund.
Gedankenverloren nippte Julius an dem Bier, schob es von sich. Es schmeckte auf einmal schal. Auf dem Bildschirm lief Werbung für einen Autoversicherer. Julius fuhr sich mit beiden Händen über den Kopf. Inmitten des vollen Pubs fühlte er sich einsam und verlassen. Er starrte vor sich hin und bemerkte die junge Frau erst, als sie mit einer Hand vor seinem Gesicht herumwedelte.
»Gehst du auch gleich?«, fragte sie Julius und warf ihrer Freundin, die eine Hand bereits fest um die Lehne des freien Stuhls gelegt hatte, einen belustigten Blick zu. »Wir würden den Tisch dann gerne übernehmen«, fügte sie kühl hinzu und zog ihren Mantel aus. Wartend klemmte sie ihn unter den Arm. Ihre Freundin zog den freien Stuhl halb zu sich.
»Ja, klar«, antwortete Julius und stand auf. »Der Tisch gehört euch.« Er nahm seine Jacke von der Stuhllehne und hatte noch keinen Schritt zur Seite gemacht, da zwängte sich die Frau, die ihn angesprochen hatte, schon ungeduldig vorbei, um Platz zu nehmen. »Einen schönen Abend«, wünschte Julius den beiden. Er erhielt keine Antwort.
Viertes Kapitel
Julius zog die Schultern hoch. Es war kalt, sein Atem bildete kleine Wölkchen in der Luft. In Purley war zu dieser späten Stunde nicht mehr viel los. Der Stadtteil im tiefen Süden Londons gehörte zum Bezirk Croydon und war vor etwa einhundert Jahren auf Teufel komm raus bebaut worden. Die typischen Reihen backsteinfarbiger Häuser zogen sich die Straßenränder entlang. Bis nach Hause hatte Julius es nicht weit. Vom Queen’s Head ging er die Godstone Road Richtung Kenley entlang, kam an einer Tankstelle vorbei. Sie hatte bereits seit Stunden geschlossen.
War schon hier, auf einer der Hauptverkehrsstraßen Purleys, kaum jemand unterwegs, wurde es nach dem Abbiegen in die Sunnydene Road noch ruhiger. In den beleuchteten Fenstern jener Wohnhäuser, in denen zu dieser späten Stunde noch Menschen wach waren, konnte Julius vereinzelt Fernsehgeräte flimmern sehen. Aus der Erdgeschosswohnung eines Gebäudes erklangen zwei Stimmen im Streit. Doch sie verstummten abrupt, als Julius im Vorbeigehen in das Fenster spähte. Nahezu gleichzeitig erlosch das Licht.
Julius lauschte seinen eigenen Schritten auf dem Asphalt. Sie erzeugten einen Rhythmus, der etwas Einschläferndes hatte. Herzhaft gähnte er. Erst jetzt bemerkte er, dass er todmüde war. Erschöpft und ausgelaugt. Alles andere wäre am Ende dieses katastrophalen Tages wohl auch ein Wunder gewesen.
Ein aufkommendes Frösteln wollte er erst der Müdigkeit zuschreiben. Doch als sich Sekunden später seine Nackenhaare aufstellten und ihm ein eisiger Zug von den Schulterblättern ausgehend durch den Körper lief, schnappte er nach Luft. Hastig wandte er sich um, spähte in die von nur wenigen Straßenlaternen durchbrochene Dunkelheit. Mehrmals drehte er sich um seine eigene Achse, suchte den Verfolger.
Dort! Bewegte sich dort etwas in den Schatten eines Gebäudes? Schmerzhaft zog sich Julius’ Magen zusammen. Nein, dort war nichts. Er hatte sich wohl getäuscht. Tief atmete er ein und aus. Doch es stellte sich keine Beruhigung ein. Wie auch? Julius war sicher, dass immer noch der Blick eines Augenpaars auf ihm lag und jede seiner Bewegungen verfolgte. Das Wissen schrie in seinem Kopf wie ein in die Ecke gedrängtes Tier. Seine Hände zitterten, und er tat einen Schritt nach hinten. Du bildest dir das nur ein, sagte er zu sich selbst. Da ist niemand. Bloße Einbildung. Während er den Gedanken wiederholte, wusste er, dass er nur versuchte, sich selbst zu belügen.
Wie zur Bestätigung waberte ein leises Lachen durch die Dunkelheit. Julius erstarrte zur Salzsäule. Das Lachen wiederholte sich. Es wirkte amüsiert. Und siegessicher. Julius’ Blick schoss über die Straße. Nirgends konnte er jemanden sehen. Mit einem Ärmel seiner Jacke wischte er über die Stirn. Sie war feucht von kaltem Schweiß. Er öffnete den Mund, wollte etwas sagen. Stattdessen kam nur ein krächzender Laut hervor. Er trat einen weiteren Schritt rückwärts. Und einen weiteren. Dann drehte er sich ruckartig um und rannte den Bürgersteig hinab. Über dem Pochen seines Herzens, das in den Ohren vibrierte, meinte er in seinem Rücken erneut das Lachen zu hören. Es klang furchtbar. Wie aus einer anderen Welt.
Erst als er in die Elm Road einbog, verlangsamte Julius sein Tempo. Während er in schnellem Schritt bis zum Ende der Sackgasse ging, grub er in seiner Hosentasche nach dem Haustürschlüssel. Mit zitternden Fingern schob er den Schlüssel ins Schloss, betrat den kleinen Flur und öffnete mit einem zweiten Schlüssel die Tür zu seinem Apartment, das sich im Erdgeschoss befand. Hastig verriegelte er die Zimmertür hinter sich, lehnte den Rücken gegen die Tür und rang nach Atem. So verharrte er ein paar Minuten. Dann ließ er sich zu Boden gleiten, schlang die Arme um seine Knie.
Er musste die Ruhe bewahren. Sonst wurde er wirklich noch verrückt. Das Lachen hallte dumpf in seinem Kopf nach. Er hatte es gehört, ganz sicher. Wieso war er eigentlich weggelaufen? Er hätte den Typ stellen sollen. Vielleicht war es nur ein Obdachloser gewesen, den er unwissentlich gestört hatte. Oder war es Marc, der sich einen Spaß mit ihm erlaubte? Kurz schöpfte Julius Hoffnung, dass dies die simple Erklärung war. Doch dann dachte er an heute Vormittag, an den Rückweg von der Arbeit. Er war sicher gewesen, dass ihm ebenfalls jemand folgte. Darum hatte er Marc ja angerufen, und der war gerade bei der Arbeit gewesen. Nein, wer immer sich einen Spaß mit ihm erlaubte, Marc war es nicht.
Er hatte das Lachen doch gehört, oder? Ganz sicher! Erschöpft stützte Julius seine Schläfen in den Handflächen ab und schloss die Augen.
Er konnte hinterher gar nicht mehr sagen, wie lange er so dagesessen hatte. In der Dunkelheit, auf dem Boden vor seiner Tür. Waren es ein paar Minuten gewesen? Eine Stunde? Jedenfalls war es seine volle Blase, die ihn zwang, die unbequeme Sitzposition aufzugeben und sich zu erheben. Mit schmerzenden Beinen humpelte Julius in das kleine Badezimmer, schaltete das Licht ein und stellte sich vor die Toilettenschüssel.
Während er dort stand, kehrte der verlockende Gedanke zurück, dass er sich den Verfolger sicherlich nur eingebildet hatte. Vielleicht lag Marc gar nicht so falsch mit seiner Mutmaßung, dass der Stress Auslöser dieser Sinnestäuschungen war. Das musste nicht heißen, dass er ein psychisches Problem hatte, so wie damals in München. Nein, das musste es ja gar nicht heißen. Der Stress hatte ihm einen Streich gespielt, mehr nicht. Erst die Kündigung, dann Claires Anruf. Jeder normale Mensch wäre davon mitgenommen. Jeder normale Mensch!
Er betätigte die Spülung, und während das Wasser durch die Rohre rauschte, wuchs seine Zuversicht. Alles würde sich einrenken. Er hatte jetzt ein paar Tage Zeit, einen neuen Job zu suchen. In München hatte er einen Abschluss in BWL gemacht. Mit Ach und Krach zwar, aber es war ein Abschluss. Damit konnte er eigentlich alles tun. Jede Art von Bürojob. Zur Not auch wieder in den Verkauf gehen. Die Briten sahen das nicht so eng. Von wegen nur in dem Job arbeiten, den man gelernt hatte! Das war typisch deutsch. Aber seine deutsche Muttersprache würde ein echter Trumpf sein, Brexit hin oder her. Mit Deutschland wollten schließlich alle Geschäfte machen.
Er wusch sich die Hände und nickte dabei seinem Spiegelbild aufmunternd zu. Er würde das hinbekommen. Und Claire sollte bleiben, wo der Pfeffer wächst. Was hatte sie überhaupt mit diesem Zettel und dieser Kathrin gemeint? Wenn er es sich recht überlegte: Sie hatte am Telefon ziemlich wirr geklungen. Nicht er hatte ein Problem, Claire hatte offensichtlich eins. Da war es besser, wenn er sich von ihr fernhielt. Er hatte jetzt andere Sorgen, da konnte er sich nicht um Claires Gemütszustand kümmern. Wirklich nicht. Er musste sich jetzt auf seine Sachen konzentrieren. Nächste Woche hatte er Geburtstag, den würde er einfach mit zwei, drei Jungs bei einem Bier feiern. Und einen Tag danach kam schon Emilia nach London. Das war jetzt wichtig – Emilia. Er hatte sie ein ganzes Jahr lang nicht gesehen und bloß gelegentlich mit ihr telefoniert. Immer nur für ein paar Minuten, was sollte man mit einem kleinen Kind am Telefon auch besprechen? Doch jetzt kam sie für zehn Tage zu ihm. Es war ein Wunder, dass Sandra dem zugestimmt hatte. Ein Weihnachtswunder sozusagen. Er grinste. Alles würde anders werden. Besser. Er würde ein guter Vater sein. Emilia die Stadt zeigen. Weihnachten hier in der Wohnung feiern, mit Weihnachtsbaum und allem, was dazugehörte. Es würde der Beginn einer ganz neuen Beziehung zu seiner Tochter sein. Ja, das würde es. Den Stress musste er einfach ausblenden, der war nicht wichtig. Emilia war wichtig. Dass er sich nicht verrückt machen ließ, das war wichtig.
Das Licht aus dem Badezimmer im Rücken, trat er zu der kleinen Küchenzeile und öffnete den Kühlschrank. Leicht rümpfte er die Nase. Er würde den Kühlschrank bald wieder einmal reinigen müssen. Seine Hand fand die Bierflasche, ohne hinzuschauen. Als er sie heraushob, entschlüpfte sie beinahe seinen Fingern. Im letzten Moment fing er sie mit beiden Händen auf. Sie fühlte sich feucht an, irgendetwas im Kühlschrank war anscheinend ausgelaufen. Er stöhnte auf. Das hatte ihm jetzt noch gefehlt. Mit drei Schritten war er neben der Wohnungstür und betätigte den Lichtschalter. Zwei Halogenstrahler tauchten den Raum in ein unangenehm kaltes Licht.
»Was zum…«, stieß Julius aus und ließ im selben Moment die Flasche los. Sie zersprang mit einem lauten Knall auf dem Boden. Biergeruch breitete sich sofort im Zimmer aus. Doch Julius konnte nur auf seine Hände starren. Sie waren rot. Blutrot. »Was zum…«, flüsterte er tonlos. Wieso waren seine Hände rot? Sein Blick glitt zu den Scherben auf dem Boden. Auch dort waren rote Flecken zu sehen. Sie mischten sich mit dem schäumenden Bier und bildeten darin kleine Lachen auf dem beigen Teppich.
Die rote Farbe war über die Flasche an seine Hände gelangt. Stirnrunzelnd sah Julius zum Kühlschrank. Er überlegte kurz, dann wusch er die Hände im Badezimmer, griff nach einer Rolle Toilettenpapier und wickelte mehrere Lagen ab. Das Papier verteilte er auf dem Teppich. Hier, an dieser Stelle, wollte er für Emilia den Weihnachtsbaum aufstellen, schoss es ihm in den Kopf. Verdammt, morgen würde er Raj, seinen Vermieter, informieren müssen. Das würde ein Theater geben. Was das wohl kosten würde, den Teppich zu reinigen?
Vorsichtig trat Julius über das vollgesogene Papier am Boden hinweg, dann ging er in die Hocke und öffnete den Kühlschrank.
Sein Verstand benötigte einige Sekunden, um zu verarbeiten, was seine Augen sahen. Dann stieß er einen gurgelnden Laut aus und fiel nach hintenüber, robbte rückwärts vom Kühlschrank weg, in das feuchte Toilettenpapier.
Von dort aus starrte er in den geöffneten Kühlschrank. Starrte auf das Rot, das überall darin klebte. Starrte in Christies Augen, die ihn vorwurfsvoll anzusehen schienen.
Julius würgte. Die Katze. Rajs Katze. Sie lag im mittleren Fach des Kühlschranks. Ein rosafarbenes Gewirr aus Fleisch und Gedärmen. Jemand hatte sie gehäutet. Und eine Seite aufgeschnitten, sodass das Innere aus dem Tier herausquoll. Der Schwanz war abgetrennt worden. Julius starrte in den Kühlschrank und würgte.
Anklagend sahen die riesigen, freigelegten Augen Julius an. Eine kleine Blutlache sammelte sich vor dem Kühlschrank. Das Rot tropfte von der Tür hinab, speiste die Lache langsam. Von Bierflaschen tropfte es, von einer Milchtüte. Von einem Stück Butter.
Julius schaffte es nicht mehr rechtzeitig bis ins Badezimmer. Ein Teil des Erbrochenen traf die Zimmertür, ein anderer den Boden vor der Toilette. Es war ihm egal. Wohin er auch blickte, er sah nur Christies malträtierten Körper.
Als er schließlich schwer atmend zurück in den Wohnraum trat, musste er sich zwingen, nicht zum Kühlschrank zu schauen. Stattdessen streifte sein Blick das Fenster. Erstmals bemerkte er, dass er wohl vergessen hatte, es ganz zu schließen. Ein kleines Stück des Holzrahmens war hochgeschoben.
Einen Schritt hatte Julius bereits auf das Fenster zugemacht, da blieb er wie versteinert stehen. Da war eine Bewegung vor dem Fenster. Dann ertönte ein Lachen, zwängte sich durch den schmalen Fensterschlitz in seine Wohnung. Es war dasselbe Lachen, das er vorhin bereits auf der Straße gehört hatte.
Fünftes Kapitel
In dem beengten Badezimmer hing immer noch der Geruch von Erbrochenem. Die Lüftung brummte wie eine wütende Schmeißfliege. Kaum anzunehmen, dass sie irgendetwas bewirken würde. Ein Badezimmer mit einem Fenster wäre wunderbar gewesen. Sein Budget gab Julius jedoch etwas anderes vor. Er schluckte. Ein Budget, das es nun nicht mehr gab. Verzweiflung stieg in ihm auf, nicht unähnlich der vorherigen Übelkeit. Nur mühsam konnte er sie niederdrücken.
Einen Schritt nach dem anderen, mahnte Julius sich. Langsam stellte er den Eimer ab und setzte sich auf den Toilettendeckel.
Nachdem er die Polizei gerufen hatte, war er mit dem Eimer und einem Lappen durch das Apartment gekrochen, um die Kotze, das Bier und das Blut zu beseitigen. Soweit es ihm möglich war. Während er die Glasscherben einsammelte, wischte und schrubbte, vermied er den Blick in den Kühlschrank. Doch wie ein übermächtiges Artefakt zog die gehäutete Katze an seiner Aufmerksamkeit.
Vom Toilettendeckel aus schaute Julius den beiden Polizisten der Metropolitan Police dabei zu, wie sie den Wohnraum inspizierten. Eine Stunde hatte es gedauert, bis die Police Constables aufkreuzten. Ihre Namen hatte er sich nicht merken können. Er konzentrierte sich auf das Summen der Lüftung. Es hatte eine aufheulende Note bekommen, die nun alle paar Sekunden einen eigenen, unregelmäßigen Takt vorgab.
Der kleinere der Männer sagte etwas zu dem anderen. Die Antwort bestand in einem Grunzen und Kopfschütteln. Beide Polizisten schauten kurz zu Julius herüber, dann drehten sie weiter ihre Runde. Blieben abermals vor dem Kühlschrank stehen und starrten hinein. Zum wievielten Mal taten sie das nun? Wie lange tanzten sie schon vor Christie herum? Julius kam es wie eine Ewigkeit vor.
Der größere Polizist drehte sich schließlich um. Er trat zwei Schritte auf die Badezimmertür zu, während sein Kollege einen Notizblock und einen Stift zückte, sich aber im Hintergrund hielt. Vor dem Kühlschrank, in dem Christie mit weit geöffneten Augen vorwurfsvoll Hof hielt.
»Sie haben das Tier also im Kühlschrank gefunden?«, fragte der Constable. »In diesem Zustand?«
Julius nickte.
»Und das Fenster war geöffnet, als Sie nach Hause kamen? Draußen haben Sie dann einen Mann gesehen?«
Julius räusperte sich, schob mit einem Fuß den Eimer ein wenig zur Seite. »Ich habe eine Bewegung vor dem Fenster gesehen. Eine Person habe ich nicht erkannt. Doch dann kam dieses Lachen. Ich denke, es gehörte einem Mann. Aber ich möchte mich da nicht festlegen.«
»Hm.« Der Polizist nickte. »Ein Lachen.« Er kratzte sich am Kinn. »Und die Katze gehört Ihrem Vermieter?«
»Ja, Raj. Er wohnt oben.« Julius deutete an die Decke.
»Wurde etwas gestohlen?«, warf der andere Polizist von hinten ein.
»Es sieht nicht so aus.« Julius schüttelte den Kopf. »Christie … also die Katze. Das ist das Einzige, was hier in der Wohnung …« Er stockte, spürte die Übelkeit zurückkehren.
»Die Katze, ja.« Der größere Constable legte die Stirn in Falten. »Haben Sie Feinde hier im Haus, Mr Sonnenberg?«
»Feinde?«, fragte Julius verdutzt. »Nein. Nicht, dass ich wüsste. Mein Vermieter wohnt oben, wie gesagt. Neben mir eine Studentin aus Spanien, doch die ist seit ein paar Wochen kaum da. Lebt im Grunde bei ihrem Freund. Keine Feinde, wirklich nicht.«
»Auch nicht unter den Nachbarn in der Straße? Jemand, mit dem Sie im Streit liegen? Weil Sie mal etwas in seine Mülltonne geworfen haben? Oder mit dem Auto auf dem Parkplatz standen, den sonst immer die Nachbarin nutzt?«
»Ich habe kein Auto«, sagte Julius tonlos.
»Meist sind es Streitigkeiten unter Nachbarn, die zu so was führen.« Der Mann deutete über seine Schulter in Richtung Kühlschrank. »Sie können sich kaum vorstellen, was wir so alles zu sehen bekommen.«
Der andere Constable gab ein zustimmendes Schnaufen von sich.
Für einen Moment wollte Julius von dem Verfolger berichten, der ihn bereits am Vormittag beobachtet hatte. Doch er musste mit einem neu aufflackernden Magenstechen an Marcs Reaktion denken. Er hatte keinerlei Beweise für seine Geschichte. Und wollte er den Polizisten im gleichen Atemzug wirklich von Claires Anruf und dem Rausschmiss bei der Arbeit erzählen? Julius stand auf und trat in den Türrahmen. »Wie geht es jetzt weiter?«
»Na, wir nehmen alles auf. Einbruch. Tierquälerei.«
»Und der Kerl vor dem Fenster?«
»Sie sagten doch, dass Sie gar nicht wissen, ob es sich um einen Mann handelt, Sir.« In die Stimme des Polizisten schlich sich Ungeduld. »Sie meinten, ein unbestimmtes Lachen gehört zu haben.« Er zuckte mit den Schultern. »Lachen allein ist noch nicht strafbar.«
»Aber …«, stammelte Julius. »Die Katze.«
»Ich muss gleich noch mit Ihrem Vermieter sprechen, doch die nehmen wir natürlich mit. Sie muss auch fachmännisch entsorgt werden. Die können Sie nicht einfach so in den Müll werfen. Mein Kollege wird das Tier einpacken.«
Ein unterdrückter Protestlaut kam von hinten, gefolgt von einem demonstrativ lauten Plastikrascheln.
Julius fasste sich an den Kopf. Pochende Kopfschmerzen rumorten hinter der Stirn. Das Geräusch der Lüftung war zu einem Brüllen angeschwollen. Die Polizisten schienen es nicht zu bemerken.
»Sie sollten sich hinlegen und schlafen«, fuhr der Constable fort. Er musterte Julius, nicht ohne eine Spur Mitleid. »Wir schreiben einen Bericht und geben ihn weiter. Mit Tierquälerei ist nicht zu spaßen. Sollten sich noch Fragen ergeben, werden sich die Kollegen bei Ihnen melden.«
»John«, ertönte die Stimme des anderen Polizisten, »schau dir das hier mal an.«
»Was denn?« Der Angesprochene trat zu seinem Kollegen.
Julius sah, wie sich beide Männer über Christie beugten, die kopfüber halb in einem Plastikbeutel steckte. Er fing die Blicke auf, welche die Polizisten ihm kurz zuwarfen, bevor sie erneut über dem gehäuteten Tier die Köpfe zusammensteckten. Für einige Sekunden vernahm Julius ihr eindringliches Gemurmel, dann winkte der größere Polizist ihn zu sich.
Wie in Trance trat Julius näher an die Beamten heran. Er vermied den Blick auf die Katze, bis der Polizist ihn aufforderte, Christie anzusehen.
»Sehen Sie hier, die Seite«, sagte der Constable und deutete mit dem kleinen Finger auf rosafarbenes Fleisch. »Erkennen Sie das?«
»Striche«, hauchte Julius. Erneut wurde ihm übel. In der Plastiktüte sammelten sich die Innereien, die aus dem Schnitt auf der anderen Seite des Tieres herausquollen. Er versuchte zu schlucken, kam aber gegen den emporsteigenden Brechreiz nicht an. Er lenkte den Blick auf den Boden. Auf die feuchten Stellen auf dem Teppich.
»Diese Striche«, sagte der Constable namens John, »sind mehr als bloße Striche.«
Sein Kollege nickte bedächtig.
»Sehen Sie hier«, forderte der Polizist Julius abermals auf.
Doch Julius hielt den Blick starr auf den Boden gesenkt, ganz damit beschäftigt, gegen den Brechreiz anzukämpfen.
»Hier hat jemand in die Seite der Katze ein Zeichen geschnitten«, fuhr der Mann unbeirrt fort. »Ein Hakenkreuz.«
»Ja, ganz eindeutig«, pflichtete der Kollege bei. »Ein Hakenkreuz. Sehen Sie?«
Ein Würgen schnürte Julius’ Kehle zusammen. Diesmal schaffte er es rechtzeitig bis zur Toilettenschüssel. Nachdem er die Spülung betätigt und den Mund mit Wasser ausgespült hatte, stellte er mit einem schnellen Blick in den Nebenraum dankbar fest, dass Christie nicht mehr zu sehen war. Constable John stand allein in der Mitte des Zimmers. Die Wohnungstür war angelehnt.
»Sie sollten sich wohl wirklich besser ausruhen«, nickte der Polizist. »Mein Kollege hat das Tier bereits in den Wagen gebracht und wartet dort auf mich.« Er schüttelte den Kopf. »Eine Tierquälerei, furchtbar. Was manchen Menschen einfällt.« Seine Worte klangen nicht wirklich erstaunt, eher wie eine sachliche Feststellung.
Es war gerade diese Nüchternheit, die erneut ein Gefühl des Grauens in Julius aufsteigen ließ. Er wollte nicht wissen, was der Constable sonst noch alles zu sehen bekam. Eine gehäutete Katze, deren Innereien sich in einen Kühlschrank ergossen, schien nicht am oberen Rand der Skala der Abscheulichkeiten zu rangieren.
»Und das Hakenkreuz?«, fragte er heiser.
Der Polizist legte die Stirn in Falten. »Sie sind Deutscher, Sir?«
Das hatte Julius bei der Angabe seiner Personalien bereits gesagt, doch er nickte bestätigend.
»Ich fragte Sie ja schon nach Nachbarn, mit denen Sie im Streit liegen. Die Erfahrung zeigt, dass Vorkommnisse wie dieses in den allermeisten Fällen mit der direkten Umgebung zu tun haben. Da werden Kothaufen durch Briefschlitze geschoben, Hunde vergiftet. Oder dem Kaninchen der Nachbarstochter der Hals umgedreht. Die Gründe sind meist albern, von außen betrachtet. Nur nicht für die Betroffenen. Da wird aus Laub, das vom Nachbargrundstück herüberweht, ein Kleinkrieg.« Der Mann zögerte kurz. »Manchmal reicht es bereits aus, einer anderen Nationalität anzugehören.« Er nahm die Hände aus den Hosentaschen und verschränkte sie vor der Brust. »Seit der Diskussion um den Austritt des Königreichs aus der EU verzeichnen wir vermehrt solche Übergriffe. Aber das sage ich nur unter uns. Auf Polen, Spanier. Manchmal auch Deutsche. Selten auf Deutsche, aber es kommt vor.« Er schaute zum Kühlschrank, dessen Tür immer noch weit geöffnet stand. »Meist handelt es sich um Beleidigungen. Zerkratzte Autotüren. Selten wird auch mal jemand handgreiflich. Dann ist fast immer Alkohol mit im Spiel.« Er überlegte. »Ich könnte mir vorstellen, dass ein übereifriger Austrittsfanatiker Freude daran hat, Ihnen einen Schrecken einzujagen. Ihnen sagen will, Sie sollen nach Deutschland zurückkehren. Aller Wahrscheinlichkeit nach handelt es sich um jemanden, den Sie kennen. Von dem Sie diese Abneigung aber gar nicht erwarten.« Der Polizist spreizte die Arme. Die Bewegung hatte etwas Entschuldigendes, aber auch etwas Resigniertes. »Im Augenblick können wir jedenfalls nicht mehr machen. Mein Kollege wird …« Er brach ab, als eine Stimme von der Wohnungstür erklang.
»Was ist denn hier los?« Mit Schwung öffnete sich die Tür, und ein kleiner Mann mit Brille und Vollglatze betrat den Raum. Er trug ein ausgefranstes, mit Essensresten beflecktes T-Shirt und eine schlabberige, ebenfalls nicht sonderlich reinliche Jogginghose. »Was ist passiert, Julius?« Doch bevor Julius etwas antworten konnte, sprach der Mann weiter. »Die Polizei in meinem Haus!« Er rang die Hände. »Es ist doch hoffentlich nichts Schlimmes geschehen? Dies ist ein sehr anständiges Haus, Constable!«
»Sie sind Mr Sonnenbergs Vermieter, Sir?« Der Polizist hatte sich keine Sekunde aus der Ruhe bringen lassen.
Der Mann nickte, während sein Blick durch das Zimmer schoss. Mit gerunzelter Stirn blieb er am geöffneten Kühlschrank hängen. Dann sah er den Constable durch verschmierte Brillengläser an. »Das ist richtig, mir gehört dieses Haus. Mein Name ist Raj Ram.« Er deutete auf den Kühlschrank. »Ist das Rote dort Blut?«
»Mein Name ist Constable Fuller, Sir. Von der Metropolitan Police. Wir wurden von Ihrem Mieter gerufen, da es wohl einen Einbruch in diese Wohnung gab. Haben Sie vielleicht etwas Ungewöhnliches bemerkt? Jemanden in der Nähe des Hauses gesehen? Etwas gehört?«
»Einen Einbruch?« Raj stemmte die Fäuste in die Hüfte. »Ich habe nichts bemerkt. Wie soll der Einbrecher denn hereingekommen sein?«
»Eines der Fenster war nicht ganz geschlossen«, sagte Julius. Er räusperte sich, fuhr mit belegter Stimme fort. »Und Raj … Christie.«
»Ihre Katze«, ergänzte der Constable.
»Mein Kater«, korrigierte der Vermieter. »Christie. Wie Linford Christie. Der Olympiasieger im Sprint. Was ist mit ihm?«
Hilfe suchend sah Julius Constable Fuller an.
»Es scheint, als sei Ihr Kater von dem Eindringling getötet worden, Mr Ram.« Fuller nickte. »Nicht in der Wohnung, wohlgemerkt. Dafür gibt es keine Spuren. Er wurde irgendwo draußen getötet und hier in den Kühlschrank gelegt. Es tut mir leid.« Er legte eine Pause ein, während Raj ihn mit offenem Mund anstarrte. »Wir schreiben eine Anzeige wegen schwerer Tierquälerei und geben den Vorgang an die zuständigen Kollegen weiter.«
»Vorgang …«, krächzte Raj. Seine Augen richteten sich abwechselnd auf den Constable und auf Julius. »Christie … getötet?« Er schüttelte vehement den Kopf. Dann glitt sein Blick zum Kühlschrank. Er machte einen unbeholfenen Schritt auf das surrende Gerät zu, die Hand auf den Mund gepresst, die Augen weit aufgerissen. »Das Blut«, hauchte er in seine hohle Hand. Er schluchzte auf.
»Raj, es tut mir leid …«, setzte Julius an.
Mit einer vehementen Drehung wandte Raj sich auf dem Absatz um, schnellte auf Julius zu und rammte ihm mit einer brüsken Bewegung einen Zeigefinger vor die Brust.
»Was hast du mit Christie gemacht?«, zischte er, Tränen in den Augen. »Was, zum Teufel, hast du mit Christie gemacht?«
»Sir, bitte beruhigen Sie sich.« Der Constable schob sich zwischen Julius und Raj. »Ich verstehe Ihre Aufregung völlig, Mr Ram. Doch es war Ihr Mieter, der uns rief, als er die Katze … ich meine, den Kater in seinem Kühlschrank fand, Sir. Mr Sonnenberg schien sehr mitgenommen, nachdem er das verstümmelte Tier gefunden hatte.«
Schrill schrie Raj auf. »Verstümmelt?« Blitzschnell schlüpfte er an dem Polizisten vorbei und griff Julius mit beiden Händen am Pullover. »Ich wusste von vorneherein, dass es keine gute Idee war, dich hier einziehen zu lassen«, stieß er hervor. »Doch meine Frau wusste es ja mal wieder besser! Der arme Junge, getrennt von seiner Tochter. Das hat sie gesagt. Sie wusste es ja mal wieder besser.«
Julius wollte einen Schritt nach hinten treten, doch der kleine Mann hatte ihn fest im Griff. Mit nassen Augen funkelte Raj ihn an. »Du hast Christie immer zu dir gelockt, das hast du. Wie hast du ihn umgebracht? Vergiftet? Was hast du dann mit ihm gemacht? Was? Ich verfluche den Tag, an dem wir dich in unser Haus gelassen haben. Warum hast du das getan? Warum?« Mit einer Faust schlug er Julius gegen die Brust.
Wie vom Donner gerührt starrte Julius in die wutverzerrte Fratze. Das war nicht mehr Raj, der hier vor ihm stand. Dies war eine Rachegottheit. Kali, schoss es Julius in den Kopf. Blut und Zorn.
»Es reicht!«, ging Constable Fuller mit harter Stimme dazwischen und zog den aufgebrachten Vermieter von Julius weg. »Sie verlassen jetzt diese Wohnung, Sir.« Er schob den schluchzenden Raj in Richtung Tür. »Gehen Sie schlafen, Mr Ram. Mit klarem Kopf sieht die Welt morgen sicherlich schon anders aus.« Der Constable bedeutete Julius mit einem Blick, im Raum zu bleiben. Dann drückte er Raj, den nun alle Kraft verlassen zu haben schien, sachte in den Flur. Wie von ganz ferne hörte Julius, wie der Constable beruhigend auf Raj einredete, während er ihn ins höher gelegene Stockwerk begleitete.
Julius ließ sich auf dem Boden nieder, zog die Beine an und umschlang sie mit den Armen. Er fühlte sich gefangen in einem Wahnsinn, der kein Ende nehmen wollte. Heute war der furchtbarste Tag seines Lebens. Ganz eindeutig.
Er hörte, wie die Männer im oberen Stockwerk ankamen und der Vermieter dort nach Putri, seiner Frau, rief. Dann folgte in Rajs Muttersprache Telugu ein Redeschwall, der von einem klagenden Aufschrei von Mrs Ram beendet wurde. In der nachfolgenden, plötzlichen Stille nahm Julius mit schmerzhafter Intensität wahr, wie das Blut in seinen Ohren pochte. Oder war es eine Mischung aus dem Brummen der Badezimmerlüftung und dem Summen des Kühlschranks? Mit dem aufgerissenen roten Rachen eines hungrigen Tieres fauchte der Kühlschrank ihm entgegen.
Der verdammte Kühlschrank. Entnervt sprang Julius auf und knallte die Tür zu.
Sechstes Kapitel
München, 1945
Du hast geweint und geschrien, im Traum«, sagt Helene.
Sie kann sich nicht daran erinnern, geschrien zu haben. Aber es wird wohl stimmen. An den Traum selbst hat sie eine Erinnerung. Natürlich. Es ist schließlich immer ein ähnlicher Traum, der sie heimsucht, sobald sie die Augen schließt. Aber dass sie geschrien hat?
Mit der flachen Hand fährt sie nachdenklich über die abgenutzte Tischplatte. Für einen Augenblick ist sie versucht, den Kopf daraufzulegen, die Wange gegen das Holz zu schmiegen. Es ist gerade so schön ruhig in der Wohnung. Alle anderen sind außer Haus. Einzig Helmut und sie sind daheim geblieben. Nur für einen Moment würde sie gern die Augen schließen. Der Müdigkeit nachgeben. Jäh schreckt sie auf – entsetzt über die Tollkühnheit dieses Gedankens. Die Augen schließen? Gütiger Gott! Nicht, wenn es nicht unbedingt sein muss.
Helmut spielt im Nebenzimmer mit ein paar Bauklötzen. Eigentlich ist er schon zu alt dafür. Doch die Auswahl ist nun einmal begrenzt. Sie schaut sich mit müden Augen um. Selbst hier in der Küche liegen zwei Matratzen auf dem Boden – die Schlafstätten von Joseph und Erich. Sie würde so gern schlafen. Joseph hat eine Verletzung am linken Arm. Er kann ihn nicht mehr richtig bewegen. Zum Glück sei es nur der linke, scherzt Joseph immer. Ein nettes Lächeln hat er. Sie muss an Franz denken, von dem sie noch immer nichts gehört hat.
Die Wohnung ist vollgestellt mit allerlei Habseligkeiten, mit Matratzen und Möbeln, die noch halbwegs zu gebrauchen sind. Die Enge ist kaum auszuhalten. Doch es könnte schlimmer sein, das weiß sie. Ein Glück, dass Helenes Wohnung nicht zerstört wurde. Sie stützt den Kopf in die Hände, schaut wieder hinab auf die Tischplatte. Sieht die Reste weißer Farbe auf dem braunen Holz. Die Oberfläche ist voller Schrammen und Kerben. Überzogen von Schnitten und Wunden. Wie ich, denkt sie mit gerunzelter Stirn. Wie ich auch.
Erschöpft schließt sie die Augen. Nach wenigen Sekunden schreckt sie erneut auf. Nicht, wenn es nicht unbedingt sein muss, mahnt sie sich. Die Hölle beginnt drei Atemzüge hinter ihren geschlossenen Augenlidern.
Ihr Kopf ist unnatürlich heiß. Die Hitze pulsiert von den Schläfen hinüber in ihre Hände. So ist es jetzt fast immer. Erst ist ihr heiß, dann plötzlich bitterkalt. Doch der Schweiß rinnt ständig den Körper hinunter, ohne Unterlass. Ein abgegriffenes Stück Stoff ist zu ihrem ständigen Begleiter geworden. Der Rest eines Mantelärmels? Mit ihm wischt sie sich beständig über die Stirn, den Nacken. Jeden Abend muss sie den Stoff auswaschen und zum Trocknen aufhängen. Bald muss sie auch den Rock wieder enger nähen. Sie wird immer dünner. Mühsam verdrängt sie den Gedanken an das Fieber, das ihren Körper verzehrt. Solange kein Husten dazukommt, wird es nicht weiter schlimm sein, beruhigt sie sich. Das leichte Krächzen, welches ihre Kehle quält, ist kein Husten. Wirklich nicht. Da ist sie sich absolut sicher. Nein, solange zu dem Fieber kein Husten dazukommt, braucht sie sich keine Sorgen zu machen. Es wird schon irgendwie gehen. Irgendwie geht es immer.
Das Flüstern im Kopf, das ist es, was sie beunruhigt. Es schweigt jetzt immer seltener, es bereitet ihr Angst. Unerbittlich erinnert es sie an etwas, an das sie sich nicht erinnern möchte. Sie möchte, dass es aufhört. Manchmal wird es so laut, dass es ihr schier den Kopf zerreißt.
Sie legt die Hände auf den Tisch. Um sich abzulenken, klopft sie einen Rhythmus auf das Holz. Wenn sie zu sehr an das Flüstern denkt, fühlt es sich eingeladen. Um Himmels willen! Alles, nur das nicht!