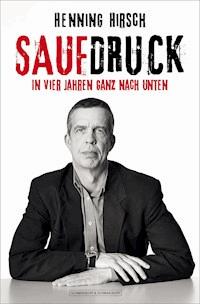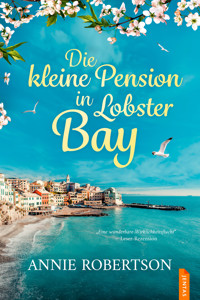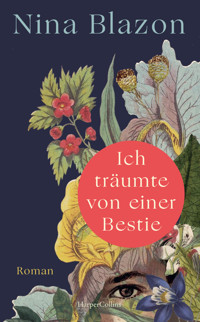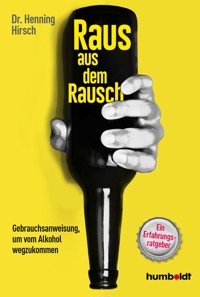
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Der Alkohol zerstörte das Leben von Henning Hirsch: Er verlor durch das Trinken seine Firma, seine Familie, wurde obdachlos und schwebte am Ende in Lebensgefahr, als er mit knapp sechs Promille ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Heute ist Henning Hirsch trockener Alkoholiker. In seinem Ratgeber erklärt er, warum wir trinken und welche körperlichen und seelischen Folgen Alkoholismus hat. Außerdem stellt er seinen Zehn-Stufen-Plan vor, mit dem er selbst dem Alkohol entkommen ist – vom Entgiften und der richtigen Therapie über die Suchtauslöser und die Unterstützung durch Selbsthilfegruppen bis hin zu wertvollen Tipps für den Umgang mit Triggern und für eine dauerhafte Abstinenz.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 215
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALT
Vorwort
Aperitif
Weshalb trinken wir?
Wenn die Endorphine nicht mehr reichen
Drei Vernebelungsstufen, um in den Orbit zu gelangen
Der Profi gehorcht anderen Regeln als der Amateur
Gesoffen hat schon unser Steinzeit-Urgroßvater
Wein, ein Geschenk der Götter
Die Germanen waren chronische Schluckspechte
Je einfacher zu besorgen, desto mehr Alkoholkranke
Pionier der Alkoholismus-Forschung: E. M. Jellinek
Wann ist man Alkoholiker?
Zu viel Alkohol ist immer hochriskant
Suchtdruck und Kontrollverlust
Körperliche und seelische Folgen
Körperliche Folgeschäden
Geistig-seelische Schäden
Muss man erst ganz unten ankommen?
Leere Drohungen bringen nichts
Menü in zehn Gängen
1. Ich bin Alkoholiker – die Krankheitseinsicht
Der Durchschnittsalki: männlich und Ü40
Ängste und Selbstbetrug beherrschen den Trinker
Spätestens in der Suchtklinik ist Schluss mit lustig
2. Entgiften, aber richtig
Entgiften: nur in der Klinik!
Turbo-Entzüge: teuer und Wirkung ungewiss
3. Therapie – ohne wird es schwieriger
Gruppensitzungen sind ein Muss
Klinik-Romanzen sind von kurzer Dauer
Wenn die Zeit zu knapp für eine stationäre Reha ist
Ambulante Therapie: Für wen und wofür?
Bahnhofskioske sind supergefährlich
Trocken wird man für sich selbst, nicht für andere
4. Auf der Suche nach dem Urknall
Bad habit: Viel mehr steckt oft nicht dahinter
Auch Liebe wird wie eine Droge konsumiert
Am Ende trinkt man aus 1001 Gründen
Auslöser kennen und offen drüber sprechen
5. Den Schalter im Kopf umlegen
Ohne Umweg erst in den Vollrausch, dann ins Koma
Drei Trinker – drei verschiedene Schicksale
6. Rückkehr in die raue Wirklichkeit
Zwei Haupt-Triebfedern fürs Weitertrinken
Meier-Doornkaats Rückkehr ins Büro
Die Kollegen: Ein Rest Skepsis bleibt
7. Unter Gleichgesinnten – die Selbsthilfegruppe
Die Geschichte von Kalle, dem Lokführer
Alkohol-Selbsthilfe ist kein Kuschelprogramm
Ernüchternde Statistik
8. Was triggert: wen, wann, wie, wo und warum?
Und wenn man Alkohol versehentlich zu sich nimmt?
9. Saufdruck noch nach Jahren?
Leichtsinn kommt vor dem Rückfall
Trinken unter Aufsicht: Was ist davon zu halten?
Wundermedizin: Mit Vorsicht zu genießen
Antabus: Finger weg, wenn man nicht sicher ist
10. Zufriedene Abstinenz
Ein kreatives Hobby hilft ungemein
Die Wochen nach der Reha sind die schwersten
Zufrieden ist Abstinenz deutlicher einfacher
Gelassenheit ist eine Kunst
Beginnen Sie heute noch mit dem Einstieg in den Ausstieg
Absacker
Kollateralschäden und Co-Abhängigkeit
Unfälle und Straftaten unter Alkoholeinfluss
Co-Abhängige: Oft noch ärmer dran als der Trinker
Wie schützt man sich und seine Kinder?
Und was tut die Politik?
Sieben einfache Maßnahmen
Schlusswort
Danksagung
Anhang
Glossar
Jellinek-Fragebogen
Anlaufstellen
Tipps zum Weiterlesen
Quellen
VORWORT
Wozu das millionste Buch über Alkohol?
„Schreib mal was Vernünftiges“, sagt die alte Schulfreundin.
„Was soll das denn sein?“, frage ich.
„Was zum Thema Alkohol. Davon verstehst du doch was.“
„Zum Thema Alkohol gibt’s schon eine Million Bücher.“
„Na und? Dann schreibst du halt das einemillionunderste dazu. Und
leg den Fokus vor allem aufs Wie-kommt-man-weg-von-der-Sucht.“
„Ich habe keine Ahnung, wie man von der Sucht wegkommt.“
„Doch, hast du. Du hast es ja gepackt.“
„Ich hab einfach nur Glück gehabt.“
„Papperlapapp, das war nicht nur Glück. Vorher gab’s jede Menge Stunden bei Psychologen und Therapeuten. Das hatte ganz sicher Einfluss auf deine Abstinenzentscheidung.“
„Über so was Langweiliges soll ich schreiben?“
„Ja, sollst du. Keinen Roman, eher was Kurzes, Knackiges.“
„Also einen Ratgeber.“
„Nenn es, wie du willst. Hauptsache, du schreibst was darüber.“
„Ich überleg’s mir“, sage ich.
„Nächste Woche komm ich wieder vorbei und schaue, was du bis dahin geschafft hast. Enttäusch mich nicht“, verabschiedet sie sich und ist durch die Tür.
Und nun sitze ich alleine an meinem Schreibtisch und zermartere mir das Hirn, was es zum Thema Alkohol Mitteilenswertes gibt, wovon die Welt bisher noch nichts weiß. Am besten fange ich damit an, mich vorzustellen und zu sagen, an wen sich dieses Buch vornehmlich richtet. Damit fülle ich schon mal das erste Kapitel, was immer gut ist. Denn das erste Kapitel ist erfahrungsgemäß eins der schwersten.
Mein Name steht vorne auf dem Buchdeckel. Aufgewachsen in mittelstandsbürgerlichen Verhältnissen, erstes Besäufnis mit 14, zum Abitur hin schon gut im Training, im Studium dann richtig Fahrt aufgenommen mit Bier, Wein, Whisky und Wodka, bis ich irgendwann zwischen viertem und sechstem Semester zum Gewohnheitstrinker wurde und Mühe hatte, mit dem Gift mal für eine Woche zu stoppen, um mich nüchtern auf eine Klausur vorzubereiten. Über 20 Jahre gelang es mir – mitunter mehr schlecht als recht –, meinen Konsum so einzudämmen, dass ich funktionierte: morgens pünktlich aus dem Bett kommen, zur Arbeit fahren, bis 18 Uhr im Büro bleiben, Familie gründen, einen bescheidenen Wohlstand schaffen.
Der Alkohol blieb in diesen zwei Jahrzehnten stets mein treuer Begleiter. Kein Abend, an dem ich nicht ein paar Bier zischte, bevor ich mich angenehm angesäuselt aufs Ohr legte. Am Wochenende konnte es auch ein halber Kasten zwischen Sportschau und Mitternachtskrimi werden. Das ging einigermaßen gut bis zu meinem 40. Geburtstag. Danach steigerte ich die tägliche Trinkmenge. Zuerst allmählich, für meine Umgebung kaum bemerkbar, bis der Konsum dann zwei, drei Jahre später zunächst galoppierte und schließlich explodierte. Wieso es dazu kam, dass die Dinge völlig außer Kontrolle gerieten, erzähle ich im Abschnitt „Die Suche nach dem Urknall“. Wird selbstverständlich nicht unter den Teppich gekehrt. Hier befinden wir uns jedoch noch im Vorwort.
Ich mutierte zu einem 24/7-Trinker. Einer, der morgens zum Aufstehen ein Wasserglas Wodka in sich reinkippte, um überhaupt „klar“ denken zu können. Einer, der sich, wenn er drauf war, zehn Tage lang nicht rasierte und duschte. Einer, der sich bei drei Promille nur leicht angeheitert fühlte. Einer, der für die nächste Flasche Schnaps eine Hypothek auf die Grabstätte seiner Eltern aufgenommen hätte. Einer, der sich auf der Intensivstation danach erkundigte, ob er zusätzlich zum Valium noch einen Jägermeister bekommen kann.
So einer waren Sie?, fragen Sie. Ja, genau so einer war ich. Zwei bis drei Dutzend klinische Entzüge – bei 20 habe ich aufgehört zu zählen –, zwei Langzeittherapien, eine Adaption zwecks beruflicher Reintegration. Zwischendurch immer mal wieder im Obdachlosenheim und im Sommer draußen auf einer Parkbank gewohnt.
Ärzte, Psychologen, Pfleger hielten mich für einen verbrannten Patienten. Eine dieser bedauernswerten Gestalten, die mit der Genauigkeit eines Schweizer Uhrwerks im Abstand von drei bis maximal vier Wochen in der Aufnahmestation anklopfen, ein paar Tage lang entgiften, sobald sie halbwegs bei Kräften sind, entlassen werden, erneut aufkreuzen und dieses Spiel so oft wiederholen, bis sie eines Tages nicht mehr auftauchen und einer schließlich im Raucherzimmer sagt: „Den Henning haben sie vorgestern blau angelaufen am Rheinufer gefunden. Neben sich ’ne Pulle Doppelkorn und ein Sixpack Bier. Sah gar nicht gut aus, der Junge.“ Kurzes betretenes Schweigen in der Gruppe, dann geht es weiter mit der Unterhaltung, ob heute Salzkartoffeln oder Speckklöße als Beilage auf dem Mittagessenplan stehen. So sieht es mit 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit für die Hardcoretrinker-Fraktion aus. Sonderlich alt wird keiner von denen.
Ich bin kein Hardcoretrinker!, rufen Sie mir empört zu? Kann noch werden, antworte ich. Hardcoretrinker wird man nicht über Nacht. Dafür sind schon ein paar Jahre Training notwendig.
Okay, nun wissen wir, dass Sie eine Zeit lang gesoffen haben wie Harald Juhnke und Spencer Tracy, wenn die zusammen Party feierten, sagen Sie. Aber was ist mit dem Glück, von dem Sie weiter oben sprachen? Kommt da noch was, oder wollen Sie uns bloß Ihr persönliches Schicksal schildern? Falls ja: Brauche ich nicht. Habe im Moment genug mit mir und meinem eigenen Schicksal zu tun. Ich antworte Ihnen: Sie haben völlig Recht, dieses Buch soll nicht von meinen Saufexzessen handeln, sondern Ihnen anhand eines leicht verständlichen Zehn-Stufen-Plans den Ausstieg aus dem Alkohol nahebringen und ermöglichen. Den ich vor zehn Jahren, sehr zum Wunder der oben genannten Ärzte, Psychologen und Pfleger, vollzogen habe.
Meine Schulfreundin Vera meinte, ich solle das Ganze aufziehen wie ein reichhaltiges Menü: Aperitif, mehrere Gänge und dann der Absacker. Ein Vorschlag, den ich gerne übernommen habe, da es zum einen immer schlau ist, gute Vorschläge zu übernehmen, und zum anderen, weil mir selbst nichts Pfiffigeres einfiel. Im Kapitel „Aperitif“ beschäftigen wir uns mit den notwendigen Grundlagen: Was ist ein Rausch, woran erkennt man Abhängigkeit, seit wann säuft die Menschheit, ein bisschen Statistik und solches Zeug. Im anschließenden „Menü in zehn Gängen“ werden die zehn Schritte vorgestellt, die uns in ein alkoholfreies Leben führen. Der Absacker schließlich ist denjenigen Menschen gewidmet, denen wir im Laufe unserer Trinkerkarriere ganz gehörig auf die Nüsse gegangen sind, wenn wir sie nicht sogar ebenfalls in den Suff oder den Tod getrieben haben. Wem nicht nach Aperitif ist, überspringt diesen Teil einfach und blättert sofort zum Menü weiter.
Um es direkt vorneweg zu sagen: Ich werde Ihnen keinen einfachen Weg skizzieren. Wer davon träumt, sich in eine Klinik zu begeben, wo er drei Tage lang im Tiefschlaf trockengelegt wird, um danach bis zum Lebensende kontrolliert weitertrinken zu können, und von diesem Traum partout nicht lassen will, der lege das Buch jetzt beiseite. Dem Alkohol abzuschwören und (zufrieden) abstinent zu leben, bedeutet am Anfang ein hartes Stück Arbeit. Und zu Beginn steht die Einsicht: Ja, ich bin Alkoholiker. Solange diese fehlt und Sie sich trotz offenkundiger Säufersymptome nach wie vor als Gelegenheitskonsument einsortieren, können Sie das Buch ebenfalls zuklappen. Es wird Ihnen keinen Nutzen bringen.
Ich verlange also von Ihnen ein gewisses Maß an realistischer Selbsteinschätzung, den Wunsch nach Veränderung und den Willen zur aktiven Mitarbeit. Das klingt jetzt schon alles verdammt schwierig. Keine Ahnung, ob ich das schaffen werde, sagen Sie? Stimmt – anfangs ist es schwierig. Es wird jedoch im Laufe der Zeit einfacher, bis Ihnen die Abstinenz schließlich in Fleisch und Blut übergeht und Sie diesen Zustand für den normalsten der Welt halten.
Das Glück, von dem ich oben sprach, stellt kein reines Zufallsprodukt dar gemäß dem von uns Sterblichen nicht beeinflussbaren Prinzip „Gott würfelt und hat mich auserwählt“, sondern es ist ein Glücksfenster, das sich nach einiger Vorarbeit öffnet. Sie müssen dieses Zeitfenster allerdings erkennen und dürfen es nicht ungenutzt sich wieder schließen lassen. Wie Sie es erkennen, werde ich ausführlich erklären.
Dieser Ratgeber wendet sich an zwei Personengruppen: zum einen an Trinker, die aufhören wollen, bisher allerdings noch nicht den richtigen Pack-an für sich gefunden haben, um endlich zielgenau in Richtung alkoholfreies Leben aufzubrechen. Zum anderen an die Angehörigen und Freunde des Abhängigen, denn ihnen kommt im Prozess der Entwöhnung eine sehr wichtige Rolle zu. Sei es, dass sie ihn auf seinem steinigen Weg begleiten, sei es, dass sie sich von ihm nach dem zehnten Delirium trennen, um nicht selbst Schaden zu nehmen. Auf jeden Fall hilft die Lektüre dieses Buches dabei zu verstehen, wie Säuferherzen schlagen und Wodkaseelen ticken.
Ich hoffe, ich konnte Sie mit diesem Intro davon überzeugen, dass ich von der praktischen Seite her ein bisschen Ahnung von der Materie habe. In manchen Passagen wird meine Sprache ruppig sein. Das sind die Spätfolgen der vielen in den Raucher- und Aufenthaltsräumen der Klinik verbrachten Stunden, die mich verbal ein wenig verlottern ließen.
Einige werden denken, der Hirsch nähert sich der Sache zu humorvoll, wo bleibt der notwendige Ernst? Keine Sorge, mir ist zu jeder Stunde bewusst, dass es sich beim Saufen um eine todernste Angelegenheit handelt. Ich stand an genügend Gräbern von Kumpels, die den Absprung nicht rechtzeitig schafften. Trotzdem sollte das Thema nicht nur tieftraurig, sondern stellenweise heiter abgehandelt werden. Nirgendwo trifft man mehr Galgenhumoristen als auf den Fluren der geschlossenen Abteilung.
Und jetzt habe ich, glaube ich, genug geschrieben. Sie wissen in etwa, was auf den folgenden Seiten auf Sie zukommt, und ich kann Vera berichten, dass ich mit dem Vorwort fertig bin.
APERITIF
Grundsätzliches zum Thema Alkohol
Weshalb trinken wir?
Was ist ein Rausch?
Gibt es ein Grundrecht, sich in den Orbit zu katapultieren?
Ist Alkohol auch eine (harte) Droge?
Der Wunsch, sich zu berauschen, ist so alt wie die Menschheit und soll deshalb neben Essen, Trinken, Sex, eigenem Auto und Bausparvertrag als eines der elementaren Grundbedürfnisse unserer Spezies angesehen werden. Und keine Sorge – ich möchte Ihnen mit diesem Buch Ihren Rausch nicht vermiesen oder gar verbieten. 90 % der Primaten kommen mit ihren gelegentlichen Wochenend- und Weihnachtsfeierräuschen gut zurecht, und daran will auch niemand ernsthaft etwas ändern.
Gefährlich sind die Räusche jedoch für das Zehntel, das sich mit Feiertagsbenebelungen nicht zufriedengibt, sondern diesen Zustand immer wieder, und zwar in kurz getakteten Zeitabständen, erleben möchte. Die 10 % der Bevölkerung, welche die Bewusstseinsveränderung, die durch ihre bevorzugte Droge eintritt, als genauso normal ansehen wie die nüchterne Realität, werden eines Tages die ständige Flucht in ihre Fantasiewelt der mausgrauen Wirklichkeit vorziehen. Dieses Zehntel nennt man drogenaffin, man könnte es auch weniger wissenschaftlich als „gierig auf das Eintauchen in ihre rosarote Parallelwelt“ ausdrücken.
Zuerst einmal eine Begriffserklärung: Was genau ist eigentlich ein Rausch? „Der Rausch bezeichnet einen emotionalen Zustand der Ekstase, der jemanden über seine normale Gefühlslage hinaushebt. Die Ursachen hierfür können vielfältig sein, z. B. eine akute Vergiftung mit Rauschmitteln oder auch manische Zustände“, so formuliert es Wikipedia. Von den manischen Zuständen wollen wir hier absehen und uns im Folgenden auf die Räusche konzentrieren, die aufgrund des Genusses – in der obigen Definition wird interessanterweise von „akuter Vergiftung“ gesprochen – psychotroper Substanzen ausgelöst werden.
Ach so, psychotrope Substanz müssen wir vorab ebenfalls klären: In diese Kategorie sortieren Fachleute all diejenigen (natürlichen und chemischen) Wirkstoffe ein, die unsere Psyche sowohl positiv als auch negativ beeinflussen. Die gängigsten Mittelchen, um uns zeitweilig in den Orbit zu katapultieren, sind: Alkohol, Opiate/Opioide, Kokain, Marihuana, LSD, MDMA und alle möglichen Pharmaka wie beispielsweise die großen Wirkstoff-Familien der Tranquilizer, Hypnotika und Neuroleptika.
In diesem Ratgeber befassen wir uns ausschließlich mit Alkohol, wenngleich die Rauschzustände, die Opium & Co. bewirken, denen von Wodka und Lakritzlikör teilweise ähneln, die Abhängigkeiten und deren gesundheitliche Konsequenzen nur graduell variieren und es für den Trinker genauso schwierig ist, vom Schnaps wegzukommen wie für den Junkie, die Finger von der Nadel zu lassen. Der Hauptunterschied beim Herstellen der Räusche besteht darin, dass es gesellschaftlich akzeptiert und vor allem legal ist, wenn Sie sich mit Maibowle und Rumpunsch bis in die Stratosphäre schießen, während Sie bereits auf der Rückbank eines Polizeiautos Platz nehmen dürfen, falls Sie dasselbe mit ein paar Gramm Marihuana zu viel tun.
Wenn die Endorphine nicht mehr reichen
Was genau geschieht nun in unserem Gehirn, wenn wir uns Rauschmittel (wozu natürlich auch der gute alte Doppelkorn gehört) reinpfeifen? Wir müssen uns das – laienhaft vereinfacht – in etwa so vorstellen: Unser Körper produziert selbst Drogen, z. B. Serotonin, Dopamin, Endorphine, die Glücksgefühle verursachen. Beispielsweise beim Essen von Schokolade, beim Sex, beim Anblick eines schönen Bildes, am Ende eines Marathonlaufs, nachdem wir eine Felswand hochgeklettert sind und erschöpft, aber rundum zufrieden am Gipfelkreuz lehnen, oder nachdem wir ein 90-minütiges Workout-Training schweißgebadet absolviert haben.
Allerdings – und das ist wichtig – müssen wir aktiv etwas dafür tun, damit diese Glückshormone produziert und ausgeschüttet werden. Dieser Weg ist manchen zu aufwendig – das Matterhorn besteigen, um im Anschluss als Belohnung ein Nanogramm Dopamin zu bekommen, klingt nicht wirklich verlockend –, weshalb sie zu einer List greifen: Sie schlucken, inhalieren, injizieren eine psychotrope Substanz, z. B. ein, zwei oder drei Gläser Captain Morgan; wenn sie ihn nicht direkt aus der Flasche trinken.
Und jetzt passiert Folgendes: Die im Schnaps in großer Anzahl rumschwimmenden C2H5OH-Moleküle (so lautet die chemische Formel für Ethanol, auch Trinkalkohol genannt) docken an jeder Menge Rezeptoren an – das sind Nervenzellen, die Reize aufnehmen und in Erregung umwandeln –, blockieren die einen und überstimulieren die anderen. Ein künstlich produziertes Euphoriegefühl stellt sich ein. Die Fachleute sprechen hier von einem Ungleichgewicht beim Austausch der Nervenbotenstoffe.
Wir wollen hier nur festhalten: Die in Drogen enthaltenen Wirkstoffe verkürzen den Weg zum körpereigenen Belohnungssystem. Statt mühsam einen Marathon zu absolvieren, kann dieselbe Hochstimmung, die den Läufer nach Kilometer 42 – unter der Voraussetzung, dass man ihn nicht erst mal in ein Sauerstoffzelt zwecks Druckbeatmung verfrachten muss – durchflutet, ebenfalls mittels eines Viertelliters Cognac erzeugt werden. Die Droge, in diesem Fall der Alkohol, verkürzt nicht nur sporadisch den Weg, sondern führt des Weiteren zu Bequemlichkeit – wozu anstrengend laufen, wenn’s ein halber Kasten Bier, zu Hause auf dem Sofa genossen, genauso tut? – und zu dem Wunsch, sich diesen einfach herzustellenden Glücksmomenten öfter hinzugeben als von der Natur vorgesehen. Falls es schlecht ausgeht, endet man bei zu häufiger Wiederholung in der Sucht.
Aber damit greifen wir schon voraus, denn über Sucht reden wir erst drei Kapitel später. An dieser Stelle reicht es, wenn Sie verinnerlichen: Die Droge bzw. der Alkohol beschleunigt den Weg zum Belohnungssystem und potenziert das Euphoriegefühl. So viel kann man gar nicht joggen, um sich so sauwohl wie nach einer Pulle Rotwein zu fühlen!
Drei Vernebelungsstufen, um in den Orbit zu gelangen
Zurück zum Rausch. Bei diesem unterscheiden wir grob drei Vernebelungsstufen:
•Schwips: Man fühlt sich angeheitert, kichert, lacht, die Welt ist schön, die griesgrämige Bürokollegin wirkt auf einmal gar nicht mehr so griesgrämig etc. etc.
•Leichter Rausch: Beginnt in etwa jenseits der 0,5 Promille, weshalb man sich ab dieser Grenze auch tunlichst nicht mehr ans Steuer eines Fahrzeugs setzen sollte. Man sieht die griesgrämige Bürokollegin plötzlich unscharf, manchmal sogar doppelt, sagt Sachen, die man sonst eher nicht sagt, und wünscht – falls man sich am Tag darauf noch daran erinnern sollte –, man hätte das alles besser nicht gesagt. Vielleicht landet man sogar im Bett der griesgrämigen Bürokollegin und hofft am Morgen danach, es habe sich nur um einen erotischen Traum gehandelt, wogegen allerdings der BH spricht, den man in der eigenen Aktentasche entdeckt. Beim leichten Rausch kann es zu Wortfindungs- und Artikulationsschwierigkeiten kommen. Bei manchem bewirkt dieser Aggregatszustand das Gegenteil, und man redet stundenlang, ohne dabei zwischendurch Luft zu holen, dummes Zeug. Einige beginnen zu schwanken und zu wanken, und ein nicht ganz so betrunkener Kollege muss sie unterhaken, ins Taxi setzen und dem Fahrer erklären, wo er den leicht Berauschten abliefern soll. Der Morgen darauf ist bestimmt von Katzenjammer und Aspirin, und der leicht Berauschte schwört, nie mehr einen einzigen Tropfen anzurühren. Dieser gute Vorsatz währt zwar nur bis zur nächsten Happy Hour, hält aber immerhin ein paar Tage. Der leichte Rausch endet – in Abhängigkeit vom Trainingszustand des Konsumenten – irgendwo im Bereich zwischen 1,5 und 2,0 Promille, und über diese Schwelle treten wir nun ein ins dunkle Reich der dritten Stufe:
•Schwerer oder gar Vollrausch: Über Wortfindung, Artikulation und Gangsicherheit brauchen wir uns hier keine Gedanken mehr zu machen: Sie sind allesamt komplett perdu. Die Welt verschwimmt im Nebel, für manche wird sie gar zappenduster. Wenn’s gut läuft, fällt der schwer Berauschte in ein zufällig in der Nähe stehendes Bett, wo er seinen Rausch komatös ausschläft. Wenn’s schlecht läuft – und es läuft oft schlecht –, beleidigt er den Chef, zertrümmert das halbe Büro, erwacht steifgefroren auf einer Parkbank oder in der Ausnüchterungszelle und bekommt am Tag darauf per Einschreiben mit Rückschein die fristlose Kündigung zugestellt.
Ein Rauschzustand auf der Betriebsfeier kann also helfen, endlich den Mut zu fassen, die seit Jahren heimlich angehimmelte Kollegin aus der Exportabteilung nach einem Date zu fragen. Ein Rausch kann dabei behilflich sein, den eben zugestellten Mahnbescheid mit Pfändungsandrohung ein paar Stunden lang beiseitezuschieben. Ein Rausch kann Wunder beim Sex wirken. Ein Rausch ist auch schön, wenn man ihn in der Gruppe genießt und alle zusammen Schlager aus den Fünfzigern und Sechzigern trällern und dazu nackt im Vorgarten des Nachbarn herumhüpfen. Ein leichter Rausch macht körperliche und seelische Schmerzen vergessen und wiegt einen angenehm in den Schlaf.
Ein Rausch kann auch sinnvoll sein, wenn man vorhat, sich umzubringen. Der Blick in eine Revolvermündung, die man sich gleich in den Mund schieben wird, ist weniger angsteinflößend, wenn man vorher eine Flasche Bourbon geleert hat. Ein Rausch ist auch eine prima Sache, um sich an Peinlichkeiten, die man im Zustand alkoholbedingter Verwirrung angestellt hat, nicht erinnern zu müssen. Wer hat schon ernsthaft etwas einzuwenden, wenn ein Trinker am Morgen darauf zerknirscht, die linke Hand an der schmerzenden Stirn festgetackert, während die rechte zitternd versucht, ein Glas Wasser mit drei darin aufgelösten Aspirin an die Lippen zu führen, sagt: „Das soll ich gestern Abend alles gemacht haben? Unmöglich!“
Der Morgen nach dem Rausch ist ohnehin nicht so schön, weder für den Hobby- noch für den Profitrinker. Während der eine kotzend über der Kloschüssel hängt, macht sich der andere auf zum nächstgelegenen Supermarkt, um dort Nachschub zu besorgen. Dazu mehr im Abschnitt „Wann ist man Alkoholiker?“
Der Profi gehorcht anderen Regeln als der Amateur
Achtung: Ein Promillegehalt, bei dem für den Normaltrinker die Lichter ausgehen und durch den er sich eine Stunde später fixiert auf der Intensivstation wiederfindet, kann für den Profisäufer den Normalzustand bedeuten, ab dem er überhaupt erst Betriebstemperatur erreicht. Ich kenne einige, die sich ein Leben unterhalb von zweieinhalb Umdrehungen nicht vorstellen können. 4,0 Promille gelten als letale Dosis, bei deren Erreichen 80 % der Menschen den finalen Atemzug tun, bevor der Notarzt bedauernd konstatiert: „Nichts mehr zu machen. Transportieren Sie den Leichnam direkt in die Kühlkammer.“ Das gilt allerdings nicht für den Profitrinker. Der wankt noch zur Nachttankstelle, um sich einen letzten Schlummer-Flachmann zu genehmigen, bevor er endlich alle Viere von sich streckt und auf dem Flur vor der Wohnungstür seinen Vollrausch ausschläft.
In diesem Kapitel haben Sie erfahren, dass gegen Gelegenheitsräusche prinzipiell nichts einzuwenden ist, insofern Sie dabei nicht auf die Idee kommen, einem zufälligen Passanten das Nasenbein zu zertrümmern oder auf dem Heimweg von einem feuchtfröhlichen Gelage mit Tempo 240 eine Abkürzung durch eine verkehrsberuhigte Wohngegend zu nehmen. Solange es beim Gelegenheitsrausch bleibt und der Zecher am nächsten Tag nicht das Verlangen spürt, den Rauschzustand ein weiteres Mal herbeizuführen, ist alles im grünen Bereich, von den Anzeigen wegen zertrümmerter Nase und Rasen in einem Wohngebiet mal abgesehen.
Das Herbeiführen eines Rausches kann aus unterschiedlichen Beweggründen heraus geschehen. Am unteren Ende der Skala steht dabei der Wunsch, beim Sex mit der Kollegin aus der Abteilung Rechnungswesen länger als fünf Minuten durchzuhalten, während die oberste Treppenstufe vom Versuch gekennzeichnet ist, sich durch die Zuführung von Alkohol in einen Trancezustand zu versetzen, durch den man befähigt wird, mit den Göttern zu kommunizieren. Ob die Stimmen, die man dann raunen hört, tatsächlich von den Göttern stammen oder doch eher von den inneren Dämonen herrühren, soll an dieser Stelle unbeantwortet bleiben.
MERKE
Hin und wieder ein Rausch ist okay, wenn er nicht in die Ausnüchterungszelle führt und kurz darauf wiederholt werden muss.
Gesoffen hat schon unser Steinzeit-Urgroßvater
Im Wodka-Galopp durch zehntausend Jahre Alkoholgeschichte: Was hat Lidschatten mit Weinbrand zu tun?
Wir alle wissen, dass sich bereits der Cro-Magnon-Mensch abwechselnd mit vergorenen Früchten und halluzinogenen Pilzen berauschte. Da unsere Steinzeitvorfahren Früchte und Pilze jedoch nicht ganzjährig fanden und einsammelten und der Kühlschrank noch nicht erfunden worden war, stellten absichtlich herbeigeführte ekstatische Bewusstseinszustände in der Mittelsteinzeit die Ausnahme und nicht die Regel dar. Saufen bzw. vergorene Früchte futtern war ein Sommer- bzw. Herbstsaisongeschäft. In der dunklen Jahreszeit sah’s damit eher mau aus.
Das änderte sich schlagartig, als unsere Ururururgroßeltern die Vorzüge der Landwirtschaft für sich entdeckten und ihr ständiges Umherreisen an den Nagel hängten. Die Geschichtswissenschaft bezeichnet diesen Vorgang des allmählichen Sesshaftwerdens unserer Vorfahren als Transformation der Jäger und Sammler, die auf der Suche nach Nahrung 24/7 in Bewegung waren, in Bauern, die mit ihrer Hände Arbeit dem Boden einen ganzjährigen Ertrag abtrotzten, dafür jedoch an ihrer Scholle festkleben mussten. Vorbei war es mit Rumstreunerei und Lagerfeuerromantik. Der Bauer blieb in Sichtweite seines Feldes und wurde zum erbitterten Feind des Nomaden. Dieser weltgeschichtlich superwichtige Vorgang, die sogenannte neolithische Revolution, trug sich vor ca. 12000 Jahren zu.
Unseren Steinzeit-Landwirt-Vorfahren gelang es, eine Urform der Gerste zu kultivieren und anzubauen, bei deren Lagerung sie feststellten, dass das zerkleinerte Getreide zu keimen und zu mälzen begann. Von dort bis zur gewerbsmäßigen Braukunst war es nur noch ein kleiner Schritt, der allerdings ein paar hundert Jahre gedauert haben dürfte.
Gebraut wurde alles, was sich in Alkohol verwandeln ließ: Gerste, Emmer, Weizen, Honig, sogar Reis (in China). Hauptsache, der Stoff schmeckte einigermaßen, war nicht toxisch und entfaltete ein angenehmes Säuselgefühl in der Nebenhirnrinde. Die immer noch herumwandernden Nomaden, die keine Gerste kultivierten und in der Konsequenz nichts zusammenbrauen konnten, mussten sich derweil mit vergorener Stutenmilch begnügen.
Von den Sumerern in Mesopotamien – das sind die, denen wir das alkoholgeschwängerte Gilgamesch-Epos, die ersten Schriftzeichen und eine Menge in Tontafeln eingeritzte Kneipenwitze verdanken – gelangte die Braukunst an den Nil, wo die Pharaonen jahrtausendelang das Staatsmonopol der Herstellung für sich beanspruchten. Gerstenbier wurde jeden Tag getrunken, allerdings zu festen Uhrzeiten und in zugeteiltem Quantum. Ob Alkoholismus bereits im frühen Altertum bekannt war, wissen wir aufgrund mangelhafter Quellenlage nicht genau; es steht jedoch zu vermuten, dass sich nicht jeder brave Bürger an die oben genannten festen Uhrzeiten und sein zugeteiltes Quantum hielt. Wie damals entgiftet wurde? Keine Ahnung. Mit hoher Wahrscheinlichkeit kalt und mit ungewissem Ausgang.
Wein, ein Geschenk der Götter
Kurz auf das erste Bierbesäufnis folgte die Entdeckung des Kelterns: Weintrauben mit den Füßen zerstampfen und die so gewonnene Matschepampe (fachmännisch Maische genannt) ein paar Tage nicht anrühren. Dann erneutem Druck aussetzen, um den Most vom Trester zu trennen. Den süß-klebrigen, dickflüssigen Saft in Fässer bzw. Tonkrüge füllen, diese hermetisch verschließen und das Ganze wiederum ein paar Wochen ziehen lassen, was man als Gärvorgang bezeichnet. Nun schmeckte das Zeug, dem man zwecks Verstärkung vor der Gärung noch Zucker beimischen kann, endlich nach Wein und wirkte auf Sensorik und Artikulationsfähigkeit unserer Vorfahren um einiges heftiger als das eher harmlose Volksgesöff Bier, weshalb man den Wein auch als Geschenk der Götter deklarierte.
Götter hin oder her – konsumiert wurde Wein quer durch alle Gesellschaftsklassen. Bei den zahlreichen Feiern zu Ehren noch zahlreicherer Gottheiten konnte der Konsum schon mal aus dem Ruder laufen, was dann in den berühmt-berüchtigten dionysischen Orgien endete. Die Ägypter kannten beispielsweise das Fest der Trunkenheit, das sie alljährlich zu Ehren der löwenköpfigen Göttin Hathor zelebrierten. Mit dem ausdrücklichen Segen der Priester, sich eine Nacht lang zu betrinken, bis die Lampen in den Tempeln erloschen und die Sinne der entrückten Gläubigen schwanden. Der Tag darauf war von Katzenjammer und zerknirschten Gebeten bestimmt, neun Monate später stieg die Geburtenrate steil an.