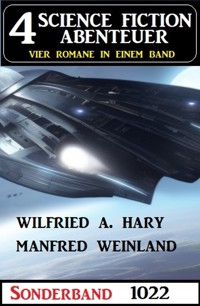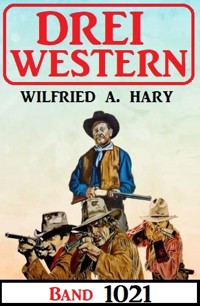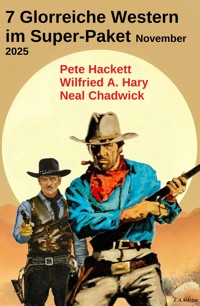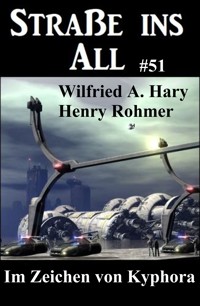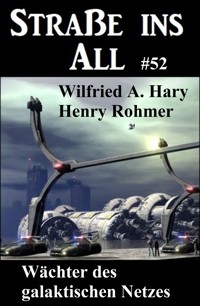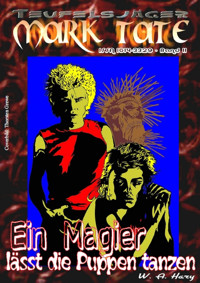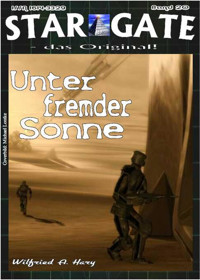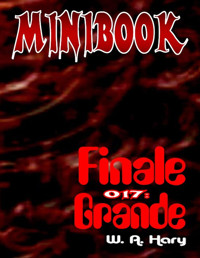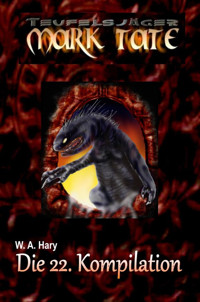8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
RB 005: Eine ganz verflixte Lady
Wilfried A. Hary: „In diesem Buch sind aus der laufenden Heftroman-Serie RED BOOK die Bände 27 bis 43 enthalten!“
Wie die verflixte Lady ins Spiel kommt - und wie ihr was gelingt, was nur sie schaffen kann - mit allen Folgen und ohne Wenn und Aber!
Natürlich wird auch wieder ein ganz besonderer Mann eine ganz besondere Rolle spielen, nämlich kein Geringerer als Dr. No, der Mann aus dem Nichts!
Fantastik plus Krimi - ist gleich: Fantastischer Krimi!
Mit Sheila – dem Callgirl mit Biss! Und natürlich mit Dr. No – dem Mann aus dem Nichts!
Impressum:
Copyright neu 2015 by HARY-PRODUCTION * Canadastr. 30 * 66482 Zweibrücken * Tel.: 06332481150 * HaryPro.de * ISSN 1861-1273
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
RB 005: Eine ganz verflixte Lady
„In diesem Buch sind aus der laufenden Heftroman-Serie RED BOOK die Bände 27 bis 43 enthalten!“
Alle Infos über den Autor siehe Wikipedia unter dem Suchwort "Wilfried A. Hary"! BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenRED BOOK Buchausgabe 5
Eine ganz verflixte Lady
- von Wilfried A. Hary:
Wie sie ins Spiel kommt - und wie ihr was gelingt, was nur sie schaffen kann - mit allen Folgen und ohne Wenn und Aber!
Natürlich wird auch wieder ein ganz besonderer Mann eine ganz besondere Rolle spielen, nämlich kein Geringerer als
Dr. No, der Mann aus dem Nichts!
Impressum:
ISSN 1861-1273
Diese Fassung:
© 2015 by HARY-PRODUCTION
Canadastr. 30 * D-66482 Zweibrücken
Telefon: 06332-481150
www.HaryPro.de
eMail: [email protected]
Sämtliche Rechte vorbehalten!
Nachdruck nur mit schriftlicher Genehmigung von
HARY-PRODUCTION!
Coverhintergrund: Thorsten Grewe
In diesem Buch sind aus der laufenden Heftroman-Serie RED BOOK die Bände 27 bis 43 enthalten!
Damit ist die Serie als Buchausgabe RED BOOK in sich abgeschlossen. Natürlich mit der Option, irgendwann fortgesetzt werden zu können!
RED BOOK 027
W. A. Hary
Eine ganz verflixte Lady
„Was wäre die Welt - ohne Sheila?“
Noch während ich in Finnland beschäftigt war (Bände 22 bis 26), geschahen in New York ganz andere Dinge. Schade, daß ich nicht dabei sein konnte, aber dafür kam Sheila zum Einsatz - ein Teufelsgirl aber auch!
Dreh- und Angelpunkt war ein geheimnisumwitterter Mann mit Namen Harry York...
*
Harry York war unserem Boß Captain Stone schon seit langem ein Dorn im Auge. Der Mann war innerhalb weniger Jahre zum Milliardär geworden und hatte es dank seiner Frau geschafft, in die höchsten Kreise der Gesellschaft vorzustoßen. Niemand vermochte zu sagen, womit er eigentlich sein Geld verdiente. Gut, er besaß dieses große Ferienschiff, das im Hafen von New York lag. Auch in vielen anderen Geschäften hatte Harry York seine Hände. Aber das alles reichte bei weitem nicht zu einem solchen Reichtum. Es machte eher den Eindruck, als wären die legalen Unternehmungen des Mannes nur ein Deckmäntelchen.
Je mehr meine beste Freundin und »Kollegin« Sheila darüber nachdachte, desto mehr wurde ihr bewußt, wie sehr sich die Laufbahnen von ihrer Kontaktperson Davey Larson und Harry York ähnelten. Nur war Larson noch um einige Nummern kleiner als der Milliardär Harry York. Alles deutete sogar darauf hin, daß Larson von dem anderen im gewissen Sinne abhängig war.
Captain Stone war auf York aufmerksam geworden, als die CIA eine Spur aufgenommen hatte, die ausgerechnet bei Harry York endete.
Allerdings war dem Mann nichts nachzuweisen gewesen, obwohl sich der seit langem gehegte Verdacht nur noch verstärkt hatte.
In dieser Notsituation wurde Sheila eingeschaltet. Es mußte ihr gelingen, den Milliardär sozusagen an Land zu ziehen. Nur auf dem direkten Wege war es möglich, mehr zu erfahren.
Falls alle Stricke rissen, war da immer noch Davey Larson, der sich vorzüglich als Sprungbrett eignen würde.
Sheilas gegenwärtige Verkleidung als junge Studentin in Jeansklamotten und mit klapprigem alten VW-Käfer hatte seinen Grund. Nur so konnte sie die Aufmerksamkeit Yorks auf sich ziehen. Sie kannte inzwischen seinen Geschmack, Frauen betreffend. Rassige Vollblutweiber machten ihn nur nervös. Er bevorzugte die ungeschminkte Weiblichkeit und natürliche Erotik.
Sheila konnte auch das bieten.
Sie war Expertin. Es gab kaum eine Rolle, die sie nicht spielen konnte - vom männermordenden Vamp über die faltenreiche Oma zum abgetakelten Strichmädchen, an dem die Zeit nicht so ganz spurlos vorübergegangen war.
Wenn es sein mußte, schlüpfte sie auch mal in Männerkleidung, allerdings höchst ungern.
Endlich hatte sie ihr Ziel erreicht. In der Nähe des Apartmenthauses fand sie einen Parkplatz und gratulierte sich insgeheim zu diesem Glück. Leider mußte sie durch die Heckscheibe sehen, wenn sie das Haus im Auge behalten wollte. Aber das nahm sie in diesem Fall gern in Kauf.
Sie war gerade rechtzeitig gekommen. Nach kurzer Zeit schon fuhr der silbergraue Cadillac mit Harry York und seinen Männern vor und spuckte drei Personen aus. Sheila wartete noch einen Moment, dann stieg auch sie aus.
Der Cadillac war um die nächste Straßenecke verschwunden. Vermutlich wartete der Fahrer dort auf weitere 0rder. Direkt vor dem Haus hatte er nicht parken können, aber das hätte York wahrscheinlich ohnehin nicht zugelassen.
Sheila schlenderte auf das Apartmenthaus zu. Sie hatte einen Kaugummi in den Mund geschoben und kaute emsig darauf herum. Nicht mal ihre eigene Mutter hätte sie in diesem Aufzug erkannt.
*
Es schellte an der Tür. Daphne ging hin und äugte durch den Spion. Ein breitschultriger Mann stand davor. Daphne erkannte ihn und öffnete.
Der Mann verschlang ihren nackten, makellösen Körper mit seinen Blicken, als er eintrat.
»Die übliche Routine«, sagte er anstelle einer Begrüßung. Sein Äußeres wirkte sehr gepflegt und sein Gesicht intelligent. Aber die Augen verrieten ihn. Sie warnten jeden, der es mit ihm zu tun bekam. Nicht umsonst gehörte er zu den engsten Vertrauten von Harry York.
Daphne zuckte scheinbar gleichmütig die Achseln und schloß hinter dem Mann die Tür.
»Es macht Ihnen doch nichts aus, wenn ich indessen mein Morgenpensum erledige?«
Er lächelte ohne Wärme.
»Nur zu, ich werde Sie nicht stören.«
Sein Atem beschleunigte sich etwas, und ein gieriger Ausdruck trat in seine Augen.
»Vorsicht«, warnte Daphne unterkühlt. »Denken Sie an Ihren Chef!«
Unwillig wandte er seinen Blick von ihren nackten kleinen, festen Brüsten und begann endlich, die Wohnung zu durchsuchen. Er war Experte. Wenn es hier etwas gab, was seinem Boß hätte in irgendeiner Weise gefährlich werden können, dann fand er es auch. Für die Ortung eventuell vorhandener Abhöreinrichtungen hatte er einen speziellen Scanner, ein wahres technisches Wunderwerk.
Daphne Ashton ließ sich durch ihren Gast nicht stören. Sie ging ins Bad und bearbeitete die dortigen Gymnastikgeräte nackt, wie sie war, bis sie ordentlich ins Schwitzen kam. Dann stellte sie sich eine Weile unter die Dusche. Als sie das Bad verließ, fühlte sie sich wie neugeboren. Eine Schüssel Cornflakes mit etwas Zucker und viel frischer Milch beendete den Hauptteil ihrer verspäteten Morgenroutine - und sie war immer noch splitternackt. Dabei dachte sie amüsiert daran, daß der Mittag längst vorbei war.
Inzwischen war auch Harry Yorks Untergebener fertig.
»Sagen Sie mal, Miß Ashton, wollen Sie sich nichts überziehen?« erkundigte er sich.
»Warum? Macht es Sie nervös?«
»Also gut, ich warte draußen auf Harry«, schnaubte er und verließ das Apartment.
Daphne Ashton grinste. Bisher hatte sie sich keine Mühe gemacht, mit ihrer Abneigung gegen diese Sorte von Männern hinter dem Berg zu halten. Auch diesmal war ihr die Provokation offenbar voll gelungen.
Anmutig lief sie zu ihrem Telefon und sagte endlich dem Kunden ab, den sie eigentlich erwartet hätte. Anschließend bürstete sie sich die Haare und zog einen transparenten Morgenmantel an. Der Stoff war so fein, daß er in ihrer kleinen Hand Platz gehabt hätte.
Zu schminken brauchte sich die reizende Daphne nicht. Ihre Kunden - und vor allem Harry York! - standen auf Natur.
*
Elisabeth Yorks Herz pochte bis zum Hals. Seit mehreren Stunden saß sie in ihrem Leihwagen und wartete. Endlich wurde ihre Geduld belohnt. Drüben schlenderte ein Mann über den Bürgersteig und blieb am Eingang zu dem zwanzigstöckigen Apartmenthaus stehen.
Sie kannte den Mann.
Es war einer von Harrys engsten Vertrauten: Mort Mackay. Wo der auftauchte, konnte Harry York nicht mehr weit sein. Der Breitschultrige warf einen letzten Blick in die Runde, dann betrat er das Hochhaus.
Elisabeths Gedanken jagten sich. Was sollte sie tun? Einfach folgen? Sie entschied sich dagegen und beschloß, noch zu warten, bis Harry kam. Sie erinnerte sich an die ungeheure Enttäuschung, als sie zum erstenmal dahintergekommen war, daß ihr Mann ein Doppelleben führte. Vor zehn Jahren, mit Zwanzig, hatte sie ihn auf einer Party kennengelernt und bald darauf geheiratet. Inzwischen war Elisabeth York klargeworden, daß ihre äußere Erscheinung für Harry nur eine Art Dreingabe gewesen war. Er hatte sie in erster Linie geheiratet, weil sie aus einer sehr renommierten Familie stammte. Um über ihren Verdacht Gewißheit zu bekommen, hatte die eifersüchtige Frau den Privatdetektiv Glenn Ellman beauftragt. Bevor er unter etwas mysteriösen Umständen von einem Lastwagen der Forester Spedition, in deren Nähe die Sache passierte, zu Tode gekommen war, hatte er noch Gelegenheit gehabt, seiner Auftraggeberin die Adresse des Callgirls Daphne Ashton zu geben.
Nun hatte Elisabeth die Sache selbst in die Hand genommen. Sie war ganz in Schwarz gekleidet und trug einen breitkrempigen Hut mit einem dunklen Schleier. Es sah fast so aus, als wäre sie gerade von einer Beerdigung gekommen, was aber nur dazu diente, daß sie niemand erkannte.
Vielleicht wird es tatsächlich zu einer Beerdigung kommen? dachte sie in einem Anflug von Galgenhumor und tastete nach der kleinen Waffe, die sie in die Handtasche gesteckt hatte.
In diesem Augenblick fuhr ein Wagen vor das Apartmenthaus. Es war ein silbergrauer, staubiger Straßenkreuzer der Marke Cadillac. Zwei Typen stiegen aus und - Harry York. Die beiden unauffällig wirkenden Männer nahmen ihn in die Mitte und geleiteten ihn zum Haus. Einer blieb am Eingang stehen und blickte lauernd in die Runde, während der Fahrer des Cadillacs Gas gab und davonbrauste.
Harry York verschwand mit dem zweiten der mit ihm ausgestiegenen Männer.
Wenig später tauchte der Typ wieder auf. Er hob seine Armbanduhr zum Mund. Seine Lippen bewegten sich. Dann lauschte er an der Uhr.
Mit dem Ergebnis schien er zufrieden zu sein, denn er nickte seinem Kollegen unauffällig zu. Sie gaben sich so, als lungerten sie zufällig am Eingang herum.
In diesem Augenblick ging ein Mann über die Straße, der den beiden irgendwie ähnelte.
Elisabeths Augen verengten sich zu schmalen Schlitzen. Dann war sie sicher, daß der Dritte auch zu den Leuten ihres Mannes gehörte.
Sie fragte sich zum wiederholten Male, wozu Harry diese Art von Leibwache brauchte.
Elisabeth hatte ihn einmal darauf angesprochen und gleichzeitig auch mehr über die Art seiner Geschäfte wissen wollen. Seine Reaktion darauf war so heftig gewesen, daß sie auf weitere Fragen freiwillig verzichtet hatte.
Nur noch ein Mann ist jetzt mit Harry im Innern des Gebäudes: Mort Mackay! dachte Elisabeth.
Sie wartete noch eine Weile, aber Mackay tauchte nicht mehr auf. Es war klar, daß er seinen Chef bewachte.
Elisabeth York gab sich einen Ruck. Ihr Herz schien im Hals zu pochen, als sie ausstieg.
Sie hatte hochhackige Lederstiefel, dazu einen wadenlangen, faltenreich fallenden Rock und ein knappes Kostümoberteil an. Die kleine Waffe steckte in dem Stoffhandtäschchen.
Mit wiegenden Hüften ging die attraktive Frau, deren Gesicht in den letzten Jahren das Babyhafte völlig verloren hatte, auf das Hochhaus zu. Innerlich war sie total aufgewühlt, aber nach außenhin blieb sie eiskalt. Der schwarze Schleier, der von ihrem breitkrempigen Hut herunterhing, war der Garant dafür, daß die Typen sie nicht erkannten.
Zumindest vertraute Elisabeth darauf.
Die lüsternen Blicke der drei Männer tasteten ihren Körper ab. Aber in ihren Augen zeigte sich kein Erkennen.
Ohne auf sie zu achten, stolzierte sie an ihnen vorbei und trat ein. Ein Mädchen in Jeanskleidung, das aussah wie eine Studentin, befand sich knapp hinter ihr.
Das dürfte ungefähr Harrys Kragenweite sein, dachte Elisabeth bitter.
Die Schwingtür pendelte langsam aus. Die drei Männer starrten der Lady nach, bis diese ihren Blicken entschwunden war. Auf das Jeansgirl achteten sie überhaupt nicht.
Das mochte zwar die Kragenweite ihres Bosses sein - ihre Kragenweite war das offensichtlich nicht. Da kam eher die Lady in Schwarz infrage.
Und dabei ahnten sie nicht einmal, daß es sich dabei um die Ehefrau ihres Bosses handelte!
Seufzend lehnte sich Elisabeth gegen die Marmorfliesen, aus denen die Wände in der Halle bestanden. Ihr Herz flatterte. Es dauerte eine Weile, bis sie sich wieder einigermaßen im Griff hatte.
Die erste Hürde war jedenfalls geschafft. Grund, zu triumphieren - und darüber diese vertrackte Nervosität zu vergessen.
Elisabeth York trat zu den Fahrstühlen und wählte den mittleren. Ihre Hand zitterte ein wenig, als sie auf den Knopf mit der Zahl 18 drückte. Die Lifttür schloß sich mit einem schmatzenden Geräusch. Der Fahrstuhl beschleunigte rasch.
Elisabeth York packte die Handtasche fester. Deutlich ertastete sie unter dem Stoff die Konturen des Revolvers. Es beruhigte sie ungemein, und der Pulsschlag wechselte über zu einer normaleren Frequenz - endlich!
Im sechsten Stock hielt der Lift plötz|ich.
Elisabeth hatte das Gefühl, von einer eiskalten Hand gewürgt zu werden. Hatte Harry Verdacht geschöpft? Seine Leute besaßen bestimmt Funkgeräte, mit denen Sie ständig untereinander in Kontakt bleiben konnten. Nur so war die Geste des einen Mannes zu erklären, den sie beobachtet hatte: Minifunkgeräte, die sogar in einer Armbanduhr Platz fanden!
Die Tür öffnete sich. Auf dem Flur schien niemand zu sein.
Stirnrunzelnd beugte sich Elisabeth vor und wollte nachsehen. Da schob sich ein vierschrötiger Typ mit unbewegtem Gesicht in die Türöffnung.
Elisabeth York hätte vor Schreck beinahe ihre Handtasche fallen lassen. Aber der Mann wollte nichts von ihr. Er nickte ihr zu und kam herein. Die Tür schloß sich hinter ihm, während er mit dem Daumen »Erdgeschoß« drückte.
»Fahren Sie aufwärts?« erkundigte er sich.
Die Frau brachte keinen Ton hervor. Ein dicker Kloß schien in ihrer Kehle zu sitzen. Sie schwitzte. Aber sie wurde einer Antwort enthoben, denn der Fahrstuhl ruckte an und kletterte Stockwerk für Stockwerk höher.
Der Mann betrachtete Elisabeth mit unverhohlenem Interesse. Die elegante Frau schien auf ihn mächtig Eindruck zu machen. Er räusperte sich schließlich.
»Entschuldigen Sie bitte, aber wohnen Sie auch hier?« fragte er.
Aha, dachte Elisabeth ungehalten, jetzt will er mit dir anbändeln.
Sie antwortete nicht. Auch wenn sie es gewollt hätte - ihre Stimme versagte ihr den Dienst.
Sie hatte sich die Sache ganz anders vorgestellt, viel einfacher. Sie hatte mit gezückter Waffe vor ihren Mann und seine Geliebte treten wollen. Sie hatte von ihm wissen wollen, warum er ihr das alles angetan hatte. Aber sie hatte ihren Mann völlig falsch eingeschätzt. Irgend was stimmte mit ihm nicht. Welcher normale Milliardär umgab sich denn mit solch hochspezialisierten Experten?
Plötzlich wußte sie, was all die Jahre für sie verborgen gewesen war: Harrys Geschäfte waren illegaler Art! Nein, er war kein Gangster im üblichen Sinne, kein Mörder. Er machte seine Geschäfte auf andere Weise:
Spionage! schoß es ihr durch den Kopf.
Ja, das war die einzige Möglichkeit. Das ganze Vorgehen der Leute wies darauf. Sie waren Spione. Ohne Zweifel war Harry York der Kopf - ein Mann, der Informationen sammelte wie andere Leute Briefmarken und dann an den Meistbietenden verkaufte.
Elisabeth schwindelte es, und sie mußte sich festhalten, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren.
Der Fremde riß erschrocken die Augen auf und griff nach ihrem Arm.
»Um Gottes willen, Madam, fühlen Sie sich nicht wohl?«
Elisabeth schüttelte seine hilfreiche Hand ab und sagte kühl: »Danke, es geht schon wieder.«
Der Mann zuckte mit den Achseln und lehnte sich zurück. Der Lift hielt, und die Frau stieg aus. Der Fremde schluckte hinunter, was er eigentlich noch hätte sagen wollen, und folgte der eleganten Dame mit den Blicken, bis sich die Tür wieder schloß.
Elisabeth York verspürte das dringende Bedürfnis, sich einen Moment lang auszuruhen, um sich wieder zu sammeln. In ihrem Kopf summte es wie in einem Bienenkorb, und sie war zu keinem vernünftigen Gedanken mehr fähig.
Aber es gab weder eine Pause noch ein Zurück für sie. Noch zehn Schritte, dann hatte sie Daphne Ashtons Wohnung erreicht. Vor der Eingangstür hatte sich ein breitschultriger Mann postiert, dessen Blicke verrieten, daß er nicht zum Scherzen aufgelegt war: Mort Mackay.
Er hatte Verdacht geschöpft. Plötzlich lag wie hingezaubert eine Pistole in seiner Hand. Sie sah in seiner Pranke wie ein kleines Spielzeug aus, was aber nicht über ihre tödliche Gefährlichkeit hinwegtäuschen konnte.
Elisabeth starrte in die schwarz gähnende Mündung der Waffe und kam scheinbar ungerührt näher.
Mackays Zeigefinger krümmte sich um den Abzug. Er witterte Gefahr für seinen Chef und würde keine Sekunde lang zögern, diese Gefahr auszuschalten, wenn es sich als notwenig erwies.
Elisabeth York handelte mehr unbewußt, indem sie das einzig Richtige tat: Sie lüftete ihren Schleier. Im gleichen Moment erkannte Mort Mackay erst, wen er vor sich hatte.
Erschrocken riß er die Augen auf. Der Lauf seiner Waffe schwenkte unsicher hin und her.
»Was - was machen denn Sie hier?« fragte er verwirrt. Er war ein Mann, den so leicht nichts umwerfen konnte. Es war ihm geglückt, sich im harten Spionagegeschäft nach oben zu boxen. Trotzdem traf ihn der Anblick der Lady wie ein Schlag.
»Ich muß zu meinem Mann.« Elisabeths Stimme klang gefaßt, und eigentlich war sie es auch. Das innerliche Chaos war wie weggewischt. Sie fühlte sich wie im Traum. Alles um sie herum erschien ihr seltsam unwirklich.
Direkt vor dem mit allen Wassern gewaschenen Mann blieb sie stehen.
»Es ist dringend. Es geht um Leben und Tod!«
Damit hatte sie nicht einmal Unrecht, obwohl das zu diesem Zeitpunkt noch nicht so sicher war.
Die Mündung der tödlichen Waffe deutete zu Boden.
Mort Mackay war intelligent, jeder Situation gewachsen - für gewöhnlich. Dieser Situation hier allerdings war er irgendwie nicht gewachsen. Er brauchte ein paar Sekunden, um seine Fassung wiederzuerlangen.
Elisabeth York beschloß, den Schreckmoment nicht zu lange in Anspruch zu nehmen. Sie öffnete ihre Handtasche. Der Revolver lag gut in ihrer Hand.
Bevor der Agent reagieren konnte, machte Elisabeth York etwas, was sie noch vor Minuten für völlig unmöglich gehalten hätte.
Ein Teufel schien sich in ihr eingenistet zu haben, der sie zu einem solchen Handeln zwang, und sie ahnte, daß ihr letztlich keine andere Wahl blieb, wollte sie überleben.
Wenn Harry York wirklich der war, als den sie ihn einschätzte, war ihr Leben keinen Pfifferling mehr wert.
Blitzschnell stach ihre Hand mit dem Revolver vor. Der Lauf bohrte sich in die linke Brustseite von Mort Mackay.
Die Frau drückte ab.
Eine reine Instinkthandlung.
Affekt.
Es gab einen dumpfen Laut, wie fast bei einer unterirdischen Detonation.
Die Waffe wurde durch den Rückstoß beinahe der zierlichen Hand der Frau entrissen.
Mort Mackay prallte mit einem ungläubigen Gesichtsausdruck gegen die Wand neben der Eingangstür.
Er wollte seine Pistolenhand heben, kam aber nicht mehr dazu. Seine Augen brachen. Der schwere Körper rutschte zu Boden, blieb dort einen Moment lang sitzen. Dann streckten sich die Beine.
*
Wie immer hatte Harry York das Bad genossen. Daphne hatte ihn gründlich eingeseift. Nun verschwand das duftende, warme Wasser gurgelnd im Abfluß.
Daphne drehte die Brause auf und duschte den Mann ab.
Er war groß und schlank. Sein Körper war bis auf die Hüften gleichmäßig braun. Unter der Haut spielten durchtrainierte Muskeln. Das dunkle Haar war feucht geworden und hing strähnig in die Stirn, was ihm ein fast jungenhaftes Aussehen verlieh. Harry York zeigte ein kräftiges, blühtenweißes Gebiß, als er das Mädchen anlächelte.
Daphnes Morgenmantel stand vorn offen und gab die Brüste frei und den Anblick ihres herrlichen, wohlgeformten nackten Körpers.
Harry zog sie an sich und küßte sie zärtlich. »Du bist wunderbar, Baby«, murmelte er erregt.
Sie spürte, daß ihr heiß wurde. Der Mann gefiel ihr, weshalb sie seine Gefühle erwiderte - obwohl sie nicht zögerte, ihn an Sheila abzugeben. Sie war der Meinung, daß die Entscheidung letztlich bei ihm lag. Allerdings hütete sie sich, etwa Sheila zu erwähnen.
Daphne wußte wohl nicht, was Sheila mit dem Mann im Schilde führte, ahnte nicht einmal etwas von ihrem Job, den sie in Wirklichkeit ausübte, aber die »Kollegin« hatte sie gebeten, ihren Namen aus dem Spiel zu lassen.
Daphne genoß die zärtlichen Berührungen des Mannes.
Er stieg aus der Wanne. Ihre Lippen fanden sich zum Kuß. Gegenseitig liebkosten sie sich. Ihre Erregung wuchs.
»Komm«, flüsterte das Mädchen, »wir geben ins Schlafzimmer!«
Er nickte nur, griff sich das Frotteetuch, um sich notdürftig abzureiben, und folgte.
Daphne Ashton ließ langsam den Morgenmantel von ihren schmalen Schultern gleiten. Der Stoff schien ihren Körper zu streicheln.
Mit einem leisen, raschelnden Geräusch landete er auf dem Boden.
Daphne legte sich rücklings auf das Wasserbett, das sich ihren Körperkonturen anpaßte und leise gluckste.
»Komm!« wiederholte Daphne mit bebender Stimme und breitete die Arme aus.
Der Mann näherte sich ihr und legte sich neben sie. Die beiden umarmten sich. Eng schmiegten sich ihre heißen Körper aneinander.
Harrys Hände suchten - und fanden, was sie ertasten wollten.
Das rassige Girl stöhnte leise und wand sich schlangengleich.
Mit einer Hand zog Daphne die leichte Sommerdecke zurück und lud den Geliebten mit einer Geste ein. Sie krochen zu zweit darunter.
»Laß mich nicht länger warten«, hauchte Daphne. Sie war nur noch Frau und wünschte nichts so sehr, als mit diesem Mann eins zu sein.
Harry schob sich behutsam über den schönen Körper, wobei die prickelnde Nacktheit ihm die Sinne zu rauben drohte und sein Blut vollends in Wallung brachte.
Begierig griffen seine Hände nach den wunderbaren Brüsten, drückten sie zusammen, kneteten sie.
Dann legte er sein Gesicht zwischen die wallenden Hügel und preßte seinen Leib gegen Daphnes geöffneten Schoß.
Engumschlungen lagen sie eine Weile später nebeneinander.
Harry brannte für sie beide Zigaretten an. Schweigend rauchten sie.
Daphne Ashton lauschte plötzlich.
»Ich glaube, ich höre etwas«, sagte sie.
»Unsinn!« Harry York lachte amüsiert. »Das kann nicht sein. Und wenn schon, dann hat es nichts mit uns zu tun. Du weißt ja, daß Mackay vor der Tür steht. Auf den ist Verlaß.«
*
Normalerweise hätte Elisabeth York laut und hysterisch geschrien, aber jemand schien in ihren Kopf Eiswürfel gefüllt zu haben. Sie ahnte plötzlich, warum sie vor allem für Harry von größer Wichtigkeit war: sie war eiskalt und berechnend, wenn es darauf ankam.
Mit dieser Eigenschaft hatte sie oft genug bei großen Empfängen und dergleichen die Situation gerettet. Nicht ohne Grund war sie als Gastgeberin geschätzt.
Sie war für Harry York stets die Garantie gewesen, daß er jedermann als absolut integer erschien. Von seinen dunklen Geschäften ahnte kaum jemand etwas, und wenn, dann hütete sich jeder, einen etwaigen Verdacht auch nur zu äußern. Die gesellschaftliche Stellung machte den Mann fast unantastbar, zumal er es sich leisten konnte, stets bei der Wahrnehmung seiner krummen Geschäfte im Hintergrund zu bleiben.
Für alles hatte er seine Leute. Er war das Oberhaupt eines gut funktionierenden Spionageapparates. Keiner wußte etwas über den anderen. Nur einer koordinierte und verteilte Aufträge und Befehle: Harry York.
Ein Pluspunkt für ihn war, daß er Gewalt verabscheute, wenn sie sich vermeiden ließ. Er war Spion und kein Mörder. Er hätte auch den Privatdetektiv Glenn Ellman nicht liquidiert, sondern ihn erst einmal nach seinem Auftraggeber ausgequetscht und dann nach einem einigermaßen humanen Ausweg gesucht. Da gab es genügend Möglichkeiten.
Elisabeth York warf einen kurzen Blick in die Runde. Niemand war zu sehen. Der Schlüssel steckte im Schloß.
Das hatte seinen Grund. Falls es wichtig war, Harry York von etwas eilig in Kenntnis zu setzen, durfte es nichts geben, was seine Leute behinderte.
Das war auch das Motiv dafür, daß die Leibwächter mittels unsichtbar in den Kleidern untergebrachten Funkgeräten ständig miteinander in Verbindung standen.
Elisabeth York öffnete leise. Nach kurzem Nachdenken steckte sie den Wohnungsschlüssel ein. Mort Mackay brauchte ihn nicht mehr.
Die Diele war für Elisabeths Geschmack furchtbar eingerichtet. Zu poppig, zu modern. Die Garderobenhaken beispielsweise hingen nicht an der Wand, sondern inmitten des Flurs von der Decke.
Die Frau erkannte den leichten Mantel und den Hut ihres Mannes, die hin und her pendelten.
Der Hochflorteppich am Boden dämpfte die Schritte der Frau in Schwarz, als sie langsam auf die Tür zuging, hinter der deutlich Stimmen zu hören waren.
Elisabeth York fühlte Haß in ihrem Innern - Haß, der fast überschäumte und sich nur mit Mühe kontrollieren ließ.
Hier vergnügte sich ihr Mann mit einer anderen, während er seine eigene Frau wie eine Madonna behandelte.
Oh, Elisabeth sehnte sich genauso nach einem Mann wie jede normale Frau. Trotzdem hatte sie sich jahrelang all dies gefallen lassen. Sie hatte ihre Gefühle gewaltsam unterdrückt und war Harry treu geblieben.
Aber nun gelang ihr dies nicht mehr: Der Damm ihrer Beherrschung brach und die Kräfte, die dabei frei wurden, verwandelten die Dame von Welt in eine wahrhaftige Furie.
Sie stieß die Tür zum Schlafzimmer auf, daß sie krachend gegen die plastikverkleidete Wand schlug.
Wie ein Racheengel stand Elisabeth in der Türöffnung.
Die beiden Nackten, die sich auf dem Wasserbett rekelten, fuhren auseinander,
Elisabeth York warf ihre Handtasche beiseite und richtete ihren Revolver auf die zwei Menschen. Der schwarze Schleier war durch ihre heftigen Bewegungen wieder heruntergerutscht und verbarg das schöne Gesicht, das sich im Moment zu einer Grimasse verzerrt hatte. Breitbeinig stellte sie sich an das Fußende des Bettes.
Das erschrockene Pärchen richtete sich auf. Harry York starrte fassungslos auf seine Frau.
»Liz, was - was...?«
»Du wunderst dich wohl, wie?« sagte Elisabeth zynisch - eine Charaktereigenschaft, die bei ihr zum ersten Mal zutage trat. »Hattest mich wohl nicht erwartet?«
Harry York faßte sich schnell. Er runzelte die Stirn.
»Was soll das Theater?« Er deutete auf den drohend erhobenen Revolver.
»Das ist kein Theater, mein Lieber, sondern rauhe Wirklichkeit.«
Der Milliardär riß die Augen auf.
»Wie ist es dir eigentlich gelungen, hier hereinzukommen? Hat dich denn niemand aufgehalten?«
»Die es versucht haben, leben nicht mehr«, antwortete sie kalt und erschrak vor der Kälte in ihrer Stimme.
»Du hast...?« Er konnte nicht begreifen, was doch Realität war.
»Mort Mackay ist tot. Ich konnte nicht anders, sonst hätte er mich erschossen.«
Harry York schnappte nach Luft wie ein Fisch, der auf dem Trockenen liegt.
»Mensch, Liz, das ist doch Quatsch. Ich habe keine Totschläger um mich herum. Was - was ist mit den anderen?«
»Sie haben mich in Ruhe gelassen, haben mich nicht erkannt.«
Harry stierte auf den Revolver.
»Verdammt, leg' das Ding weg. Es macht mich nervös.«
Elisabeth lachte verächtlich.
»Das kann ich mir denken.«
»Was wollen Sie?« stieß Daphne Ashton hervor. Ihre Augen waren unnatürlich geweitet. Todesangst hatte sie gepackt.
»Fragen stellen«, erwiderte Elisabeth knapp und fixierte ihren Mann. Sie wußte, wenn von einem der beiden eine Gegenaktion kam, dann nur von ihm. Er war abgebrüht genug.
Ob er wirklich begriff, daß seine Frau zu allem entschlossen war?
»Welche Fragen?«
»Ich möchte nur eines wissen, Harry York: wer bist du?«
In seinen Augen loderte es. »Dein Mann«, erwiderte er trocken.
»Das weiß ich, obwohl du mit einer anderen im Bett liegst. Ich will etwas anderes erfahren.«
»Wenn ich dir das sage, ist dein Leben keinen Pfifferling mehr wert.«
»Oh, ich dachte, du würdest dich nicht mit Totschlägern und Mördern umgeben? Oder habe ich das falsch verstanden? Nun, vielleicht habe ich mein Leben sowieso schon verwirkt?«
»Du irrst dien, Liz«, rief Harry York verzweifelt. »Wenn du die Waffe weglegst, werden wir eine Lösung finden, mit der wir beide einverstanden sein können. Tötest du mich aber, wird man eine Treibjagd auf dich veranstalten. Du hast ja gar keine Ahnung, was alles von meiner Organisation abhängt. Ich bin der Kopf, und wenn ich nicht mehr da bin, kommt eine Lawine ins Rollen.«
Sein Körper spannte sich. Er bereitete sich auf einen Gegenangriff vor.
Elisabeth York entging das nicht. Sie umklammerte ihre Waffe fester.
»Das sind große Worte, aber ich werde dich dennoch töten. Du hast mich genug gedemütigt.«
Harry erschrak.
»Liz, warum denn? Du bist doch keine Mörderin.«
Daphne Ashton zitterte plötzlich stärker. Sie wußte, daß es um Leben und Tod ging.
»Lassen Sie ihn doch!« rief sie. »Er kann nichts dafür. Ich habe ihn verführt.«
»Geben Sie sich keine Mühe«, entgegnete Elisabeth. Sie war plötzlich den Tränen nahe.
»Du bist verrückt«, stieß Hany hervor. »Liz, so kenne ich dich gar nicht.«
»Du kennst mich überhaupt nicht. Schließlich hast du dich all die Jahre kaum um mich gekümmert. Du hast mich nur gebraucht, damit ich dir zu einem gesellschaftlichen Sprungbrett für deine krummen Geschäfte verhelfen konnte. An wen verkaufst du denn die Landesgeheimnisse? An die russische Mafia? An Terrorgruppierungen jeglicher Coleur? Nein, halt, du treibst bestimmt auch Geschäfte mit Industriespionage. Natürlich, erst das rundet die Sache ab.«
»Liz, komm zu dir!« versuchte es Harry York noch einmal. »Bedenke die Folgen.«
»Ich habe bereits getötet. Draußen liegt der unumstößliche Beweis. Auf einen weiteren Mord kommt es mir nicht mehr an.«
Ihr Zeigefinger krümmte sich um den Abzug. Tränen schossen ihr aus den Augen und rannen über ihr Geischt.
»Lebe wohl, du Nichtsnutz!«
»Nein!« schrie Daphne.
Vielleicht hätte Elisabeth York nicht abgedrückt, Es steht noch in den Sternen. Aber die folgenden Ereignisse brachten bei ihr die letzte Sicherung zum Durchbrennen. Harry York hatte lange genug gewartet. Er hatte es im Guten versucht und keinen Erfolg gehabt. Nun wollte er sich seiner Haut erwehren und versuchen, an seine Waffe zu gelangen, die sich im Jackett neben dem Bett befand.
Im selben Moment warf sich Daphne Ashton schreiend auf ihn. Sie ahnte nichts von dem, was hinter der Stirn des Mannes vorging. Sie wollte nur einen Mord verhindern und handelte instinktiv. Sie wollte mit ihrem Körper Harry York schützen, um so vielleicht dessen Frau von einem Schuß abzubringen.
Elisabeth York sah nur, daß ihr Mann nach der Waffe greifen wollte. Er hätte es wahrscheinlich geschafft und die Sache für sich entschieden, hätte ihn nicht Daphne ungewollt behindert.
Reflexartig drückte Elisabeth ab. Der Revolver entlud sich krachend. Der Schall brach sich ohrenbetäubend an den Wänden.
Harry York spürte, daß das Mädchen, das auf ihm lag, starb.
Die Nähe des Todes ließ Panik in ihm entstehen. Er schüttelte die Leiche ab und sprang vom Bett, gleichzeitig nach seiner Waffe greifend. Doch in der Hast entglitt sie ihm und fiel polternd zu Boden.
Elisabeths Augen waren unnatürlich geweitet. Sie konnte nicht fassen, daß sie das Mädchen getötet hatte. Es mußte ein Zufallstreffer gewesen sein, denn so genau konnte sie unmöglich schießen.
Sie gab alle Schuld ihrem Mann.
»Du Schuft!«
Abermals löste sich ein Schuß aus der kleinen Waffe.
Harry hatte sich gerade nach seiner Pistole bücken wollen. Er spürte einen harten Schlag gegen den linken Oberschenkel und verlor den Boden unter den Füßen. Schwer kam er auf.
Plötzlich stand seine Frau über ihm.
Der dritte Schuß krachte.
Harry York hörte diesmal den Knall nicht, denn eine Kugel ist schneller als der Schall.
*
Langsam kam Elisabeth York wieder zu sich und begriff, was geschehen war.
Weinend wankte sie zum Telefon, um die Polizei zu rufen. Es blieb ihr nichts anders übrig. Sie war zur mehrfachen Mörderin geworden.
Mit einem tauben Gefühl hob sie den Hörer von der Gabel. Der Revolver entfiel ihrer Hand. Sie brauchte ihn nicht mehr.
Langsam wählte sie eine Nummer. Es läutete einmal, dann meldete sich eine dunkle Männerstimme.
Elisabeth York verstand gar nicht, was der Mann zu ihr sagte. Nur das Wort »Police« drang bis zu ihrem Bewußtsein durch.
Ihr Blick fiel auf die Leiche des Callgirls. Ein blühendes Leben - durch einen einzigen tödlichen Schuß vernichtet.
Elisabeth schluchzte laut auf.
»Hallo!« rief der Cop. »So melden Sie sich doch!«
Die Frau bekam kein Wort heraus. Sie legte den Hörer auf und brach zusammen. Weinend lag sie da, vielleicht eine Minute lang. Dann gewann die sorgfältige Erziehung in ihr wieder die Oberhand - die Erziehung, die sie gelehrt hatte, in jeder Situation eine Dame zu bleiben.
Sie beruhigte sich und erhob sich einigermaßen beherrscht.
Mit einer fahrigen Handbewegung legte sie den Schleier über die Hutkrempe zurück und rückte den Hut zurecht. Dann suchte sie nach einem Taschentuch. Wo war die Handtasche? Elisabeth fand sie in einer Ecke und hob sie auf.
Sie trocknete ihre Tränen ab und vermied es dabei, das tote Mädchen anzuschauen. Die Augenschminke war zerlaufen und bildete häßliche Streifen, die sich senkrecht über ihre Wangen zogen. Es gelang der schönen Frau nicht, sie ganz zu beseitigen. Aber der Schleier würde dafür sorgen, daß es niemand sah.
Elisabeth York warf einen Blick auf das Telefon. Nein, es wäre ein großer Fehler gewesen, die Polizei zu verständigen.
Sie war eine Mörderin und hätte die Konsequenzen dafür tragen müssen. Aber das war nicht das einzige. Sie war mitten in einen Spionageskandal verwickelt, obwohl ihr Motiv reine Eifersucht gewesen war.
Eigentlich war Elisabeth York mehr als nur in die Sache verwickelt. Sie hatte gerade einen der führenden Köpfe der politischen, militärischen und der Wirtschaftsspionage getötet.
Durch eine Benachrichtigung der Polizei würde nicht nur die Justiz auf sie aufmerksam werden, sondern auch - was wesentlich schlimmer war - Mitglieder der internationalen Spionage- und Terrorbühne. Man würde sie bis ins Zuchthaus verfolgen. Eine Hölle würde sie erwarten.
Diese Erkenntnisse halfen ihr, ihre eiserne Beherrschung mehr und mehr aufzubauen. Elisabeth nahm die Waffe wieder an sich und ging zu den Kleidern ihres Mannes hinüber, die über einen futuristisch anmutenden Stuhl hingen. Auf Anhieb fand sie Harrys Papiere und alle seine Schlüssel. Möglicherweise konnten sie von Wichtigkeit sein.
Schließlich verließ Elisabeth York die Wohnung. Beinahe stolperte sie dabei über die Leiche von Mort Mackay.
Gehetzt blickte sie sich um. Der Gang war leer. Ob noch niemand die Leiche entdeckt hatte? Aber darauf konnte sie sich nicht verlassen. Vielleicht war bereits die Polizei in Kenntnis gesetzt?
Sie lief zum Fahrstuhl. Einer war in Betrieb. Wie hypnotisiert blickte die Frau auf das Licht, das an der Zahlenreihe aufwärts wanderte. Fünfzehntes Stockwerk, sechzehntes, siebzehntes...
Eisiger Schreck fiel sie an, und sie drückte den Knopf des zweiten Fahrstuhls. Die Tür öffnete sich sofort. Erst dadurch bemerkte Elisabeth York, daß der Lift ausgerechnet in ihrem Stockwerk gestanden hatte. Ein unwahrscheinliches Glück.
Sie sprang hinein und drückte »Erdgeschoß«. Gleichzeitig hörte sie, daß der Nachbarlift anlangte.
Ihre Gedanken jagten sich. Würde ihr die Flucht gelingen, ohne daß sie jemand erkannte?
Auf einmal war sie ganz sicher, daß es die Leute ihres Mannes waren, die heraufgefahren kamen. Sie hatten Sprechfunkgeräte und mußten inzwischen gemerkt haben, daß hier oben etwas nicht stimmte.
Ihre Überlegungen berührten einen weiteren Punkt: Den Liftkorb, der im achtzehnten Stockwerk - im Stockwerk des Mordes! - gestanden hatte und it dem sie nun abwärts fuhr.
Eisiger Schrei durchzuckte sie.
Es gab keinen Zweifel: In den letzten beiden Minuten war jemand hochgefahren und im achtzehnten Stockwerk ausgestiegen.
Das bedeutete, daß dieser Jemand die Leiche von Mackay entdeckt hatte.
Vielleicht wohnte er hier oben und hatte längst die Polizei veständigt?
Dann wurde es sehr knapp!
Ihr Atem ging keuchend.
Aber der Verstand der Frau funktionierte wie ein Computer, obwohl sie mit den Nerven ziemlich am Ende war. Sie rechnete ihre Chancen aus: Die Agenten waren oben angelangt, als sich ihre Fahrstuhltür geschlossen hatte. Noch war sie unterwegs. Wie lange würden die Männer brauchen, um ihr zu folgen? Sie würden erst die Leiche entdecken, dann den abwärtssausenden Lift. Elisabeth hatte höchsten fünfzehn Sekunden Vorsprung, vielleicht auch noch zwanzig. Immer noch knapp genug!
Sie konnte nicht mehr weiter über dieses Problem nachdenken, denn ihr Lift hatte das Erdgeschoß erreicht. Elisabeth York stürmte heraus und auf den Portier zu. In der Halle waren nur wenige Menschen, die sie erstaunt ansahen. Gottlob erkannte keiner ihr Gesicht, das vom Schleier bedeckt wurde.
»Um Gottes Willen«, sagte sie zu dem Portier, nach Luft ringend, »ich habe eine Leiche entdeckt!«
Das Gesicht des Mannes wurde aschfahl.
Elisabeth blickte zu den Aufzügen hinüber. Der Fahrstuhl mit Yorks Leuten hielt bereits unten. In der nächsten Sekunde mußte sich die Tür öffnen. Die Männer waren clever. Sie würden schnelll genug schalten, wenn sie die Schwarzgekleidete hier sahen.
Und sie stand da und hatte keine Möglichkeit zur Flucht. Es war viel zu weit bis zum Ausgang.
*
Die drei Agenten waren oben angekommen und sprangen aus dem Lift. Auf dem Flur drüben lag eine zusammengesunkene Gestalt. Überall Blut.
Andy Coverdale rannte hin.
»Seht her«, rief David Hughes und deutete auf den Nachbarlift, »der ist eben erst weg - eben, als wir ankamen.«
»Tatsächlich.« Richard Fenwick winkte Andy Coverdale zu. »Los, komm, wir fahren wieder hinunter!«
Coverdale hatte sich über den toten Mort Mackay gebeugt. Nun richtete er sich auf und rannte zurück. Die beiden anderen stiegen schon ein und drückten »Erdgeschoß«.
Im letzten Augenblick zwängte sich Coverdal noch herein.
Sein Gesicht war leichenblaß.
»Mort ist tot - einfach niedergeschossen.«
»Wer war das?« Hughes schüttelte verständnislos den Kopf.
»Jemand muß Mort die Waffe direkt auf das Herz gedrückt haben«, erklärte Coverdale.
»Aber das ist doch nicht möglich!« entfuhr es Hughes. »Mort war ein Profi. Wie konnte er seinen Mörder so nahe heranlassen? Hatte er denn seine Waffe nicht mehr?«
»Die lag neben ihm auf dem Boden. Sie muß ihm im Augenblick des Todes entglitten sein.«
»Vielleicht... ein Bekannter?« vermutete Richard Fenwick.
»Nicht bei Mort. Der fällt auf so etwas nicht herein!« meinte Hughes.
»Dann kann es nur einer von uns gewesen sein«, sagte Fenwick leise. Wie eine Gewitterwolke hingen diese Worte in der engen Kabine.
»Und wie ist er an dir vorbeigekommen, ohne erkannt zu werden?« erkundigte sich Hughes.
»Vielleicht war er noch früher da als ich«, brauste Fenwick auf.
»Das kann ich mir nicht denken. Er hätte dann wissen müssen, daß Harry vor hatte, dem Callgirl einen Besuch abzustatten. Sicher war das keinen Moment lang. Es hat sich einfach so ergeben.«
»Einfach so ergeben«, äffte Andy Coverdale nach.
Dann sagte keiner mehr etwas, denn sie waren im Erdgeschoß angelangt, und die Tür öffnete sich. .
*
Der Portier handelte endlich, wie Elisabeth es vorausberechnet hatte. Er riß sich von der beeindruckenden Erscheinung der Schwarzgekleideten los. Einige in der Halle schienen Brocken von dem, was sie gesagt hatte, aufgeschnappt zu haben. Sie blickten befremdet herüber. Der Portier mußte handeln, ehe die attraktive Frau noch mehr sagen konnte.
»Still!« herrschte er sie an und riß die Tür auf. Ehe sich Elisabeth York versah, hatte er sie am Arm gepackt und hereingezogen.
»Was fällt Ihnen ein?« protestierte sie.
»Seien Sie doch um Gottes willen ruhig!« zischte der Portier. Er äugte ängstlich hinaus. »Es braucht doch nicht jeder gleich zu hören, was passiert ist. Das könnte eine Panik geben.« Das war wohl übertrieben, aber es konnte zumindest die Arbeit der Polizei erschweren, wenn die Sache zu schnell publik wurde.
Der Portier zog Elisabeth York weiter von der Glastür weg. Dabei wagte die Dunkelgekleidete einen kurzen Blick hinaus. Einer von Yorks Vertrauten stand an den Fahrstühlen und schaute sich stirnrunzelnd um. Die anderen beiden hetzten gerade zum Ausgang.
»Jetzt beruhigen Sie sich erst einmal und erzählen, was Sie wirklich gesehen haben!« redete der Portier auf die zitternde Frau ein.
»Ich - ich...« Elisabeth hatte Mühe, Gewalt über ihre Stimme zu bekommen. Endlich gelang es ihr. »Ich besuchte einen Bekannten oben«, log sie. »Als ich zum Lift ging, fiel mir die zusammengesunkene Gestalt auf. Ich dachte erst, es handele sich um einen Betrunkenen, und schüttelte den Kopf darüber. Bevor ich jedoch in den Lift stieg, warf ich noch einmal einen Blick zurück. Da erst sah ich das Blut am Boden.«
Aber warum sind Sie dann nicht zu Ihrem Bekannten zurück?« fragte der Portier verwundert.
Elisabeth York blickte ihn entgeistert an. Undeutlich erkannte er das durch den Schleier. »Sie haben vollkommen recht... Ja, wieso eigentlich habe ich das nicht getan?«
Der Portier winkte ab. »Ist ja schon gut. Ich kann verstehen, daß Sie kopflos geworden sind.« Er wurde leutselig. »Schließlich passiert es nicht alle Tage, daß man einer Leiche begegnet, nicht wahr? Sogar hier in New York ist das nicht unbedingt eine Alltäglichkeit.«
Er redete wie ein Wasserfall. Elisabeth York ließ es über sich ergehen. Ob die Agenten noch draußen waren? Sie mußte hier weg. Jeden Augenblick konnte die Polizei auftauchen. Was sollte sie denen sagen?
Und dann kam die entscheidende Frage des Portiers:
»Hm, wen haben Sie eigentlich besucht? Ich kenne jeden hier im Haus«.
Elisabeth wankte zur Tür.
»He, was ist los?«
»Mir - mir ist plötzlich so übel. Ich - ich muß an die frische Luft.«
Er ging zu ihr hin, wollte sie stützen.
Die Frau schüttelte seine Hand ab.
Ein Blick durch die Glastür. Die Luft war sauber. Keiner der drei Männer war zu sehen. »Lassen Sie mich nur, ich finde allein den Weg.«
»Aber, Sie dürfen nicht gehen. Sie sind als Zeugin für die Polizei von großem Interesse«, wandte der Portier ein.
Elisabeth York stellte sich taub. Sie öffnete die Tür. Bange Sekunden. Standen die drei Agenten vor dem Haus, um auf Sie zu warten? Noch konnte sie nichts Verdächtiges entdecken.
Der Portier war unschlüssig, ob er ihr nun folgen sollte oder nicht.
Elisabeth York nahm ihm die Entscheidung ab. »Keine Angst, ich laufe nicht weg. Ich bleibe direkt vor dem Eingang.«
Der Mann nickte beruhigt.
»Okay. Aber wer ist es nun, den Sie besucht haben?«
Elisabeth York ignorierte auch diese Frage. Langsam ging sie zum Ausgang. Alles in ihr schrie: Beeile dich! Doch das konnte sie nicht, wollte sie keine Aufmerksamkeit erregen.
In der Ferne ertönten Polizeisirenen. Sie kamen schnell näher.
Endlich war der Ausgang erreicht. Die Tür pendelte hinter der Frau aus. Sie war draußen. Endlich!
Ein Blick zurück. Der Portier stand vor seinem Schalter und rieb sich nachdenklich den Nacken.
In diesem Moment kam wieder ein Fahrstuhl an. Die Tür öffnete sich.
Die Spione!
Der Portier blickte herüber.
Elisabeth York war unfähig, sich zu rühren.
*
Nachdem ihre Suche in der Halle ergebnislos verlaufen war, fuhren die drei Männer wieder hinauf.
»Das hätten wir uns sparen können«, sagte Richard Fenwick zerknirscht.
»Du wärst am besten gleich unten geblieben«, hielt ihm David Hughes vor.
Fenwick ging nicht darauf ein.
»Es ist doch nicht möglich, daß uns der Kerl durch die Lappen gehen konnte«, sagte er kopfschüttelnd.
»Es kann nicht anders sein«, bemerkte Andy Coverdale. »Oder hast du jemanden gesehen, der sich von den Fahrstühlen wegbewegt hat?«
»Ich befürchte das Schlimmste - für Harry.« David Hughes machte ein verkniffenes Gesicht.
»Dazu braucht man allerdings nicht viel Scharfsinn«, brummte Fenwick an seiner Seite.
Endlich stoppte der Lift. Im Flur war alles unverändert. Sie rannten zum Apartment Daphne Ashtons. Coverdale rief: »Der Schlüssel steckt nicht mehr!«
Mit vereinten Kräften brachen sie die Tür auf. Dann stürmten sie in das Schlafzimmer.
Sie waren Profis und brauchten nicht lange zu überlegen. Den toten Mort Mackay und die Leiche Harry Yorks rollten sie in einen Bodenteppich. Ächzend schleppten sie die beiden Leichname weg. Mit dem Fahrstuhl fuhren sie abwärts.-
Schüsse waren im achtzehnten Stockwerk gefallen, Leichen waren abtransportiert worden, Tragisches hatte sich ereignet. Doch niemand von denen, die hier wohnten, hatte es gewagt, einmal einen Blick hinauszuwerfen.
Undenkbar?
Diese Menschen waren New Yorker. Sie waren es gewohnt, die Augen zu verschließen, denn sie wollten nicht selber zum Opfer werden.
RED BOOK 028
W. A. Hary
Der neue Boss
„Höchste Zeit, ihn ordentlich aufzumischen!“
Noch während ich in Finnland beschäftigt war (Bände 22 bis 26), geschahen in New York ganz andere Dinge. Schade, daß ich nicht dabei sein konnte, aber dafür kam Sheila zum Einsatz - ein Teufelsgirl aber auch!
Dreh- und Angelpunkt war ein geheimnisumwitterter Mann mit Namen Harry York. Was Profis nie gelang, schafft Harry Yorks eigene Frau: Sie sorgt dafür, daß sein Doppelleben tödlich endet. Doch sein Erbe ist ganz besonderer Art.
Fragt sich, ob Sheila und der Dicke den Braten rechtzeitig riechen...
Nun, Sheila ist bereits am Ball...
*
Elisabeth York schaute erstarrt durch die Glasscheibe des Hoteleingangs zurück und sah die Spione, die einen besonders schweren Teppich schleppten. Sie wußte im gleichen Augenblick, daß Leichen darin eingewickelt waren.
Wen transportierten sie denn weg?
Es hatte ja insgesamt drei Tote gegeben: Sie hatte erst seinen Leibwächter und dann ihren Mann Harry selber erschossen. Leider war auch das Callgirl zu Tode gekommen, weil sie sich schützend vor Harry geworfen hatte. Das tat Elisabeth York leid, aber es war nicht mehr zu ändern.
Und wen transportierten die drei Spione, die ebenfalls für Harry gearbeitet hatten, jetzt ab?
Bestimmt nicht das Callgirl Daphne Ashton. Wahrscheinlich Harry und seinen Leibwächter.
Aber wieso?
Sie erwachte aus ihrer Erstarrung und setzte sich in Bewegung. Der Portier sah, daß sie weglief, anstatt auf die Polizei zu warten, wie sie ihm versprochen hatte. Sie hatte sich schließlich als wichtige Zeugin ausgegeben, und er hatte weder ihren Namen noch sonst etwas von ihr. Noch nicht einmal ihr Gesicht hatte er gesehen, da sie es mit dem Trauerschleier verdeckt hatte. Er gestikulierte wie wild mit den Armen und verließ die Rezeption. Aber die drei Agenten mit ihrer schweren Last behinderten ihn. Er ahnte ja nicht, was sie da mit dem schweren Teppich abtransportierten, und hatte nur Augen für die Fliehende.
Elisabeth eilte zu ihrem Leihwagen und stieg hastig ein.
Aber sie fuhr nicht sofort los. Blitzschnell duckte sie sich.
Nur einer hatte es beobachtet: Sheila. Sie war direkt hinter den Agenten auf die Straße getreten.
Der silbergraue, staubige Cadillac, der Harry York gehörte, raste herbei. Offenbar war der Fahrer inzwischen über Funk verständigt worden. Die Männer gingen routiniert und ohne Aufsehen ans Werk.
Innerhalb weniger Sekunden hatten sie den Teppich mitsamt Inhalt im voluminösen Kofferraum verstaut. Dann brausten sie los.
Sheila in ihrer Verkleidung als jeansgewohnte junge Studentin erreichte ihren klapprigen Tarn-VW-Käfer.
Einen Blick über die Schulter - vom Cadillac waren nur noch die Stopplichter zu sehen. Der Portier war kopfschüttelnd zu seinem Arbeitsplatz zurückgekehrt, nachdem er vergeblich nach der Schwarzgekleideten mit dem Trauerschleier am Hut Ausschau gehalten hatte. Er führte laute Selbstgespräche.
Nun kam Leben in Elisabeth York. Sie richtete sich hinter dem Lenkrad des schweren Buicks auf. Die Schnauze ihres Wagens zeigte in dieselbe Richtung wie der VW der Agentin. Die ließ den Motor an und wartete.
Die Männer waren mit ihrem Cadillac in die Gegenrichtung gefahren. Die Polizeisirenen waren bedrohlich nahe. Sie schienen von allen Seiten gleichzeitig zu kommen.
Elisabeth York fuhr an. Ihr Wagen hoppelte etwas. Es gab eine kurze Unterbrechung.
Offenbar hatte sie in ihrer Aufregung den Motor abgewürgt. Der Anlasser orgelte. Endlich kam der Motor wieder. Die Frau zupfte die Touren hoch. Der Wagen rollte an der wartenden Agentin vorbei.
In diesem Moment trat wieder der Portier vor das Haus, wahrscheinlich, um die Polizei zu empfangen. Sheila blickte hinter dem dunklen Buick her. Auch sie fuhr an und nahm sofort die Verfolgung auf.
Kaum hatten die beiden so unterschiedlichen Fahrzeuge die nächste Kreuzung passiert, als die Streifenwagen der City Police heran waren und alles blockierten. Nur um Sekunden waren Sheila und ihr Verfolgungsopfer dem Zugriff der Polizei entgangen. Sheila war das nur recht. Denn ihr war daran gelegen, daß sich die angeblich Trauernde unbeobachtet und unerkannt wähnte.
In der Tat ahnte nur ein Mensch, wer die Dame in Schwarz in Wirklichkeit war: Sheila.
*
Elisabeth York fuhr kreuz und quer durch die Stadt. Sie schien kein festes Ziel zu haben.
Dank der Verkehrsdichte während der rush hours hatte Sheila alle Hände voll zu tun, um nicht abgehängt zu werden. Allerdings brauchte sie bei der Verfolgung nicht besonders vorsichtig zu sein, so lange Elisabeth York ahnungslos blieb.
Endlich, nach einer schier endlos erscheinenden Fahrt, hielt Elisabeth vor dem riesigen Hotel Hilton und stieg aus. Der livrierte Portier eilte herbei und nahm die Autoschlüssel in Empfang, um den Wagen wegzubringen. Erhobenen Hauptes betrat Elisabeth York die riesige Empfangshalle.
Elisabeth ging zur Rezeption und verlangte von einem der Angestellten ihren Schlüssel. Dienstbeflissen wieselte der Mann zu den Schlüsselfächern und kehrte nach Sekunden wieder zurück. In der Rechten hielt er den Zimmerschlüssel, in der Linken eine Notiz.
»Mrs. Browne«, so hatte sich Elisabeth York hier eingetragen, »Sie werden bereits erwartet.«
Das war ein kleiner Schock für sie.
Sie wurde erwartet? Von wem denn?
Der Angestellte schaute sich suchend um. Dann erhellten sich seine Züge. Er hob den Arm.
»Da kommen ja die Herren.«
Elisabeth hatte das Gefühl, von einem Zentnergewicht erdrückt und am Atmen gehindert zu werden. Es kostete sie unendlich viel Mühe, sich umzudrehen und mit den Blicken in die Richtung zu folgen, in die der Angestellte deutete.
Es traf die Frau wie ein Schlag. Die beiden freundlich dreinblickenden Herrn, die auf sie zukamen, waren ihr nur zu gut bekannt.
Andy Coverdale und Richard Fenwick - die engsten Mitarbeiter ihres Mannes Harry York und diejenigen, die seine Leiche abtransportiert hatten. Sie hatte es selbst gesehen!
*
Sheila wartete, bis Elisabeth York im Hotel verschwunden war. Dann stieg sie ebenfalls aus und blickte sich aufmerksam um.
Sie traute ihren Augen nicht, als sie in der Nähe den Cadillac stehen sah.
Trotz der Entfernung und der spiegelnden Windschutzscheibe erkannte sie deutlich den Fahrer.
»Wie kommen die denn hierher?« murmelte sie vor sich hin.
Der Vorgang zeigte ihr, daß sie es in der Tat mit Vollprofis zu tun hatte, die in keiner Weise zu unterschätzen waren.
Sie hätte einiges darum gegeben, in die Köpfe der Männer blicken zu können. Was ging in ihnen vor - jetzt, da sie um den Tod ihres Chefs wußten? Was zog das Ableben Harry Yorks nach sich? Er war in seiner Organisation ein Alleinherrscher gewesen. Alle Fäden waren bei ihm zusammengekommen. Er allein kannte sämtliche Mitglieder und wußte, von wem man Informationen erhalten konnte und wer bereit war, dafür teures Geld auf den Tisch zu blättern. Nun brach alles zusammen, was er mühsam aufgebaut hatte.
Für die Agentin gab es auch einen weiteren Aspekt. Noch nie war sie dieser Organisation so nahe gewesen. Es ging darum, die Verbindungsmänner dingfest zu machen. Außerdem mußte herausgefunden werden, wer sein Land, seine Firma oder was immer verraten wollte. Das war aber nur möglich, wenn die Organisation noch stand und man alle Wege zurückverfolgen konnte.
Für die rassige Agentin wäre es am einfachsten gewesen, die Flinte ins Korn zu werfen und Polizei und CIA zu benachrichtigen. Aber ihre Intuition hinderte sie daran. Den Geheimdienst konnte sie immer noch in Kenntnis setzen. Das lief nicht weg. Viel wichtiger erschien es Sheila, zunächst selber am zu bleiben, denn sie hatte das untrügliche Gefühl, daß die Spione sich etwas hatten einfallen lassen. Denn da war immer noch diese Kreuzfahrt. Offenbar sollte eine besondere Sache laufen - wenn erforderlich auch ohne den Chef des Ganzen.
Sie überlegte, ob sie wenigstens ein kurzes Telefongespräch mit dem Dicken wagen sollte.
Auch dagegen entschied sie sich. Es befand sich keine Telefonbox in Reichweite, mit dem Handy war es zu riskant - wegen der Abhör- und Ortungsgefahr - und Sheila hätte somit das bombastische Hotel betreten müssen - und in ihrem gegenwärtigen Aufzug bestimmt Aufsehen erregt. Das Hilton gehörte zu Manhattans ersten Hotels.
Sheila öffnete die Kofferraumhaube und kramte darunter herum. Dann hatte sie gefunden, was sie suchte. Die Haube wurde zugeknallt. Ein Blick zum Cadillac hinüber.
Der Fahrer hatte keinerlei Interesse an ihrer Person. Das war nicht verwunderlich.
Sheila machte sich auf den Weg. Kaugummikauend schlenderte sie über den Bürgersteig und kam dabei dem Cadillac immer näher.
Der Verkehr war hier in der Madison Avenue, Nähe Central Park, nicht so stark, aber die mannigfaltigen Geräusche reichten für Sheilas Zwecke voll und ganz aus.
Sie erreichte den Cadillac und ging dicht an dem Fahrzeug vorüber. Dabei ieß die Agentin unauffällig einen kleinen Gegenstand fallen, den sie in der geschlossenen Hand gehalten hatte. Das Ding fiel aber nicht zu Boden. Der Magnet sprach an, als er die Stoßstange passierte. Es gab ein leises, metallisches Geräusch, das im Verkehrslärm ungehört unterging, dann saß der Minisender fest.
Sheila lächelte zufrieden. Sie machte einen kleinen Umweg und kehrte zu ihrem klapprigen VW zurück.
Dann konnte sie nur noch warten und beobachten.
Der Fahrer des Cadillac wirkte reichlich nervös. Er trommelte ständig mit den Fingern auf dem Lenkrad herum.
Sheila konnte diese Nervosität voll und ganz verstehen. Für die Agenten stand eine ganze Menge auf dem Spiel. Als ständige Begleiter Harry Yorks waren sie am besten in alles eingeweiht, was die Organisation betraf. Falls die Organisation zusammenbrach, könnte es durchaus sein, daß sich der eine oder andere an sie erinnerte und dabei zu dem Schluß kam, daß sie eine Gefahr für ihn darstellten, da sie gefährliche Mitwisser wären. Mord war im harten Spionageschäft nie auszuschließen.
Sheila schaltete den Miniaturempfänger ein.
Der Sender, den sie am Wagen der Agenten festgemacht hatte, strahlte einen rhythmischen Piepston aus. Er war einwandfrei zu empfangen.
Sheila wollte unbedingt herausfinden, wohin sich die Leute wandten, nachdem sie sich der Mörderin angenommen hatten.
Das kleine, aber raffinierte technische Gerät sollte ihr diese Aufgabe erheblich erleichtern helfen.
Die Agentin blickte zum Himmel.
Noch immer hing eine riesige Gewitterwolke über New York und wartete auf ihre Entladung.
Es war fast symbolisch, wenn man an die Lage der Spionageorganisation dachte, die Harry York hinterlassen hatte. Auch darüber hing eine Gewitterwolke. Sie war vielleicht noch mächtiger und vor allem wesentlich drohender als die tatsächliche.
Sheila machte es sich im VW Käfer bequem und harrte der Dinge, die noch kommen mochten.
*
Professor Matthew Hegarth war mit seinen fünfzig Lebensjahren nicht gerade eine Schönheit, konnte sich aber über die Nachfrage bei der Damenwelt nicht beklagen. Sein schütteres Haar umrahmte einen hageren Schädel. Hegarth war schlank und hochgewachsen - in der Erscheinung ein Tennistyp, obwohl er noch nie in seinem Leben einen Tennisschläger in die Hand genommen hatte.
Seine Vorliebe galt nicht nur den Frauen. Der sympathisch erscheinende Mann mit den intelligenten Augen war auf der einen Seite ein Wissenschaftler von besonderem Rang, obwohl er stets vorzog, nicht zu sehr in die Öffentlichkeit zu treten.
Das hatte auch seinen Grund, denn auf der anderen Seite gehörte Professor Matthew Hegarth zu den größten Spionen seines Landes. Kein Mensch verdächtigte ihn. Aufgrund seiner Kapazität und Beliebtheit bei Kollegen jeder Richtung hatte er Zugang zu vielen staatlichen Forschungseinrichtungen. Diese Tatsache nutzte er rigoros aus.
Es gab nur einen einzigen Menschen in New York, der über seine Person bestens Bescheid wußte: Harry York.
Professor Hegarth war für den Abend zur Kreuzfahrt eingeladen - nicht ganz ohne Motiv. Die meisten geladenen Gäste dienten nur zur Tarnung. Hegarth sollte für eine Ladung sorgen, die klein, aber hochbrisant war.
Deshalb hielt er sich an diesem Nachmittag im Institut für Biophysik in Westchester auf. Das Gelände wurde sorgfältig überwacht. Trotzdem war es für Hegarth dank seiner Referenzen eine Kleinigkeit gewesen, hineinzukommen.
Er wußte, daß man in dem Institut an einem neuen militärischen Knüller arbeitete. Es ging um einen neuartigen Lähmungsstrahler, der sich des Prinzips des sogenannten Lasers bediente.
Wurde beispielsweise ein Mensch von einem solchen Strahl getroffen, so war er für Stunden paralysiert. Was bis dahin noch utopisch klang, sollte in diesem Institut zur Wirklichkeit werden.
Das war allerdings noch ein weiter Weg, denn vorläufig gab es nur theoretische Grundlagen. Unzählige Experimente standen noch bevor, ehe es möglich war, die Waffe zur Anwendung zu bringen - vielleicht erst in Jahren.
Die Welt sollte damit überrascht werden.
Aber Professor Matthew Hegarth war ein guter Bekannter des Forschungsleiters Professor Hedley Flinder und beobachtete die Arbeiten an dem Lähmungsstrahler schon seit geraumer Zeit.
Vor zwei Tagen nun hatte ihn Flinder angerufen und stolz verkündet, daß es endlich soweit war. Die theoretischen Erwägungen waren abgeschlossen. Erste Experimente wurden begonnen.
Hegarth konnte die Euphorie seines Kollegen und Freundes teilen, wenn auch aus anderem Grund.
Matthew Hegarth war nicht nennenswert überprüft worden, als er das Institut betreten hatte.
Mittlerweile kannten ihn alle gut, und es war nicht das erste Mal, daß er Flinder besuchte - so wie es auch nicht das erste Mal war, daß er reiche Beute machte.
Zu Hegarths Prinzipien zählte es, grundsätzlich nie fertige Errungenschaften zu verkaufen. Diesem Umstand hatte er es zu verdanken, daß er noch nicht entlarvt worden war: Sobald etwas eine gewisse Reife erreicht hatte, schlug er zu. Die Gegenseite konnte sich dann die Köpfe über den Unterlagen zerbrechen und eigene Gedanken dazu beisteuern. Das Ergebnis war dann, daß beide Seiten zu vielleicht unterschiedlichen Schlüssen kamen. Im Pentagon wurde offenbar nur beiläufig registriert, daß sich die Gegenseite scheinbar rein zufällig mit ähnlichen Dingen beschäftigte...
Professor Matthew Hegarth trat in das Büro seines Freundes.
Hedley Flinder hatte sich mit zerfurchter Stirn über schriftliche Unterlagen gebeugt. Es dauerte eine Weile, bis er bemerkte, daß er nicht mehr allein war. Erstaunt blickte er hoch. Als er den Besucher erkannte, nahm er die Brille ab und sprang erfreut auf.
»Matthew, du bist also tatsächlich gekommen!« rief er euphorisch. Sie drückten sich die Hände.
Hegarth gab sich gespielt verlegen. »Schließlich habe ich dir versprochen, einmal kurz vorbeizusehen, und du weißt, daß ich stets zu halten pflege, was ich Freunden verspreche. Außerdem interessieren mich deine Ergebnisse brennend.«
Flinders Augen leuchteten. Er winkte den Mann, den er für einen seiner besten Freunde hielt, heran. Zu zweit beugten sie sich über die streng geheimen Unterlagen. Auf jedem Blatt war ein Stempel aufgedrückt: TOP SEKRET.
Hedley Flinder erging sich in weitschweifigen Erklärungen, bei denen Matthew Hegarth trotz seiner wissenschaftlichen Bildung nur teilweise mitkam. Kurze Zeit später hatte er den Faden gänzlich verloren und sah nur noch böhmische Dörfer. Aber er heuchelte nach wie vor Interesse. Flinder machte schließlich den Vorschlag, ins Labor zu gehen, um die Versuchsanordnung in der Realität zu besichtigen.
Hegarth zeigte sich aus verständlichen Gründen begeistert.
Es erwies sich allerdings, daß die Sache einen kleinen Haken hatte.
»Das Labor wird speziell überwacht«, erläuterte Professor Flinder. »Es sind eine Menge Vorsichtsmaßnahmen getroffen worden. Wenn das so weitergeht, darf ich mit meinen Assistenten das Gebäude hier nicht mehr verlassen, um jegliche Eventualität auszuschließen.«
»Aber dann darf ich dich ja auch nicht mehr besuchen kommen«, sagte Hegarth enttäuscht,
»Leider.« Flinder zuckte bedauernd die Achseln. »Na ja, noch ist es ja nicht soweit. Paß auf, ich gehe mal zum Boß der Sicherungsleute und rede ein paar Takte mit ihm. Dann steht der Besichtigung nichts mehr im Wege. Allerdings mußt du sämtliche metallischen Gegenstände, die du am Körper trägst, hier lassen, sonst gibt es Alarm, sobald du die Schwelle zum Labor überschreitest.« Er kicherte verhalten. »Mir ist das in meiner Zerstreutheit leider schon mehrmals passiert.«
Professor Flinder ging dann zum Boß der Sicherungsgruppe.
Hegarth wartete ein paar Sekunden und lauschte auf den Flur hinaus.
Befriedigt registrierte er, daß sich die Schritte des Freundes rasch entfernten. Dann entwickelte Hegarth rege Aktivität. Er zog seine Miniaturkamera aus der Tasche und stellte sie ein. Von der Kamera baumelte eine Entfernungskette.
Professor Matthew Hegarth beugte sich über die streng geheimen Unterlagen und hielt das Ende der Kette an den unteren Rand des oben gelegenen Papiers. Sicherheitshalber machte er zwei Aufnahmen. Das Licht reichte dank des hochempfindlichen Objektivs aus.
Hegarth arbeitete sehr routiniert. Innerhalb kürzester Zeit hatte er sämtliche Unterlagen abgelichtet.
Er wurde gerade rechtzeitig fertig. Auf dem Gang draußen näherten sich wieder Schritte. Hastig versteckte er die Kamera. Er wollte sie nicht mit ins Labor nehmen. Möglicherweise gab es dort eine Röntgensperre, die den ganzen Film vernichtet hätte.
Hedley Flinder lächelte strahlend, als er eintrat.
»Wir können gehen. Dem steht nichts mehr im Wege«, verkündete er.
Hegarth folgte ihm mit hämmerndem Herzen. Die Spannung zehrte an seinen Nerven. Er war sich bewußt, daß er bald eine der größten militärischen Errungenschaften der Nachkriegszeit im frühen Versuchsstadium zu Gesicht bekam.
Ohne Schwierigkeiten gelangten sie zum Labor. Es sah völlig anders aus, als es sich Hegarth vorgestellt hatte. Sie betraten eine unterirdisch gelegene Halle, die mindestens fünfhundert Yards im Quadrat maß und annähernd fünfzehn Fuß hoch war. Den Mittelpunkt der futuristisch anmutenden Einrichtung bildete ein Arrangement, das an einen Schießstand für ballistische Experimente erinnerte.
Neugierig trat Professor Matthew Hegarth näher. Eine seltsame Apparatur erregte seine Aufmerksamkeit. Das Ding ähnelte entfernt einem übergroßen Laser. Etwas aber stimmte nicht. Es dauerte eine Weile, bis Hegarth dahinterkam, obwohl es eigentlich auf der Hand lag:
Der Laser war nicht zylindrisch geformt, sondern kugelrund. Ein absolutes Novum.
Hegarth überschlug in Gedanken alles, was er über die Laser- und Masertechnik wußte.
Demzufolge war die Kugelfonn völlig sinnlos und mußte den Effekt verringern.
Oder irrte er sich?
Hedley Flinder erklärte ihm, warum das nicht so war - allein, Hegarths Verstand kam nicht ganz mit. Er konnte mit den Erläuterungen nicht viel anfangen. Das machte die Besichtigung letztlich für ihn uninteressant. Er ließ die Erklärungen des Professors ungehört an sich vorüberplätschern und konzentrierte seine Aufmerksamkeit auf die technischen Gerätschaften, von denen er etwas verstand. In seinem Kopf formulierten sich schon die Worte für seinen nächsten Bericht. Die Einrichtung des Labors war geeignet, die Gegenseite - in diesem Fall eine international operierende Terrororganisation - aufhorchen zu lassen.
Endlich führte ihn Flinder wieder hinaus. Sie gingen in das Büro, in dem sie sich begrüßt hatten, und während sie bei einem Glas Whiskey alte Geschichten erzählten, nahm Matthew Hegarth unauffällig seine Miniaturkamera wieder an sich. Er hatte, was er wollte und brauchte sich nicht mehr länger aufzuhalten. Plötzlich täuschte er Eile vor.
Noch einmal bedauerte er ehrlich, daß dies vorläufig wohl sein letzter Besuch wäre, da in Zukunft Flinder und sein Team streng von der Außenwelt abgeschirmt werden sollten, dann verließ Hegarth das Institut.
Als er in seinem Wagen saß, mußte er erst einmal richtig tief durchatmen, bis seine innere Erregung abgeklungen war.
Eigentlich kam Hegarth sich wie ein Schweinehund vor, da er seinen alten Freund Flinder so sehr hintergangen hatte. Aber im Laufe der Jahre hatte er es gelernt, sein Gewissen zum Schweigen zu bringen, falls es ihm lästig wurde. Das war bequem - und verlangte sein Job.
Professor Matthew Hegarth war Wissenschaftler, aber seine wissenschaftliche Tätigkeit hatte ihm nie so viel Geld gebracht, wie er zu brauchen glaubte. Deshalb war er zum Spion geworden, inzwischen zu einem der größten in den Vereinigten Staaten, und er hatte mit seiner »Nebentätigkeit« Millionen verdient. Skrupel waren da völlig fehl am Platz. Sobald er für die Gegenseite nicht mehr interessant war, wurde er liquidiert. Das Ganze war also nicht mehr allein ein finanzielles Problem, sondern es ging bei ihm um Leben und Tod.
Matthew Hegarth drehte das Radio an und ahmte die aus den Stereolautsprechern dringende Musik pfeifend nach. Dann lenkte er sein Fahrzeug in Richtung Nassau, wo er seine pompöse Villa stehen hatte.
Im Grunde genommen konnte er sehr zufrieden sein.
*
»Es freut mich, Mrs. Browne«, höhnte Andy Coverdale.
Gleichzeitig erwachte Elisabeth aus ihrer Erstarrung. Sofort wollte sie die Flucht ergreifen.
Richard Fenwick erwischte sie am Oberarm.
»Nicht doch, Mrs. Browne, wer wird sich denn gleich wieder verabschieden wollen, wo wir doch so lange auf Sie gewartet haben?«
Mit sanfter Gewalt zwang er die schöne Frau in Richtung Fahrstühle. Der Mann hinter der Rezeption achtete nicht mehr auf sie. Für ihn war die Sache erledigt.
Andy Coverdale hatte seine Rechte in die Jackentasche versenkt. Er trat dicht neben Elisabeth. Die schöne Frau spürte einen eisenharten Gegenstand.
»Ich hoffe, Sie wissen, was das ist, Mrs. Browne«, zischelte er.
Elisabeths Haltung versteifte sich. Und ob sie das wußte. Gleichzeitig aber wurde ihr klar, daß sie diesen Männern nicht entwischen konnte. Sie hatte sich alles ganz anders vorgestellt. Hier hatte sie es nicht mit blutigen Anfängern zu tun, sondern mit Vollprofis. Hätte sie nur geahnt, in was sie sich da eingelassen hatte...
Ihre Gedanken bewegten sich im Kreis. Was hatte sie verkehrt gemacht?
Auf jeden Fall hatte sie ihren Mann völlig falsch eingeschätzt.
Sie hatte ihn erschossen, und hier waren seine Leute. Wäre Harry York der gewesen, als den sie ihn immer gesehen hatte, hätte sich die Sache ganz anders entwickelt. Warum riefen die Männer nicht die Polizei? Warum bemühten sie sich selbst um sie?
In ihrer Brust pochte die Angst. Elisabeth York ahnte, was die mit ihr anstellen wollten. Sie öffnete den Mund, um zu schreien. Sollten die sie doch erschießen. Vielleicht blieb ihr damit Schlimmeres erspart?
Doch Richard Fenwick hatte rechtzeitig erkannt, was die Frau vorhatte. Blitzschnell preßte er die Hand auf ihren Mund.
Inzwischen war der Fahrstuhl angelangt. Elisabeth wurde unsanft hineingeschoben, dann ging es aufwärts.
»Ich würde Ihnen raten, sich ruhig zu verhalten«, warnte Andy Coverdale. »Wir wollen Sie nicht töten, aber treiben Sie es nicht zu weit.«
Elisabeth musterte ihn lauernd. Coverdales Linke zuckte vor. Ehe es die Frau verhindern konnte, hatte er den Schleier gehoben.
»Sieh an, unsere Mrs. Browne!« spöttelte er. »Also, sie hat wirklich verblüffende Ähnlichkeit mit Harrys Frau. Was meinst du, Rick?«
Fenwick grinste über das ganze Gesicht.
»Tatsächlich, ich glaube, du hast recht.«
Tränen schossen Elisabeth York in die Augen. Sie begann, hemmungslos zu weinen. Mit ihrer Beherrschung war es vorbei.
Der Fahrstuhl hielt. Coverdale streifte den Schleier über das Gesicht der Frau. Die zwei Komplicen stützten die Schwarzgekleidete und führten sie hinaus. Ein rührendes Bild. Die Sterbensmienen der beiden bulligen Männer und das Schluchzen der Frau verfehlten ihre Wirkung nicht.
Die Leute, die der Gruppe begegneten, blickten ihr mitfühlend nach.
Richard Fenwick hatte den Zimmerschlüssel an sich genommen und schloß auf. Er überließ die Frau seinem Kollegen und setzte sich an die Spitze - nicht bevor er seine Waffe gezückt hatte. Sie schwenkte nach allen Richtungen.
»Hallo«, sagte der Mann, der in dem bequemen Sessel in der Ecke saß, »hat ja lange genug gedauert, bis ihr endlich gekommen seid.«
Die Waffe deutete auf seine Brust. Er verzog das Gesicht.
»Richard, kannst du mit dem Ding nicht irgendwo anders hinzielen? Mein Herz beginnt so komisch zu hämmern.«
Grinsend steckte Richard Fenwick seine Pistole wieder weg. Er winkte Coverdale herein. »Komm, die Luft ist sauber!«
Andy Coverdale stieß die Frau vor sich her. Ihre geweiteten Augen richteten sieh auf den Mann, der sich langsam aus seinem Sessel erhob und von ihr erkannt wurde. Er gehörte zu den beiden anderen. Es war David Hughes.
*
Matthew Hegarth fuhr seinen schweren Wagen in die Garage und eilte ins Haus. Der Butler begegnete ihm.
»Johns, ist meine Frau da?«
»Nein, Sir, sie ist zum Einkaufen, wollte aber längst schon zurück sein. Soll ich ihr etwas ausrichten, wenn sie kommt, Sir?«
Hegarth winkte ab.
»Lassen Sie nur. Sorgen Sie lieber dafür, daß ich nicht gestört werde! Ich habe im Keller zu tun.«
Johns deutete einen Diener an, und Hegarth eilte über die Treppe in den Keller. Dort hatte er sich ein Labor eingerichtet. Dazu gehörte auch eine Dunkelkammer. Bevor er sich jedoch ans Entwickeln des Spezialfilms machte, tippte er seinen Bericht. Die beschriebenen Blätter lichtete er ebenfalls ab, dan vernichtete er sie.
Es war eine diffizile Arbeit, den Film zu entwickeln, aber Matthew Hegarth war gut ausgerüstet. Er machte alles selbst, was ihm die Gewähr gab, sich auf niemanden verlassen zu müssen. Nicht mal seine eigene Frau wußte etwas von seiner Spionagetätigkeit. Sie lebte gern im Luxus und fragte nicht danach, woher dieser kam.
Matthew Hegarth war gerade fertig und wusch sich die Hände, als es zaghaft gegen die Tür zur Dunkelkammer klopfte. Seine Haltung versteifte sich. Wer war das? Hatte er seinem Butler nicht ausdrücklich gesagt, daß er nicht gestört zu werden wünschte?
»Wer ist da?« fragte er unwirsch.
»Darf ich hineinkommen?« Eine weibliche Stimme.
»Ja«, sagte Hegarth, denn er hatte die Stimme seiner Frau erkannt.
Die Tür wurde von außen geöffnet. Das hereinfallende Licht vertrieb die dürftige Rotbeleuchtung. Hegarth zwinkerte geblendet. Seine Frau stand im Türrahmen. Die Hintergrundbeleuchtung verlieh ihr eine Art Aura. Das Gesicht war nicht zu erkennen, es lag im Schatten. Deutlich aber konnte er die aufregenden Kurven sehen.