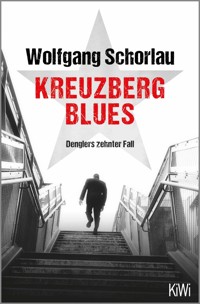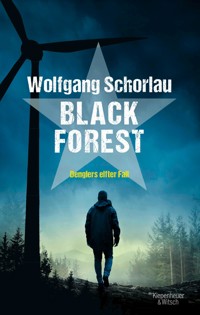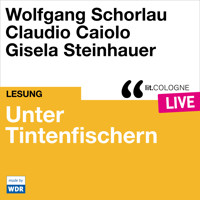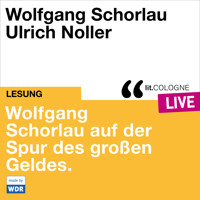9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Was blieb von der Rebellion und den Idealen der Jugend? Dies ist die Geschichte von Alexander und Paul. Es ist die Geschichte einer ungewöhnlichen Freundschaft zwischen einem Jungen aus begüterten Verhältnissen und einem Kind aus dem Waisenhaus. Es ist die Geschichte eines Verrats. Und die Geschichte einer großen Liebe. Nicht zuletzt erzählt sie von den gesellschaftlichen Umwälzungen der Sechziger- und Siebzigerjahre, von den damit verbundenen Träumen und Hoffnungen und von dem, was davon schließlich übrig bleibt.Alexander wohnt in dem wohlhabenden Freiburger Stadtteil Herdern. Er freundet sich mit Paul an, der im Eisenbahn-Waisenhort gleich nebenan aufwächst – wenige Meter entfernt, und doch in einer ganz anderen Welt. Jeder entdeckt im anderen das, was ihm zu fehlen scheint. Der eine ist der Spiegel des anderen. Aus unterschiedlichen Motiven engagieren sich die beiden jungen Männer schließlich in linken Bewegungen. Alexander sucht Freiheit, Paul will soziale Gerechtigkeit. Da taucht Toni auf, die Frau ihres Lebens. Das Schicksal führt sie zusammen und wieder auseinander. Sie landen im Heute. Und alle drei Figuren müssen entscheiden, wie sie mit den Idealen der Jugend umgehen wollen. Soll man retten, was davon übrig geblieben ist? Oder sind sie ein Panzer, den es zu sprengen gilt?Am Beispiel von Alexander, Paul und Toni untersucht Wolfgang Schorlau die Anatomie der Rebellion, überzeugt davon, dass ihre Kenntnis in unruhigen Zeiten nützlich sein kann. »Ich erzähle etwas Spezifisches«, schreibt Schorlau im Nachwort, »um etwas Allgemeines auszudrücken.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 334
Ähnliche
Wolfgang Schorlau
Rebellen
Roman
Kurzübersicht
> Buch lesen
> Titelseite
> Inhaltsverzeichnis
> Über Wolfgang Schorlau
> Über dieses Buch
> Impressum
> Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
Inhaltsverzeichnis
Wer glaubt, sich selbst oder einen alten Bekannten in diesem Buch wiederzuerkennen, irrt sich. Alle Figuren in diesem Buch sind erfunden.
Alles ist nur ausgedacht.
Die Entstehung dieses Romans wurde von dem Förderkreis Deutscher Schriftsteller in Baden-Württemberg unterstützt.
Natürlich für Petra
Sagen Sie ihm, dass er die Träume
seiner Jugend nicht vergessen soll,
wenn er ein Mann geworden.
Marquis von Posa in: Friedrich Schiller, Don Karlos
Was hat die Zeit mit uns gemacht?
Was ist denn bloß aus uns geworden?
Das kann doch echt nicht unser Ding sein.
Udo Lindenberg
Anfang
Der Anfang bestimmt die Struktur
Was die adligen Schriftsteller von der Natur umsonst bekommen haben, das erkaufen sich die Leute ohne Rang und Titel mit dem Preis ihrer Jugend. Schreiben Sie doch mal eine Erzählung darüber, wie ein junger Mensch, Sohn eines Leibeigenen, seinerzeit Ladenschwengel, Kirchensänger, Gymnasiast und Student, erzogen zur Ehrfurcht vor Ranghöheren, zum Küssen von Popenhänden, zur Verbeugung vor fremden Gedanken, zur Dankbarkeit für jedes Stückchen Brot, oft verprügelt, ohne Galoschen zum Unterricht gegangen, der sich geprügelt hat, Tiere gequält hat, gern bei reichen Verwandten gegessen hat, ohne Notwendigkeit geheuchelt hat vor Gott und den Menschen, nur aus dem Bewusstsein seiner Minderwertigkeit – schreiben Sie, wie dieser junge Mann aus sich tropfenweise den Sklaven herauspresst und wie er eines schönen Morgens aufwacht und spürt, in seinen Adern fließt kein Sklavenblut mehr, sondern echtes, menschliches.
Anton Tschechow, Brief an Suworin vom 7. Januar 1889
1.Alexander
Das Erste, was er von Paul sah, war die Glut seiner Zigarette.
Zunächst dachte er, es sei eines jener selten gewordenen Glühwürmchen, die er manchmal abends von seinem Zimmer aus beobachtete, wenn sie drüben auf der anderen Seite des niederen Buchsbaumzaunes ihre Tänze aufführten und so eigenwillige Kurven und Linien flogen, so schnell die Richtung ihres Fluges änderten, dass es ihm nie gelang, ihre Bahnen vorherzusagen. Doch dieses Glühwürmchen leuchtete jäh auf und verlosch gleich wieder. Alexander drückte sich enger an die Wand und schob die Gardine ein wenig weiter zur Seite. Er kniff die Augen zusammen, um durchs Dunkel besser sehen zu können, und drüben auf der Heimwiese verwandelte sich der Schatten in eine Kontur, und die Kontur wurde zur Gestalt, zur Gestalt eines Jungen, kaum älter als er, zwölf, vielleicht schon dreizehn Jahre alt. Mit dem Rücken lehnte er gegen den Stamm des alten Apfelbaumes und rauchte.
Unvermittelt überfiel ihn Neid. Ekelhafter, sündiger Neid. Neid, den er am Samstag würde beichten müssen. Neid auf den Jungen auf der anderen Seite des Zauns, für den die Gebote der Erwachsenen nicht galten. Der nicht beim Dunkelwerden ins Bett geschickt wurde. Der nicht jeden Abend die Schande ertragen musste, dass der Bruder eine Stunde länger bei den Eltern vorm Fernseher sitzen durfte, obwohl er nur zwei Jahre älter war. Dieser Junge, nur wenige Schritte von ihm entfernt, wurde bestimmt nicht gezwungen, Klavier zu üben, bestimmt musste er nicht mit den Eltern Mozart hören oder die Schlager von Freddy Quinn.
Als sei es selbstverständlich, hielt der Junge dort drüben eine Kippe in der hohlen Hand. Dann trat er sie mit dem Absatz aus, so wie John Wayne es in den Filmen tat, die er sich manchmal sonntags nachmittags im Friedrichsbau ansah, heimlich, wenn eine großherzige oder kurzsichtige Kartenverkäuferin ihm ein Billett verkaufte.
Der Junge auf der anderen Seite des Zauns stieß sich plötzlich von dem Baum ab, stand einen Augenblick still, als denke er nach, dann marschierte er mit fünf ausholenden Schritten geradeaus, riss die Füße hoch wie ein Soldat. Dann blieb er stehen, drehte sich mit einer einzigen schnellen Bewegung nach links und ging noch einmal fünf Schritte. Er bückte sich. Saß nun in der Hocke und streifte mit der rechten Hand über den Boden. Er griff in die Hosentasche, zog ein Messer hervor und stach in den Boden. Lockerte die Erde, buddelte mit beiden Händen und hob Erde aus. Manchmal hielt er inne und sah sich um. Dann verbarg Alexander sich hinter der Gardine und wartete einen Augenblick.
Kein Zweifel: Der Junge grub mit Messer und bloßen Händen den Boden auf. Als er fertig war, zog er mit beiden Händen eine dunkle Schachtel aus der Erde. Er hob den Deckel hoch und zog eine Pistole hervor. Mit einer kurzen Bewegung steckte er sie in den Hosenbund, legte die Schachtel in das Loch zurück, schob mit dem rechten Fuß die Erde zurück in die Grube und trampelte sie fest.
Eine Pistole!
Alexander zuckte hinter der Gardine zurück.
Verboten!
Absolut verboten!
Vorsichtig beugte er sich vor und schob mit dem Zeigefinger erneut die Gardine zur Seite.
Der Junge auf der anderen Seite des Zauns wischte sich die Hände an der Hose ab und ging mit steifen Schritten über die Wiese zu dem Heckenzaun, der sie von der Haydnstraße trennte. Die Dunkelheit radierte seine Kontur aus und ließ Alexander alleine hinter der Gardine zurück.
Barfuß tapste er wieder ins Bett. Auf dem Rücken liegend streckte er die Beine aus, doch seine Fersen stießen prompt gegen die Fußleiste des Bettes und erinnerten ihn daran, dass er immer noch in einem Kinderbett lag, während sein Bruder schon in einem richtigen, von ihm selbst ausgesuchten Bett schlief. Wütend drehte er sich zur Seite und zog die Knie an den Bauch. Es wuchs in ihm der Beschluss, mehr noch die Gewissheit: Dieser Junge würde sein Freund werden, sein bester Freund. Sie würden abwechselnd diese Pistole tragen und spätabends gemeinsam rauchen.
Er lag in seinem zu klein gewordenen Kinderbett, und er entbehrte etwas, das so grundlegend und elementar war wie Luft oder Wasser oder Brot. Er sehnte sich nach etwas und wusste nicht, wonach.
2.Alexander heute
Die lokale Presse hatte die Vorabmeldungen der großen Wirtschaftsredaktionen sofort aufgegriffen und die Nachricht bereits heute auf die erste Seite gehoben. Immerhin ging nun ein jahrzehntelanger Kampf auf dem Markt für Werkzeugmaschinen zu Ende, und dass ein Freiburger Unternehmen die Konkurrenz aus dem Schwäbischen schluckte, war nun wirklich berichtenswert, denn meist, so die Erfahrung der letzten Jahrzehnte, lief es umgekehrt. Umso mehr wurde es ihm, dem Unternehmer Alexander Helmholtz, angerechnet, dass er sich zum Mittagessen im Hotel Colombi einfand, wo sich, wie jeden Montag, sein rotarischer Klub zum Essen traf. Dass ein so bedeutend gewordener Mann Mitglied blieb und sogar seiner Präsenzpflicht nachkam, jedenfalls weitgehend, denn bei den umfassenden Geschäften der Helmholtz-Gruppe musste man an diesem schwierigen Punkt eine gewisse Großzügigkeit walten lassen, wurde im Klub mit Anerkennung und Respekt kommentiert, obwohl Dr. Esser, der in diesem Jahr präsidierte, vermutete, dass sich Helmholtz irgendwann doch einmal zurückziehen würde, um dann Gruppen und Zirkeln anzugehören, deren Mitglied zu sein den normalen Rotariern, also leider auch ihm, versagt bleiben würde.
Umso mehr ärgerte er sich, dass an diesem Tag drei ältere Mitglieder, zwei emeritierte Professoren und ein ehemaliger Forstpräsident, während des Vortrags einschliefen, der regelmäßig dem Essen folgte. Nun, sie schliefen jeden Montag und bei jedem Vortrag, aber dass sie auch an diesem Tag die Köpfe so schamlos nach vorn fallen ließen, nahm Esser ihnen richtiggehend übel. Immerhin: Helmholtz schien es nicht zu bemerken. Vielleicht war er zu sehr mit den eigenen Gedanken beschäftigt. Er saß wie immer an dem Tisch in der Mitte, den Kopf leicht zur Seite geneigt, und hörte aufmerksam zu.
Erst später, nach dem Essen, als man ihnen in der Lobby bereits die Mäntel reichte, ergab sich die Gelegenheit, und Dr. Esser gelang es, seinem rotarischen Freund mit einigen wenigen Worten zu gratulieren.
»Als einen unserer nächsten Klubpräsidenten haben wir Sie mit dem heutigen Tag wohl verloren?«
Helmholtz lachte. Sorgfältig zog er die Handschuhe an den Fingern gerade. »Wer weiß. In Ihrer Nachfolge zu stehen wäre eine große Ehre. Aber vielleicht nicht gerade im nächsten Jahr.«
»Abgemacht. Für den Klub wäre es eine Ehre.« Dr. Esser zögerte einen Moment: »Es gibt da noch eine Sache, zu der ich Sie gern gesprochen hätte. Sie betrifft, nun ja …«
Er blieb stehen. Helmholtz sah auf seine Uhr.
»Unsere Kanzlei hat ein Mandat angenommen, ein Mandat, das möglicherweise Ihre Interessen berührt.« Er räusperte sich. »Der Name Paul Becker sagt Ihnen vielleicht etwas?«
Helmholtz hob den Kopf und sah Esser direkt in die Augen. Was immer in Helmholtz vorging, an seinen Augen konnte Esser es nicht ablesen. Zum ersten Mal bekam er eine Vorstellung davon, mit welch harten Bandagen dieser Mann kämpfen konnte.
»Allerdings.« Helmholtz zögerte einen Augenblick: »Soweit ich weiß, ist Paul Becker vor einigen Jahren gestorben.«
»Nun, wir vertreten seinen Sohn. Jonas Becker. Er hat gewisse Unterlagen seines Vaters gefunden, die er Ihnen gern zeigen würde.«
»Unterlagen?«
»Offenbar Notizen seines Vaters.«
Der pensionierte Forstpräsident, nun lebhaft und wach, steuerte aus dem Nebenzimmer direkt auf sie zu.
Helmholtz zog Esser mit einer schnellen Bewegung zur Seite, sodass der Forstpräsident a.D. verblüfft ins Leere lief. Der wohldosierte Druck auf Essers rechten Unterarm verlagerte sich, und er wurde unversehens zurück in den Speiseraum geschoben, der nun menschenleer war. Verwüstet sah es hier nun aus, zerknüllte, verschmutzte Servietten auf den Tischen und den Sitzflächen der achtlos nach hinten gerückten Stühle, Fleischreste und Pfützen übrig gelassener Soße auf den Tellern.
»Jonas Becker will mit mir reden? Warum ruft er mich nicht an?«
»Ein Termin in unserer Kanzlei wäre wohl angemessen.«
Helmholtz überlegte: »Dann sollten wir den jungen Mann nicht allzu lange warten lassen.«
»Sicher. Mein Büro wird sich mit Ihnen wegen eines Termins in Verbindung setzen.«
Helmholtz griff erneut mit einer schnellen Bewegung Essers Arm. »Warum nicht sofort? Heute?«
»Heute Nachmittag? In meiner Kanzlei?«
»Ja. Passt Ihnen 17 Uhr?«
Esser nickte, und Helmholtz ging.
Gedächtnis und Erinnerung sind zwei völlig verschiedene Dinge. Das Gedächtnis, so hatte jedenfalls Alexander Helmholtz lang gedacht, ist ein gut geölter Apparat, der umstandslos alles in sich hineinstopfte, eine Maschine, die Informationen, Eindrücke und Erlebnisse in Nervenzellen und Synapsen speicherte, wie eine Verkehrskamera, die unbeteiligt alles aufnimmt, was sich in ihrem Blickwinkel bewegt.
Helmholtz war es gewohnt, Informationen zuverlässig abzurufen, entweder aus dem eigenen Kopf oder aus dem von Frau Ballhaus, die sein Büro seit vielen Jahren führte. Er verlangte, dass die Information zur Stelle war, wenn er sie brauchte. Das verlangte er, obwohl ihm sein eigener Gedächtnisapparat seit zwei, drei Jahren immer öfter Streiche spielte und er zu seinem Ärger Dinge vergaß, vor allem Namen. Sogar wenn es um einen wichtigen Auftrag ging und er sich von einem Mann verabschiedete, der ihm bereits im Juni die Jahresbilanz rettete und mit dem er zwei Stunden lang über technische Details, Lieferzeiten, Zahlungsziele und Rabatte gefeilscht hatte, fiel ihm zum Abschied, wenn man sich die Hände reichte und noch einmal, einer Beschwörungsformel gleich, die nun begründete langfristige, verlässliche Partnerschaft betonte, der Name seines Gegenübers nicht mehr ein. Das Gedächtnis versagte auf empörende Weise, statt des Namens fühlte er auf beunruhigende Weise ein saugendes Vakuum im Hirn.
Als er Toni davon erzählte, lachte sie ihn aus. Das seien normale Alterserscheinungen. Er müsse sich keine Sorgen machen. Allerdings: Besser würde es nicht werden. Seitdem notierte er sich die Namen seiner Gesprächspartner in dem gebundenen schwarzen Notizbuch, das er aufgeschlagen vor sich liegen ließ und in das er am Ende des Gesprächs unauffällig einen Blick warf, um die aufgeschriebenen Namen zumindest jetzt noch einmal ins Kurzzeitgedächtnis zu rufen.
Helmholtz fror, als er die Rathausgasse hinaufeilte, obwohl es ein warmer Frühlingstag war. Die Bäume um den Brunnen, den die Stadt zu Ehren des Franziskanermönchs Berthold Schwarz erbaut hatte, trugen bereits frische Blätter in dem unschuldigen Sanftgrün des späten April. Doch Wolken stauten sich über dem Schlossberg, und ein plötzlicher Regen konnte alles zunichtemachen. Nichts war sicher in dieser frühen Jahreszeit.
Helmholtz eilte weiter, den Mantelkragen mit der Rechten am Hals zusammendrückend. Er wollte nicht an Paul denken. Er wollte Toni sehen.
Ja, er wollte seine Frau sehen. Sehen, dass sie lebte, sehen, dass alles an seinem Platz war. Paul war seit Jahren tot. Doch nun schien es ihm, als greife er erneut nach ihm.
Am Ende der Kaiser-Joseph-Straße befand sich ihre Praxis: Dr. Antonia Helmholtz, Diplom-Psychologin, Jugend- und Familientherapie. Er stürmte die Treppe hinauf und riss die Tür zu ihrer Praxis auf.
Sonja, die hinter der Anmeldetheke saß, schreckte auf, lächelte, als sie ihn erkannte, legte dann einen Finger auf die Lippen. »Ihre Frau hat eine Patientin«, flüsterte sie und deutete auf den Therapieraum. Sie streckte alle zehn Finger in die Höhe.
Noch zehn Minuten also.
Immer noch schwer atmend, ging Alexander Helmholtz ins leere Wartezimmer und setzte sich auf einen Stuhl. Stand auf und zog seinen Mantel aus. Setzte sich wieder, stand erneut auf, trat zum Fenster und schob, einem inneren Impuls folgend, die Gardine zur Seite.
Erinnerung ist ein anderes Kaliber als das Gedächtnis. Erinnerung wählt aus. Erinnerung bewahrt jene Dinge auf, die ein unkontrollierbares Unterbewusstsein für wert hält, dass sie aufbewahrt werden, oder die so schrecklich sind, dass sie unvergesslich werden. Sie hält sie frisch wie am ersten Tag. Ihr Maßstab sind weder Uhr noch Frau Ballhaus’ Terminkalender. Erinnerung lässt sich nicht kontrollieren, bestellen, kommandieren, sie kommt und geht, wie es ihr passt, oft ohne Vorwarnung und ohne Ankündigung, und wenn sie erscheint, ist sie wahr, sosehr man zuvor auch versucht haben mag, sie zu verbiegen, zu verleugnen oder gar ganz zu löschen.
3.Paul
Paul stemmte sich gegen die Tür. Mit der Schulter und beiden Händen drückte er dagegen. Im Flur nahm Moppel Anlauf. Trotz seines enormen Gewichts beschleunigte er auf den wenigen Metern, die ihm zur Verfügung standen, erstaunlich schnell und krachte mit der rechten Schulter gegen die Tür zum Klo, die sich unter seinem Ansturm um einige Zentimeter öffnete. Paul hielt dagegen. Auf keinen Fall durfte Moppel einen Fuß in den Spalt setzen. Paul stützte sich mit beiden Beine an dem steinernen Sockel der ersten Kabine ab und presste mit Brust, Armen und Schulter gegen die Tür, die sich Millimeter um Millimeter öffnete. Er schaffte es nicht, die Tür wieder zurück ins Schloss zu drücken, aber noch war der Spalt zu klein für Moppels Schuh. Die Muskeln von Pauls Oberarmen flatterten.
»Ich krieg dich«, zischte Moppel durch die Öffnung. »Ich krieg dich. Ich mach dich fertig.«
Moppel presste.
Paul drückte.
Plötzlich ließ der Druck nach, und die Tür krachte zurück ins Schloss. Paul wischte sich mit dem Ärmel den Schweiß von der Stirn. Es war nur eine Atempause, er wusste es. Moppel nahm nur erneut Anlauf.
Das Fenster war nachts immer nur angelehnt, weil die Älteren dann an dem Fallrohr der Regenrinne hinabkletterten, in die Freiheit, wie sie sagten. Paul ging von der Tür weg zum Fenster und zog es weit auf. Dann stieg er aufs Fensterbrett. Mit einer Hand hielt er sich am Fensterkreuz fest und stellte einen Fuß draußen auf den steinernen Vorsprung. Es war schon dunkel, trotzdem sah er deutlich wie nie zuvor zehn Meter unter sich die Händelstraße, den Bürgersteig und den schmalen Grünstreifen.
Wenn ich falle, bin ich tot.
Mit der linken Hand griff er zum Fallrohr, das vom Dach bis hinunter auf den Boden führte. Doch er schaffte es nicht. Die Fingerspitzen berührten zwar das Blech, aber er konnte das Rohr nicht greifen.
Er beugte sich noch ein Stück weiter vor. Es reichte nicht.
In diesem Augenblick krachte die Tür auf. Moppel stürzte in den Vorraum der Toilette. Sein eigener Schwung ließ ihn straucheln, sein rechter Fuß knickte um, er ging in die Knie, fiel, aber noch in der Abwärtsbewegung wendete er den Kopf, suchte er sein Opfer wie ein Hund, der Blut gerochen hat. Moppel schlidderte ein kurzes Stück auf den Kacheln, sprang dann erstaunlich behände auf. Mit den kleinen, in Fettpolster eingelagerten Äuglein fixierte er Paul, der draußen auf dem Fenstervorsprung stand.
»Spring doch, du Arschloch!« Er kam einen Schritt auf Paul zu. Gleich würde er ihn am Fuß packen.
»Los, spring doch, wenn du dich traust.« Moppel ging noch einen Schritt auf das Fenster zu.
Plötzlich schlotterte Pauls rechtes Knie. Er streckte es, er dehnte es, er verlegte das Gewicht auf das wackelnde Bein, doch es zitterte einfach weiter. Moppel stand direkt vor ihm. Er genoss die Angst, die Angst des Kleineren. Sie rief bei ihm weder Gnade noch Großherzigkeit noch Erbarmen hervor, sondern steigerte seinen Appetit.
Paul sah es und sprang.
4. Paul
Es hatte an Pauls erstem Tag im Waisenhaus begonnen. Er packte gerade seinen Koffer aus, stapelte seine Hemden in den Wandschrank, als Moppel vor ihm stand.
»Du bist also der Neue?«
Paul nickte und starrte Moppel an. Einen so fetten Jungen hatte er noch nie gesehen.
»Was gibt es denn da zu glotzen? Ich bin Moppel, ich bin der Stärkste in der Gruppe.«
»Ich bin Paul.«
Ansatzlos schlug Moppel zu. Er traf Paul mit der Faust zwischen Oberlippe und Nase. Es blutete sofort. Paul schlug instinktiv zurück und traf Moppel genau auf die Nase. Eine Blutfontäne schoss aus dem Gesicht des fetten Jungen, stürzte übers Kinn aufs Hemd und versaute den Boden.
Moppel schlug beide Hände vors Gesicht und rannte in den Waschraum. Paul hörte den Wasserstrahl. Er zog eins der großen Herrentaschentücher aus dem Koffer, die seine Mutter ihm mitgegeben hatte und die zuvor vermutlich seinem Vater gehört hatten, und wischte sich das Gesicht ab. Der weiche Stoff roch vertraut nach dem Waschmittel, das seine Mutter verwendete.
Am Abend lag er in dem großen Schlafsaal, und Heimweh quälte ihn. Vierzehn Jungs, Bett an Bett. Alles hier erinnerte ihn an den Saal, in dem sein Vater gestorben war. Zwanzig andere hustende, keuchende, stinkende Männer, in dem großen Saal, den er immer nur widerstrebend betreten hatte, an der Hand seiner Mutter, die ihn unbarmherzig hinter sich herzog.
Doch hier gab es keine Schwestern in weißen Kitteln, die ihn freundlich anlächelten. Hier gab es eine Erzieherin, Fräulein Wackenhut, und nach ihr war auch die Gruppe benannt: Gruppe Wackenhut. Mit seinen erbärmlichen zehn Jahren war Paul der Jüngste in der Gruppe. Der älteste Junge war fünfzehn. Fräulein Wackenhut stellte ihm jeden einzeln vor, aber er konnte sich kaum einen Namen merken.
»Stimmt das, dass du dem Moppel die Nase blutig gehauen hast?«, flüsterte der Junge im Bett neben ihm. Werner. Das hatte er sich gemerkt.
»Ja. Hab ich.«
»Hat er verdient. Aber er wird dir bestimmt fürchterlich die Fresse polieren.«
»Ich hab gar nichts gemacht. Er hat zuerst zugeschlagen.«
»Weißt du, warum der Moppel Moppel heißt?«
»Nein.«
»Weil der so fett ist, dass er Moppeln hat wie ein Weib.«
»Ruhe jetzt. Schlaft endlich.« Fräulein Wackenhut stand in der Tür. Sie trat noch einmal an Pauls Bett und strich ihm über den Kopf. »Schlaf gut, Paul. Leb dich gut ein bei uns.«
Paul nickte. Er war müde und konnte doch nicht schlafen. Noch drei Wochen und ich werde elf Jahre alt. Mama hat versprochen, mich dann zu besuchen. Ich hab ihr viele Sorgen gemacht. Ich mache immer allen Sorge. Ich bin zu oft nicht zur Schule gegangen.
Sechs Wochen lang war Paul im Rechenunterricht verschwunden. Manchmal, drei- oder viermal, lief er mittwochs sogar nach dem Schulgottesdienst durch die Stadt und ging erst nach Hause, wenn die Schule zu Ende war. So als sei nichts geschehen. Er übte drei Tage, bis er die Unterschrift der Mutter nachmachen konnte. Dann schrieb er sich selbst Entschuldigungen. Es flog auf, weil Lehrer Fuhr seiner Mutter zufällig in der Stadt begegnete. Es gab zwei Ohrfeigen vor der gesamten Klasse; Nasenbluten, das einfach nicht aufhören wollte. Die Mutter mit gesenktem Kopf in der Schule. Paul, Paul, ich muss doch arbeiten, und du machst mir immer nur Sorgen. Er verstand nicht, worum es im Rechnen ging. Du bist doch kein dummer Junge.
Doch, das war er. Ich bin dumm. Deshalb bin ich jetzt hier. Es ist die gerechte Strafe. Jetzt mache ich der Mama keine Sorgen mehr. Vielleicht kommt sie doch zum Geburtstag.
5. Alexander
Alexanders Mutter hasste das Waisenhaus.
Manchmal stand sie nach dem Abendessen vor dem großen Panoramafenster, das Glas mit dem Möselchen in der einen und die Lord Extra in der anderen Hand. »Seht euch das nur an«, rief sie dann, und langsam scharrte sich die Familie um sie, der Vater mit dem unvermeidlichen Cognacschwenker, rechts neben ihm Maximilian, der dann sofort nach Vaters Hand griff, die Mutter stand einen halben Meter davor und Alexander neben ihr. Sie starrten hinüber zum Waisenhaus, das nur durch Heimwiese und Haydnstraße von ihrem Haus getrennt war.
»So etwas gehört einfach nicht in unsere Gegend«, sagte der Vater dann, aber es klang, als sage er das nur, um die Mutter zu beruhigen. Trotzdem ärgerte sich Alexander, weil Maximilian es sofort nachquasselte, wie er alles nachquasselte, was der Vater sagte. Dabei hatte der Vater das große Fenster nachträglich einbauen lassen, so als brauche er den freien Blick auf den riesigen weißen Bau, den seine Frau so verabscheute.
Maximilian und Alexander mochten die Kinder da drüben auch nicht.
Von Maximilians Zimmer im ersten Stock sahen sie jeden Samstagvormittag einem Trupp Heimkinder dabei zu, wie sie Unkraut jäteten. Sie zählten meist zwölf oder dreizehn Mädchen oder Jungs, beaufsichtigt von einer Erzieherin, die sie manchmal nicht von den Kindern und Jugendlichen unterscheiden konnten, so jung war sie. Gebückt zogen die Kinder das Unkraut am Rand der geteerten Straße heraus, die sich von der Küche bis zur Ausfahrt hinzog, dann zupften und jäteten sie am Zaun zur Gluck- und schließlich zur Haydnstraße. Die Kinder erinnerten Alexander an Strafgefangene in einem Film, und es hätte ihn nicht gewundert, wenn sie, durch Ketten gefesselt, an ihren Füßen schwere Eisenkugeln nach sich gezogen hätten.
Trotzdem: Es ging etwas Faszinierendes von ihnen aus. Sie zogen Gras und Löwenzahnwurzeln mit sichtbarem Widerwillen aus der Erde und warfen sie mit einer so aufsässigen Langsamkeit in einen blechernen Abfalleimer, dass sich Alexander der Wirkung selbst aus der Ferne nicht entziehen konnte. Nie hätte er es gewagt, mit einer ähnlichen Geste eine Anweisung der Mutter zugleich zu befolgen und aufzubegehren. Zwei Wochen Stubenarrest wären das geworden, von der Häme des älteren Bruders ganz abgesehen.
Erst Jahrzehnte später, als er Paul schon fast vergessen hatte, interessierte er sich für diesen merkwürdigen Fremdkörper in seinem früheren Stadtteil. Am Bahnhof löste er eine Fahrkarte, um nach Bärental zu fahren, wo das Wochenendhaus der Eltern stand. Am Fahrkartenschalter entdeckte er eine Sammelbüchse. Unterstützen Sie die Waisen der Bundesbahn stand darauf. Neugierig geworden, fragte er den Bahnbeamten, was es damit auf sich habe, und der zog aus einer Schublade eine kleine Broschüre. Während der Fahrt las er, dass der Eisenbahn-Waisenhort als soziale Einrichtung 1902 gegründet worden war, um eine Heimstatt für die Kinder, Waisen oder Halbwaisen der beim Schienenlegen, Sprengen oder Rangieren umgekommenen Reichsbahner zu schaffen.
Damals, als er Paul zum ersten Mal sah, wohnten mehr als dreihundert Jungs und Mädchen in dem Eisenbahn-Waisenhort. Sie besuchten die üblichen Freiburger Schulen, und jeden Morgen strömten sie gemeinsam in dunklen Trauben aus der riesigen Pforte, gingen in die Karlschule, die Weiherhofschule und einige wenige auch ins Kepler-Gymnasium.
Der Bau bestand aus einem turmartigen weißen Gebäude als Mittelteil, an den sich zwei Flügel mit je vier Stockwerken anschlossen. Links der Mädchentrakt, rechts der Trakt der Jungs. Der Innenhof umschloss auf der Seite der Jungs einen Fußballplatz, auf Seite der Mädchen ein Schwimmbad mit einem Zwanzigmeterbecken.
Aber auch das war Vergangenheit. Das Studentenwerk hatte das riesige Anwesen gekauft und vermietete jetzt Zimmer an Studenten. Manchmal trug der Wind die Musik und den Lärm ihrer Feste zu Alexanders Geburtshaus hinüber. Aber er war nur noch selten dort. Er hatte es Maximilian gelassen. Es war das Mindeste, was er für ihn hatte tun können.
6. Paul
Moppel hatte sich mit der Rache Zeit gelassen.
Eine Woche später wartete er im Treppenhaus auf Paul. »Komm, ich zeig dir was.«
Er ging in den engen Garderobenraum, in den die Kinder ihre Anoraks und Regenjacken hängten, und winkte. Paul folgte ihm unsicher. Es war düster. Es roch nach durchnässtem Stoff.
Moppel stand am anderen Ende des Raums und starrte ihn an. »Mach die Tür zu. Die Wackenhut darf das nicht sehen, was ich dir jetzt zeige.«
Paul drückte die Tür ins Schloss.
Moppel rannte los.
Siebzig Kilo Fleisch, Fett und Knochen rammten Paul und pressten ihn gegen die Tür. Die Klinke bohrte sich in seinen Rücken. Paul schrie. Sein Gesicht drückte gegen Moppels Brust oder Hals. Der Gestank des verschwitzten dicken Jungen ätzte in seiner Nase, und er bog instinktiv den Kopf zurück, es ekelte ihn, während er gleichzeitig nach Luft schnappte. Mit beiden Händen stemmte er sich gegen Moppels Schultern, aber der bemerkte es nicht einmal.
Doch da ließ Moppel unerwartet los. Paul wankte einen Schritt nach vorn. Moppel griff mit einer schnellen Bewegung Pauls linkes Ohr und riss es nach unten. Vor Überraschung und Schmerz schrie Paul hell auf, taumelte zwei Schritte vorwärts, stürzte und fiel. Sofort lag Moppel auf ihm. Mit der linken Hand hielt er ihm den Mund zu. Paul zappelte, versuchte sich zur Seite zu drehen, drückte mit beiden Händen gegen Moppels Schultern, Hände und Arme. Er riss den Kopf hin und her, versuchte Moppel abzuschütteln. Vergeblich. Mit aller Kraft bäumte Paul sich auf, streckte das Kreuz, als er merkte, dass sich Moppels rechte Hand unter seinen Hosenbund schob. Moppel rutschte ein Stück von ihm ab, und für einen Augenblick hoffte Paul verzweifelt, er könne den dicken Jungen abschütteln, doch Moppel verlagerte nur kurz sein Gewicht, und schon lag Paul wieder platt unter ihm.
Wie eine hungrige Schlange kroch Moppels Hand weiter nach unten, schob sich unter das Gummi der Unterhose und weiter den Bauch abwärts. Paul presste die Beine zusammen.
Er schrie.
Moppel lachte und drückte den Handteller fester auf Pauls Mund.
Mit dem Druck seines linken Knies schob er Pauls Beine auseinander, seine rechte Hand stieß in die Lücke und umfasste Pauls Hoden. Dann drückte er zu.
Ein nie erlebter, gellender Schmerz explodierte in Pauls Unterleib, sengend und hell. Über ihm: Moppels Augen, die ihn interessiert, fast warmherzig musterten. Paul heulte. Tränen, Rotze und Schweiß flossen über Wangen und Mund. Angst schmeckt salzig.
Moppel verlagerte das Gewicht, lockerte den Griff. Dann drückte er erneut zu, und eine weitere Welle grellen Schmerzes ließen Paul über eine Sekunde das Bewusstsein verlieren.
Als es vorbei war, stand Moppel auf. »Wenn du der Wackenhut nur einen Ton sagst, schlag ich dich tot.« Dann ging er.
Paul verriet nichts. Zweimal stand er vor Fräulein Wackenhuts Tür, aber er klopfte nie an. Er schämte sich. Er wusste nicht, mit welchen Worten er es der Erzieherin berichten sollte. Manchmal versuchte er auf dem Schulweg, die richtigen Worte und Sätze zu finden. Aber er fand weder Worte noch den Mut für das, was er ihr sagen wollte. Nach zwei Tagen war ihm klar, dass er niemandem davon erzählen konnte.
Das zweite Mal erwischte ihn Moppel eine Woche später im Vorraum der Toilette. Die Toilette der Gruppe Wackenhut bestand aus drei Boxen, einem Urinal, das die Kinder Pissbox nannten, und zwei, die sie Scheißbox nannten. Die erste Tür führte in den Vorraum mit dem Waschbecken. Durch eine zweite Tür gelangte man in den Flur.
Moppel brachte Didi und Nobbi mit.
»Da ist ja Paulchen, der gefürchtete Schläger.«
Paul trocknete sich gerade die Hände ab und versuchte, sich das Zittern nicht anmerken zu lassen. »Ihr kommt gerade rechtzeitig. Alle drei Boxen sind frei.«
Wenn er schnell war, konnte er sich vielleicht an den Jungen vorbeizwängen.
Keine Chance.
Didi grinste: »Ich muss pissen, wirklich.« Er öffnete die zweite Tür.
»Bleib hier, du Idiot«, fauchte Moppel ihn an.
Didi schloss erschrocken die Tür.
»Hast deinen witzigen Tag heute«, sagte Moppel leise zu Paul.
»Nein, eigentlich nicht.«
Paul war auf der Hut, aber Moppel schlug so schnell und so kräftig gegen Pauls Brust, dass er zurückstolperte und mit dem Rücken gegen die Tür fiel.
»Hau ihm noch eine rein, Moppel«, rief Nobbi.
»Lasst mich vorbei, sonst sag ich’s der Wackenhut.«
»He, der Kleine will petzen.« Didi grinste immer noch.
»Mach schon, Moppel, hau ihm eine rein«, rief Nobbi.
Aus dem Stand rannte Moppel los, und unter seinem Gewicht ging Paul zu Boden.
Später, als die drei Jungen gegangen waren, lag Paul auf den kalten Kacheln des Toilettenbodens. Er drehte sich auf den Rücken, starrte auf die sinnlosen Muster des Deckenputzes, drückte mit der Zunge von innen gegen die Unterlippe, um das Zittern zu beenden und das Zucken der Mundwinkel nicht zum Heulen ausarten zu lassen.
Ich will hier weg.
Ich will nach Hause zu meiner Mami. Ich will zu meiner Mami.
Er zog die Rotze hoch.
Das Zucken in seinen Mundwinkeln wurde stärker. Er drückte von innen mit der Zunge fester dagegen an.
Ich werde hier abhauen. Einfach abhauen.
Mit beiden Händen griff er nach seiner Unterhose, die sich um seine Waden geschlungen hatte, und zog sie nach oben.
Dann gab er sich selbst einen Schwur, den er nie wieder vergessen wollte: Wenn ich groß bin und zu den Starken gehöre, werde ich nie, nie, nie Schwächere quälen. Ich schwöre es, ich schwöre es. Niemals werde ich Schwächere schikanieren. Ich schwöre es beim lieben Gott. Ich werde anders sein als die Kinder hier.
Er wischte sich die Tränen aus dem Gesicht, stand auf, zog seine Hose hoch und den Pulli herunter, den Boden wischte er mit Klopapier sauber. Dann ging er hinunter auf den Fußballplatz.
In den nächsten Monaten ging er Moppel aus dem Weg, so oft er nur konnte. Es gelang ihm nicht immer.
7. Paul
Eines Tages hatte sich Paul einen Revolver gekauft. Es war eine Schreckschusspistole, genauer gesagt, ein Trommelrevolver, ein tolles Stück, die RG 69 von Röhm. 30 Mark wollte der Junge aus der 9. Klasse dafür haben. Paul schrieb seiner Mutter einen Bettelbrief.
Jeder Junge hier im Heim hat ein Fahrrad. Nur ich nicht. Alle lachen mich deshalb aus. Ich will auch eins haben. Es gibt eines, das sogar billig ist. Gebraucht. Grün. Ein Fünfgangrad. Das gefällt mir sehr gut. Ein Kamerad aus der Karlschule zieht weg mit seiner Familie in die Berge. Da kann er sein Fahrrad nicht mehr gebrauchen, weil die Berge zu steil sind.
Brauchst Du wirklich ein Fahrrad? Der Weg zur Schule ist doch gar nicht so weit. Und weißt Du sicher, dass das Rad nicht gestohlen ist? Stell Dir mal vor, ich schicke Dir Geld, und das Fahrrad wird Dir wieder weggenommen. Sind die Eltern Deines Freundes mit dem Verkauf überhaupt einverstanden?
Liebe Mami, ich brauche 30 Mark. Sonst kann ich hier nicht länger bleiben. Jeder hier hat ein Fahrrad, nur ich nicht. Du hast immer gesagt, dass Du Dir für mich gute Kleider und gute Schuhe vom Mund abgespart hast. Damit die Leute nicht sehen, dass wir so wenig Geld haben. So ist das hier mit dem Fahrrad. Ich brauche es in einer Woche, sonst ist der Junge fortgezogen oder er hat es an jemand anderen verkauft. Davon abgesehen geht es mir gut. Ich lerne viel in der Schule. Die Briefmarken sind zu Ende. Vielleicht kannst Du mir noch ein paar schicken. Dein Sohn Paul.
Drei Tage später kam ein Brief mit 30 Mark und zwanzig Briefmarken. Am Tag darauf gehörte der Revolver ihm.
Nachts, wenn alle anderen Kinder schliefen, schlich er sich aus dem Schlafsaal. Die Pistole lag eingewickelt in absichtlich mit Scheiße verfärbten Unterhosen in seinem Wäschesack. Es gab keine Schlösser an den Türen, und es wurde gestohlen. Gern hätte er die Pistole Manfred gezeigt, sich mit dem Revolver wichtiggemacht, aber jedes Mal, wenn er ihn zur Seite nehmen wollte, zum Schrank führen und ihn in sein Geheimnis einweihen, überlegte er es sich anders. Stattdessen schlich er sich nachts aufs Klo, schraubte die Waffe auseinander, ölte sie, zeichnete sogar die Einzelteile ab, setzte sie wieder zusammen, zerlegte sie, baute sie erneut zusammen, bis er verstand, wie sie funktionierte.
Werkunterricht war das einzige Fach, in dem er wirklich gut war. Er formte Vasen aus Ton, und der alte Werklehrer Schimmel zeigte ihm, wie man die aufeinandergeschichteten Tonwülste richtig miteinander verband. Nicht so, nicht die Wülste mit den Fingern zusammenpressen, dann wird deine Vase nach oben immer dünner. Nimm etwas Ton vom oberen Ring und drücke ihn in die Naht. Erst in der Innenseite, dann außen. Genau so. Dem Lehrer gefiel das Interesse des Heimkindes an seinem Unterricht.
Paul fragte den Lehrer, wie eine Bohrmaschine funktionierte, Schimmel zeigte ihm, was er wusste – Holzbohrer, Metallbohrer, Schaft, Kopf, Drehmoment, Kühlschmiermittel. Als Paul wusste, wie es ging, stahl er sich in der großen Pause in den Werkraum, spannte das Rohr des Revolvers ins Backenfutter und bohrte den Lauf der Waffe auf. Nach der Schule rannte er den Schlossberg hinauf, lief, bis er keinen Menschen mehr sah, dann schoss er eine Platzpatrone ab und sah zufrieden, wie eine halbmeterlange Feuergarbe aus der Mündung fauchte.
Noch am gleichen Abend versteckte er die Waffe in einer Schuhkiste und vergrub sie auf der Heimwiese unter den Streuobstbäumen. Als handele es sich um die Schatzinsel, zeichnete er sich einen genauen Plan. Vom alten Apfelbaum fünf Schritte parallel zur Straße und dann noch einmal fünf Schritte nach links.
Das war sein Versteck.
8. Alexander
Alexanders Großeltern hatten das Haus in der Schubertstraße gebaut, parallel zur Haydnstraße und damit auch zum Waisenhaus. Die größte Straße des Viertels war, man konnte es sich denken, die Richard-Wagner-Straße.
Trotzdem, so dachte Alexander oft, haben all diese berühmten Komponistennamen weder auf mich noch auf Maximilian abgefärbt. Es war der Wunsch des Vaters gewesen, dass er mit sieben Jahren Klavierunterricht bekam, aber er hasste es von der ersten Stunde an und scheiterte bei der einfachsten Clementi-Sonate. Das Instrument war erbarmungslos und schenkte ihm nichts. Hinter jedem erlernten Akkord lag eine Schlacht, in der er den Tasten mühsam geringe Fortschritte abtrotzen musste.
Manchmal erschien der Vater beim Unterricht und hörte seinem Geklimper zu. Die rechte Hand sollte vom C zum F wechseln, und wieder griff er daneben. Der Vater schüttelte dann ganz leicht, so als sollte Alexander es nicht merken, den Kopf.
In der nächsten Woche weigerte sich der Bub, weiterzuspielen. Er saß mit verschränkten Armen vor dem Klavier der Mutter, sprach nicht und rührte sich nicht. Der Klavierlehrer, ein hektischer, großer, dünner Mann mit langen Armen, der sonntags hin und wieder in der Urbanskirche an der Orgel aushalf, ertrug die mangelnde Begabung leicht, verzweifelte aber an seiner Verstocktheit. Er rief die Mutter herein, die nachgab und ihm den Unterricht erließ.
Jeden Mittag außer montags, wenn er in seinem Klub aß, bog der Vater pünktlich um eins mit seinem schwarzen Mercedes in die Garageneinfahrt vor dem Haus. Maximilian rannte dann aus der Tür, nahm ihm die braune Aktentasche ab und trug sie stolz wie eine Eroberung ins Haus. Ebenso pünktlich servierte Frau Ebersbach, die im Haushalt arbeitete, seit Alexander denken konnte, das Essen.
Um den großen Tisch im Wohnzimmer saß jeder an seinem Platz: die Mutter am Kopfende, das Panoramafenster im Rücken, rechts neben ihr der Vater und daneben der Besuch, den er hin und wieder mitbrachte, meist Herrn Rieger, den Prokuristen der Firma. Neben dem Gast, der Mutter gegenüber, saß Maximilian, Frau Ebersbach an der Seite, immer bereit aufzuspringen und in die Küche zu laufen, wenn etwas fehlte. Dann Alexander.
Nach dem Essen trank die Mutter jeden Tag ein Glas Möselchen. Sie mochte keinen sauren Wein, und daher stellte Frau Ebersbach, wenn sie den Tisch deckte, immer eine kleine silberne Zuckerdose neben ihr Glas mit einem winzigen, handgefertigten silbernen Löffel darin. Damit füllte die Mutter einen Löffel Zucker in den Wein und rührte um, bis er sich auflöste.
Das Mittagessen war die Zeit der Ermahnungen: Alexander, nicht an der Stuhllehne ausruhen! Sitz aufrecht! Nimm die Unterarme vom Tisch! Wirf die Serviette nicht auf den Boden! Sei still! Kinder reden nur, wenn sie gefragt werden!
Sie wurden selten gefragt. Manchmal wollte der Vater etwas über Schule und Noten wissen. Maximilian drehte dann prompt auf, als würde sich irgendjemand wirklich dafür interessieren. Wenn Alexander gefragt wurde, sagte er etwas vorher Ausgedachtes. Meistens redeten die Erwachsenen am Tisch über die Firma. Es ging um die Blechschneidemaschinen, die in der Firma des Vaters hergestellt wurden. Wieder einmal hatte die Firma Ditzinger dem Vater einen Auftrag weggeschnappt. Herr Rieger mochte diese Firma gar nicht. Er schüttelte den Kopf hin und her und sagte, es ginge uns gut, wenn es nur die Firma Ditzinger nicht gäbe, die alles kaputt mache mit ihren Preisen. Der Vater redete auch gerne über die Kulturlosigkeit der Amerikaner, schimpfte über die Negermusik und die abstrakte Malerei, die die deutsche Kultur zerstörten.
Alexander langweilte sich und versank beim Mittagessen jedes Mal in innere Welten.
In der Schule las er unter der Schulbank die Bildergeschichten von Akim, dem Helden des Dschungels, Tarzanhefte und Ritterstorys von Sigurd. Er schwang sich von Liane zu Liane an der Seite von Akim, dessen Bildabenteuer in der Schule getauscht wurden und die er zu Hause verstecken musste. Er stellte sich vor, Akim sei sein bester Freund. Manchmal wollte er auch gerne Bodo sein, der Kumpel von Ritter Sigurd von Eckbertstein.
Das Träumen machte das Stillsitzen erträglich und Maximilians Wichtigtuerei auch. Wenn ihm der Stoff zum Träumen fehlte, versuchte er unter dem Tisch seinen älteren Bruder zu treten, aber es gelang ihm nur, wenn er weit auf dem Stuhl nach vorne rutschte, und das »Alexander, setz dich richtig hin!« der Mutter erfolgte meist, bevor er richtig ausholen konnte.
Das einzig Gute am Mittagessen war, dass die Mutter nicht rauchte. Nur während der Mahlzeiten sonderte sie nicht die kleine Rauchsäule ab, die morgens, tagsüber und am Abend neben ihr aufstieg. Lord Extra. Drei oder vier Schachteln pro Tag. Sie stank. Ihre Blusen und Kleider stanken nach Rauch, ihre Haare stanken nach Rauch, ihre Haut roch, und vor ihren Gutenachtküssen ekelte sich Alexander. Manchmal war er zu langsam, und es gelang ihm nicht, das Gesicht zur Seite zu drehen, dann hielt er die Luft an, bis es vorbei war. Die Mutter liebte ihren jüngsten Sohn, und dass er sich abwandte, wenn sie ihn küsste oder streichelte, war ihr schlimm. Sie begriff nicht, dass es an den Lord Extra lag. Sie dachte, ausgerechnet ihr Lieblingssohn wende sich von ihr ab, und verdoppelte ihre Anstrengungen wie eine abgelegte Geliebte. Ständig versuchte sie, den jüngsten Sohn in die Arme zu nehmen, seinen Kopf an die Brust zu drücken und ihn zu küssen. Alexander war wachsam, durchschaute ihre Absichten früh und ging ihr aus dem Weg.