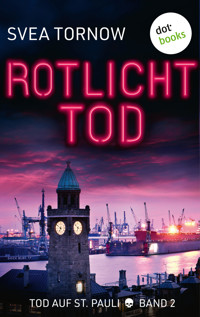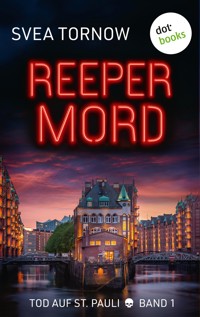
5,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Tod auf St. Pauli
- Sprache: Deutsch
Zwischen Neonlicht und Polizeisirenen: Der abgründige Hamburg-Krimi »Reepermord« von Svea Tornow jetzt als eBook bei dotbooks. Nackt, schön, tot: Der Duft von Fleurs Parfüm hängt noch schwer in der Luft des Hamburger Bordellzimmers, in dem Michelle ihre Kollegin regungslos vorfindet. Ihr Boss will den mysteriösen Todesfall lieber unter den Teppich kehren; zu unangenehm sind die Fragen, die er aufwirft. Michelle setzt hingegen alles daran, den Mörder ihrer Freundin ausfindig zu machen. Zusammen mit dem zuständigen Polizisten Paul begibt sie sich auf die Spur des Killers und kommt dabei einem unglaublichen Fall auf die Spur, der die Abgründe der menschlichen Seele offenbart. Ein lebensgefährliches Spiel mit dem Feuer beginnt … Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der fesselnde Hamburg-Krimi »Reepermord« von Svea Tornow ist der Auftakt ihrer »Tod auf St. Pauli«-Reihe und wird Fans von Simone Buchholz und Andreas Winkelmann begeistern. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 438
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über dieses Buch:
Nackt, schön, tot: Der Duft von Fleurs Parfüm hängt noch schwer in der Luft des Hamburger Bordellzimmers, in dem Michelle ihre Kollegin regungslos vorfindet. Ihr Boss will den mysteriösen Todesfall lieber unter den Teppich kehren; zu unangenehm sind die Fragen, die er aufwirft. Michelle setzt hingegen alles daran, den Mörder ihrer Freundin ausfindig zu machen. Zusammen mit dem zuständigen Polizisten Paul begibt sie sich auf die Spur des Killers und kommt dabei einem unglaublichen Fall auf die Spur, der die Abgründe der menschlichen Seele offenbart. Ein lebensgefährliches Spiel mit dem Feuer beginnt …
Über den Autor:
Svea Tornow studierte Amerikanistik und Psychologie. Sie jobbte auf drei verschiedenen Kontinenten, u.a. für ein internationales Modelabel. Heute arbeitet sie in einem Medienunternehmen. Hamburg kennt sie aus ihrer Studienzeit in allen seinen Facetten, von Reeperbahn bis Rathaus.
Bei dotbooks veröffentlichte Svea Tornow ihre »Tod auf St. Pauli«-Reihe, bestehend aus den Bänden »Reepermord« und »Rotlichttod«.
***
eBook-Neuausgabe Juni 2024
Dieses Buch erschien bereits 2015 unter dem Titel »eXXXit« bei LYX, Egmont Verlagsgesellschaften mbH
Copyright © der Originalausgabe 2014 Svea Tornow
Copyright © der Neuausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Montasser Medienagentur, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/Maksim Toome, Park Ji Sun, Tartila, Joris Photography
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (fe)
ISBN 978-3-98952-238-1
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Reepermord«an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Svea Tornow
Reepermord
Tod auf St. Pauli, Band 1
dotbooks.
Kapitel 1
Michelle kannte nur den Vornamen ihres Tanzpartners und wusste nicht einmal, welchen Beruf er ausübte. Aber das störte sie nicht. Er zahlte den üblichen Satz, da konnte sie genauso gut mit ihm tanzen gehen.
Für Michelle war es das erste Mal. Das erste Mal, dass jemand sie nicht für Sex bezahlte, sondern für ... ihre Gegenwart.
Paul war ein ausgezeichneter Tänzer. Letzte Woche hatte er beiläufig erwähnt, dass er gern in die neu eröffnete Salsa-Bar am Neuen Pferdemarkt gehen wollte ... aber mit wem?
Im Scherz hatte sie geantwortet: »Mit mir natürlich – ich hab sogar mal einen Salsa-Kurs gemacht.«
Sie hatte nicht damit gerechnet, dass er auf ihr Angebot eingehen würde. Oder doch? Warum sonst hätte sie den Vorschlag gemacht – diese Tür geöffnet? Michelle wusste ganz genau, dass man sich niemals privat mit Kunden einlassen sollte. Und bislang hatte sie sich immer an diese Regel gehalten. Aber Paul war ... anders.
Jedenfalls hatte er spontan gesagt: »Ja, gern! Nächsten Freitag um neun?« Und ohne auch nur zu zögern, hatte er hinzugefügt: »Keine Angst – es ist kein Date. Ich bezahle dich für deine Zeit, genau wie immer.«
Es war kein Date, aber es machte Spaß. Paul war ein guter Tänzer, und der DJ wusste, was er tat. Neun Uhr war zu früh für das Partyvolk, aber die neue Location hatte sich offenbar in der Salsa-Szene bereits herumgesprochen. Etwa zehn weitere Paare wirbelten um sie herum. Hier trug niemand hochhackige Schuhe oder Angeber-Jacketts – die Leute waren zum Tanzen hier, mit ihrem Partner oder Tanzpartner, sie verloren sich in der Musik. Die meisten Männer waren dunkelhäutig; Charaktergesichter von Kerlen, die hart arbeiten mussten, um über die Runden zu kommen. Aber im schnellen Rhythmus des Tanzes, im flackernden Stroboskoplicht, mischten sich die fröhlich bunten Kleider der Frauen und die flirrenden Melodien aus Südamerika zu einem halluzinogenen Kaleidoskop. In der Luft lag die Freude an der Musik, am Tanz, am Leben. Dazu kam der Duft nach Limetten, Rum und Rohrzucker. Der Barkeeper kam kaum nach mit Mojitos und Cuba Libres. Ab und zu steckten typische Pistengänger die Köpfe zur Tür herein, verschwanden aber schnell wieder. Hier wurde heute kein Pop gespielt, hier waren nicht die bekannten Hits zu hören. Die Musik war ebenso eigenwillig wie verzaubernd – wer dem atemlosen Salsa-Takt einmal verfallen war, kam davon nie wieder los.
Michelle hatte keine Ahnung, wovon die Texte der Lieder handelten. Sicher waren sie nicht so fröhlich, wie sie klangen. Die Songs kamen aus einigen der ärmsten Gegenden der Welt.
Paul wirbelte sie über den Betonboden, fing sie auf, schob sie fort, hielt sie fest. Er zog sie dicht an seine Brust, ließ sie dann von sich schnellen wie ein Jojo. Sie musste nichts tun, außer die Füße im rasanten Takt aufzusetzen, er führte souverän. Bei ihm fühlte sie sich sicher, federleicht, und eine unbefangene Fröhlichkeit, die sie lange nicht mehr verspürt hatte, ergriff von ihr Besitz. »Ich hab heut Nachtschicht, muss um halb elf los«, hatte er gleich zu Anfang angekündigt, als sie an der Bar standen.
Auch Michelle musste noch arbeiten. Doch jetzt, für eine kurze, unerwartete Stunde, gab sie sich dem Moment hin, den Lichtern und der Musik. Sie durfte bloß nicht anfangen, etwas für Paul zu empfinden. Nur für den Bruchteil einer Sekunde lächelte sie ihn an. Unmöglich zu sagen, ob er es sehen konnte, so schnell drehten sie sich umeinander. Michelle genoss den Augenblick. Sie dachte nicht weiter darüber nach, weil sie es nicht wahrhaben wollte, schon gar nicht im Zusammenhang mit einem Kunden, aber sie war glücklich.
Kapitel 2
Michelle war die Einzige im Pretty Woman, die unrasiert war. Landing Strips, Brazilian, Hollywood Cut, Pfeile, Triangles, verspielte Schmetterlinge, der typische europäische Puschel auf dem Venushügel, alles im Überangebot. Aber den guten, alten Busch, den gab es nur bei ihr. Das war gar nicht schlecht im Sinne von Angebot und Nachfrage, weil sie etwas zu bieten hatte, was es bei den anderen nicht gab. Vor allem aber ermöglichte die Nicht-Rasur ihr eine gezielte Definition des Kundensegments. Ihre Männer waren älter, gesettled, grundanständig. Die wollten keine Sperenzchen, die wollten nur mal wieder ordentlich vögeln.
Manche dieser Typen hatten einen Bauch und andere Mundgeruch, aber das war allemal besser als ständig Analverkehr.
Der Kerl über ihr war deutscher Durchschnitt. Nicht zu groß, nicht zu klein, nicht wirklich selbstsicher, aber auch keiner, der im Bett den Rambo machen musste. Bisschen übergewichtig, aber ging noch. Jeansjacke, Karohemd, Baseballmütze, Kordhose, Boxershorts, Fußbettschuhe.
Im Pretty Woman reichte das Angebot von/bis, und sie war da für das »von«: angstfreier Blümchensex mit dem freundlichen Mädchen von nebenan. Schulterlanges, leicht gewelltes honigblondes Haar, ein natürliches Lächeln. Kein Make-up. Jetzt im Sommer trug sie High Heels, Hotpants und karierte ärmellose Tops – in dem Outfit könnte sie jede Gartenparty in der Stadt crashen, und keiner würde sich beschweren. Im Winter sah man Michelle in Thermohosen und einem Daunenblouson von Napapijri. Der Marketingaufwand lohnte sich, ihre Zielgruppe suchte Geborgenheit. Sie hatte in den wenigen BWL-Vorlesungen, die sie besucht hatte, gut genug aufgepasst, um sich von Anfang an geschickt zu positionieren: grundsolide, eine sichere Sache, der VW Golf unter den Mädchen für eine Nacht.
»Ja, Baby, ja – genau so, gib’s mir, du bist so gut!«, murmelte sie, ohne bei der Sache zu sein.
Kapitel 3
»Fuckscheiße!«
Gordons Lieblingswort. Es konnte alles bedeuten, von Desinteresse bis zu heller Begeisterung. In diesem Fall war es ein Ausdruck seiner Unzufriedenheit.
»Sieh dir das an! Das geht so nicht!« Vorwurfsvoll deutete er auf die nackte Fleur.
Gordon trug ein Daft-Punk-T-Shirt, vintage vom ersten Album, obwohl er vermutlich gar nicht wusste, was er da für ein Sammlerstück anhatte. Darüber eine Lederjacke. Der Hosenboden seiner Levi’s hing tief, dazu weiße Socken und Adidas.
Michelle stand in ihrem Bademantel neben ihm und starrte die Tote an. Sie hatte bei ihrer Freundin geklopft, um ein wenig zu plaudern. Dann war sie ins Zimmer nebenan zurückgekehrt und hatte Gordon gerufen. Ganz ruhig, ohne etwas zu fühlen. Sie fühlte noch immer nichts, außer ihrem zu raschen Herzschlag.
Fleur lag mit offenen Augen auf dem Bett. Der Radiowecker auf dem Nachttisch spielte leise Radio Hamburg: »... lange nicht gehört: Angel von Robbie Williams!«, freute sich der Moderator.
Lange Wimpern berührten fein gezupfte Augenbrauen. Die Nase war seit einer Operation im letzten Jahr von unmerklich irritierender Gleichmäßigkeit.
Auf Fleurs Lippen war noch ein Rest des Lippenstifts zu ahnen, überraschendes Dunkelblau mit einem Stich ins Violette. Ein Hauch ihres Parfüms lag in der Luft.
Ihre kleinen Brüste ragten wie makellose Pfirsiche auf, die Brustwarzen von einem faszinierend dunklen Braun. Der Torso der jungen Thailänderin war knabenhaft schlank und wirkte biegsam wie der einer Tänzerin. Deutlich zeichneten sich ihre unteren Rippen und das Becken unter der Haut ab, ohne dass sie knochig gewirkt hätte. Um diese zeitlose Schönheit hatte Michelle Fleur vom ersten Tag an beneidet.
Ihr Körper war zart und elfenhaft wie der einer Puppe oder eines Models. Nur der linke Knöchel war nach einem Brandunfall auf der Innenseite mit knotigem Narbengewebe überzogen. Die Haut spannte sich an dieser Stelle so straff, dass sie fast durchsichtig wirkte. Und hinter ihrem rechten Ohr, in dieser Position nicht sichtbar, hatte Fleur eine geschwungene Tätowierung – den stilisierten Flügel eines Phönix, der sich aus der Asche erhebt. Weil sie in ihrem kurzen Leben bereits so viel durchgemacht und überstanden hatte und trotz allem fest daran glaubte, dass eine goldene Zukunft auf sie wartete.
Doch da hatte sie sich geirrt. Denn Fleur atmete nicht mehr.
Michelle war wie betäubt. Wusste nicht, was sie tun sollte.
Sie bemerkte einen eigenartigen Geschmack in ihrem Mund. Ein ganz leichter Hauch nur. Metallisch. Als hätte ihr jemand im Schlaf eine Centmünze unter die Zunge geschoben. Absurd.
Plötzlich verspürte Michelle den eigenartigen Drang zu lachen, obwohl an der Situation nun wirklich nichts komisch war.
Gordon neben ihr schien sich wie im Zeitraffer zu bewegen, auch der Radiomoderator hörte sich an wie Micky Maus. Wie war es ihr eigentlich eben gelungen, Fleurs Zimmer zu verlassen und ihren Boss zu verständigen? Sie konnte sich nicht erinnern. Sie konnte sich auch nicht daran erinnern, wann sie Fleur das letzte Mal lebend gesehen hatte. Worüber sie gesprochen hatten. An die letzten Worte, die ihre Freundin zu ihr gesagt hatte. Sie konnte sich nicht erinnern, sie konnte ...
Sie starrte Fleurs Mund an.
Ihre Freundin war tot. Was hatte sie zuletzt zu ihr gesagt?
Michelle schloss die Augen und versuchte zurückzudenken. Wann hatte sie ... wo ... wann ... was hatte sie ...
Dann riss sie die Augen wieder auf. Mit einem Mal schienen die Reize auf sie einzustürzen. Farben. Licht. Töne. Bewegung.
Fleur war tot.
Nein, Fleur war nicht einfach tot, sie war ermordet worden. Vielleicht absichtlich, vielleicht unabsichtlich – ihr Job war nicht ungefährlich, das war auch Michelle klar. Aber Fleur war viel zu jung gewesen, um einfach so zu sterben.
»Wir müssen die Polizei ...«, setzte sie an. Ihre Stimme klang unsicher.
Im selben Moment sagte Gordon: »Ich kenne jemanden, der bringt ...«
Sie starrten einander an.
»Nein, nein, nein!« Gordon schüttelte den Kopf. »Das ist ganz schlecht fürs ...«, aber Michelle ließ ihn nicht ausreden.
»Polizei«, sagte sie. Diesmal lag Entschlossenheit in ihrer Stimme.
Gordon stöhnte genervt. Dann zog er ein platt gesessenes Tütchen Koks aus einer Gesäßtasche, wischte es von beiden Seiten am T-Shirt ab, vermutlich um seine Fingerabdrücke zu entfernen, und ließ es in die geöffnete Nachttischschublade fallen. »So haben die Bullen wenigstens ein bisschen Spaß. Vielleicht sehen sie die Sache dann etwas lockerer.«
Michelle biss die Zähne zusammen. Sie konnte Gordons Misstrauen verstehen. Auch sie war keine große Anhängerin offizieller Vorgehensweisen. Aber sie war es Fleur schuldig. Wenigstens das.
Möglicherweise hatte der Täter Fleur nicht als junge Frau gesehen, die den Großteil ihres Lebens noch vor sich hatte – sondern als Ware, die kaputt gegangen war. Und dann hatte er sie im Laden liegen gelassen, in der Hoffnung, die Geschäftsführung würde schon sauber machen. Polizei und Skandale waren schlecht fürs Geschäft.
Krank, aber von einer gewissen Logik. Sie selbst zog andere Männer an als die exotische Fleur. Mit ihren biederen Freiern hatte sie noch nie wirklich beängstigende Momente erleben müssen. Aber die Kerle, die auf ein zartes Thaigirl standen, waren ein anderes Kaliber.
Michelle konnte sich einfach nicht vorstellen, dass irgendwer Fleur absichtlich getötet hatte. Warum? Aber andererseits ... es waren keine Würgemale zu sehen, keine Kampfspuren, keine Hinweise auf schiefgelaufene Sadomaso-Experimente.
»Was noch?« Gordon sah sich um. Wütend stapfte er ins Bad. »Fuckscheiße!«, grummelte er wieder und kam mit einem benutzten Handtuch zurück. In der anderen Hand hielt er einen kleinen grünen Mülleimer. Michelle hatte genau so einen, nur in Blau. »Da, nimm.« Er hielt ihr die Sachen hin, unwillkürlich griff sie zu. Auf dem Boden des Mülleimers lagen zwei benutzte Kondome.
»Du hast nichts gesehen. Niemand hat was gesehen. Nur ich, klar?« Gordon zuckte einmal mit dem Kinn, um ihr zu bedeuten, das Zimmer zu verlassen, dann ging er selbst hinaus und ließ sie einfach stehen.
Michelle schüttelte den Kopf. Der würde sich schon wieder einkriegen. Wortlos stellte sie den Mülleimer wieder zurück ins Bad. Da drin waren wichtige Spuren für die Ermittler. Sie würde nicht zulassen, dass der Mord an Fleur unter den Teppich gekehrt wurde.
Auf keinen Fall.
Was, wenn es sich um die Tat eines durchgedrehten Kunden handelte? Vielleicht würde er wiederkommen.
Sie mussten die Polizei rufen und bei den Ermittlungen unterstützen. Egal, wie Gordon es fand. Da musste er durch. Er würde es überleben.
Im Gegensatz zu ...
Sie warf einen letzten Blick auf Fleur. Ihr aufklaffender Mund, ihre glatt rasierte Scham. Die nackte Unschuld. Ihre Augen, dunkel wie schwarze Murmeln, waren im Tod milchig geworden, wie von Frost überzogen.
Unwillkürlich berührte Michelle die Stelle hinter ihrem rechten Ohr, wo sie dieselbe Tätowierung trug wie Fleur.
Kapitel 4
Im Flur stand Mina-Cheyenne mit ihrem vierjährigen Sohn Raven. »Er kann nicht schlafen, er hat ein bisschen Fieber«, sagte sie verzweifelt. »Eigentlich sollte er heute bei seinem Vater sein, aber der ist nicht gekommen.«
Mina-Cheyenne brauchte das Geld noch viel nötiger als Michelle. Ravens Vater war ein arbeitsloser Gitarrist, der sich so wenig wie möglich um seinen Sohn kümmerte. Michelle hatte ihn einmal kennengelernt und konnte verstehen, was ihre Kollegin an ihm gefunden hatte. Er war charmant, unzuverlässig und unbekümmert, wie es nur Kleinkinder und Musiker sein können.
»Komm mit«, sagte Michelle und nahm Ravens Hand. Sie wunderte sich, wie normal ihre Stimme klang. Erstaunlich, zu was der Mensch fähig ist, wenn es sein muss. Der Junge trug einen Schlafanzug mit »Star Wars«-Motiv. »Soll ich dir was vorlesen?«
Raven nickte. Michelle hatte selbst keine Kinder, aber sogar sie konnte sehen, wie übermüdet er war.
»Seine Sachen sind in Steffis Zimmer, wir haben auch ein paar Bücher mitgebracht«, sagte Mina-Cheyenne, während sie schon rückwärts Richtung Treppe lief. Sie trug Hotpants, weiße Turnschuhe, ein transparentes Top und einen neonpinken BH darunter. Ihr Haar war zwei Drittel blond, ein Drittel violett. »Danke, danke, danke, du bist wirklich ein Schatz!« Sie verschwand um die Ecke.
Brav ging Raven neben Michelle her. Steffis Zimmer befand sich am Ende des Gangs, es war das ruhigste von allen im Pretty Woman. Michelle fragte sich, wer darauf gekommen war, den Jungen Raven zu nennen – mit seinen weichen, freundlichen Zügen, den kinnlangen blonden Locken und Pausbacken sah er eher nach Rauschgoldengel als nach Rabe aus.
»Hier, willst du dich hinlegen?«, fragte sie und klopfte auf das Bett. Neben dem Kopfkissen lagen zwei Stofftiere, ein Hund und eine Katze.
Sie deutete auf die beiden Tiere. »Sind die beiden Freunde?«, fragte sie.
Raven nickte ernst. »Die besten«, sagte er. »Die allerbesten.« Dann zog er seine Hausschuhe aus und schlüpfte unter die Decke. »Bärenstern«, sagte er.
»Bärenstern?«
Raven nickte. »Bärenstern!«
Michelle griff nach einem kleinen Rucksack mit einem Piratenkopf auf der Klappe, der neben dem Bett stand. Darin steckten Ravens Klamotten, außerdem ein Raumschiff aus Legosteinen und zwei Bücher. Eines handelte von Piloten, in dem anderen suchten ein Bär und seine Freunde den Abendstern.
Sie hielt das Buch hoch. Raven nickte erneut. »Bärenstern.« Zufrieden schloss er die Augen. Ein Lächeln erhellte sein Gesicht. Glücklicherweise verstand Raven noch nicht, wo er war – er machte einfach nur die Erfahrung, dass seine Mutter und ihre Freundinnen sich gut um ihn kümmerten, wenn es ihm schlecht ging.
Mit sanfter Stimme begann Michelle vorzulesen. Sie fragte sich, ob ihr jemals jemand vorgelesen hatte. Aber sie konnte sich nicht erinnern. Ihr Vater ... sie hatte alle Erinnerungen an ihren Vater verdrängt. Und ihre Mutter ... irgendwann bestimmt einmal.
»... und schließlich saßen die Tiere des Waldes dicht aneinandergekuschelt auf der Lichtung und sahen hinauf zu den Sternen. Und einer von ihnen strahlte ganz besonders hell und beschützte sie. Er nahm ihnen die Angst und machte ihnen Mut. Und so schliefen sie ein und träumten von all den schönen Dingen, die sie am nächsten Tag miteinander unternehmen würden.«
Michelle klappte das Buch zu. Raven atmete ruhig und tief. Er war eingeschlafen.
Sie würde nie wieder mit Fleur unter dem Sternenhimmel sitzen und von der Zukunft träumen.
Wann kam endlich die Polizei?
Kapitel 5
»Ich hab Fleurs Zimmer abgeschlossen, aber ansonsten geht alles seinen Gang«, sagte Gordon. »Die anderen wissen noch gar nichts.«
Michelle presste die Lippen aufeinander. Es hatte gutgetan, Raven vorzulesen, aber jetzt traf die Realität sie wieder mit voller Wucht. Sie ließ sich auf ihre Bettkante sinken und starrte gegen die Tür. Nicht mal ihr Handy hatte sie, um sich abzulenken.
»Verdammte Fuckscheiße«, sagte Gordon noch einmal. Aber es klang müde und nicht so, als wäre er noch ernsthaft empört. Ausnahmsweise traf sein Spruch die Sachlage ja sogar perfekt.
Er ging. Sie musste unbedingt den Geschmack dieser Nacht aus dem Mund bekommen. Im Nachttisch lagen noch ein paar alte Zigaretten. Michelle trat an das gekippte Fenster. Drei Züge lang half das, dann begann sie zu husten und schmiss die noch brennende Kippe nach draußen. Ein Funkenbogen stob durch die Nacht, unbemerkt im Neonfeuerwerk der Reeperbahn.
Als sie die Augen zusammenkniff, weil der Hustenanfall schlimmer wurde, spürte sie das Brennen der Tränen. Schnell schlang sie die Arme um sich selbst, kniff fest in ihre Oberarme. Der Schmerz vertrieb die Trauer.
Das Schlimme am Weinen waren nicht die Tränen, sondern das Gefühl zu ersticken. Deshalb hatte sie vor vierzehn Jahren für immer aufgehört zu weinen. Und sie würde jetzt nicht wieder damit anfangen. Ganz sicher nicht.
Verdammt! Sie war wütend auf sich, wütend auf Fleur – dass die sie auch einfach so im Stich gelassen hatte. Wütend auf alle.
Kapitel 6
Paul Hinnerken und Svenja Meißen betrachteten die nackte Frau, die ausgestreckt auf einem Bett im dritten Stock des Hamburger Bordells Pretty Woman lag.
Meißen seufzte und schüttelte den Kopf. »Was für Männer kommen nur hierher?«, fragte sie ihren Partner, während sie Fotos mit der digitalen Spiegelreflexkamera schoss, die um ihren Hals hing – Fotos von vorne, von der Seite, aus jedem nur denkbaren Winkel.
Schamlos, dachte Hinnerken, obwohl ihm klar war, dass Meißen nur ihre Arbeit tat. Und zwar sehr gut und gründlich.
Er wusste, im Verlauf der Ermittlungen würde er dankbar sein für ihre Aufnahmen. Aber jetzt ...
Und dann auch noch diese Bemerkung. Ganz normale Männer kamen hierher. Männer wie er.
»Und was muss im Leben einer Frau geschehen sein, damit sie hier arbeitet?«, fuhr Meißen fort, während sie sich hinkniete und unter das Bett sah. Dann machte sie von den Staubmäusen ein Foto. »Ich weiß, Sex gehört zum Leben, und in der Großstadt ist es ein Business wie alle anderen auch. Aber trotzdem.«
Sie richtete sich auf und zuckte ratlos mit den Schultern.
Eine einfache Energiesparbirne tauchte das Zimmer in bläulich kaltes Licht. Das Bett war ein Prunkstück. Massivholz, deutsche Buche, handgewachst, Überbreite. Durchaus einladend. Auf dem Nachttisch stand eine Digitaluhr mit Weck- und Projektionsfunktion sowie integriertem iPod-Dock, davor lag der rote Drücker für Notfälle. Die Schublade unter der Tischplatte war nicht ganz geschlossen. Der Radiowecker auf dem Nachttisch spielte leise Reamonns »Supergirl«. Das Display zeigte 01:34. So spät nachts war Hinnerken noch nie hier gewesen.
Unter dem Bett standen Hausschuhe ordentlich nebeneinander. Das flauschige Rosa biss sich mit dem Dunkelrot des Vorhangs.
Die Scham der Frau war glatt rasiert, sie hatte die Beine gespreizt. Ihre Arme lagen seitlich neben dem Körper, die Handflächen nach oben gerichtet, die Finger leicht gekrümmt. Auch die Achselhöhlen waren sorgfältig enthaart, ebenso die Beine. Die Spitzen der schillernd blau lackierten Nägel zeigten zur Zimmerdecke. Ein kleines weißes Blümchen klebte auf dem rechten großen Zehennagel.
Hinnerken presste die Lippen aufeinander. Er hatte nichts Verbotenes getan. Er kannte die Frau auf dem Bett nicht. Vielleicht hatte er sie einmal gesehen, zufällig im Flur. Wenn überhaupt. Aber wahrscheinlich nicht.
Also kein Interessenskonflikt. Ganz klar.
Meißen ging ins Badezimmer und fotografierte weiter. Duschkabine, Toilette, Waschbecken, Spiegel. In der Ecke stand ein kleiner grüner Mülleimer. Das Bad war weiß gefliest und in gutem Zustand, die Fugen hell.
Auf einem rechteckigen Hocker neben der Duschkabine lagen mehrere gestreifte Handtücher, ordentlich gefaltet. Neben dem Waschbecken hingen zwei kleinere Handtücher auf dem Handtuchhalter, ebenfalls gestreift, aber aus einer anderen Serie. Ein großes Handtuch war nach der Benutzung achtlos auf den Boden vor der Duschkabine geworfen worden.
Ein trockenes, leicht rissiges Stück Seife fand sich auf der Ablage des Waschbeckens. Es gab kein Bord unterhalb des Spiegels, obwohl Löcher in die Fliesen gebohrt worden waren, in denen rote Dübel steckten. Ein kleiner rechteckiger Kosmetikspiegel stand hochkant an die Wand gelehnt hinter dem Wasserhahn.
Hinnerken hatte nie hier geduscht, und er ging davon aus, dass es auch keiner der übrigen Kunden tat. Ein Puff war schließlich kein Sportclub.
»Können Sie die Tote identifizieren?«, fragte Hinnerken den Mann, der abwartend in der Tür stand.
»Was?«, fragte der.
»Wissen Sie, wie sie heißt?« Der Polizist deutete auf die Frau auf dem Bett.
»Na logo. Das ist Fleur. Aus Thailand, wenn Sie wissen, was ich meine!«, posaunte der Mann und zog gleichzeitig die Nase und seine zu tief hängende Hose hoch.
»Nein, ich weiß nicht, was Sie damit meinen«, schnappte Hinnerken verärgert, während Meißen hinter ihm unaufhörlich klick-, klick-, klickte. »Wenn Sie mich bitte aufklären würden?«
Tolle Wortwahl, dachte er. Aber außer ihm merkte es keiner.
»Das weiß doch jeder. Die Thaimädchen, die haben’s drauf. Alles, meine ich. Und sie sind schön eng. Weil sie so klein sind. Da stehen viele drauf. Gerade Männer, denen man es nicht ansieht.«
Er zwinkerte Paul Hinnerken zu.
Scheiße, dachte der Kommissar der Mordkommission. Der erinnert sich an mich.
Oder?
Kapitel 7
Unsere Leben sind keine Geraden, die sich mit mathematischer Genauigkeit von der Geburt bis zum Tod durch Raum und Zeit erstrecken. Nein, unsere Lebensläufe gleichen wilden Kritzeleien. Linien laufen im spitzesten Winkel aufeinander zu, von außen betrachtet kann man schon ahnen, was gleich passiert. Doch dann schießt eine weitere Lebenslinie scheinbar aus dem Nichts heran, durchschneidet gleißend die beiden anderen, die gerade im Begriff standen, zu einer dickeren Linie zu verschmelzen, reißt eine mit sich davon, lässt die andere zurück ...
Rückblickend mag manches im Leben uns unausweichlich erscheinen. Doch auch wenn wir dann denken, wir hätten es besser wissen müssen, in Wahrheit taumeln wir alle nur orientierungslos durch das Dunkel. Es ist nun einmal unmöglich, in die Zukunft zu schauen.
Sieht man genau hin, so scheinen sich die meisten Linien irgendwann mit anderen zu vereinigen, zu umschlingen, zu verknoten, um dann gemeinsam, als wäre ihr Gewicht zu groß geworden für die bisherigen Flugbahnen, in die Tiefe zu sinken. Mal fällt der dicke gemeinsame Strich steil ab, mal vollzieht sich die Bewegung langsam, dennoch unaufhaltsam. Manchmal lösen sich zwei Lebenslinien wieder voneinander, doch wenn sie das tun, so hebt sich meist nur eine von ihnen wieder in die Höhe, oft mitgerissen von einer weiteren, die sie magnetisch angezogen zu haben scheint. Alles auf Anfang, auch das kommt vor.
Das Schlimmste aber, was man auf einem derartigen Abbild unserer Lebenslinien entdecken kann, das Traurigste, sind die kurzen Linien, die nur wenige Jahre repräsentieren, vielleicht fünf oder nur drei. Linien, die so kurz sind, dass sie Punkten gleichen, die wenige Monate, Wochen oder Tage markieren. Ein Hauch von Leben, das viel zu früh zu Sternenstaub zerfiel.
Und genauso furchtbar ist das brutale Zusammentreffen von Linien, die wie mit dickem Filzer hingeschmierte Graffiti aussehen – eine Linie zuckt kurz in Richtung einer anderen, die am Berührungspunkt endet, für immer.
Der gewaltsame Tod.
Kapitel 8
Michelle kannte die Stimme im Flur.
»Bitte erstellen Sie eine Liste aller Personen, die sich in den letzten zwölf Stunden im Gebäude aufgehalten haben.«
Ihre Tür war nur angelehnt. Nebenan war inzwischen offenbar die Polizei bei der Arbeit.
Die Stimme klang streng, anders als sonst.
Michelle schlich zur Tür.
Wessen Stimme war das? Woher kannte sie sie?
Ein kalter Luftzug fuhr durch den Spalt, als sie den Griff packte und die Tür ein wenig weiter aufzog. Sie presste ihr Gesicht an den Türrahmen.
Im Pretty Woman war Wegschauen meist besser als Hinsehen. Darin glichen sich der Puff, der Kiez, die Stadt.
Drei Personen standen im Flur. Ein Polizist, eine Polizistin, Gordon. Die Polizistin hatte eine Kamera in der Hand und knipste den Flur. Erst von Michelle weg, Richtung Treppe. Dann drehte sie sich um. Michelle zuckte zurück. Auf einem hochauflösenden Digitalbild wäre sicher zu sehen, dass sie durch den Spalt spähte. Sie wagte es jedoch nicht, die Tür zu schließen, aus Angst, durch die Bewegung auf sich aufmerksam zu machen. Es blitzte. Einmal. Zweimal. Pause, dann noch mal, aber jetzt weniger hell.
Michelle beugte sich wieder vor.
Die Polizistin mit der Kamera hatte schulterlange blonde Haare, zu zwei Zöpfen geflochten, die unter ihrer Mütze hervorhingen.
Gordon deutete jetzt in Michelles Richtung.
Der zweite Polizist drehte sich um.
Es war seine Stimme gewesen, die sie erkannt hatte.
Sie wusste, wer dieser Mann war.
Paul.
Gerade waren sie Salsa tanzen gewesen. Er gehörte zu ihren regelmäßigen Kunden.
Allerdings hatte sie nicht gewusst, dass er Polizist ist.
Verdammt! Was jetzt?
Ihre Gedanken wirbelten durcheinander. Würde er gründlicher ermitteln, weil er selbst Kunde hier war? Oder erst recht versuchen, die Sache schnell abzuwickeln, um nicht selbst ins Zwielicht zu geraten?
Würde er sie verhören? Und wenn ja, was sollte sie am besten sagen?
Kapitel 9
Dorothea Hagen trat auf das Gaspedal ihres Siebeners. Wagner dröhnte aus den Lautsprechern und ließ die Innenverkleidung des Batmobils beben.
Die Vorstandsvorsitzende der Deutschen Versicherungs-AG brauchte für die Strecke Hamburg–Potsdam regelmäßig unter zwei Stunden. Aber heute stand sie kurz davor, ihren eigenen Rekord zu brechen.
Sie war high wie nie.
Rote Locken gaben ihrer blassen Haut mit den zahlreichen zarten Sommersprossen, die sie schon als Kind gehasst hatte, einen strahlenden Rahmen. Ihre Lippen waren schmal, das grelle Rot des Lippenstifts biss sich mit ihrer Haarfarbe, aber einer Frau ihres Kalibers konnte das egal sein. Die Zähne waren von einem unnatürlich strahlenden Weiß. Und wenn sie die zeigte, dann war es zu spät.
Sie war stolz darauf, auch mit Anfang fünfzig noch Röcke tragen zu können, in denen Frauen, die halb so alt waren wie sie, nur peinlich aussahen. Dass ihr Rock von Chanel war, die Strümpfe von Agent Provocateur, ihre Unterwäsche von Lise Charmel und dass ihr Busen mittlerweile mehr gekostet hatte als ein Mittelklassewagen, schadete ihrem Selbstbewusstsein nicht.
Dorothea Hagen hatte über den Abend verteilt reichlich Kokain zu sich genommen, dessen Wirkung nun langsam nachließ. Als viel prickelnder empfand sie jedoch die Wirkung des körpereigenen Adrenalins. Die war um Längen besser als jede andere Droge, aber leider nur zu erarbeiten, nicht zu kaufen. Hätte einer ihrer Ärzte oder Dealer etwas entsprechendes im Angebot – sie hätte ihn längst zum Millionär gemacht. Schade, wirklich schade.
Hagen trug ein kurzes, schwarzes, recht konservatives Kleid und eine Kette aus schwarzen hawaiianischen Perlen. Ein Geschenk ihres Mannes, ebenso wie die preislich vergleichbare Platin-Rolex. Das Kribbeln zwischen ihren Beinen nahm langsam ab, und sie genoss jede Sekunde, die es noch anhielt.
Sie beschleunigte und blendete auf, denn weiter vorne war auf der linken Spur ein Hindernis aufgetaucht. Dass sie noch nie im Leben Angst empfunden hatte, betrachtete sie als Stärke, nicht als psychologischen Defekt.
Während sich die Walküren in Hysterie steigerten, war ihr, als erfüllte das gierige Vibrieren des Motors ihren ganzen Körper. Solange sie sich zurückerinnern konnte, hatte sie immer das Gefühl gehabt, auf Hochtouren zu laufen. Dorothea Hagen kannte nur »Vollgas« oder »Aus«. Beinahe hätte sie den braunen Audi touchiert, der dann im letzten Augenblick nach rechts zog. Die Bahn vor ihr war frei, und sie blieb auf der linken Spur, wo sie hingehörte.
Dorotheas schmale, eisgraue Augen huschten zur Digitalanzeige auf dem Armaturenbrett. Vor etwas mehr als einer Stunde hatte sie eine Frau getötet. Und jetzt war sie schon an der Abfahrt Schwerin vorbei.
Es war mit Abstand das Geilste, was sie je erlebt hatte.
Selbst Dorothea Hagen wusste, sie sollte Abscheu vor den Gefühlen empfinden, die sie erfüllten. Aber das wäre verlogen. Und wenn sie eines war, dann ehrlich zu sich selbst. Zudem gab es keinen Grund zur Scham. Die Schlampe hatte es verdient.
Das Einzige, was ihr Sorgen bereitete, war Torben. Er war schwach. Doch wenn er sie ansah, hatte sie dieses eigenartige, fast ein wenig unheimliche Gefühl, geliebt zu werden. Zum ersten Mal in ihrem Leben.
Es war ein Risiko, aber seit sie dieses Gefühl kennengelernt hatte, wollte sie auf keinen Fall mehr darauf verzichten.
Sie setzte ihr gewinnendstes Lächeln auf, da blitzte auch schon die Radarfalle. Sie lebte in Berlin, ihr Lover in Hamburg, sie fuhr diese Strecke im Schlaf.
Kapitel 10
Paul Hinnerken war nie zuvor in diesem Zimmer gewesen. Aber schon öfter in einem der anderen. Hatte dieser dicke Manager ihn erkannt? Sah nicht so aus. Oder es kümmerte ihn nicht. Vielleicht würde er ihm auch später noch die Rechnung präsentieren. Er würde es abwarten müssen.
Michelle wusste es natürlich – er würde entscheiden müssen, ob ihre »Beziehung«, wenn man es so nennen konnte, einen Interessenskonflikt bei der Befragung darstellte.
Im Zweifelsfall würde er sich eine gute Begründung einfallen lassen müssen, die Wahrheit war in dieser Hinsicht wenig hilfreich. Ich bin eben manchmal einsam, seit meine Frau nach Spanien zurückgegangen ist ... So machohafte Sprüche die Kollegen auch spuckten, dafür hätten sie bestimmt kein Verständnis. Das würden sie ihn nie vergessen lassen. Dabei fand er einen Besuch im Puff ehrlicher, als irgendwem in der Disco drei Cocktails auszugeben, und der Deal war im Grunde genauso klar.
Meißen hatte alles dokumentiert, als wollte sie ihre Fotoreportage einem Wochenmagazin anbieten. Aber seine Erfahrung war, dass Fotos und Videos dem Tatort nie gerecht wurden. Je genauer und umfangreicher das Bildmaterial, desto schneller ließ man sich vom Wesentlichen ablenken: dem Grauen, das in die Welt gekommen war. Dem absolut Bösen, das Gestalt angenommen hatte. Wie eine tiefschwarze Wolke, die sich an einem der wenigen wirklich warmen Sommertage in der Hansestadt unerwartet vor die Sonne schiebt. Man sieht sie nicht kommen, und wenn man schließlich aufschaut, ist es eiskalt und regnet.
Wenn er oder seine Kollegen gerufen wurden, war es jedes Mal bereits zu spät, das war sein Job, doch diese Last zu tragen fiel ihm zunehmend schwerer. Er war Mitte vierzig, aber an manchen Tagen hatte er das Gefühl, selbst nur noch von Tiefschwarz erfüllt zu sein. Ein Kind, das singend zum Kindergarten hopste, ein Liebespaar Hand in Hand am Hafen, für ihn alles nur die Toten von morgen. Als trübte ein fauliger Gestank seine Sinne. An manchen Tagen war der Eindruck derart intensiv, dass es ihm fast den Atem nahm. Er wollte nicht Luft holen. In der Luft lag der Tod.
Reglos stand Hinnerken im Zimmer und starrte mit leicht zusammengekniffenen Augen die nackte Leiche auf dem Bett an.
Irgendetwas störte ihn an der Sache. Vielleicht nur, dass sie so friedlich aussah. Die junge Thailänderin machte ihrem Vornamen Ehre. Sie war eine bezaubernde Blume der Nacht. Immer noch, selbst im Tod.
Paul fand, eine junge Frau, die gewaltsam zu Tode gekommen war, durfte nicht so friedlich aussehen. Beinahe glücklich. Zumal man davon ausgehen konnte, dass eine Thailänderin, die in einem deutschen Bordell anschaffte, nicht glücklich war. Nicht wirklich.
Vielleicht war es ein Sexunfall gewesen. Ein bisschen zu viel Sadomaso. Berufsrisiko. Polizisten kamen ja auch im Dienst ums Leben. Nicht auszuschließen.
Aber auf ihn wirkte das Ganze nicht, als wäre ein panischer Freier einfach abgehauen, sondern eher, als machte ein eiskalter Täter sich noch im Nachhinein über sein Opfer lustig.
Hinnerken ließ den Anblick auf sich wirken. Ihre Brüste. Ihre Scham. Ihr flacher Bauch. Das aufgefächerte schwarze Haar. Was war geschehen?
Seufzend strich er sich über die stoppelkurzen Haare auf seinem markanten Quadratschädel, der fast ansatzlos in einen muskulösen Oberkörper überging. Paul Hinnerken war schon über zwanzig Jahre bei der Polizei. Umso irritierender fand es dieser Schrank von Mann, wie sehr ihn die zarte Frau auf dem Bett anrührte.
Zwei junge Kollegen der Spurensicherung waren still in der Tür stehen geblieben und beobachteten, wie Hinnerken die nackte Tote anstarrte. Sie wussten nicht recht, ob der Kriminalwachtmeister bemerkenswert gründlich war. Oder pervers.
Kapitel 11
Polizei und Spurensicherung hatten den Betrieb für den Rest der Nacht zum Erliegen gebracht. Außer Fleurs Zimmer hatte zwar vorläufig nichts abgesperrt werden müssen, aber drei Streifenwagen vor dem Haus waren eben keine Werbung für einen Puff.
Andererseits würde morgen früh das Foto des roten Schilds über der Tür, mit der geschwungenen Schreibschrift und dem stilisierten Lockenkopf einer jungen Schönheit, in der Morgenpost auf der Titelseite prangen und von Tausenden potenzieller Neukunden auf dem Weg zur Arbeit neugierig betrachtet werden. Und wenn sie dann ein paar Tage oder Wochen oder Monate später über die sündige Meile bummelten, dann gab es in ihrem Kopf zwischen lauter unbekannten, austauschbaren Bars und Kaschemmen einen vertrauten Anker: das Pretty Woman an der Ecke Reeperbahn/Große Freiheit.
Gordon knurrte ärgerlich: »Die Bullenparade vor der Tür ist höchstens was für ganz harte Fetischisten – aber die wollen ja lieber gleich Hakenkreuze.«
Michelle musste lachen. Augenblicklich schämte sie sich dafür. Sie war noch am Leben. Und Fleur nicht mehr.
Sie sah das Gesicht ihrer Freundin vor sich. Das seidige Haar auf dem Kissen. Der Blick ins Nichts. Der offen stehende Mund. Hatte Entsetzen in ihren Zügen gelegen? Fleur gehörte zu denen, die alles gesehen hatten. Die alles mitmachten, wenn die Kohle stimmte, weil sie in ihrem Innersten eine Zelle gefunden hatten, in der sie ihre Seele einsperren konnten.
Was hatten ihre Augen zuletzt gesehen? Wen hatte sie gesehen? Hatte ein Schrei in ihrer Kehle gebrannt?
Was würde Michelle tun, wenn ein Mann sie plötzlich würgte, ihr den Mund zuhielt oder das Kissen aufs Gesicht drückte? Natürlich würde sie sich wehren, aber hätte sie genug Kraft, oder wäre sie ihm ausgeliefert? War Fleur vielleicht tot und sie am Leben, nur weil sie langweiliger und bürgerlicher aussah als die gertenschlanke Fleur mit ihren dunklen Bambi-Augen und der verlockend braunen Haut?
Der falsche Mann zur falschen Zeit – Pech gehabt. War es so einfach und zugleich so schrecklich gewesen? So unpersönlich?
Unwillkürlich berührte sie das Tattoo hinter ihrem rechten Ohr, die Schwinge des Phönix, das Symbol der Wiederauferstehung aus der eigenen Asche. Wie Fleur es sich erträumt hatte. Wie sie selbst es vorhatte, später. Sie wollte nicht als MILF oder GILF enden – als Mother I’d Like to Fuck oder gar Grandmother I’d Like to Fuck ...
Es klopfte. Sie wirbelte herum. Paul stand in ihrer Tür.
Kapitel 12
»Hallo«, sagte Paul.
Michelle wusste nicht recht, wie sie auf ihn reagieren sollte. Er war nicht anders gekleidet als sonst, wenn er zu ihr kam. Genau genommen trug er sogar noch dieselben Sachen wie vor ein paar Stunden in der Salsa-Bar, nur andere Schuhe und ein dunkles Jackett.
»Hallo«, sagte sie so neutral wie möglich.
Sie war erschüttert, dass Paul Polizist war. Das hätte sie nie von ihm gedacht. Natürlich gingen auch Polizisten in den Puff. Männer waren in dieser Hinsicht alle gleich, egal ob reich oder arm, verheiratet oder Single, jung oder alt. Aber irgendwie ... sie hatte sich immer vorgestellt, dass er in einem Krankenhaus arbeitete, oder als Teamleiter in irgendeiner Firma. Nicht zu viel Führungsverantwortung, dafür war er zu weich, aber auch kein kleines Licht, dafür war er zu hart.
»Darf ich reinkommen?«
Sie nickte.
»Mein Name ist Paul Hinnerken von der Kripo Hamburg. Ihr Kollege sagte, Sie wären diejenige gewesen, die die Tote gefunden hat?«
Aha, so wollte er die Sache spielen. Sie kannten einander nicht und waren auch nicht per Du. Vielleicht war das besser so, aber trotzdem fand sie es feige von ihm.
Kein guter Anfang, wenn der Bulle, der Fleurs Tod aufklären sollte, ein feiger Hund war.
»Michelle Müller«, sagte Michelle. Das Spiel konnten zwei spielen. Sie blieb am Fenster stehen. »Setzen Sie sich doch«, sagte sie und deutete auf das Bett, in dem sie sonst gemeinsam lagen.
»Nein, danke.« Sein Mund zuckte, aber sie konnte den Ausdruck nicht deuten. »Ich wollte nur ...« Er zögerte, sah über die Schulter zur Tür, zuckte dann mit den Schultern. »Ihr Kollege sagt, Sie kannten die Tote gut?«
»Fleur. Sie heißt Fleur. Und – ja, ich kannte sie gut. Wir arbeiteten Wand an Wand, wie Sie sehen. Außerdem waren wir befreundet. Ganz normal, wie andere Leute auch.« Wieso verspürte sie diesen Drang, sich zu verteidigen? Fühlte sie sich von Paul angegriffen, weil er es offenbar okay fand, seine Bedürfnisse von ihr befriedigen zu lassen – aber jetzt doch lieber so tat, als hätte er sie noch nie gesehen? In gewisser Weise war das aus ihrer Sicht ein Verrat. Er tat, als wäre er etwas Besseres als sie.
Dabei waren sie beide nur Dienstleister an der Gesellschaft.
Michelle riss sich zusammen. Sie trat zwei Schritte vor und setzte sich aufs Bett. Stützte die Hände auf die Knie. »Fleur und ich waren Freundinnen. Sie ist vor ein paar Jahren aus Thailand hergekommen. Ich weiß nicht viel über sie, aber sie hatte keine schöne Kindheit. Hier fühlte sie sich viel wohler. Sie ist ... sie war ein bisschen verschlossen, aber sehr nett. Ich kenne eigentlich niemanden, der so – der es so wenig verdient hat zu ...« Jetzt hatte sie doch wieder einen Kloß im Hals und konnte nicht weitersprechen.
»Wissen Sie, ob die ... ob Fleur Feinde hatte? Streit mit jemandem? Oder vielleicht gab es Probleme mit einem Kunden, möglicherweise waren unerwiderte Gefühle im Spiel?«
Bildete sie es sich ein, oder hatte sich bei seinen letzten Worten sein Blick verändert? Jedenfalls sah er sie auf einmal forschend an, das war ihr unangenehm.
Michelle zuckte mit den Schultern. »Sie hat jedenfalls nichts gesagt. Und im Pretty Woman gibt’s keine Kundenliste – wir sind alle offiziell selbstständige Unternehmerinnen, die hier nur Räume mieten. Höchste Diskretion, das wissen unsere Kunden zu schätzen.«
Sie schaute ihn herausfordernd an.
Leise sagte Paul: »Das kann ich mir vorstellen. Aber vielleicht können Sie sich ja doch an jemanden erinnern, der Fleur besucht hat?«
»Ach, wissen Sie, hier herrscht so ein Kommen und Gehen, ich kann mir wirklich nicht alle Männer merken, die hierherkommen. Tut mir leid.«
Paul senkte den Blick.
Treffer, versenkt.
Dann zog er eine Visitenkarte aus der Tasche und hielt sie ihr hin. »Wenn Ihnen noch etwas einfällt, melden Sie sich bitte bei uns, okay?«
»Natürlich«, sagte Michelle. »Ganz klar. Mache ich.«
Kapitel 13
»Svenja Meißen von der Kripo Hamburg. Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass eine Ihrer Kolleginnen tot aufgefunden wurde.« Meißen schaute in ihr Notizbuch, um nicht den falschen Namen zu nennen. »Fleur Sutha. Ich würde Ihnen gern ein paar Fragen stellen.«
»Oh mein Gott!«, sagte die junge Frau und schlug die Hand vor den Mund. »Ich muss sofort nach Raven sehen!«
Sie wandte sich ab und wollte davonlaufen. Svenja Meißen packte sie am Arm. »Hey, ich habe Sie etwas gefragt!«
»Ich ... mein Sohn schläft dort hinten im Zimmer. Ich würde es nicht überleben, wenn ihm etwas passiert ist.«
»Ihr Sohn?«
Meißen hätte sich ohrfeigen können. Abschätzige Kommentare machten mögliche Zeugen nicht auskunftsfreudiger. Aber die Frau mit den zweifarbigen Haaren war offenbar viel zu besorgt, um auf solche Feinheiten zu achten. Oder sie war derartige Reaktionen gewohnt und entsprechend abgestumpft.
»Sie können gern mitkommen, ich will nur sicher sein, dass alles okay ist, dann reden wir.« Sie lief voraus, Meißen hinterher. Vor der letzten Tür im Gang blieb die Frau stehen, drückte langsam die Klinke herunter, öffnete die Tür einen Spaltbreit. Auf dem Bett lag ein kleiner Junge mit blonden Locken. Er lächelte im Schlaf, zwei Stofftiere fest an sich gedrückt.
Meißen konnte sehen, wie sich die Decke hob und senkte.
Die Mutter des Jungen wollte gerade die Tür wieder schließen, da trat Meißen vor. Sie warf der Mutter einen warnenden Blick zu, zog ihre Pistole, schob die junge Frau beiseite. Mit der freien Hand drückte sie langsam die Tür weiter auf, bis sie ins Zimmer treten konnte. Sie sah sich um. Bett, Nachttisch, Schrank, Bad. Genau wie die anderen Zimmer. Die Tür zum Bad stand offen. Mit zwei Schritten war sie dort, schaute hinein, niemand. Dann stellte sie sich seitlich neben den Schrank, zog mit der Linken die Tür auf. Leer.
Leise schloss sie die Tür wieder, warf einen letzten Blick auf den schlafenden Jungen, verließ das Zimmer.
»Danke«, flüsterte die Mutter des Jungen, die offenbar begriffen hatte, wonach Meißen suchte.
Die Kripobeamtin steckte ihre Pistole weg.
»Wir können in mein Zimmer gehen«, sagte die junge Frau. »Ich bin übrigens Mina-Cheyenne.« Sie ging voraus in das Zimmer neben dem, in dem ihr Sohn schlief, und setzte sich auf das Bett. Auf einmal schien ihr etwas einzufallen, und sie starrte Meißen voller Angst an. »Ich krieg doch jetzt keinen Ärger, oder? Raven ist wirklich nur ganz selten hier. Er wird sich später gar nicht mehr daran erinnern können. Das Langzeitgedächtnis setzt nämlich erst mit fünf ein. Aber sein Vater – Sie müssen wissen, auf seinen Vater ist einfach überhaupt kein Verlass. Er sollte heute eigentlich bei ihm sein, aber er ist einfach nicht gekommen. Sein Vater ist Musiker, verstehen Sie, aber trotzdem, man kann doch nicht einfach ...«
Meißen hob die Hand. »Ich bin bei der Kripo, nicht beim Jugendamt«, sagte sie. Die junge Frau tat ihr leid. Der Junge auch, aber seine Mutter gab sich erkennbar Mühe. Was mehr war, als man über manche Vorstadtmütter sagen konnte.
In ihrem Job sah sie alles – und erfuhr viel mehr über die Menschen, als sie wissen wollte.
Mina-Cheyenne seufzte erleichtert und entspannte sich für einen Augenblick. Dann fiel ihr offenbar wieder ein, warum Meißen sie angesprochen hatte. »Und was ist jetzt mit Fleur passiert?«
»Ihre Kollegin ist ... sie wurde tot aufgefunden. Es besteht Verdacht auf Fremdeinwirkung – versehentlich oder absichtlich. Deswegen ermitteln wir.« Meißen hatte ihr Notizbuch aufgeschlagen. »Bitte nennen Sie mir zuerst einmal Ihren vollständigen Namen, Ihre Anschrift und eine Telefonnummer, unter der wir Sie gegebenenfalls erreichen können.«
Sie schrieb Mina-Cheyennes Angaben mit. Dann fragte sie: »Können Sie sich erinnern, wann Fleur heute zur Arbeit kam?«
Die junge Prostituierte schüttelte den Kopf. »Ich hatte heute solchen Stress wegen Raven. Sein Vater sollte ihn abholen, wir haben gewartet, seine Sachen waren gepackt, er hat sich auch so gefreut. Aber der Dreckskerl ist einfach nicht gekommen. Ist auch nicht ans Handy gegangen. Und Raven hat ein bisschen Fieber, nicht schlimm, aber ich konnte ihn doch nicht einfach zu Hause lassen!«
»Und können Sie sich denn vielleicht erinnern, ob Sie Ihrer Kollegin begegnet sind, als Sie kamen?«, unterbrach Meißen.
»Also, ich glaube, sie war schon da. Sie müssten da mal Gordon fragen. Vielleicht ist sie auch nach mir gekommen. Ich bin wirklich nicht ganz sicher. Erst einmal habe ich Raven in Steffis Zimmer gebracht, die hat freitags nämlich immer frei, und letztes Mal hat sie mir auch erlaubt, dass Raven bei ihr schläft, Steffi ist wirklich eine ganz, ganz Süße. Und er ist dann auch eingeschlafen, aber nach einer halben oder Dreiviertelstunde ist er wieder aufgewacht, und ich muss doch arbeiten, aber Michelle war so lieb und hat ihm vorgelesen. Es ist komisch, bei jedem anderen beruhigt er sich, nur bei mir nicht, da will er einfach nicht schlafen. Deshalb war ich Michelle sehr dankbar, und ...«
»Sie können mir also nicht sagen, ob Fleur schon hier war, als Sie zur Arbeit kamen?«
Mina-Cheyenne schüttelte den Kopf. »Wissen Sie, jetzt, wo Sie so fragen, bin ich nicht mal sicher, dass ich sie überhaupt gesehen habe, heute. Vielleicht war das auch gestern. Ja, ich glaube, das war eher gestern. Aber es kann auch heute gewesen sein. Ich weiß es wirklich nicht. Haben Sie denn schon mit Michelle gesprochen? Michelle weiß das sicher, sie ist mit Fleur befreundet ... oh, das muss ja ganz schrecklich für sie sein, und dabei ist Michelle so eine Liebe!«
»Hatten Sie denn Schwierigkeiten im Umgang mit Fleur?«
»Nein, überhaupt gar nicht. Im Gegenteil! Also, das soll jetzt nicht rassistisch klingen oder so, aber die Kunden, die Fleur wollten, die haben sich sowieso nicht für mich interessiert. Wissen Sie, sie war ja Thai. Das sind ganz andere Männer, die auf so was stehen. Da gab es keine Probleme. Und persönlich ... also, wir haben nicht viel geredet. Ich weiß nicht, was Michelle an ihr fand. Aber sie war immer freundlich, und ich auch. Das muss auch sein. Solidarität. Frauenpower. Das können Sie sicher auch nachvollziehen, oder?«
»Hm«, machte Meißen. Sie war für Gleichberechtigung, hielt aber nicht viel von Feminismus und Frauenquoten. »Können Sie mir sagen, ob Fleur vielleicht Stammkunden hatte? Oder wissen Sie, ob es möglicherweise einmal zu Problemen gekommen ist – ein unzufriedener Kunde oder jemand, der gern Grenzen überschreitet? Ihr Beruf ist ja nicht ganz ungefährlich.«
»Das würde ich nicht sagen. Ich habe eine Schulfreundin gehabt, die ist Verlagskauffrau geworden, und auf einem Firmenempfang ist sie über so ein Geländer gefallen, aus dem zweiten Stock. Schädelbasisbruch. Schrecklich, wirklich schrecklich.«
Meißen begann die Geduld zu verlieren. »Wissen Sie, ob Fleur jemals Probleme mit Kunden hatte?«
Mina-Cheyenne schüttelte den Kopf. »Wie gesagt, wir hatten nicht viel miteinander zu tun. Wenn, dann wüsste Michelle das. Aber das Pretty Woman hat Niveau, das darf man nicht unterschätzen. Viele Probleme, die andere Läden haben, kennen wir gar nicht.«
»Und kennen Sie vielleicht Stammkunden von Fleur?«
Jetzt schüttelte die junge Frau den Kopf. »Nein. Jede von uns macht ihre eigenen Termine. Entweder vorab, oder wir warten draußen. So läuft das Geschäft. Ich bin sicher, es gab Männer, die gern wieder zu ihr kamen. Gerade weil sie – wie gesagt, ich meine das überhaupt nicht negativ – eine andere Hautfarbe hatte. Aber andererseits findet man das natürlich auch anderswo.«
»Ist Ihnen vielleicht mal im Vorbeigehen jemand aufgefallen, an den Sie sich erinnern können?«
Wieder Kopfschütteln. »Nein. Aber ich muss zugeben, ich habe auch nie darauf geachtet. Wozu auch? Fleur und ich waren keine Konkurrentinnen, verstehen Sie?«
Meißen klappte ihr Notizbuch zu und zog eine Visitenkarte aus der Tasche. »Wenn Ihnen noch etwas einfällt ...«
Mina-Cheyenne nahm die Karte und nickte. »Klar. Wie im Fernsehen. Dann rufe ich Sie an. Aber keine Sorge. Ich bin sicher, mir fällt nichts ein.«
Kapitel 14
Svenja Meißen beugte sich zu ihrem Kollegen Paul Hinnerken hinüber und flüsterte: »Der muss doch mehr wissen.«
Streng musterte Hinnerken Gordon, der total entspannt hinter seinem Schreibtisch saß. Geistesabwesend zwirbelte er das Ende seines fusseligen Pferdeschwanzes um die Finger.
»Jetzt hören Sie mal auf, die Unschuld vom Lande zu spielen, und sagen Sie uns, was Sie wissen!«, befahl Hinnerken.
»Hab ich doch schon. Und ich bin vom Land. Aus dem Wendland. Da weiß man noch, was richtig und was falsch ist.« Er schaute trotzig.
Hinnerken dachte zurück an einen Einsatz im Wendland. Im strömenden Regen hatten sie gewaltfreie Atomkraftgegner von den Gleisen tragen müssen, die einfach dort gesessen und in Endlosschleife »Imagine« und »Give Peace a Chance« gesungen hatten. Ihm war eigentlich egal gewesen, ob der blöde Zug mit den Atommüllfässern nun durchkam oder nicht. Er hatte nur nach Hause in die heiße Badewanne gewollt. Und zu Carmen.
Die Typen dort hatten alle so ausgesehen wie dieser Gordon. Bisschen ungepflegt, aber grundsolide. Unter anderen Umständen hätten sie gut ein Bier miteinander trinken können.
»Auf jeden Fall ist doch wohl falsch, was Ihrer Mitarbeiterin Fleur Sutha widerfahren ist«, sagte Hinnerken. »Oder sind Sie etwas anderer Meinung.«
»Fleur war nicht meine Mitarbeiterin. Sie war selbstständige Sexualdienstleisterin, die von der Firma meiner Vorgesetzten nur eine Immobiliendienstleistung in Anspruch genommen hat.«
»Was?«, fragte Meißen entgeistert.
»Der Puff hier ist gar kein Puff, sondern so ’ne Art Bürogebäude«, übersetzte Paul. »Gehört vermutlich auch noch irgendeinem internationalen Investorkonsortium.« Er sah Gordon an. »So viel schon mal zu Richtig und Falsch, Gut und Böse, Schwarz und Weiß – Sie wissen auch ganz genau, auf welcher Seite Ihr Brötchen gebuttert ist.« Dann wandte er sich wieder Meißen zu. »Die Frauen hier arbeiten auf eigene Rechnung, sie zahlen nur Miete – stundenweise, tageweise, irgendwie so. Und unser Freund hier« – er deutete auf Gordon – »ist nicht etwa der Chef des Ganzen, sondern wohl eher so eine Art Faktotum.«
»Was?«, fragten Meißen und Gordon gleichzeitig.
»Hausmeister. Ein Faktotum ist ein Hausmeister«, erklärte Hinnerken.
Daraufhin nickte Gordon. »Genau. Und es ist ein fester Betrag pro Woche. Das erhöht die beiderseitige Planungssicherheit«.
Großartig. Sah aus wie der Weihnachtsmann auf Hartz IV und hörte sich an wie so ein Immobilienwichser.
»Okay, lassen wir das«, sagte Hinnerken. »Ehrlich gesagt, ist mir völlig egal, von wem Sie Ihr Geld kriegen und wem die Hütte hier gehört. Was mich interessiert, ist: Wer war heute bei Fleur?«
Gordon zuckte mit den Schultern. »Keine Ahnung. Männer halt.« Er kniff die Augen zusammen, als würde er Paul ein wenig genauer mustern. Dann sagte er: »Irgendwann sehen die alle gleich aus.«
Paul fürchtete schon, Gordon würde irgendwelche Anspielungen machen oder ihm drohen. Er war immer noch nicht sicher, ob sein Gegenüber ihn wiedererkannte oder nicht.
»Außerdem«, setzte Gordon hinzu, »ist Diskretion schließlich Ehrensache.« Er grinste, dann wurde er wieder ernst. »Aber ich weiß es wirklich nicht. Hab einfach nicht drauf geachtet. Die Mädchen sind für sich allein verantwortlich. Davon kann man halten, was man will, aber so isses.«
»Und die Videoaufzeichnungen?«, fragte Meißen und sah sich nach Kameras um.
Gordon schnaufte. »Datenschutz, Süße – dafür kannste deinen Chefs danken.«
Hinnerken schüttelte den Kopf. Die gespielte Leutseligkeit des Langhaaraffens ging ihm auf die Nerven. Aber egal. Es gab keine Aufnahmen, niemand hatte etwas gesehen – viel Spaß bei den Ermittlungen. Typisch: Auf dem Hamburger Kiez waren immer alle noch ein kleines bisschen weniger hilfreich als anderswo in der Stadt. Aber davon würde Hinnerken sich nicht aufhalten lassen. Ganz sicher nicht.
Gordon wollte nun seinerseits wissen: »Wann können wir eigentlich das Zimmer sauber machen lassen? Sonst nimmt das keiner.«
»Wenn wir fertig sind«, sagte Meißen barsch. »Wir sagen Ihnen Bescheid.«
»Ist ja gut. Aber wir haben ... gute Nutten finden Sie echt leichter als ’ne gute Putzfrau. Wir haben da momentan einen kleinen Engpass, sagen wir mal so, und die werden mir was erzählen, wenn sie ’ne Sonderschicht schieben sollen. Oder eher, die werden mir gar nichts erzählen, weil ich nicht ihre Sprache spreche ... ich weiß noch nicht mal, welche Sprache die sprechen ... aber sie kommen einfach nicht wieder, wenn ihnen die Arbeit nicht passt. Und das ist dann ganz und gar nicht in meinem Sinne.«
»Aha«, erwiderte Meißen nüchtern. »Und Sie glauben, das interessiert mich?« Sie sah Gordon direkt in die Augen. Der hielt ihrem Blick eine Weile stand, sah dann aber doch weg. Es war klar, er hatte etwas zu verlieren, sie nicht.
Meißen legte nach: »Übrigens – im Zimmer der Toten haben wir ihre Bekleidung und etwas Bargeld sicherstellen können – sie wird von der Spurensicherung mit abtransportiert. Aber wir haben keine Wertsachen gefunden, Kreditkarten, Handy, Schlüssel. Können Sie uns sagen, wo die aufbewahrt werden?«
Gordon zuckte mit den Schultern, entgegnete dann aber: »Unten im Keller haben wir Schließfächer. Da können unsere Mieterinnen ihre Handtaschen und so lassen.«
»Haben Sie einen Schlüssel dafür?«
»Die Dinger funktionieren mit Transpondern. Vermutlich steckt Fleurs in ihrer Hosentasche. Aber ich kann das Fach von hier aus öffnen, Moment.«
Er vollführte auf seinem Bürostuhl eine Vierteldrehung zum Computer, rief ein Programm auf und klickte einige Male mit der Maus. »So«, sagte er dann. »Kommen Sie.«