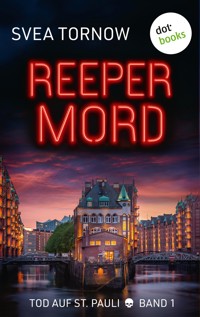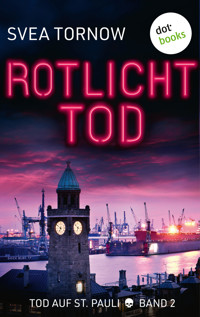
5,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Tod auf St. Pauli
- Sprache: Deutsch
Nur ihr Tod ist Garantie: Der fesselnde Hamburg-Krimi »Rotlichttod« von Svea Tornow jetzt als eBook bei dotbooks. Wie vom Erdboden verschluckt … In der Hamburger Rotlichtszene verschwinden Prostituierte – und gleichzeitig macht das Gerücht die Runde, dass Unbekannte einen Snuff-Film drehen wollen – ein Porno, in dem nur eines gewiss ist: dass die Frau am Ende stirbt. Könnten die Vermissten dafür missbraucht werden? Als auch eine Bekannte der Prostituierten Michelle verschwindet, beschließt sie, auf eigene Faust nach Antworten zu suchen. Doch um an Hinweise zu gelangen, muss sie Kontakt zum ermittelnden Kommissar aufnehmen – und gerät dabei ins Visier der Täter. Es dauert nicht lange und sie selbst schwebt in größter Gefahr … Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der knallharte Hamburg-Krimi »Rotlichttod« von Svea Tornow ist der zweite Band ihrer »Tod auf St. Pauli«-Reihe und wird Fans von Henrik Siebold und Bernd Aichner begeistern. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 449
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über dieses Buch:
Wie vom Erdboden verschluckt … In der Hamburger Rotlichtszene verschwinden Prostituierte – und gleichzeitig macht das Gerücht die Runde, dass Unbekannte einen Snuff-Film drehen wollen – ein Porno, in dem nur eines gewiss ist: dass die Frau am Ende stirbt. Könnten die Vermissten dafür missbraucht werden? Als auch eine Bekannte der Prostituierten Michelle verschwindet, beschließt sie, auf eigene Faust nach Antworten zu suchen. Doch um an Hinweise zu gelangen, muss sie Kontakt zum ermittelnden Kommissar aufnehmen – und gerät dabei ins Visier der Täter. Es dauert nicht lange und sie selbst schwebt in größter Gefahr …
Über den Autor:
Svea Tornow studierte Amerikanistik und Psychologie. Sie jobbte auf drei verschiedenen Kontinenten, u.a. für ein internationales Modelabel. Heute arbeitet sie in einem Medienunternehmen. Hamburg kennt sie aus ihrer Studienzeit in allen seinen Facetten, von Reeperbahn bis Rathaus.
Bei dotbooks veröffentlichte die Autorin ihre »Tod auf St. Pauli«-Reihe, bestehend aus den Bänden »Reepermord« und »Rotlichttod«.
***
eBook-Neuausgabe Juni 2024
Dieses Buch erschien bereits 2016 unter dem Titel »eXXXtrem« bei LYX, verlegt durch EGMONT Verlagsgesellschaften mbH, Köln.
Copyright © der Originalausgabe 2016 by Svea Tornow
Copyright © der Neuausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Montasser Medienagentur, München.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/Maksim Toome, Park Ji Sun, Tartila, sunfun
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (fe)
ISBN 978-3-98952-298-5
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13, 4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/egmont-foundation. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Rotlichttod«an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Svea Tornow
Rotlichttod
Tod auf St. Pauli, Band 2
dotbooks.
Kapitel 1
»Guck mal, meinst du nicht, die passt ganz wundervoll auf ...?«
Michelles Mutter hielt eine schlanke Vase hoch und ließ die Frage unbeendet. Das war ihre Art, nicht anzuecken – ihre Gesprächspartner konnten die Sätze selbst zu Ende führen, wie es ihnen gefiel.
»Ja, Mama, wo würde die denn ganz wundervoll draufpassen?«, fragte Michelle gereizt.
Monika hatte un-be-dingt zu Ikea fahren müssen. Un-be-dingt! Und jetzt spazierten sie schon über eine Stunde durch die Verkaufshalle, und sie hielt ihrer Tochter Vasen und Lampen, Kissen und Bilderrahmen hin, aber im Einkaufswagen lagen bislang nur die unvermeidlichen Teelichter und ein Bratenwender aus grünem Plastik.
»Ich dachte ja nur!«, schnaufte Monika beleidigt und stellte die Vase wieder weg.
»Was? Was dachtest du?«, fragte Michelle und hob die Hände. Sie war nicht sicher, ob es eine Geste der Verzweiflung war oder ob sie ihre Mutter am liebsten erwürgt hätte. Wahrscheinlich beides. »Du musst auch mal sagen, was du meinst, Mama!«
Monika presste die Lippen aufeinander. Sie schlang die Arme um ihren Oberkörper und schloss die Augen. Eine einzelne Träne drang unter dem rechten Lid hervor, hing einen Moment lang an den Wimpern und rollte dann über die Wange.
Michelle hatte das Gefühl, als würden alle Geräusche um sie herum verschwinden, sich in nichts auflösen. Es gab nur noch sie und ihre Mutter. Und sie hatte Schuld daran, dass ihre Mutter traurig war.
»Mama!«, sagte Michelle und streckte die Hand aus. Sie berührte ihre Mutter am Oberarm.
»Lass mich. Lass mich einfach. Ich verstehe schon. Du ... ich ... Du hast dein eigenes Leben. Ich falle dir zur Last. Ich wollte es uns nur ... aber du ...« Ihre Stimme wurde immer leiser. Dann trat Monika einen Schritt zurück und verstummte.
Michelle beugte sich vor, als könnte sie ihre Mutter schlecht verstehen. »Du wolltest nur was, Mama? Und du fällst mir nicht zur Last. Überhaupt nicht.« Sie holte Atem. Es musste gesagt werden. »Du gehst mir nur manchmal auf die Nerven. Ich dir bestimmt auch. Wir werden das schon hinkriegen. Wir werden uns aneinander gewöhnen.«
Ihre Mutter öffnete vorsichtig ein Auge. »Aber ich dachte ... na ja.«
Michelle schüttelte den Kopf. Sie raufte sich mit beiden Händen die langen Locken. »Mama. Ich kann keine Gedanken lesen. Du musst schon sagen, was du denkst.«
»Das sagt Raimund auch immer.«
Mist. Raimund nun wieder. Hörte sie sich etwa an wie Raimund, dieses Arschloch?
»Und dass wir uns doch lieben.«
Wer? Wir? Sicher. Aber ... Dann erst fiel bei Michelle der Groschen. Ihre Mutter redete nicht mehr von sich und ihrer Tochter, sondern von ihrem Freund. Ihrem Lebensabschnittsgefährten. Wie auch immer. Raimund. Sie liebten und sie schlugen sich. Also, eigentlich schlug nur er sie, und sie liebte ihn. Immer noch, offenbar. Obwohl es dafür wirklich keinen Grund gab.
»Verstehe ich dich jetzt richtig, du wolltest mir die Vase zeigen, weil du findest, sie würde richtig gut auf Raimunds Quadratschädel passen?« Ein kleiner Scherz. Um die Stimmung zu lockern.
Doch ihre Mutter sah sie verständnislos an. Sie ließ die Arme sinken und sagte: »Nein. Natürlich nicht. Was denkst denn du von ...? Nein.« Jetzt sah sie wieder zu der Vase im Verkaufsregal. »Ich dachte, die passt vielleicht ganz gut ...« Sie zögerte. »... auf das Sideboard im Wohnzimmer«, setzte sie dann leise hinzu, als kostete es sie große Mühe, die Worte auszusprechen.
Michelle nahm die Vase in die Hand, drehte sie. Eine elegante, schlanke Form mit einem langen Hals. Die Farbe irgendwo zwischen rosa und orange. Sie warf einen Blick auf das Preisschild, dann legte sie die Vase in den Wagen.
»Es ist eine von diesen Dekovasen, weißt du? Man kann vielleicht einige Zweige hineinstellen, aber man muss nicht. Sie sieht auch so gut aus. Weißt du? Ich habe das mal in einer Zeitschrift gesehen und dachte ...« Ihre Mutter gestikulierte hektisch. Es sah aus, als wären ihre Hände kleine Vögel, die nicht wussten, wo sie hinsollten.
»Mama«, sagte Michelle. »Es ist alles okay. Die Vase ist schön. Du hast recht. Das ist ein toller Vorschlag. Sie sieht sicher gut aus. Und wenn nicht, können wir sie immer noch zurückbringen. Mach dir keine Sorgen.«
Sie fing die rastlosen Hände ihrer Mutter ein. »Ganz ruhig. Ich freue mich, dass du bei mir wohnst. Nicht für immer, dafür ist es zu klein. Aber jetzt, und so lange es nötig ist. Du fällst mir nicht zur Last, aber du musst mir das auch glauben. Sonst machst du uns beide verrückt.«
Ihre Mutter stieß den Atem aus und sackte leicht in sich zusammen. Wenigstens hielt sie die Hände still. Schließlich sagte sie leise: »Das hat er auch immer gesagt. Dass ich ihn verrückt mache.«
Wieder schloss sie die Augen. Wieder lief eine einzelne Träne über ihre Wange.
Michelle wusste nicht recht, was sie tun sollte. Einerseits hatte sie Mitleid mit ihrer Mutter. Unglücklich verliebt zu sein war schrecklich. Sich unsicher und schuldig zu fühlen war auch schrecklich. Aber andererseits ging Monika ihr mit dieser angstvollen Opferrolle auch verdammt auf die Nerven. Michelle konnte doch nichts dafür, dass ihr Vater sich umgebracht hatte. Sie konnte nichts dafür, dass ihre Mutter sich danach einen Typen wie Raimund ausgesucht hatte. Sie konnte nichts dafür, dass ihre Mutter immer von allen anderen hören wollte, dass sie in Ordnung war – und es dann doch nicht glaubte.
Sie selbst hatte sich nach dem Tod ihres Vaters die Augen aus dem Kopf geheult. Tagelang. Wochenlang. Und danach nie wieder. Das Leben musste weitergehen. Notfalls auch bei Ikea.
»Komm«, sagte sie. »Lass uns mal die Stoffe angucken.«
Monika schlug die Augen auf und wischte sich mit dem Handrücken über die Wange. »Ja, okay. Klar.«
Wortlos gingen sie nebeneinanderher. Michelle schob den Wagen, während ihre Mutter immer wieder mal Dinge aus den Verkaufskörben nahm – Ablagen, Wandhalterungen, bizarr geformte Gummiuntersetzer. Manchmal kam es Michelle vor, als hätten sie und Monika in den letzten Wochen die Rollen getauscht. Sie war jetzt die Mutter, die sagte, wo es langging, und ihre Mutter war die Tochter auf der Suche nach dem rechten Weg. Wenn es nicht so traurig wäre, hätte sie lachen müssen. Als wäre sie auf dem rechten Weg.
Monika glaubte, sie arbeitete in der Nachtschicht für eine Versicherung.
Doch in Wahrheit ...
Jetzt wurde sie schon wie ihre Mutter und ließ Sätze unbeendet ins Nichts driften. Aber in diesem Fall war es besser so.
»Guck mal, der wäre doch was für dein Schlafzimmer«, schlug Monika vor und hielt eine Stoffbahn hoch.
»Ich hab doch immer die Rollläden zu, weil ich so spät komme und dann lange schlafe«, wandte Michelle ein.
»Das muss dich doch nicht daran hindern, es dir schön zu machen.«
»Ach Mama. Ich schlafe in meinem Schlafzimmer. Dabei hab ich die Augen zu!«
Monika ließ die Stoffbahn sinken und schüttelte den Kopf. »Aber man weiß doch nie, wann vielleicht mal jemand ... du weißt schon. Es muss doch auch bei euch im Büro nette junge Männer geben. Oder in deinem Chor. Oder ...« Sie zuckte ratlos mit den Achseln.
Das Letzte, wonach Michelle am Ende ihres Arbeitstages war, war Sex. Was an ihrem Job lag. Aber das konnte ihre Mutter natürlich nicht wissen.
»Mama, du lebst echt hinterm Mond«, sagte Michelle. »Wenn ich wirklich einen Mann mit nach Hause bringe, meinst du, der geht wieder, weil ich keine Vorhänge im Schlafzimmer habe?«
»Das vielleicht nicht. Aber wer weiß, ob er noch mal wiederkommt. Männer mögen ... du weißt schon ... den häuslichen Typ«, rang ihre Mutter sich ab.
»Soll ich dich jetzt dafür loben, dass du gesagt hast, was du denkst – oder soll ich sauer sein darüber, was du gesagt hast?«, fragte Michelle mit einem Grinsen.
Statt einer Antwort zog Monika eine weitere Stoffbahn hervor. »Oder den hier? Der ist doch auch schön. Zeitlos elegant, ein Klassiker. Gibt’s schon lange, aber gefällt mir immer noch.«
Michelles Herz setzte einen Schlag aus.
Genau aus diesem Stoff waren die Vorhänge in Fleurs Schlafzimmer gewesen. Fleur. Ihre ehemalige Kollegin. Ihre ehemalige beste Freundin. Die doch so viele Geheimnisse mit ins Grab genommen hatte.
Ihre Knie wurden weich, vor ihrem inneren Auge blitzten schreckliche Bilder auf. Fleurs nackte Leiche, die Michelle gefunden hatte. Ihr schwarzes Haar wie ein Fächer auf dem Kissen. Fleurs Wohnung, in der sie mit Paul nach Hinweisen auf den Mörder gesucht hatte. Fleurs Mörder – ein perverses Pärchen – im Folterkeller des Pretty Woman. Sie schlugen mit der Peitsche auf Michelle ein, sie quälten sie aus Lust, sie wollten sie töten, um sich zu retten.
Fleurs Bruder, der ihr im letzten Moment zu Hilfe kam.
Blut. So viel Blut.
Schmerz.
Schmerz und Blut.
»Ist dir nicht gut? Ist dir schwindelig? Das kommt davon, wenn man nicht richtig frühstückt, ich sag es dir. Und der Nachtdienst bringt auf die Dauer auch den Körper ganz durcheinander. Das ist bewiesen, kam neulich gerade wieder im Fernsehen«, drang Monikas Stimme zu ihr durch.
Unwillkürlich hatte Michelles Hand sich um den Haltegriff des Einkaufswagens gekrampft.
»Es ... es geht schon«, murmelte sie.
Sie durfte jetzt nicht umfallen. Nicht ohnmächtig werden. Nicht das Bewusstsein verlieren.
Sie war gut darin, Schrecken und Entsetzen zu verdrängen und in ihrem Innersten unter Verschluss zu halten. Das würde sie auch diesmal wieder schaffen. Es ging nicht anders.
Die Vergangenheit war nicht zu ändern.
Es war zum Kotzen, aber wahr.
»Hey«, kam plötzlich eine markante Stimme von hinten, und eine Pranke landete auf Michelles Schulter. »Na, ganz allein hier?«
Oh Gott, was war das denn für ein Spruch? Sie hörte ja viel, aber das ... Michelle wirbelte herum.
Quadratschädel, breite Schultern, flacher Bauch, kurzes Haar. Und diese Augen!
Wieder wurde ihr flau im Magen. Aber diesmal aus einem anderen Grund.
Paul grinste sie an.
Kapitel 2
Paul betrachtete zufrieden die doppelte Portion Köttbullar auf seinem Teller.
Vor Michelle standen ein Stück Apfelkuchen und ein schwarzer Kaffee.
Monika hatte sich unbedingt noch die Bäder ansehen wollen. Michelle war klar, dass sie versuchte, ihr ein wenig Privatsphäre zu geben. Ihre Mutter schien Paul zu mögen.
Michelle seufzte. »Tut mir leid. Ich komme mir vor wie mit zwölf. Mit meiner Mutter bei Ikea.«
»Ach, mach dir keine Gedanken. Ist doch schön, dass ihr euch gut versteht. Und was gemeinsam unternehmt.«
»Genau. Zu Ikea gehen.« Sie lachte.
»Egal.« Er steckte eines der Fleischbällchen in den Mund und kaute. »Mit meinen Eltern geht das nicht mehr.«
Seine Eltern waren im Pflegeheim, das wusste sie. Er hatte es ihr erzählt.
»Yolo. Carpe diem. Leb jeden Tag, als wär’s dein letzter. Schon klar«, entgegnete Michelle. »Aber Teelichter bei Ikea kaufen ist ja keine Städtereise nach Paris.«
»Egal«, sagte er noch einmal. Dann sah er sie direkt an. Sie starrte zurück. Diese Augen! »Wie geht es dir?«
Er wartete einen Moment, dann senkte er den Blick und aß weiter.
Michelle war froh, dass er ihr Raum ließ. Sie nicht drängte.
»Gut«, sagte sie und war selbst überrascht, als sie merkte, dass es der Wahrheit entsprach. Wie konnte es ihr gut gehen, wenn Fleur nicht mehr lebte? Wenn Raimund ihrer Mutter blaue Augen schlug und die zu ihrer Tochter fliehen musste? Wenn ihr geliebter Porsche 928 – ihr einziges Erinnerungsstück an ihren Vater – halb schrottreif in der Werkstatt stand und sie nicht mal genug Geld hatte, den Wagen wieder instand setzen zu lassen.
Sie waren mit dem Bus zu Ikea gefahren. Mit dem Bus! Zu Ikea!
Obwohl ... in den Kofferraum des Porsches passte auch nicht viel mehr als eine Tüte Teelichter. Aber trotzdem.
Sie hatte kein Auto und wohnte mit ihrer Mutter zusammen. Sie saß da, starrte auf ihr Kuchenstück und brachte kein Wort heraus.
Dabei kannte sie Paul doch.
Sie hatten miteinander geschlafen. Er war einer ihrer Kunden.
Aber seit sie gemeinsam den Mord an Fleur aufgeklärt hatten, war er nicht mehr bei ihr gewesen.
Dabei hatte sie gedacht ... Einmal waren sie tanzen gewesen. Salsa. Er hatte für ihre Zeit bezahlt. Denselben Stundensatz wie immer.
Er tanzte gut. Seine Frau hatte ihn verlassen, eine Spanierin, das war schon ein paar Jahre her. Die beiden hatten Turniere gewonnen.
Es war ein schöner Abend gewesen. Sie fragte sich, warum er seitdem nicht wieder bei ihr gewesen war. Oder wenigstens mal angerufen hatte.
»Doch, mir geht es gut«, bekräftigte sie dann. »Und dir?«
»Isst du gar nichts?«, fragte Paul. Sein Teller war bereits halb leer.
Michelle nippte an ihrem Kaffee. Aus reiner Höflichkeit aß sie ein Stück vom Kuchen. »Doch, siehst du?«, sagte sie.
»Mir geht’s auch gut«, entgegnete er. »Läuft alles, gerade. Arbeit und so.«
»Freut mich zu hören.« Sie legte ihre Gabel hin. »Und was treibt dich her?«
Paul sah sich um, als würde ihm erst durch ihre Frage wieder bewusst, wo sie waren. »Zu Ikea?«
Michelle nickte. »Ja, klar. Wohin denn sonst?«
»Ich brauche ein Regal. Zu viel Papier, zu wenig Platz. Oder genau genommen, zu wenig Regale. Platz ist ja da.«
Er lachte. Sie lachte.
Das frühere Vertrauen stellte sich langsam wieder ein. Es war angenehm, mit Paul zu reden. Er war nett. Er war einfühlsam, freundlich. Und er war ... sie traute sich kaum, es zu denken. Niemals persönliche Bindungen zu Kunden eingehen, niemals, niemals, niemals.
Er war gut im Bett. Nicht zu entschlossen, nicht zu soft. Er wusste, was wohin gehörte – und wann.
Paul sah sie mit seinen dunkelbraunen Augen an, als könnte er ihre Gedanken lesen.
»Ich ... äh ...«, murmelte Michelle und errötete.
Auf einmal bemerkte sie, dass sie eine Locke um den rechten Zeigefinger wickelte.
Flirtete sie etwa mit Paul? Bei Ikea?
Über Apfelkuchen und einem Teller Fleischbällchen?
Erschrocken ließ sie ihre Locke los. Sie war doch sonst nicht so ein Girlie.
»Ich glaube, wir ... also, wir müssen dann mal«, sagte sie. »Termine, Termine.«
»Was machst du denn ...« Er zögerte. »... heute noch so?«, fragte er dann aber doch.
Es war Freitagabend. Andere Frauen würden antworten: Kino, Freundinnen, Fernsehen, Disco.
Oder besser noch: Nichts – und du?
»Arbeiten«, sagte sie.
Er kratzte sich im Nacken. »Ich auch«, sagte er dann. »Und übrigens ...« Er zögerte. »Ich weiß nicht, ob du schon davon gehört hast. Aber es heißt, eine junge Frau vom Kiez sei verschwunden. Schlank, blond, schulterlange Haare.« Sein Blick huschte über ihr Gesicht, wanderte weiter. »Noch ein Grund, warum ich mich gefreut habe, dich heute hier zu treffen.«
Fehlte nur noch, dass er ihr riet: Sei vorsichtig.
Aber das verkniff er sich dann doch. Gut.
Stattdessen schob Paul sich den letzten Köttbullar in den Mund und griff nach dem Tablett. »Ist dein Auto eigentlich wieder heil?«, wechselte er das Thema.
Michelle schüttelte nur stumm den Kopf. Ihre Augenbrauen zogen sich vor Wut und Trauer zusammen. Paul hatte mit ihr im Porsche gesessen, als der Unfall passiert war.
»Wie seid ihr denn dann hier?«, fragte Paul. Er deutete auf ihr Kuchenstück. »Willst du das noch?«
Michelle schüttelte den Kopf.
Paul zog den Kuchenteller zu sich heran. »Darf ich?«
»Klar.« Michelle lachte auf. Sein Leben war so viel einfacher als ihres. Sie dachte über ihre Mutter und die Zukunft nach. Er freute sich über ihr halb gegessenes Stück Apfelkuchen. Sie beneidete ihn.
»Soll ich euch nach Hause fahren?«, fragte Paul dann. »Ich bin mit dem Auto da.«
Ihr wurde klar, dass er alles über sie wusste – wo sie wohnte, wie sie nackt aussah – und sie über ihn fast nichts. Und dass sie mehr wissen wollte.
»Nee, nicht nötig«, sagte sie und hätte sich dafür ohrfeigen können. Obwohl sie wusste, dass es die richtige Entscheidung war.
»Wirklich, das ist kein Problem«, sagte er.
Michelles Kuchen war verschwunden.
»Was ist kein Problem?«, fragte Monika, die auf einmal neben ihrem Tisch stand.
»Nichts, nur ...«, begann Michelle.
Im gleichen Moment sagte Paul: »Ich hatte angeboten, Sie beide nach Hause zu fahren.«
»Oh, das ... ist ja reizend von Ihnen!«, rief Monika. »Gerne! Dann könnten wir ...« Jetzt wandte sie sich ihrer Tochter zu. »Dann könnten wir Stoff kaufen und dieses kleine Beistellschränkchen, das wir vorhin gesehen haben!«
Michelle bemühte sich um ein Lächeln. »Ja, Mama. Okay. Klar. Machen wir.«
Was soll’s. Früher oder später würde ihre Mutter wieder ausziehen, da konnte sie die Zeit mit ihr bis dahin ebenso gut genießen. Damit hatte Paul ganz einfach recht.
»Freut mich«, sagte der. »Ich brauche nur ein weißes Billy. Aber ich habe es nicht eilig.«
»Dann kommen Sie. Ich zeige Ihnen mal, welchen Stoff ich Michelle gerade für ihr Schlafzimmer vorgeschlagen habe«, sagte ihre Mutter.
Oh Gott. War das peinlich. Michelle spürte, wie ihre Wangen sich röteten.
Paul grinste mitfühlend.
Kapitel 3
»Hier«, sagte Ingolf und legte eine unbeschriftete DVD auf den Schreibtisch seines Chefs. »Ich hab was für dich.«
Raimund Krämer sah auf. »Was ist das?«
»Wirst du ja sehen.« Ingolf grinste. »Aber sagen wir mal so, ich würde es mir an deiner Stelle nicht hier ansehen. Besser zu Hause. Allein. Wenn du verstehst, was ich meine.«
»Hm«, machte Raimund. »Du musst mir nicht deine Pornos kopieren, nur weil Monika ausgezogen ist. Die kommt schon zurück. Das hat sich bisher noch jedes Mal eingerenkt.«
»Auch keine schlechte Idee. Aber: nein. Es ist eine Vorschau auf ... du weißt schon.« Er sah sich um. Die Tür stand offen, aber die übrigen Mitarbeiter waren alle beschäftigt. Dennoch senkte er die Stimme. »Für unseren Film.«
Raimunds Handy piepste, aber er beachtete es nicht weiter.
Ingolf Teschke war Raimunds bester Freund. Sie kannten sich noch aus der Zeit, bevor sie ihre ersten Freundinnen gehabt hatten. Als Raimund sich vor dreißig Jahren selbstständig gemacht hatte, war Ingolf von Anfang an dabei gewesen. Zuerst als Prokurist und stiller Teilhaber. Später hatte er seine Anteile an Raimund verkauft, um seine erste Frau auszubezahlen und sich für die zweite Ehe standesgemäß einzurichten.
Raimund war der mutige Unternehmer mit den verrückten Ideen. Ingolf sorgte dafür, dass die Zahlen stimmten. Sie waren ein gutes Team. Aktuell beschäftigte RI SAILING sieben Mitarbeiter in Vollzeit. In den fetten Zeiten waren es auch schon mal ein paar mehr gewesen. Aber man soll nicht klagen.
Sie waren beide Mitte fünfzig. Raimund sah man an, dass er Genussmensch war – guter Wein, gutes Essen und gute Zigarren hinterließen ihre Spuren. Aber das war es wert!
Ingolf wirkte dagegen wie ein Asket. Bohnenschlank, fast mager und beinahe zwei Meter groß. Er lief Marathon, Triathlon, träumte vom Iron Man auf Hawaii.
Raimunds Jeans hing tiefer, als vom Designer gedacht. Dazu trug er Turnschuhe und ein weißes Leinenhemd. Das Haar verwuschelt, Dreitagebart, Seglerbräune. Es war schließlich seine Firma.
Ingolf kam seit seinem Fünfzigsten nicht mehr im Anzug in die Firma, aber noch in Schlips und Kragen. Dazu eine schwarze Stoffhose mit Bügelfalte und schwarze Schuhe, die aus dünnen flachen Lederriemen geflochten waren. Stylish war das nicht, aber er war ein guter Buchhalter, auf den man sich verlassen konnte.
Vor ein paar Monaten hatte Ingolf von einem todsicheren Geschäft erzählt. Eine unabhängige Filmfinanzierung. Raimund hatte gezögert, aber war dann doch mit ein paar Tausend eingestiegen. Wenige Wochen später hatte er über Ingolf eine DVD und seinen Einsatz plus zehn Prozent erhalten.
Auf der DVD war ein banaler Wichsfilm gewesen. Dass man damit immer noch Geld verdienen konnte ... Aber: Sex sells! Raimund hatte schon überlegt, ob sie mal eine Sonderedition mit einer nackten Nixe auf dem Segel auflegen sollten.
»So schnell kann das doch gar nicht ...«, begann er nun.
»Doch, klar. Die wollen ja keinen Oscar«, unterbrach Ingolf. Dann beugte er sich zu Raimund hinunter und setzte noch leiser als zuvor hinzu: »Ich war mal am Set. Die schaffen echt was weg. Guck’s dir mal an. Vielleicht willst du ja auch mal ... du weißt schon.« Er grinste schief. »Zuschauen«, sagte er dann.
Und es war eindeutig, dass er damit ganz sicher nicht zuschauen meinte.
Erst als Ingolf gegangen war, griff Raimund nach seinem Handy.
Monika hatte geantwortet.
Er hatte 19:30 bei ihrem Stammitaliener vorgeschlagen. Sie war einverstanden. Raimund hätte es nicht einmal Ingolf gegenüber zugegeben, aber er war erleichtert.
Kapitel 4
»Ich komme mit.«
»Auf keinen Fall.« Monika starrte ihre Tochter einen Moment lang verärgert an. Dann aber ließ sie den Blick sinken.
»Doch«, sagte Michelle mit fester Stimme.
»Nein.« Das klang schon leiser. »Was soll er denn dann denken?« Noch leiser.
»Dass ich ihn für ein Arschloch halte, das meine Mutter geschlagen hat. Dass er von Glück sagen kann, dass du keine Anzeige erstattet hast. Dass ich ihn am liebsten auf den Mond schießen würde. Mir doch egal. Aber du triffst dich nicht allein mit diesem Kerl. Viel zu gefährlich.«
»Aber ... es ist doch ... wir sind doch in einem Restaurant ...«
»Und?« Michelle zwang sich zur Ruhe. Tief atmen, tief und ruhig atmen. »Ich befürchte ja auch nicht ernsthaft, dass er dich umbringt. Aber ...« Jetzt war sie es, die ihre Gefühle nicht in Worte fassen konnte. »Ich trau ihm nicht. Und ich traue ihm zu viel zu. Er hat dich nicht gut behandelt, und jetzt will er ...« Sie zögerte. Strich sich eine Haarsträhne hinters Ohr. »Ja, was will er eigentlich?«
Monika zuckte mit den Schultern. »Sich ... versöhnen vielleicht?«
»Iih!« Michelle rümpfte in gespieltem Ekel die Nase.
Ihre Mutter wedelte sofort abwehrend mit den Händen. »So doch nicht! Michelle! Du immer mit deiner schmutzigen Fantasie! Wir gehen essen. Beim Italiener. Sonst nichts. Das ist ...« Sie hob die Hände, als wäre es offensichtlich, was das war.
»Das ist mindestens mal schlechter Stil«, beendete Michelle den Satz. »Man schlägt doch nicht einer Frau ein blaues Auge, meldet sich wochenlang nicht, und dann bringt eine Pizza Hawaii alles wieder ins Lot!« Sie schüttelte den Kopf. »Vergiss es. Ich komme mit. Oder du bleibst hier.«
»Meinetwegen«, gab Monika nach. »Wenn es sein muss.«
Doch Michelle konnte die Erleichterung in ihrer Stimme hören.
»Aber hast du nicht gesagt, du musst zur Arbeit?«, fragte sie dann.
»Gleitzeit«, behauptete Michelle.
Ihre Mutter nickte beruhigt. »Ach so. Okay.«
Kapitel 5
Wenn sich niemand mehr an uns erinnert, sterben wir zum zweiten Mal.
Deshalb wollen so viele Menschen ihre Geschichte bewahren – sie füllen Tagebücher mit ihren Erlebnissen, horten Andenken und Erinnerungsstücke, hängen an der Vergangenheit. Sie fahren immer wieder dorthin, wo sie einmal glücklich waren, schauen stets dieselben Serien, bestellen jahrzehntelang immer die gleiche Pizza.
Veränderung ist notwendig, aber gerade dass sie zwangsläufig erfolgt, macht sie beängstigend.
Festzuhalten, Beständigkeit zu erzwingen ist das Gegengift zur Wirklichkeit.
Alles ändert sich, aber wenn wir einfach tun, als ob nicht – vielleicht bleibt dann alles, wie es war.
Im Team, als Paar lässt sich die Zukunft noch besser vermeiden. Jeder Sonntag verläuft gleich, man kennt einander und gibt sich Halt. Der Nippes, die gemeinsamen Habseligkeiten festigen noch das Bollwerk der Zeitlosigkeit. Die Geschichte der Beziehung wird auf diese Weise fassbar, also muss sie wahr sein.
Je instabiler die Gemeinschaft, desto wichtiger der äußere Halt.
Deswegen können wir so schwer zurücklassen, was wir angehäuft haben. Deshalb ist der Besitz uns überhaupt so wichtig. Er zementiert unser Jetzt, das wir für zeitlos halten. Je mehr wir haben, je schwerer wir sind, desto geringer die Gefahr, von einer Flutwelle weggespült zu werden.
Bücher, Kleidung, Geschirr, Küchenmaschinen – je schwerer, größer und mehr, desto sicherer sind wir vor den Unwägbarkeiten des Lebens. Wenn wir genug Trinkgläser haben, um die große Glaskrise von 2025 ungerührt überstehen zu können, verschafft das Sicherheit, Erleichterung, mindert die Angst.
Und es überhaupt so weit gebracht zu haben, Reserven für jede noch so unvorstellbare Krise anhäufen zu können, ist ein Triumph für sich. Die Dinge schützen uns vor dem Leben.
Kapitel 6
Raimund reagierte wie erwartet.
»Hast du dich nicht allein getraut?«, begrüßte er Monika. »Schön, dich zu sehen.« Er streckte Michelle die Hand hin, aber es blieb unklar, wen er mit seinem Satz meinte.
Romeo’s Ristorante in Nienstedten war ein Speckgürtel-Edelitaliener. Lauter behäbige Althippies in karierten Sakkos, die um diese Zeit bereits beim Dessert angelangt waren.
»Setzt euch«, sagte Raimund und deutete auf seinen Zweiertisch. Darauf standen schon zwei Gläser Rotwein und die halb leere Karaffe.
Hauswein zur Versöhnung. Der Wein musste ja nicht schlecht sein, aber eine große Geste war es nicht.
Michelle zog sich einen Stuhl vom Nachbartisch heran.
»Tja«, sagte Raimund und nahm einen Schluck Roten.
»Ja«, entgegnete Monika deutlich leiser. Sie zögerte, dann griff sie ebenfalls nach ihrem Glas.
Raimund gurgelte den Wein, als wäre er beim Zahnarzt, und kam sich garantiert wie ein weltmännischer Kenner vor.
Monika nippte zaghaft.
Keiner von beiden kam darauf, Michelle ein drittes Glas zu bestellen.
Monika stellte ihr Glas ab und starrte auf die Tischdecke. Die Hände lagen in ihrem Schoß. Michelle konnte sehen, dass sie nervös ihre Finger knetete.
Der Kellner kam. Auch er brachte kein Glas für Michelle.
Ohne zu fragen, orderte Raimund: »Eine Pizza Margherita, die isst sie immer. Und für mich Spaghetti Vongole.« Dann erst warf er einen Blick auf Michelle. »Und die junge Dame bestellt selbst.« Als wäre sie vierzehn und man hätte sie widerwillig ins Restaurant mitgenommen, weil sie keine Freunde hatte. Bitte einmal den Kinderteller.
»Haben Sie auch Fisch?«, fragte sie.
Der Kellner nickte eifrig. »Für die junge Fräulein vielleicht eine Steinbeißer in Senfsoße?«, schlug er vor. »Oder eine Lachs-Carpaccio. Oder ...«
»Ich nehme den Steinbeißer. Und ein Glas Weißwein, bitte. Trocken. Und aus der Flasche.«
Mit einem Lächeln, das ihre Verachtung ausdrückte, warf sie einen Blick auf die Karaffe.
»Natürlich, gerne.«
»Und eine Flasche Wasser. Drei Gläser. Oder?«
Sie sah ihre Mutter an. Die wagte kaum, sich zu rühren, nickte dann aber.
Erst in diesem Moment begriff Michelle, welche Angst ihre Mutter vor Raimund hatte. Welche Macht er über sie ausübte.
Was sie nicht verstand, war: Wieso schoss sie dieses aufgeblasene Arschloch nicht in den Wind und – wenn sie schon nicht allein leben wollte – suchte sich jemand, der sein Ego nicht durch Gewalt an Schwächeren aufbessern musste?
Schweigen. Monika schaute weiter auf die Tischdecke. Raimunds Pranken lagen auf dem Tisch. Michelle sah ihn herausfordernd an, aber er wich ihrem Blick aus.
An den umliegenden Tischen wurde bereits abgeräumt. Zehn Euro Trinkgeld, sah Michelle aus dem Augenwinkel, waren hier durchaus nicht unüblich. Provinzprahlerei.
»Und? Wann kommst du wieder nach Hause?«, fragte Raimund auf einmal.
In seiner Stimme lag eine Gutsherrenherablassung, dass Michelle ihm am liebsten eine Gabel in die Hand gerammt hätte. Arroganter Sack.
»Ich ... ich dachte mir ... vielleicht ...«, murmelte ihre Mutter.
»Ach komm schon«, setzte Raimund nach. »Du weißt doch, wie gut wir es ...«
»Jetzt lass sie doch mal ausreden!«, fuhr Michelle ihm in die Parade.
Sein Kopf zuckte zu ihr herum, seine Augen wurden schmal. Verärgert musterte er sie – für ihn war sie wirklich nur eine nervige Göre, der niemand Manieren beigebracht hatte.
Instinktiv wollte Michelle ihn herausfordern. Sollte er doch versuchen, sie zu erziehen. Sollte er sein wahres Gesicht zeigen! Dann würde ihre Mutter schon erkennen, was für ein Typ das war.
Doch Raimund riss sich zusammen. Sein Lächeln war gelogen, aber er sagte: »Natürlich. Du hast recht.« Dann sah er Monika an. »Entschuldige. Bitte! Was wolltest du sagen?«
»Ich ... ich dachte ...«
Michelle hätte ihre Mutter am liebsten gepackt und aus ihr herausgeschüttelt, was sie sagen wollte. Sie konnte Raimunds Ungeduld durchaus verstehen. Aber das war noch lange kein Grund, sie zu schlagen.
Monikas Pizza und Raimunds Spaghetti erlösten sie von dem Diskussionsversuch. Sekunden später kam der Steinbeißer samt Weißwein.
»Guten Appetit!«, wünschte Monika.
Raimund hatte bereits angefangen zu essen und nickte kauend.
Er hatte vielleicht Geld – und für sein Alter sah er nicht wirklich schlecht aus –, aber trotzdem. Er benahm sich, als wäre er der Mittelpunkt der Welt. Und alle anderen müssten ihm zu Diensten sein.
Unzufrieden stellte Michelle fest, dass ihr Steinbeißer ganz hervorragend schmeckte. Die Soße elegant, die Gemüsebeilage bunt und geschmackvoll, der Fisch selbst buttrig zart.
»Also komm, das ist doch nichts, in deinem Alter bei der Tochter unterzukriechen. Geht ihr euch nicht schon auf die Nerven?«, setzte Raimund mit vollem Mund nach.
Michelle konnte es nicht lassen. »Also, ich freu mich, dass Mama bei mir wohnt. Wir hatten es, wie du sicher weißt, nicht immer leicht miteinander – da ist es schön, jetzt als Erwachsene noch einmal füreinander da sein zu können.«
Monika schaute auf und sah sie verwundert an. »Wirklich?«, fragte sie.
Raimund war fast fertig mit seinen Spaghetti, auf Monikas Teller lagen noch mehr als drei Viertel ihrer Pizza.
»Ja, Mama.« Michelle legte ihre Linke auf die rechte Hand ihrer Mutter. »Ich freu mich. Meinetwegen musst du nicht zu Raimund zurück.«
»Was heißt denn hier ›müssen‹?«, sprang der sofort darauf an. »Als wäre es so eine Zumutung, mit mir zu leben! Das ist doch ...« Er starrte Michelle wütend an. »Deine Mutter hat es gut bei mir«, sagte er dann. »Wir hatten es gut miteinander. Bis sie sich in den Kopf gesetzt hat, ihr eigenes Leben leben zu wollen.«
»Äh ... bitte?«, fragte Michelle.
»Ich habe vielleicht ein wenig überreagiert. Aber es muss doch auch Grenzen geben. Und was geht dich das überhaupt an, hm? Wieso mischst du dich in Dinge ein, von denen du nichts verstehst?«
Michelle wurde klar, dass sie ihre Mutter nie danach gefragt hatte, was eigentlich an jenem Abend geschehen war, als sie mit ein paar Klamotten, ihrem Aquarium und einem blauen Auge bei ihr vor der Tür gewartet hatte. Und es interessierte sie auch nicht. Wer ihre Mutter schlug, hatte bei ihr verschissen, so einfach war das.
»Jetzt lass Michelle in Ruhe! Sie meint es nur gut!«
»Aber so kommen wir nicht weiter. Du musst einsehen, dass wir gut zueinanderpassen. Wir können gleich deine Sachen holen und ...«
»Hör auf, sie so unter Druck zu setzen!«
»Ich setze sie gar nicht unter Druck. Ich sage nur, was ich denke. Das wird doch noch erlaubt sein. Wir leben immer noch in einem freien Land!«
»Ich sag dir auch mal, was ich denke. Ich denke, dass du eine arme Wurst bist, die es nötig hat, sich daran aufzugeilen, stärker zu sein als eine über fünfzigjährige Frau. Und du schämst dich noch nicht mal dafür, sondern bist insgeheim stolz darauf. So. Das denke ich von dir!«
»Was ist eigentlich in deine Tochter gefahren? Und wieso lässt du sie so mit mir reden?«, wandte Raimund sich nun an Monika. »Ich fasse es nicht. Da gibt man sich Mühe ... ich habe dich immerhin zum Essen eingeladen. Ich habe dir den Ölzweig entgegengestreckt, und jetzt ...«
Auf einmal nahm Monika ihre Serviette aus dem Schoß, faltete sie sorgsam wie ein Origami, während Michelle und sogar Raimund gebannt zuschauten, legte sie auf den Tisch, stand auf und sagte mit einer Stimme, in der nur ein leiser Hauch des Zitterns lag: »Komm, Michelle, wir gehen.« Dann mit Blick auf Raimund: »Es war ein Fehler, dass ich gekommen bin. Entschuldige, wenn du dir Hoffnungen gemacht hast. Ich dachte, es könnte wieder ... aber das ist ja auch egal. Du bist, wie du bist. Ich bin, wie ich bin. Ich komme in den nächsten Tagen meine restlichen Sachen holen.«
Raimund saß da und starrte seine ehemalige Lebensgefährtin an. »Das wagst du nicht«, sagte er schließlich.
Michelle traute ihren Ohren kaum. Sie wollte gerade zurückschießen, da wiederholte ihre Mutter: »Komm. Lass uns fahren.«
Michelle nickte. In einem Zug trank sie ihr Glas leer, dann gingen sie.
Von draußen durch die Scheibe sah sie noch, wie Raimund anfing, mit dem Kellner zu diskutieren. Wahrscheinlich würde er jetzt behaupten, das Essen sei so schlecht, dass die Damen gegangen seien. Hauptsache, keine Eigenverantwortung.
»Wie bist du eigentlich an den geraten?«, fragte sie ihre Mutter auf dem Weg zum Metrobus.
»Ach, na ja«, sagte die. »Immerhin hat er sich nicht meinetwegen umgebracht. Das ist doch schon mal ein Vorteil.«
Michelle hätte fast ihren halben Steinbeißer ins Wartehäuschen gekotzt. Sollte das heißen, ihre Mutter liebte Raimund mehr als Michelles Vater, weil der Selbstmord begangen hatte? Als ob Wolfgang eine Wahl gehabt hätte.
Ihr war zum Heulen. Oder zum Schreien. Wie konnte ihre Mutter so etwas sagen?
Wie konnte sie es überhaupt wagen, Wolfgang und Raimund miteinander zu vergleichen?
Sie war so wütend, am liebsten hätte sie sich ein Taxi herangewunken und ihre Mutter am Straßenrand stehen gelassen.
Kapitel 7
Michelle und Mina-Cheyenne begrüßten einander mit einer Umarmung. Mina-Cheyenne war keine Fleur, aber Michelle und sie verstanden sich gut.
»Alles gut mit Raven?«, fragte Michelle nach Mina-Cheyennes Sohn.
Sie gingen gemeinsam die Treppe hinunter, um ihre Wertsachen in den Schließfächern zu verstauen.
»Er ist bei Dirk. Der war tatsächlich mal ... na ja, pünktlich ist was anderes. Aber er ist gekommen und hat den Jungen mitgenommen. Raven hat sich wahnsinnig gefreut. Er hat gestrahlt, ach ... wenn er nur einmal so gucken würde, wenn ich ihn wieder abhole.« In Mina-Cheyennes Stimme schlich sich eine tiefe Trauer, die ihr wahrscheinlich gar nicht bewusst war. Sie war vier Jahre jünger als Michelle und hatte es nicht leicht. Ravens Vater war Musiker.
Mina-Cheyenne trug ihr kinnlanges Haar pechschwarz gefärbt mit einer neonpinken Strähne. Ihre Kleidung passte dazu: eng anliegendes Schwarz mit einem Touch Wahnsinn. Sie trug mehrere Piercings in der linken Augenbraue, der Nase und beiden Ohren. Ob noch woanders, war Michelle nicht bekannt – so gute Freundinnen waren sie nun auch nicht.
»Sein Papa ist eben noch ein Held für ihn«, sagte Michelle mitfühlend. »Ist doch schön.«
Mina-Cheyenne nickte langsam. »Da hast du recht. So habe ich es noch gar nicht gesehen. Aber er wird früh genug merken, was für eine Pfeife Dirk ist. Dazu habe ja selbst ich nur ein paar Wochen gebraucht. Also sollte ich ihm das Vergnügen lassen.«
»Beiden«, sagte Michelle und nickte. »Beiden.«
Sie öffnete ihren Spind und legte Handy, Schlüssel und Geldbörse hinein. Dann nahm sie ihre Kette ab.
»Okay. Stimmt.« Jetzt lächelte Mina-Cheyenne wieder. Ihre Launen wechselten schnell wie das Wetter. »Übrigens, weißt du, was ich vorhin gehört habe?« Sie senkte die Stimme und sah sich um, obwohl sie allein in dem kleinen Kellerraum standen.
Michelle schüttelte den Kopf. »Nein.« Aber sie hatte eine Befürchtung. Sie klappte die Metalltür zu und ließ das Schloss einschnappen.
Als sie zur Seite trat, öffnete Mina-Cheyenne ihren Spind, der sich zwei Fächer neben Michelles befand. »Angeblich ist ein Mädchen verschwunden. Einfach so. Du weißt schon, was ich meine, oder?« Ohne auf eine Antwort zu warten, fuhr sie fort. »Also, kein Schulmädchen. Eine Kollegin. Jung, hübsch, schlank. Den einen Tag ist sie noch zur Arbeit gekommen. Danach hat niemand sie mehr gesehen. Nie-mand!« Wie um das letzte Wort zu betonen, drehte sie den Kopf und sah Michelle an.
Im Neonlicht war Mina-Cheyennes Haut ungesund bleich. Michelle wusste, dass sie selbst hier unten genauso aussah. Und dass es nur eine Frage der Beleuchtung war.
Dennoch überkam sie das Gefühl, dass sie alle dem baldigen Tod geweiht waren. Jede einzelne armselige Hure in dieser verfluchten Stadt.
Kapitel 8
Michelle hatte ihr Fenster gekippt und schaute hinaus. Normalerweise hätte sie jetzt eine geraucht. Nur ein paar Züge, um sich zu entspannen. Aber seit ein paar Wochen bekam sie dabei Hustenanfälle. Fleurs Mörder hatten sie fast erstickt, sie konnte noch immer nicht richtig tief ein- und ausatmen.
Also musste sie so mit dem Leben klarkommen. Ohne Hilfe.
Der Tag war echt anstrengend gewesen.
Ikea. Paul. Raimund. Ihre Mutter. Mina-Cheyenne mit ihrer Panik.
Am liebsten hätte sie die Augen zugemacht, sich ins Bett gelegt und geschlafen. Aber dafür wurde sie nicht bezahlt.
Draußen grellte Neon durch die Nacht. Rot, gelb, blau, grün. Ein flackerndes Feuerwerk, das die Sinne doch nur immer weiter abstumpfte. Nimm mich! Nimm mich! Nimm mich ...
Eine dunkle Trauer ballte sich in Michelles Bauch. Sie wusste nicht, wo dieses verdammte Gefühl herkam, aber sie fand es scheußlich und wollte, dass es wieder verschwand.
Stattdessen entdeckte sie auf einmal auf der anderen Straßenseite eine ihr bekannt vorkommende Silhouette. Ein Mann mit breiten Schultern und kurzen Haaren redete mit einer Frau, die einen viel zu kurzen Rock, eine Fischnetzstrumpfhose und hohe Absätze anhatte.
Michelle kannte die Frau vom Sehen.
Der Mann sagte etwas, die Frau sagte etwas, dann berührte sie den Mann am Oberarm und lachte. Michelle konnte die beiden nicht hören – und doch wusste sie genau, wie das Gespräch lief. Die Hand am Oberarm, so weit musste man kommen, dann war der Deal besiegelt. Kaum einer drehte sich danach noch um und ging – es wäre unmännlich gewesen, wie eine verlorene Mutprobe.
Die Frau dort unten machte alles richtig, aber gerade weil der Mann offensichtlich darauf ansprang, öffnete sich die Faust in Michelles Innerem und ließ die Düsternis frei wie schwarze Tinte in einem Glas Wasser.
Der Mann, das war doch ... aber warum sollte ...
Auf einmal spürte sie, wie sie die Stirn an die Scheibe presste, ihre Hand krampfte sich um die Fensterbank, ihr ganzer Schultergürtel war verspannt.
Ärgerlich stieß sie den Atem aus. So ein Quatsch. Das war er nicht. Gerade wollte sie sich abwenden, da setzten sich die beiden dort unten in Bewegung. Sie gingen in das neonbeschriftete Haus hinein, vor dem die Frau gestanden hatte. Das war ja auch nicht anders zu erwarten gewesen.
Der Mann kehrte Michelle den Rücken zu, aber dann drehte er sich auf einmal ins Profil und schaute zu ihr hoch – direkt zu ihrem Fenster –, und sie schreckte zurück. Sie wusste nicht, ob er sie gesehen hatte, schließlich stand sie im Dunkel.
Paul. Er war es doch gewesen. Oder?
Warum sollte Paul ...?
Andererseits – warum nicht?
Sie kannte doch die Männer.
Vielleicht fühlte er sich schuldig ihr gegenüber. Oder ...
Nimm mich! Nimm mich ... flehte eine leise Stimme in ihrem Inneren, die sie nicht abschalten konnte, sosehr sie sich auch bemühte.
Nein, es musste jemand anders gewesen sein. Nicht Paul. Irgendwer. Irgendein dahergelaufener Kerl, wie sie täglich zu Tausenden über die Reeperbahn kamen. Es wäre doch ein viel zu großer Zufall, Paul gleich zweimal an einem Tag zu begegnen.
Wütend stapfte sie hinunter auf die Straße und machte sich wieder an die Arbeit. Keine fünf Minuten später war sie zurück auf ihrem Zimmer. Zu beschäftigt für irgendwelche blöden Gefühle und mit ein paar Scheinen mehr im Portemonnaie.
Nur einmal noch drifteten ihre Gedanken zu Paul ab. Wer nicht will, der hat schon, rief sie sich mit ironischer Bitterkeit zur Ordnung.
Und der Laden auf der anderen Straßenseite war echt ein übler Puff. Da würde sie im Leben keinen Schritt reinsetzen.
Kapitel 9
»Fuckscheiße«, urteilte Gordon fachmännisch. »Das geht nicht. Das geht auf keinen Fall.«
Er strich hektisch über den Fusselbart am Kinn, den er sich seit ein paar Tagen wachsen ließ. Der machte die Sache zwar auch nicht besser: Übergewicht, Pferdeschwanz, Hängejeans und uralte Turnschuhe – aber Gordon musste ja auch nicht gut aussehen, er musste nur aufpassen, dass im Pretty Woman alles lief. In seinem Aufzug machte er den Kunden wenigstens keine Konkurrenz. »Ich halte die Augen offen. Macht euch mal keine Sorgen.« Er tätschelte Mina-Cheyenne väterlich die Wange.
Michelle schüttelte kaum sichtbar den Kopf. Mina-Cheyenne sagte: »Sorry. Ich dachte nur ...« Sie kicherte unsicher. »Na ja, ich geh wieder raus. Nächste Woche ist Monatsanfang – Miete fällig.«
Sie war in Ballerinas gekommen, jetzt trug sie Glitzer-Plateauschuhe, auf denen sie kaum das Gleichgewicht halten konnte. Gordon und Michelle sahen ihr hinterher.
Es war kurz nach Mitternacht, und Mina-Cheyenne war Michelle jedes Mal, wenn sie sich trafen, mit ihren Angstgeschichten auf die Nerven gegangen. Bis die sich schließlich bereit erklärt hatte, mit Gordon zu sprechen. Auch wenn es sinnlos war. Was sollte der denn machen? Aber wenigstens war Mina-Cheyenne jetzt beruhigt.
»Tut mir echt leid, unsere kleine Mina«, brummte Gordon. »Ich verstehe nicht, wieso sie dauernd blank ist. Die verdient auch nicht weniger als ... die meisten anderen. Ein bisschen weniger als du. Aber nicht viel.«
»Schleimer«, entgegnete Michelle mit einem Lächeln. Sie war gut im Geschäft, zufriedene Stammkunden brachten zuverlässig Umsatz. Offiziell war Michelle immer noch für Betriebswirtschaftslehre eingeschrieben, und das ein oder andere war in den ersten Semestern doch hängen geblieben. Als sie noch zu den Vorlesungen gegangen war. Premiumpositionierung beispielsweise.
Sie war der Typ »natürliches Mädchen von nebenan«. Freundlich. Berechenbar. Hübsch, aber nicht aufgedonnert. Anspruchslos. Jederzeit bereit.
Die ideale Freundin.
Dafür waren Männer bereit zu zahlen.
Und warum auch nicht? Wenn sie im Fitnessstudio eine Frau kennenlernten, mussten sie erst mal drei teure Dates lang ausloten, ob man zueinanderpasste. Da war es preiswerter und effektiver (und in gewisser Weise auch ehrlicher), gleich ins Pretty Woman zu kommen.
»Ich glaub, sie füttert Ravens Vater noch mit durch. Der ist Musiker, das ist ein hartes Brot.«
»Hm, hm«, machte Gordon und kratzte sich am Hintern. »Schön doof. Schön doof.«
»Wo die Liebe hinfällt«, sagte Michelle. Sie hatte den Glauben an das Gute noch nicht verloren.
»Liebe. Auch das noch. Hast du heute deinen Philosophischen?«, schnaufte Gordon. Er schaute hoch zu dem Fernseher in der Ecke des Eingangsbereiches und murmelte: »Schieß doch, du Idiot. Wozu kriegst du denn die Millionen?«
Michelle sah ebenfalls auf den Bildschirm. Ein kleines weißes Männchen stolperte über den Ball und stürzte.
»Ach, das kann doch nicht wahr sein!«
»Was ist das? Hobbyrunde?«, fragte sie.
»Peru gegen Vietnam. Die sind wahrscheinlich beide froh, wenn sie elf Spieler zusammenbringen. Auch egal.« Jetzt wandte er sich wieder ihr zu. »Wir können nicht zulassen, dass sich das rumspricht. Nicht unter den Kolleginnen. Nicht unter den Kunden. Das ist schlecht fürs Image. Ganz schlecht. Mit Entführungen will niemand was zu tun haben. Sex sells. Verschwundene Mädchen sellen überhaupt nicht.«
Michelle grinste. »Was glaubst du eigentlich, wo du arbeitest? Im Apple Store?«
»Pfft«, prustete Gordon. Dann setzte er leiser hinzu: »Ich hab noch nie davon gehört, dass so was wirklich passiert ist. Immer nur Hörensagen. Aber trotzdem. Man weiß nie. Also, sei vorsichtig, okay? So was ist echt Fuckscheiße.«
Michelle nickte.
Keiner glaubte richtig daran. Aber trotzdem. Auf einmal fühlte sich die Sache verdammt ernst an.
Kapitel 10
Das Ende.
Der größte Gleichmacher.
Das Einzige, was sicher ist.
Unsere größte Angst – und zugleich die größtmögliche Motivation, etwas aus dem Leben zu machen.
Niemand weiß, wie lange man lebt.
Wochen, Monate.
Jahre.
Jahrzehnte.
Oder eben doch nur noch ein paar Tage.
Und was macht schon ein gutes Leben aus? Leb jeden Tag, als wäre es der letzte. Was soll das heißen? Keine Arbeit, lieber tanzen?
Wenn sich der Vorhang senkt, worauf wollen wir zurückblicken? Angeblich hat jeder Mensch ein Ziel, ein Talent, eine Aufgabe. Aber woher soll man wissen, worin die eigene Aufgabe besteht? Und wer hat sie gestellt?
Schulden wir am Ende einem himmlischen Lehrvater Rechenschaft? Oder sind wir nur Ameisen, winziger als Staubkörner, die zufällig auf einem blauen Planeten umherirren und einander daran hindern, glücklich zu sein?
Was ist der Sinn des Lebens? Gibt es ihn überhaupt?
Hört deine Freiheit dort auf, wo meine beginnt?
Sind die glücklichsten Menschen diejenigen, die mit sich und der Welt in Einklang leben – die nicht mehr verlangen, als sie bereits besitzen?
Oder sind die freiesten und glücklichsten Wesen vielleicht eher jene, die keine Rücksicht kennen, keine Gnade, deren Ich heller lodert als der Tag, die sich ihre Welt erschaffen und jeden anderen untertan machen? Unzweifelhaft bringen sie Leid über ihre Mitmenschen, aber die könnten sich ja wehren. Entsteht eine neue Welt vielleicht erst im Gleichmaß dieser Kräfte statt in hippiehaftem Rückzug?
Müssen wir überhaupt Angst vor dem Tod haben?
Oder ist er nicht in Wahrheit unser größtes Glück? Denn sonst müssten wir ewig leben. Ewig leiden.
Das ganze verdammte Leben war eine einzige offene Wunde, von der niemand wusste, wie sie zu heilen ist.
Kapitel 11
Raimund Krämer erwachte vom Klirren des Weinglases, das er mitsamt der Flasche vom Couchtisch gestoßen hatte.
Er war auf dem Sofa eingeschlafen.
Ärgerlich kniff er die Augen zusammen, das ganze Gesicht. Er fühlte sich alt und verbraucht.
Und er musste pissen.
Diese undankbare Kuh. Er stemmte sich hoch, saß einen Moment da, erhob sich dann und stampfte Richtung Klo. Überall glommen Lichter: der Fernseher, der Computer, das Telefon, durch das Fenster sickerte ein Rest Straßenlaterne. Raimund stützte sich mit der rechten Hand an der Wand ab und zielte mit der linken. Es dauerte einen Moment, bis der Urin zu tröpfeln begann. Diese blöde, undankbare Kuh. Jetzt musste er wieder von vorne anfangen, sich jemand anders suchen. Er war nicht gern allein.
Raimund war nun mal eine Unternehmerpersönlichkeit. Ein Alphamann. Das hatte doch nicht nur Schattenseiten, verdammt noch mal!
Er stand da und starrte gegen die Wand.
Und die Tochter. Noch schlimmer als die Mutter.
Vielleicht war es besser so. Auch wenn es Mühe machte.
Sie hatten es doch gut gehabt, so was warf man doch nicht einfach weg, mal eben so. Aber wenn sie es so wollte, dann würde er auch ohne sie klarkommen. Er würde ihr ganz sicher nicht hinterherlaufen. Hatte man ja heute gesehen, dass das ein Fehler war.
Und die Tochter stachelte sie nur auf.
Weil er nicht ihr Papa war, natürlich. Niemand war so toll wie der Herr Papa, der aber nicht mit dem Leben klargekommen war und sich die Birne rausgepustet hatte.
Raimund hatte das nie verstehen können. Warum Menschen sich umbrachten. Das Leben war doch lebenswert. Da konnte man doch was draus machen. Sogar aus Krisen. An denen konnte man wachsen, da musste man doch nicht gleich den Stecker ziehen.
Auf einmal saß er wieder auf dem Sofa. Keine Ahnung, wie er hierher zurückgekommen war.
Die Uhr unter dem Fernseher zeigte halb drei. Draußen fuhr ein einsames Auto vorbei. Es war eine gute Gegend, in der die meisten Leute früh zu Bett gingen. Man hatte seine Ruhe und man ließ einander in Ruhe.
So ließ es sich doch leben.
Er war müde und wach zugleich.
Beinahe hätte er sich wieder auf die Couch zurücksinken lassen. Aber dann stützte er sich doch wieder hoch. Er schlief doch nicht wie ein Penner seinen Rausch aus!
Auf der Treppe wäre er beinahe gestolpert, fing sich aber rechtzeitig. Als er auf sein Schlafzimmer im ersten Stock zuging, schwankte die Welt ein wenig, und er ließ vorsichtshalber die Hand an der Wand entlanggleiten.
Schließlich hatte er es geschafft. Raimund sank rücklings ins Bett, strampelte seine Hose ab und überlegte, ob er sich das Hemd ausziehen sollte oder nicht, entschied sich dann aber dagegen, zog die Decke bis zum Kinn hoch und schloss erschöpft die Augen.
Dass es ihm jetzt so mies ging, war alles nur die Schuld dieser undankbaren Kuh. Dabei hätten sie es so gut haben können. Alles nur ihre Schuld.
Kapitel 12
Amira Zhao kam um vier Uhr morgens zur Arbeit. Auf diese Weise war sie zurück, um ihre Schwester May-Lin zur Samstagsschule zu schicken. Chinesisch, die Sprache ihrer Eltern.
Auf der Reeperbahn konnte man rund um die Uhr alles kaufen – von Waffen über Drogen bis zu Sex. Nur Liebe war selten im Angebot.
Doch das Hauptgeschäft endete um drei. Dann schickte Gordon die Mädchen nach Hause und schloss ab.
Amira öffnete den Notausgang und ging den Reinigungskarren holen, der in einem abgeschlossenen Raum im Keller stand. Sie kippte das Fenster, denn die Luft im Raum war miefig-feucht. Mit einem alten Lastenaufzug fuhr sie in den zweiten Stock.
Nur die Notbeleuchtung brannte. Es roch nach Schweiß und ... ja, vor allem nach Schweiß. Und nach Körpern, nach Haut auf Haut, vielleicht nach Bier und Auspuffgasen, den Ausdünstungen der Nacht. Das vergitterte Fenster am Ende des Flurs war auch geschlossen, auf der anderen Straßenseite blinkte seelenlos eine grellbunte Neonreklame. Davor ein halb toter Ficus.
Der Teppich im Flur war abgetreten. Amira leerte zügig die Mülleimer in den Zimmern, wechselte Handtücher und Bettlaken. Sie saugte einmal durch den Flur, dann ein Stockwerk tiefer dasselbe.
Als sie den Karren wieder wegstellte, hörte sie durch das gekippte Kellerfenster eine männliche Stimme. »Hallo? Hallo? Arbeiten Sie hier?«
Amira schaute auf.
Durch den Fensterspalt war ein halbes Männergesicht zu sehen. Der Mann musste dort draußen auf dem Boden knien, um sie ansehen zu können.
»Entschuldigung«, sagte der Mann mit gepresster Stimme. »Ich suche meine Schwester. Sie ...« Er machte eine Pause, blinzelte. »Ich glaube, sie hat hier in der Gegend gearbeitet. Sie heißt Sarah. Haben Sie sie vielleicht gesehen?« Er hob ein Foto und schob es durch den Fensterspalt.
Amira zögerte, danach zu greifen. Man wusste ja nie. Aber was sollte der Kerl ihr durchs Fenster schon antun? Und er guckte wie ein trauriges Hündchen.
Auf dem Foto war ein hübsches Mädchen mit dunkelblondem Haar und einem freundlichen Lächeln. In wenigen Jahren würde May-Lin im selben Alter sein.
»Ich ... nein!«, sagte sie und schüttelte den Kopf. »Nein. Tut mir leid.«
Sie wandte sich ab. Der Mann rief ihr hinterher: »Sind Sie sicher? Ich kann Ihnen meine Nummer geben! Sarah muss doch irgendwo sein!«
»Tut mir leid«, rief Amira noch einmal über die Schulter und verließ schnell den Raum.
Sie dachte an ihre kleine Schwester. Und dass sie alles, wirklich alles dafür tun würde, niemals in die Situation des Mannes dort draußen zu geraten.
Armer Kerl.
Deswegen kam sie jede Nacht hierher. Sie musste diesen Job behalten und Geld für sich und May-Lin verdienen. Sonst drohten Jugendamt, Waisenhaus, Adoption, die schiefe Bahn – auf die Amira fast selbst geraten wäre. Auf jeden Fall würde man sie auseinanderreißen. Und niemand konnte so gut für May-Lin sorgen wie sie. Niemand.
Seit dem Tod ihrer Eltern lebte Amira in ständiger Angst. Lange hatte sie die mit Gewalt und Drogen betäubt. Das ging jetzt nicht mehr. Was gut war für May-Lin. Aber an manchen Tagen furchtbar für Amira.
Kapitel 13
Monika hatte die Frühstücksnische in der Küche aufgehübscht. Bunte Schneidebretter, bunte Eierbecher, Teller mit bunten Punkten, gemusterte Servietten. Wie bestellt blühte eine der Geranien auf der Fensterbank.
»Ist Ostern, oder was?«, murmelte Michelle verschlafen.
»Ich dachte ... ich mache mich mal ...«, entgegnete Monika mit einem Hauch Angst in der Stimme.
»Schon gut, Mama, schon gut. Es gefällt mir ja. Es ist nur ... du überraschst mich immer wieder. Ich hatte gar nicht mitbekommen, wie du alle diese Sachen in den Wagen gepackt hast.«
»Aber es gefällt dir? Ja?«
»Ja. Wirklich sehr hübsch. Fröhlich. Ganz anders als ich am Morgen.«
»Ja, ich dachte, vielleicht ...«
Wie so oft ließ Monika ihren Satz unbeendet.
»... hilft das gegen meine Muffigkeit?«, vollendete Michelle ihn.
»Das habe ich nicht gesagt!«
»Aber gedacht!« Michelle ließ sich auf einen der Stühle sinken, die in der Küchenecke vor dem kleinen Tisch standen. Ihre Mutter schenkte ihr Kaffee ein. »Hast du etwa auf mich gewartet?«, fragte Michelle, als sie entdeckte, dass der Teller ihrer Mutter noch unbenutzt war.
Die Küchenuhr zeigte kurz nach elf.
»Natürlich!«
»Mach das nicht. Dann kriege ich nur ein schlechtes Gewissen.«
»Ich habe Eier gekocht«, ignorierte Monika ihre Tochter. Sie griff nach einem Körbchen auf dem Küchentresen, in dem ein Handtuchpäckchen lag. »Und ich kann dir sagen, wessen Eier ich auch gern kochen würde!«, setzte sie dann mit einem Lächeln und in ganz normalem Gesprächston hinzu.
»Was?«, fragte Michelle entgeistert, während sie das Geschirrhandtuch aufschlug und sich ein Ei nahm. »Was hast du gesagt?«
»Ich habe gesagt, ich wüsste schon, wessen Eier ich gern kochen würde«, entgegnete Monika liebenswürdig. »Dieser sexversessene alte Bock.«
»Mama, was ... Moment mal. Du redest von Raimund, oder?«
Ihre Mutter nickte, stellte das Körbchen mit den Eiern zurück und zog für sich eine Scheibe Knäckebrot aus einer Packung, die Michelle bestimmt nicht gekauft hatte.