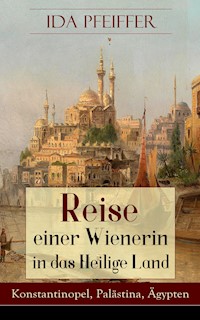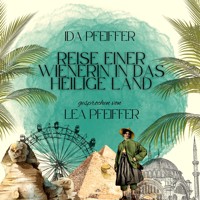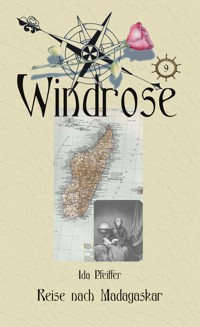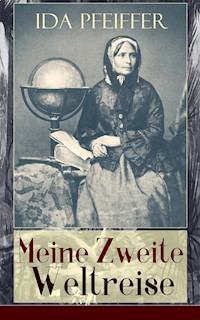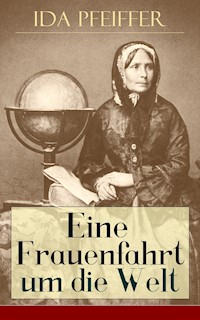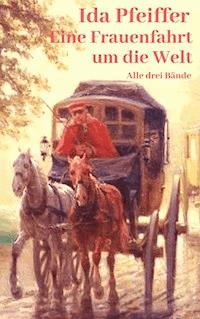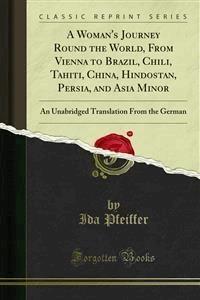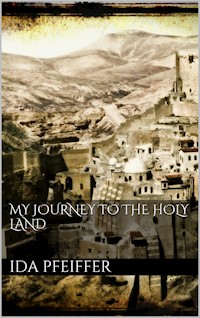1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Dieses eBook: "Reise nach Madagaskar" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Ida Pfeiffer (1797-1858) war eine österreichische Weltreisende, die als erste europäische Frau das Innere der Insel Borneo durchquerte. Zur Handlung: Ziel der nächsten Reise, die im Mai 1856 begann, sollte Australien sein - der einzige Kontinent, den Ida Pfeiffer noch nicht besucht hatte. Nach Stationen in Berlin, Amsterdam und London bestieg sie in Rotterdam ein Schiff nach Mauritius. Dort hielt sie sich mehrere Monate auf und reiste im April 1857 weiter nach Madagaskar. Trotz der generell ausländerfeindlichen Haltung der Königin Ranavalona erhielt die Reisende Gelegenheit, das Landesinnere, die Hauptstadt Antananarivo und dort auch die Königin zu besuchen. Als jedoch innenpolitische Unruhen ausbrachen, wurde sie der Spionage beschuldigt, inhaftiert und zusammen mit weiteren fünf Europäern ausgewiesen. Fieberkrank und von Soldaten eskortiert musste sie auf dem Weg zur Küste 53 Tage lang sumpfige und malariaverseuchte Gebiete durchqueren. Im September 1857 war sie wieder auf Mauritius, überstand mehrere Krankheitsschübe und plante die Weiterreise nach Australien. Nach erneuter Erkrankung im Februar 1858 war sie gezwungen, nach Europa zurückzukehren und erreichte über London und Berlin im September 1858 ihre Heimatstadt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Reise nach Madagaskar
Nebst einer Biographie der Verfasserin, nach ihren eigenen Aufzeichnungen (Ihre letzte Reise)
Inhaltsverzeichnis
Reise nach Madagaskar
Vorrede.
Ich befand mich in Buenos-Ayres, als ich die traurige Nachricht von dem Ableben meiner geliebten Mutter erhielt. Kurz vor ihrem Tode hatte sie den Wunsch geäußert, daß ich ihre Papiere, die letzte Reise nach Madagaskar betreffend, ordnen und zur Veröffentlichung vorbereiten sollte. Die schwere Krankheit, welche sie gleich nach ihrer Rückkunft von Madagaskar in Mauritius befiel, und die trotz der besten ärztlichen Hilfe, trotz der aufmerksamsten Pflege und Sorgfalt von Seite ihrer Freunde und Verwandten, ihren Tod herbeiführte, hatte ihr nicht erlaubt, dieß selbst zu thun.
Als ich nach einigen Monaten von Buenos-Ayres nach Rio de Janeiro zurückkehrte, fand ich daselbst sämmtliche Schriften meiner Mutter bereits vor; aber der Verlust war zu neu, mein Schmerz noch zu heftig, als daß es mir möglich gewesen wäre, dieselben zu lesen, oder sie gar mit jener Muße und Aufmerksamkeit zu sichten, die zu ihrer Veröffentlichung erforderlich waren.
Endlich entschloß ich mich dazu — ich mußte es thun — es war ja der letzte Wunsch meiner Mutter. Die Pietät gebot mir, die Niederschreibungen der Verblichenen mit möglichst wenig Veränderungen wiederzugeben. Indem ich daher dieß letzte Werk meiner Mutter in die Oeffentlichkeit einführe, hege ich die Ueberzeugung, daß die freundlichen Leser es mit jenem Wohlwollen aufnehmen werden, das den früheren Werken der Weltreisenden von so vielen Seiten zu Theil wurde.
Rio de Janeiro, am 8. Juli 1860.
Oscar Pfeiffer.
1. Kapitel.
Abreise von Wien. — Linz, Salzburg, München. — Das Künstlerfest. — Der König von Baiern. — Berlin. — Alexander von Humboldt. — Hamburg.
Am 21. Mai 1856 verließ ich Wien, um abermals eine große Reise zu unternehmen. Ich schiffte mich in Nußdorf (nächst Wien) auf dem schönen Dampfer „Austria“ ein, welcher die Donau aufwärts nach Linz ging. Die Dampfschiffahrts-Gesellschaft war nicht nur so gefällig, mir eine Freikarte zu geben, sie stellte sogar eine Kabine zu meiner alleinigen Verfügung und sorgte für Kost und alle Bequemlichkeiten.
Die kurze Fahrt von Wien nach Linz (30 deutsche Meilen, welche man in 21 Stunden zurücklegt) ist höchst reizend. Wenig andere Stromufer bieten gleich jenen der Donau so mannigfaltige Ansichten, so malerische Landschaften dar. Berge und Thäler, Städte und Ortschaften, prachtvolle Klöster und geschmackvolle Landsitze ziehen in nie endender Reihenfolge an dem Auge vorüber, und auch an halbverfallenen Ritterburgen mit romantischen Märchen und Sagen fehlt es nicht. Von dem freundlichsten Wetter begünstigt, von einer angenehmen Gesellschaft umgeben, hegte ich den Wunsch, auf meiner neuen Reise noch öfter mich in so angenehmen Verhältnissen zu bewegen.
Auf dem Schiffe machte ich außer anderen Bekanntschaften auch jene der Gattin des geschätzten Arztes Herrn Pleninger in Linz. Diese liebenswürdige Frau bestand darauf, daß ich in ihrem Hause absteigen müsse. Leider war meines Bleibens in Linz nicht lange, denn ich wollte am Tage meiner Ankunft noch nach Lambach fahren. Dr. Pleninger veranstaltete nichts destoweniger des Vormittags eine kleine Lustpartie nach dem nahen Freudenberge, auf welchem ein großes Jesuiten-Kloster liegt, das außer den geistlichen Herren über 150 Zöglinge beherbergt, welch' letztere für die geringe Summe von 12 fl. C.M. monatlich Wohnung, Kost und überdieß noch Unterricht empfangen. Das Institut scheint mit Sorgfalt und besonderer Ordnung verwaltet zu werden; es besitzt bereits eine kleine Sammlung ethnographischer Gegenstände und einen botanischen Garten, der unter der Leitung des hochwürdigen Herrn Hintereker, eines sehr geschätzten Botanikers, steht. Die Aussicht von dem Freudenberge gehört zu den hübschesten, und ich empfehle Jedermann diesen Spaziergang, selbst wenn er das Kloster nicht sollte besichtigen können.
Ich blieb bei Dr. Pleninger über Mittag und nach Tische fuhr ich mit der Eisenbahn nach Lambach, 8 deutsche Meilen, zu welchen man 3 volle Stunden benöthigt.
In Lambach nahm ich den Salzburger Omnibus. Leider war es kein englischer Omnibus, sondern ein deutscher, ein echter, unverfälschter deutscher Omnibus, dessen deutsche Pferde mit ruhiger Gemächlichkeit dahintrabten, jede Meile eine Stunde — 12 Meilen beträgt die Entfernung, nach 12 Stunden kamen wir an — die Rechnung war vollkommen richtig.
In Salzburg regnete es, wie gewöhnlich. Nicht mit Unrecht nennen meine Landsleute diese Stadt ein „wahres Regenwinkel.“
Man erzählt, daß einst ein Engländer, der mitten im Sommer nach Salzburg kam, Stadt, Thal und Berge in Nebel und Regen gehüllt fand. Er hatte so viel von der reizenden Lage Salzburgs gelesen, daß er, einige Tage verweilte; da sich aber der Himmel nicht im geringsten aufheiterte, verlor der Sohn Albions am Ende die Geduld und reiste ab. Nach zwei Jahren, auf der Rückreise von Italien, nahm er den Weg wieder über diese Stadt, in der Erwartung glücklicher zu sein — vergebene Hoffnung, es regnete gerade so wie vor zwei Jahren! Da rief der Mann ganz erstaunt aus: „Wie, hat dieser Regen noch nicht aufgehört?“
Ich hätte dasselbe sagen können, denn obwohl ich auf meinen verschiedenen Reisen schon einige Male über Salzburg gekommen war, bin ich doch nur einmal so glücklich gewesen, diese schöne Gegend im Sonnenscheine zu sehen. Und schön ist sie, wunderbar schön; nicht leicht wird man ein freundlicheres Städtchen finden, in einem so frischen, üppigen Thale gelegen und von so großartigen Gebirgsmassen umgeben (der Watzmann mit beinahe 9000 Fuß Höhe).
Ich blieb dießmal nur einen halben Tag in Salzburg und besuchte lediglich das Standbild Mozart's, welches seit meinem letzten Hiersein aufgestellt worden war. Mozart ist, wie bekannt, in dieser Stadt im Jahre 1756 geboren.
Von Salzburg fuhr ich mit dem Stellwagen nach München. Diese Art zu reisen gehört wohl von jeher nicht zu den angenehmsten, ist aber nun seit Erfindung der Eisenbahnen wirklich unerträglich geworden. Zusammengepreßt gleich Negern in einem Sklavenschiffe trieben wir uns auf dieser kleinen Strecke (19 deutsche Meilen) zwei ganze Tage umher. Glücklicherweise hörte wenige Stunden hinter Salzburg der Regen auf, auch ist die Gegend bis ungefähr 4 Meilen vor München fortwährend schön. Die baierische Grenze betritt man schon nach der ersten Meile; das Besehen des Passes und des Gepäckes ging zu meiner größten Verwunderung sehr rasch von statten.
Gegen Abend kamen wir an den Chiem-See, auch das baierische Meer genannt. Dieser herrliche See hat 2 Meilen in der Länge, 1½ in der Breite, ist auf drei Seiten von bedeutenden Gebirgen umschlossen und mündet auf der vierten in eine unübersehbare Ebene.
Unweit Traunsteins schlugen wir einen Seitenweg nach Sekon ein, einer freundlichen Besitzung der verwitweten Kaiserin von Brasilien (geborne Leuchtenberg). Sekon liegt an einem winzigen See, dessen Wasser mineralische Bestandteile enthalten soll. Die Kaiserin hat ein am Ufer stehendes großes Gebäude, ein einstmaliges Kloster, in ein Badehaus mit 50 Zimmern umwandeln und sehr geschmackvoll einrichten lassen. Ein niedlicher Garten umgibt das Gebäude; für Küche, Fahrgelegenheiten und andere Bequemlichkeiten ist auch auf das Beste gesorgt, und zwar zu erstaunlich billigen Preisen. Ein sehr schönes Zimmer z. B. kostet pr. Woche 3 fl. C.M., Table d'hôte 24 Kreuzer, ein einspänniger Wagen pr. Tag 2 fl. u.s.w. Gewiß wird daher dieser liebliche Badeort, wenn er einmal mehr bekannt ist, Gäste in Menge herbeilocken; freilich werden dann auch die Preise steigen.
Von Sekon ging es nach Wasserburg. Dieses Städtchen hat eine merkwürdige Lage; es liegt in einem förmlichen Kessel, welcher beinahe auf allen Seiten von schroff abfallenden Stein- und Sandwänden umfaßt ist. Als wir an den Rand gelangten, kam es mir vor, als thäte sich plötzlich zu meinen Füßen ein riesiger Krater auf — aber statt Feuer und Flammen barg er eine reizende Landschaft. Die Häuschen lagen da, so abgeschieden und verborgen wie in einer anderen Welt, der Inn strömte dazwischen mit seinen dunkelgelben Fluten, auf welche gar reges Leben herrschte, denn Hunderte von Flößen werden hier aus Bauholz und Brettern zusammengefügt und nach fernen Gegenden verschifft. In einem großen Bogen fuhren wir nach der Tiefe, und da gewahrte ich erst, daß der Kessel viel größer war als er von der Höhe schien, und daß er auch zahlreichen Hopfen-Pflanzungen Raum gab, die man füglich Baierns Weingärten nennen könnte.
Am 26. Mai kam ich in München an. Der Theil Baierns, welchen ich auf dieser kleinen Reise kennen lernte, gefiel mir ausnehmend gut; die Landschaften sind reizend, die Städtchen und Dörfer freundlich, die Felder gut angebaut. Die einzelnen Bauernhöfe besonders tragen ein gewisses Gepräge von Wohlhabenheit, Reinlichkeit und Ordnung an sich. Sie sind von Stein, geräumig und meist mit einem Stockwerke versehen; die Bedachung ist nach Schweizer-Art, wenig aufsteigend und mit großen Steinen beschwert, um sie gegen die heftigen Stürme zu schützen. Was ich tadeln möchte, ist, daß Wohnhaus, Scheune und Stall unter einem Dache vereint sind, und daher der Bauer bei einer Feuersbrunst leicht um sein ganzes Hab und Gut kommen kann.
Wenn man diese herrlichen Gründe und Felder sieht (alles stand gerade in üppiger Fülle) — die freundlichen Dörfer, die schön gebauten Bauernhöfe, sollte man meinen, daß es da Armuth gäbe, daß viele der Bewohner gezwungen seien auszuwandern, um in fremden Welttheilen eine neue, die Mühen besser lohnende Heimath zu suchen?
Und doch ist es so. — Die Hauptursache mag wohl darin zu finden sein, daß in einem großen Theile von Baiern, besonders in Ober- und Unter-Baiern und in der Oberpfalz, die Bauerngüter nicht getheilt werden, sondern auf ein einziges der Kinder übergehen, und zwar auf jenes, welches der Vater dazu bestimmt. Der glückliche Auserwählte hat wohl die Verpflichtung, seine Geschwister, wie man sagt, hinauszubezahlen, doch bekommen die letzteren nie sehr viel; denn das Gut wird immer unter seinem Werth geschätzt und dem Haupterben außerdem noch eine verhältnißmäßig bedeutende Summe unter dem Namen „Mannslehen“ zuerkannt. Den Geschwistern bleibt natürlich nichts Anderes übrig, als Dienst zu suchen, Gewerbe zu erlernen oder auszuwandern. — Doch auch in den übrigen Provinzen, wo die Güter getheilt werden, findet man viel Armuth und gleichfalls die Auswanderung in Blüthe — aus welchen Ursachen, weiß ich nicht zu bestimmen.
Höchst eigenthümlich ist in dieser Gegend die Tracht der Bäuerinnen. Sie tragen kurze, aber sehr faltenreiche Röcke und doppelte Leibchen, von welchen das erste mit langen Aermeln versehen ist. Das zweite, ohne Aermel und gewöhnlich von dunkelfarbigem Sammt, wird über das Erste angezogen und mit silbernen Nesteln zusammengeschnürt. Der Halsschmuck besteht bei den Wohlhabenden aus 8 bis 10 Schnüren kleiner echter Perlen mit großen Schließen, welche vorne angebracht sind. Die Aermeren begnügen sich statt der echten Perlen mit von Silber nachgeahmten.
München kam mir sehr stille vor; es wird wenig gefahren und nur in den Hauptstraßen herrscht einiges Leben.
Ich hielt mich nur sechs Tage in dieser Stadt auf, lernte aber in der kurzen Zeit viele Familien kennen. Soviel ich beurtheilen konnte, ist das häusliche Leben einfach und gemüthlich und das schöne Geschlecht scheint hier nicht so viel auf äußeren Prunk zu halten, wie es in anderen Hauptstädten der Fall ist. Ich gestehe, daß mir die Lebensweise in München sehr gut gefiel.
Einem besonderen Zufalle hatte ich es zu verdanken, daß ich die Bekanntschaft vieler ausgezeichneter Leute, besonders Künstler, machte. Es wurde nämlich gerade das Künstlerfest gefeiert, und man war so freundlich mich dazu einzuladen. Die Namen all' der bedeutenden Persönlichkeiten zu nennen, welchen ich bei dieser Gelegenheit vorgestellt wurde, möchte meine Leser vielleicht ermüden — in meinem Gedächtnisse erlöschen sie aber nicht.
Des Festes selbst, das jedes Jahr an einem schönen Maitage abgehalten wird, will ich nur mit einigen Worten erwähnen.
Es fand zu Schwanegg und Pullach statt, auf schönen Wiesen mitten in Waldungen gelegen. Bei Schwanegg, einem Schlößchen, von Herrn von Schwanthaler im gothischen Styl erbaut, wurde ein komischer Drachenkampf vorgestellt, eine Parodie des Schiller'schen „Kampf mit dem Drachen.“ Die Burg Schwanegg war während eines vollen Jahres von einem Drachen derart belagert, daß Niemand weder aus noch ein konnte. Ein Ritter zieht zufällig des Weges, man gewahrt ihn von dem Wartthurme aus, die Bewohner der Burg versammeln sich allsogleich auf dem Söller und flehen den Ritter in höchst burlesken Knittelversen an, sie von dem Ungethüme zu befreien. Hierauf erfolgt der Kampf, das Unthier erliegt u.s.f.
Nach dem Drachenkampfe fand in dem Wäldchen bei Pullach eine zweite Vorstellung statt: der Frühling den Winter vertreibend. Hier gab es lustige Umzüge: Bacchus auf einer Weintonne sitzend, von riesigen Maikäfern (jeder von einem Menschen dargestellt) gezogen und umschwärmt — Apollo auf einem Triumphwagen mit Pegasus als Gespann und von Schmetterlingen, Blumen und Insecten umgeben, die von 1 bis 2 Fuß Höhe in Kartenpapier ausgeschnitten, schön gemalt und an hohen Standarten befestigt waren. Kurz, ein heiterer Scherz und Schwank löste den andern ab, und das schaulustige Publicum unterhielt sich auf das beste — es war ein wahres Volksfest. Gewiß an 10,000 Personen fanden sich da versammelt, die sich alle fröhlich und vergnügt den ganzen Tag umhertrieben und nur eine große Familie auszumachen schienen. Die Einen fanden Platz unter den Bäumen an langen Tischen, die Anderen lagerten sich einfach auf den Rasen, überall aber wurde gar tapfer dem Lieblingsgetränke zugesprochen, dem Bier, ohne das sich ein echter Baier wohl nicht gut unterhalten kann. Dessenungeachtet lief alles sehr anständig ab und nur gegen Abend gab es hie und da Einen, der des Guten ein wenig zu viel gethan hatte. Glücklicherweise scheint der Hopfengeist ein gutmüthiger Geist zu sein, der bloß die Munterkeit steigert, denn ich hörte von keinem Zanke oder Raufhandel.
Zu der ersten Vorstellung war auch der König Max gekommen, und zwar in einfachem schlichten Bürgerrocke. Später im Theater sah ich sowohl den König als auch den ganzen Hof in Civil-Kleidern. Schon seit langer Zeit habe ich keinen Monarchen im Civil-Kleide gesehen; Uniform und nichts als Uniform tragen die gekrönten Häupter, als ob sie blos dem Soldatenstande zugehörten. Freilich, was wären auch die Meisten ohne Soldaten?!
König Max scheint nicht dieser Ansicht zu sein; er ehrt die Bürger und scheut es nicht mit ihnen zu verkehren. Er ging so recht mit dem großen Haufen, ohne von Dienern begleitet oder von Polizei-Agenten eskortirt zu sein; er bahnte sich selbst den Weg und die Leute umschwärmten ihn ungezwungen von allen Seiten.
Es wurde dem Könige gesagt, daß sich meine Wenigkeit unter den Zuschauern des Festes befände, und sogleich mußte ich ihm im Angesicht von Tausenden von Menschen vorgestellt werden. Seine Majestät unterhielt sich einige Zeit auf das Freundlichste mit mir.
Von den Sehenswürdigkeiten, von all' den Kunstwerken zu sprechen, welche München enthält, gehört nicht in mein Tagebuch; das finden meine Leser, die hierüber Aufschluß haben wollen, viel besser in einer oder der anderen von den vielen trefflichen Beschreibungen, die über diese kunstsinnige Stadt erschienen sind.
Zwei liebenswürdige Damen, Baronin Du-Prel und Baronin Bissing, waren so freundlich, mich von Gallerie zu Gallerie, von Kirche zu Kirche zu führen. Nichts ermüdet jedoch mehr, nichts ist anstrengender für Geist und Körper, als zu Vieles sehen in kurzer Zeit. Diese sechs Tage erschöpften mich mehr als ein doppelt so langer Aufenthalt in tropischen Urwäldern, wo ich den ganzen Tag auf den beschwerlichsten Pfaden wandelte, wo der feuchte Boden mein Lager und in Wasser halbgekochter Reis meine Nahrung war.
Bevor ich München verlasse, muß ich noch einer komischen Scene erwähnen, die ich erlebte als ich eines Abends aus dem Theater ging. Ich kannte den Weg nicht gut und bat eine Frau, die mit einem Herrn ging, um Auskunft. Die Frau lud mich ein mitzugehen, da sie gerade derselben Richtung folgte. Unterwegs fragte sie mich, ob ich dem Künstlerfeste beigewohnt und daselbst die „große Reisende“ Ida Pfeiffer gesehen habe. Sie selbst sei mit ihrem Manne dahingegangen, aber erst Abends, und da habe sie dieselbe nicht zu sehen bekommen. Ich erwiederte ihr, daß die große Reisende eine ziemlich kleine Person und mir gar wohl bekannt sei, und daß ich sie sehen könne, so oft ich wolle, ich benöthige dazu bloß eines Spiegels. Die guten Leute waren sehr erfreut mich kennen zu lernen und geleiteten mich bis an meine Wohnung.
Am 1. Juni ging ich über Hof nach Berlin (95 Meilen), wo ich am 2. Juni eintraf, und von meinen lieben Freunden, Herrn Professor Weiß und dessen Gemalin eben so herzlich aufgenommen wurde wie früher.
Die Reise von München nach Berlin bietet wenig Anziehendes, hie und da niedliche, aber durchaus keine überraschenden Partien; bei Plauen ist die Gegend noch am hübschesten. Bevor wir Hof erreichten, den letzten baierischen Ort, brach etwas an der Dampfmaschine; wir verloren eine ganze Stunde und versäumten dadurch den sich anschließenden Zug. An der preußischen Grenze verlangte man den Paß, besah ihn aber kaum, auch die Koffer wurden nur zum Scheine aufgemacht; in wenig Augenblicken war die ganze Ceremonie vorüber.
In Berlin wurde mir eine große Ueberraschung zu Theil: Alexander von Humboldt gab mir einen sehr warmen offenen Empfehlungsbrief an alle seine Freunde in der weiten Welt. Ich hoffe, man wird es mir nicht als Eitelkeit auslegen, wenn ich im Gefühle der Freude, von solch' einem Manne derart ausgezeichnet worden zu sein, die Abschrift dieses so wie auch einige andere Briefe, die ich so glücklich war von ihm zu erhalten , meinem Werke beifüge (siehe Beilage Nr. 1).
Auch der berühmte Geograph, Professor Carl Ritter, erwies mir eine große Ehre; er lud mich zur Sitzung der geographischen Gesellschaft ein, die gerade stattfand. Bereits im Monate März hatte man mich zum Ehren-Mitgliede dieser Gesellschaft aufgenommen— eine Auszeichnung, die bisher noch keiner Frau zu Theil geworden war.
Ich verweilte in Berlin nur acht Tage und fuhr von da nach Hamburg (38 deutsche Meilen), wo ich wieder bei der lieben Familie Schulz abstieg. Aber auch in Hamburg war meines Bleibens nicht lange; ich wollte meine Zeit für das mir noch ganz unbekannte Holland sparen und so schiffte ich mich schon am 14. Juni Abends auf dem Dampfer Stoomward, Capitän C. Bruns, nach Amsterdam ein (312 Seemeilen).
Dieß war die erste Fahrt, die ich in Europa auf einem holländischen Dampfer machte, und wie auf jenen, die ich auf meiner zweiten Reise um die Welt in Indien bestiegen hatte, war man auch hier so freundlich, mir nicht nur eine freie Fahrt zu geben, sondern auch für Kost und dergleichen keine Vergütung anzunehmen. Wie leicht würde mir das Reisen werden, fände ich bei den englischen Dampfschiffahrt-Gesellschaften ähnliche Großherzigkeit — leider ist dieß aber bisher nie der Fall gewesen; die englischen Herren Directoren, Agenten u.s.w. zeigten viel mehr Sinn für meine Thaler als für meine Reisen, und ließen mich stets ganz ruhig für die kleinste wie für die größte Fahrt bezahlen.
2. Kapitel.
Ankunft in Holland.— Amsterdam. — Holländische Bauart. — Bilder-Gallerien. — Herrn Costa's Diamanten-Schleiferei. — Das Harlemer Meer. — Ein holländischer Kuhstall. — Utrecht. — Das Studentenfest.
Ich traf in Amsterdam am 16. Juni Mittags ein. Schon im Hafen erwartete mich mein würdiger Freund Oberst Steuerwald. Dieser Herr ist eine meiner ältesten Reise-Bekanntschaften; ich lernte ihn auf der Reise von Gothenburg nach Stockholm kennen, traf ihn später in Batavia und nun hier in seinem Vaterlande, wo er mich auf das herzlichste aufnahm und sogleich in seinen Familienkreis einführte.
Ich blieb in Holland bis 2. Juli und hatte während dieser Zeit Gelegenheit, einen großen Theil dieses interessanten Landes zu bereisen; doch will ich all' des Gesehenen nur flüchtig erwähnen, da es natürlich nicht in dem Zwecke meines Buches liegt, ausführliche Beschreibungen von allgemein bekannten Ländern oder Städten zu machen.
Was mir in Amsterdam vor Allem auffiel, war die Bauart der Häuser; ich möchte sie der altdeutschen vergleichen, wie z. B. in Magdeburg. Die Häuser, meistens nur von einer Familie bewohnt, sind sehr schmal, 2 bis 4 Stockwerke hoch und enden in spitze oder runde Giebeldächer. Sie sind von Backsteinen aufgeführt, dunkelbraun übertüncht und zuweilen mit Arabesken geschmückt. Einen sonderbaren Eindruck macht der Ueberblick einer Straße; die Häuser stehen zwar in geraden Reihen, erheben sich aber nicht in senkrechter Linie. Bei manchen überragt der obere Theil den unteren, bei den anderen der untere den oberen, bei anderen wieder ragt der mittlere Theil hervor. Die Abweichung von der geraden Linie beträgt oft über einen Fuß. Man sollte meinen, daß dergleichen Häuser leicht dem Einstürze ausgesetzt seien; ich las jedoch manche Inschriften, welche bezeugten, daß sie bereits über 100 Jahre, ja einige sogar über 200 Jahre standen. — Ein sehr großer Uebelstand in den holländischen Häusern ist die schmale, steil aufsteigende Treppe. Man muß wahrlich ein geborener Holländer und von frühester Kindheit an diese Unbequemlichkeit gewohnt sein, um sie ertragen zu können, um so mehr, da man durch das Bewohnen eines schmalen und hohen Häuschens jeden Augenblick gezwungen ist die Treppe auf und ab zu klettern. Daß die Häuser der Reichen, die Gasthöfe u.s.w. bequemer eingerichtet sind, versteht sich von selbst.
Nicht minder befremdend war es mir zu sehen, daß in den Häusern, deren Erdgeschoß zu Verkaufsläden dient, letztere den ganzen Raum einnehmen und eine besondere Hausthüre unmöglich machen. Die Köchin mit dem Einkaufskorbe, der Wasserträger mit dem Kübel, die Frau vom Hause wie der Besucher, Alles geht durch das oft sehr geschmackvoll eingerichtete und kostbare Waarenlager. Natürlich muß an Sonn- und Festtagen die Thüre des Ladens wie an den Wochentagen offen stehen.
Alle diese Unbequemlichkeiten werden durch den hohen Preis des Bodens veranlaßt. Jedermann weiß, wie mühsam der größte Theil von Hollands Grund und Boden dem Meere abgetrotzt wurde, wie kostspielig ein Bau auf einem Grunde kommt, der durch eingeschlagene hohe Pfähle so zu sagen erst geschaffen werden muß. Gewöhnlich kostet der Bau bis an die Oberfläche der Erde eben so viel wie jener, der sich über der Erde erhebt.
Amsterdam ist von unzähligen Kanälen durchschnitten, die alle mehr oder minder breit sind und über welche 250 Brücken führen. Man könnte diese Stadt füglich das „Venedig des Nordens“ nennen, nur fehlen ihr die Marmor-Paläste, das muntere Leben und Treiben des Volkes, das Gewühl der Gondeln auf den Kanälen und die melodischen Gesänge der Barcarolis. Doch zeichnet sich Amsterdam vor Venedig dadurch aus, sie ihre Meister gefunden, wie der Schliff des großen Diamanten beweist, welchen der Sultan besitzt und der in Hinter-Indien geschliffen wurde. Dieser Diamant, der größtbekannte in der Welt, ist, obwohl unten sich rundend, dennoch durchaus in gleich große Rosetten eingetheilt — eine Kunstfertigkeit, welche selbst die Holländer nicht begreifen können.
Ueberraschend ist die Größe des Fabriksgebäudes, wenn man bedenkt, wie kleine Gegenstände da verarbeitet werden; es ist über 100 Fuß lang und drei Stockwerke hoch.
Die Schleiferei geht auf folgende Art vor sich: der rohe Diamant kommt erst in die Hände der Klopfer, dann der Schneider und zuletzt in jene der Schleifer. Der Klopfer entfernt die in dem Steine befindlichen Flecken mittelst eines scharfen Diamanten; er feilt damit in den Stein hinein und schlägt dann das schadhafte Stück ab. Der Schneider gibt dem Steine die gehörige Form, indem er die Ecken und Ungleichheiten auf ähnliche Art beseitigt. Der Staub, der bei diesen Arbeiten abfällt, wird auf das Sorgfältigste gesammelt, denn er ist zu dem Schliff des Diamanten unentbehrlich. Der Schleifer bedient sich einer Bleikugel, die in Holz gefaßt ist und deren freier Theil in der Glut erweicht wird, damit man den Stein so tief als nöthig hineindrücken kann. Er wird auf einer Stahlscheibe geschliffen, auf welche etwas weniges von dem Diamantstaube gestreut ist. Die große Kunst besteht darin, die Kanten und Rosetten vollkommen gleich zu schleifen, wodurch das Feuer und die Schönheit des Diamanten unendlich gesteigert werden.
Das Drehen der Schleifmaschine (durch Dampfkraft) geht so rasch, daß man glaubt, die Scheibe bewege sich gar nicht; sie macht in einer Minute zweitausend Umdrehungen.
Durch den Schliff geht sehr viel verloren; der englische Krondiamant, Koh-i-noor z. B. verlor, als er zum zweiten Male geschliffen wurde, ein Viertheil seiner Größe. Die erste Schleifung dieses schönen Diamanten war mißglückt und das englische Gouvernement ließ im Jahre 1852 einen holländischen Schleifer aus Herrn Costa's Fabrik kommen, um den Stein kunstgerecht zu schleifen. Der Arbeiter benöthigte hiezu sechs Monate, und die reinen Kosten ohne Gewinn für den Fabriksherrn (Herr Costa nahm nämlich keine Zahlung an) betrugen 4000 holländische Gulden, etwas mehr als 330 Pfund Sterling.
Herrn Costa's Fabrik, deren Eigenthümer er allein ist, beschäftigt 125 Arbeiter, von welchen 5 Klopfer, 30 Schneider und 90 Schleifer sind. Die Arbeiter gewinnen pr. Woche von 30 bis 70 und 80 holländische Gulden.
Ich besah in Amsterdam auch die Zucker-Raffinerien der Herren Spakler, Vloten und Fetterode. Der Zucker wird, wie ich schon in anderen Ländern gesehen habe, mittelst Dampfmaschinen raffinirt. Diese Fabrik liefert jährlich ungefähr 5 Millionen Kilos (nahe an 100,000 Wiener Centner) Zucker. Die größte Fabrik Hollands liefert 16 Millionen Kilos und das Gesammt-Erzeugniß beträgt 80 Millionen.
Ganz nahe bei Amsterdam liegt das berühmte „Harlemer Meer“, dessen Austrocknung gewiß eine der großartigsten Unternehmungen unseres Jahrhundertes ist. Wo vor wenig Jahren noch große Schiffe fuhren, wo der Fischer seine Netze auswarf, da weiden jetzt Tausende von Kühen, da prangen üppige Felder und Wiesen, ja hie und da erheben sich schon einzelne Häuschen, und gewiß wird es bald an Ortschaften und Dörfern nicht fehlen.
Die Trockenlegung des Sees, dessen durchschnittliche Tiefe 13 Fuß betrug, wurde im Februar 1849 begonnen, und schon nach vier Jahren war dieses Riesenwerk beendet. An drei verschiedenen Orten wurden Dampfmaschinen von 400 Pferdekraft eingerichtet, deren jede 8 Pumpen sechsmal pr. Minute in die Höhe hob und das Wasser in die Kanäle goß, welche nach dem Meere führten. Die 24 Pumpen der drei Maschinen schöpften in jeder Minute 20,340 Eimer Wasser aus.
Der Gewinn an Flächeninhalt beträgt 31,000 Joch (österreichisches Maß); die ersten Anpflanzungen wurden schon im Jahre 1853 gemacht.
Herr Muyskens, der die Güte hatte mir dieses neue Weltwunder zu zeigen, ist Eigenthümer einer hübschen Besitzung, auf welcher er bereits im vergangenen Jahre die erste Ernte abgehalten hat. Auch sein Haus war schon fertig und mit vielem Geschmacke gebaut. Hier sah ich zum ersten Male, wie weit die Vorliebe der Holländer für die Viehzucht geht — der Kuhstall war unstreitig der schönste Theil des Hauses. Man muß freilich bedenken, daß, da der größte Theil Hollands aus fetten Wiesen und Triften besteht, die Viehzucht der Hauptreichthum des Landes ist, und daß natürlicherweise für die Ausdehnung desselben alle mögliche Sorge getragen wird. Daß aber diese Sorgfalt so weit geht, den Kühen reinlichere und elegantere Wohnungen einzurichten als gar viele wohlhabende Leute in den weniger civilisirten Ländern Europa's (von anderen Welttheilen gar nicht zu sprechen) besitzen, hätte ich doch nicht erwartet. Der Kuhstall nahm den größten Theil des Gebäudes ein; seine Fenster, von gefälliger ovaler Form, waren mit weißen Vorhängen versehen, die von farbigen Bändern gehalten wurden. Auch die Eingangsthüre, deren oberer Theil von Glas war, schmückte ein blendend weißer Vorhang. Das Innere bestand aus einer hohen luftigen Halle; die Stände waren gerade so breit, daß die Hinterfüße der Thiere an die Grenze eines fußtiefen Kanales zu stehen kamen, in welchen die Excremente fielen, ohne die Streu oder den Boden zu verunreinigen. Oberhalb des Kanales war den Ständen entlang ein Seil gezogen, an welches die Schwänze der Kühe gebunden werden, damit sie mit denselben nicht um sich schlagen und sich beschmutzen. Alle diese Einrichtungen fand ich für das Auge recht hübsch; meiner Meinung nach würden aber die armen Thiere, könnte man sie befragen, es gewiß vorziehen, etwas weniger Reinlichkeit und etwas mehr Freiheit zu haben.
Eine Abtheilung des Stalles war durch eine drei Fuß hohe Bretterwand abgeschieden, mit gedieltem Boden versehen und bildete ein ganz niedliches Zimmerchen, welches den Bauersleuten zum Aufenthalte diente. Die Käse-, Milch- und andere Vorraths-Kammern waren von eben so fabelhafter Reinlichkeit wie der Stall. Die Wände in den Eingangshallen, an den Treppen, in der Küche, in den Vorrathskammern u.s.w. sind beinahe in jedem Hause 3 bis 4 Fuß hoch mit weißen Porzellan- oder grünen Thon-Platten belegt, die leichter rein gehalten werden können, als weiß übertünchte Wände.
Bei Herrn Muyskens trank ich nach langer Zeit zum ersten Male wieder Kaffee mit guter Milch; sie wurde rein gegeben, wie sie von der Kuh kam. Man sollte glauben, daß es in einem Lande wie Holland, wo solcher Reichthum an Kühen herrscht, der guten Milch im Ueberflusse gebe; dem ist aber nicht so; vor lauter Butter- und Käse-Machen gönnt sich der Holländer, wie der Schweizer, nicht einmal so viel gute Milch, als er zum häuslichen Gebrauch benöthigt. Beinahe überall, selbst in den wohlhabendsten Familien, fand ich den Kaffee ziemlich schlecht.
Da ich gerade bei diesem für uns Frauen so wichtigen Artikel bin, kann ich nicht umhin eines Gebrauches zu erwähnen, der in Holland allgemein herrscht, und welchen ich weder unter die Rubrik der Reinlichkeit rechnen, noch überhaupt als nachahmungswürdiges Beispiel ausstellen möchte. Sobald das Kaffee- oder Theetrinken zu Ende ist, wäscht die Frau oder Tochter, oder sonst ein weibliches Wesen des Hauses, das Geschirr am Tische im Beisein der Gesellschaft ab. Sie gießt etwas heißes Wasser in die Tassen, spült sie einfach aus, trocknet sie ab — und die Geschichte ist fertig.
Herr Muyskens war so freundlich, mich den ganzen ausgetrockneten See hindurchzuführen, bis an eine der drei Maschinen, die das Wasser herausheben und von welchen zeitweise eine oder die andere in Gang gesetzt wird, wenn sich zu viel Regenwasser angesammelt hat. Wir kamen gerade zu rechter Zeit, die Maschinen arbeiten zu sehen.
Von hier ging es nach Harlem, wo wir den schönen Park mit dem geschmackvollen königlichen Lustschlosse, so wie einen Theil der netten Stadt besahen. In letzterer fiel mir über dem Thore eines Hauses eine ungefähr anderthalb Fuß lange, ovale Platte auf, die mit rosenrothem Seidenstoff überzogen und mit in reiche Falten gelegten Spitzen überdeckt war. Diese Platte bedeutet, wie man mir sagte, daß sich in dem Hause eine Wöchnerin befindet. Ragt oberhalb der Platte noch ein Papierstreifen hervor, so ist dieß ein Zeichen, daß das Kind weiblichen Geschlechtes ist. Dieser Gebrauch stammt aus den alten Kriegszeiten her, wo das Haus einer Wöchnerin von dem Krieger geschont wurde, und war in ganz Holland üblich. Jetzt hat sich die Sitte verloren und nur in Hartem ist man ihr treu geblieben.
Ich war so glücklich, in Holland außer dem Herrn Obersten Steuerwald, der sich meiner auf das wärmste annahm, auch noch einen anderen, mir sehr wohlwollenden Freund zu finden, den Herrn Residenten van Rees, welchen ich, wie sich die Leser meiner zweiten Reise um die Welt erinnern werden, in Batavia kennen gelernt hatte. Herr van Rees lebte im Haag. Kaum hatte er aber von meiner Ankunft in Holland gehört, so kam er nach Amsterdam, mich zu einer kleinen Rundreise in seinem Vaterlande einzuladen.
Wir begannen mit Utrecht (8 deutsche Meilen), in welcher Stadt zufälligerweise gerade ein großes Studentenfest stattfand. Die Studenten Pflegen nämlich alle fünf Jahre die Errichtung der Universität zu feiern. Die Feier währt eine ganze Woche und besteht aus Masken-Umzügen, Konzerten, Bällen, Wettrennen, Mahlzeiten, Beleuchtungen u.s.w. Dieses Jahr sollte das Fest ganz besonders glänzend sein; die Herren Studenten hatten sich nämlich überwerfen und in zwei Partheien getheilt, in die aristokratische und in die demokratische. Eine Parthei wollte es der anderen zuvorthun und jede nahm eine Woche für sich allein in Anspruch.
Wir kamen in Utrecht in der Woche der Aristokraten an. Der Zudrang war so groß, daß wir in keinem Gasthofe Platz fanden; glücklicherweise nahmen uns Herr und Frau Suermondt, Freunde des Herrn van Rees, mit größter Zuvorkommenheit in ihrem Hause auf.
Nachmittags fand ein Umzug statt. Die Studenten trugen alle die kostbarsten Kostüme; da sah man nichts als Sammt, Atlas, Spitzen und Straußfedern. Die Einen stellten Scenen aus dem 16ten Jahrhunderte dar, die Anderen Prinzen von Java, Hindostan, Bengalen u.s.w. mit reichem Gefolge. Selbst an einer indischen Gottheit fehlte es nicht, die im Palankin getragen wurde und von einem malai'schen Musikchor begleitet war. Ganze Scenen wurden auf unglaublich langen Wagen vorgestellt, von welchen einige wirklich sehr malerisch waren. So z. B. ein ganzes Haus mit offenen Seitenwänden. Ein Ehepaar saß an einem Tische, die Frau hatte ein Kind auf dem Schöße, ein zweites spielte zu ihren Füßen, der Arzt und ein anderer Freund des Hauses waren zum Besuche da, man sprach und trank Thee; vor dem Hause scheuerte die Magd u.s.w.
Auf einem anderen Wagen stand eine Windmühle; ein Mann zimmerte davor an seinem Boote, ein Anderer besserte sein Netz aus.
Auf einem dritten sah man das Innere einer Bauernstube; da wurde Butter gerührt, Segeltuch gewoben, Seil gedreht. Dazwischen kam wieder ein Jagdzug, die Jäger mit den Falken auf dem Arme, es war wirklich herrlich anzusehen. — Militär-Musik eröffnete den Zug und königliches Militär schloß ihn. Abends wurde die Stadt herrlich beleuchtet, und zwar mit weißen und farbigen Glaslampen und mit papierenen Laternen in schönen Festons an beiden Seiten der Straßen und der vielen Kanäle. An manchen Häusern hatte man die ganzen Vorderwände reich beleuchtet, und an den Brücken waren die Portale und Geländer mit Tausenden von Lampen behangen. Manche Straße gewährte einen wahrhaft feenartigen Anblick.
Gegen Mitternacht kehrte der Zug mit einer Unzahl von Fackeln, welche blaue und dunkelpurpurfarbige Lichter von sich sprühten, zurück. Erst um 2 Uhr ging das Fest zu Ende.
Schön und glänzend war es, das ist nicht zu läugnen, aber viel zu großartig für Studirende. Es ginge noch an, wenn es alle hundert oder höchstens alle fünfzig Jahre stattfände; auch wäre wohl ein Tag dazu hinreichend; allein in der gegenwärtigen Form kann es nicht von guter Wirkung sein. Die jungen Leute beschäftigen sich gewiß schon mehrere Wochen vor dem Feste viel weniger mit ihren Studien als mit ihren Masken, ihren Costümen, den Bällen und anderen Unterhaltungen. Außerdem sind die Kosten so groß, daß nur der Reiche sie leicht tragen kann; der Unbemittelte muß zurückbleiben oder Schulden machen. Da lobe ich mir das einfache, burleske Künstlerfest in München; das verursachte wenig Kosten, war voll Heiterkeit und Witz, dauerte nur einen Tag und befriedigte die Zuseher wie die Mitwirkenden eben so, wenn nicht mehr, als dieses glänzende Studentenfest.
Auch die Bewohner der Stadt werden durch die Beleuchtung, welche an zwei Abenden stattfindet, zu Ausgaben veranlaßt, die gar vielen armen Bürgern nicht sehr willkommen sein mögen; unterließen sie indeß die Illumination, so würden die Studenten ihnen wahrscheinlich die Fenster einwerfen oder irgend einen Schabernack treiben.
Eine andere Sache, die ich eben auch nicht sehr passend fand, ist, daß die Studenten die ganze Woche in ihren Masken-Anzügen, der Eine als Prinz, der Andere als Ritter u.s.w. in der Stadt umhergehen.
Das zweite Fest, welchem ich beiwohnte, bestand aus Wettrennen zu Pferde und aus einigen Kunststücken, wie sie von Kunstreitern gezeigt werden. Ich erwartete, aufrichtig gesagt, etwas Besseres — ein Ringelstechen oder ein Karoussel, von den Studenten im Kostüme ausgeführt, hätte, da sie ja die Kostüme und Pferde schon besaßen, auch nicht mehr Kosten verursacht, und wäre dem großartigen Programme entsprechend gewesen. Bei dieser Gelegenheit beobachtete ich, wie schwer es ist, den Holländer aus seiner kalten Ruhe zubringen. Ein Herr Loisset führte ein schönes, wunderbar geschultes Pferd vor, welches die schwierigsten Kunststücke vollbrachte, die gewiß bei jedem anderen Publikum die lautesten Beifalls-Bezeigungen veranlaßt hätten. Zu meinem Erstaunen blieben die Leute kalt wie Eis und Herr Loisset verließ den Circus mit seinem Pferde, ohne das geringste Zeichen von Anerkennung erhalten zu haben.
Die Stadt Utrecht ist von sehr hübschen Bosquets und parkähnlichen Anlagen umgeben, doch fehlen hier, wie überall in Holland, Hügel und Berge.
An Sehenswürdigkeiten bietet sie wenig. Von den Kirchen besuchte ich bloß die protestantische Domkirche, deren imposantes Aeußere mich verführte. Leider fand ich das Innere auf eine unbegreifliche Weise entstellt. Man hatte nämlich, da die Kirche sehr groß ist, und die Zuhörer die Predigten nicht gut vernehmen konnten, einen hohen großen Verschlag von Holz errichtet — eine Kirche in der Kirche. Natürlich geht der Eindruck, den das wirklich schöne Gebäude hervorbringen würde, ganz verloren durch diesen abscheulichen Bretter-Verschlag, welcher über die Hälfte des inneren Raumes einnimmt.
Unser freundlicher Wirth, Herr Suermondt, ließ uns nicht so bald fort, und nur zu gerne gaben wir seiner herzlich gemeinten Einladung nach und verweilten noch einige Zeit; die ersten Tage wurden der Stadt selbst und den Festen geweiht, dazwischen fand ich hie und da ein Stündchen, die ausgezeichnet schöne Bilder-Gallerie zu besehen, welche Herr Suermondt besitzt und deren Besucher Fremden gestattet.
Den Lieblingsort der Utrechter, das Dörfchen Zeijst (2 deutsche Meilen), besuchten wir ebenfalls. Es ist dieß eine reizende Spazierfahrt. Die Straße, wie beinahe alle Landstraßen Hollands mit Backsteinen gepflastert, führt an niedlichen Landhäusern mit schönen Garten-Anlagen vorüber; an vielen Stellen ist sie mit Alleen besetzt von so stämmigen, umfangreichen Bäumen, wie ich noch wenige gesehen. Linden, Eichen und Buchen, und von letzteren besonders die Blutbuchen, gelangen in Holland zu einer Höhe und zu einem Umfange, wie vielleicht in keinem anderen Lande.
In Zeijst ist der Sitz einer Herrnhuter-Gemeinde.
3. Kapitel.
Zaandam. — Das Dörfchen Broek und dessen berühmte Reinlichkeit. — Sonderbarer Kopfputz. — Der Haag. — Berühmte Gemälde. — Leyden. — Rotterdam. — Abreise von Holland.
Als ich von Utrecht nach Amsterdam zurückgekehrt war, führte mich Herr van Rees nach Zaandam und Broek — eine Partie, die man zu Wagen in einem Tage ausführen kann.
In Zaandam hat, wie bekannt, Peter der Große durch mehrere Monate als Zimmermann gearbeitet, um den Schiffsbau praktisch zu erlernen. Man zeigt noch die hölzerne Hütte in demselben Zustande, in welchem sie war, als der große Kaiser sie bewohnte. Sie besteht aus zwei einfachen kleinen Kammern mit einigen hölzernen Stühlen und Tischen. Um sie vor dem Einflusse der Witterung zu bewahren, hat man eine gemauerte Halle darüber gebaut, welche im Winter auf allen Seiten mit Bretterwänden bekleidet wird. Das Städtchen Zaandam (13.000 Einwohner) ist sehr rein und freundlich, die Häuser sind beinahe alle mit Gärten umgeben.
Nicht minder berühmt als Zaandam ist das Dörfchen Broek, und zwar durch seine ausgezeichnete Reinlichkeit, was viel sagen will in einem Lande, wo die Straßen der Städte meistens reinlicher sind, als in gar manchen Ländern das Innere der Häuser. Ich erwartete natürlich etwas ganz Besonderes zu sehen, muß aber dessenungeachtet gestehen, daß die Wirklichkeit meine Erwartung noch übertraf. Meine Leser werden es mir verzeihen, daß ich ihnen von diesem kleinen Orte eine ziemlich große Beschreibung mache.