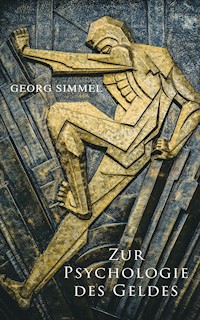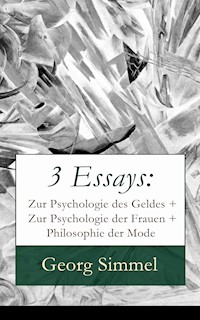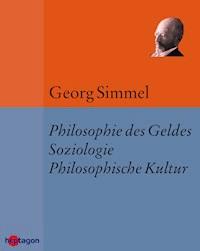Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Den wissenschaftlichen Versuchen, das Kunstwerk zu deuten und auszuwerten, sollte die Entscheidung zwischen zwei Wegerichtungen zugrunde liegen. Ihren Trennungspunkt bildet das Erlebnis der Kunst, die primäre, ungeteilte Tatsache, dass das Werk da ist und in dem Aufnehmenden seine unmittelbare Wirkung übt. Von hier nun geht die analytische Richtung gleichsam abwärts. Inhalt: Vorwort 1. Kapitel: Der Ausdruck des Seelischen
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 326
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rembrandt - Ein kunstphilosophischer Versuch
Georg Simmel
Inhalt:
Georg Simmel – Biografie und Bibliografie
Rembrandt - Ein kunstphilosophischer Versuch
Vorwort
1. Kapitel: Der Ausdruck des Seelischen
Die Kontinuität des Lebens und die Ausdrucksbewegung
Sein und Werden im Porträt
Die Reihen der Porträts und der Handzeichnungen
Verschlossenheit und Offenheit der Porträtgestalt
Der Zirkel in der Darstellung des Menschen
Die Beseeltheit des Porträts
Der subjektivische Realismus und das Selbstporträt
Die künstlerische Zeugung
Die Lebensvergangenheit im Bilde
Die Darstellung der Bewegtheit
Die Einheit der Komposition
Deutlichkeit und Detaillierung
Das Leben und die Form
2. Kapitel: Die Individualisierung und das Allgemeine
Typik und Repräsentation
Zwei Erfassungen des Lebens
Anmerkung über die Individualität der Form und den Pantheismus
Der Tod
Der Charakter
Schönheit und Vollkommenheit
Die Individualistik der Renaissance und Rembrandts
Arten der Allgemeinheit
Alterskunst
Der raumlose Blick
Stimmung
Das Menschheitsschicksal und der heraklitische Kosmos
3. Kapitel: Religiöse Kunst
Objektive und subjektive Religion in der Kunst
Die Frömmigkeit
Das konkrete Dasein und das religiöse Leben
Die Einheitsart der religiösen Bilder
Individuelle Religiosität, Mystik und Calvinismus
Die Seelenhaftigkeit
Religiös-künstlerisches Schöpfertum
Das Licht, seine Individualistik und Immanenz
Zwischenerörterung: Was sehen wir am Kunstwerk?
Die dogmatischen Inhalte
Zum Abschluss
Schöpfertum und Gestaltertum
Die Gegensätzlichkeiten in der Kunst
Rembrandt, Georg Simmel
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849617318
www.jazzybee-verlag.de
Frontcover: © Vladislav Gansovsky - Fotolia.com
Georg Simmel – Biografie und Bibliografie
Geb. 1. März 1858 in Berlin, gest. 26. September 1918 in Straßburg.
S. verbindet die psychologisch-genetische, evolutionistische mit einer logisch-idealistischen, an Kant und Hegel orientierten, vielfach »dialektischen« Betrachtungs- und Denkweise. Das Erkennen enthält apriorische Faktoren, die aber (als Kategorien) eine Entwicklung durchmachen, nicht unverändert bleiben. Alle Formen und Methoden des Erkennens haben sich im Verlaufe der menschlichen Geistesgeschichte entwickelt und entwickeln sich weiter, so aber, daß das Erkennen eine formende, gesetzgebende Aktivität des Geistes bleibt, welche aus dem Chaos der Erlebnisse erst einen sinnvollen, verständlichen, einheitlichen Zusammenhang gestaltet. Die Kategorien usw. stammen aus »der dem Geiste eigenen Fähigkeit, zu verbinden, zu vereinheitlichen«, können aber als historische Gebilde die Totalität der Weltinhalte nie völlig adäquat aufnehmen. Das Ich hat die Funktion der Einheitsetzung, das Streben zur Einheit. Die Wahrheit ist, rein logisch, etwas Zeitloses, Absolutes, vom subjektiven Denken Unabhängiges, sie gehört dem »dritten Reich«, dem »Reich der ideellen Inhalte« an; diese Inhalte sind wahr, gleichviel ob sie gedacht werden oder nicht. Das Geistige bildet inhaltlich einen geschlossenen Zusammenhang, den unser individuelles Denken unvollkommen nachzeichnet. Die ideellen Inhalte sind nicht, sie gelten, sie sind nicht mit den psychologischen Vorgängen zu verwechseln. Anderseits hat die Wahrheit auch eine biologisch-evolutionistische Seite. Wahr sind hier jene Vorstellungen, die, als reale Kräfte in uns wirksam, »uns zu nützlichem Verhalten veranlassen« (vgl. James). Durch Selektion haben sich bestimmte Vorstellungen als wahr erhalten, nämlich jene, »die sich als Motive des zweckmäßigen, lebenfördernden Handelns erwiesen haben« (vgl. Nietzsche). »Die Nützlichkeit des Erkennens erzeugt zugleich für uns die Gegenstände des Erkennens.« Es gibt so viele prinzipielle »Wahrheiten«, als es verschiedene Organisationen und Lebensanforderungen gibt. Das Objektive und Wahre bedeutet die »gattungsmäßige Vorstellung«.
Auch in der Ethik verbindet S. die genetisch-relativistische Betrachtungsweise betreffs der empirischen Einzeltatsachen mit einem gewissen Apriorismus und Idealismus. So ist das Sollen etwas Ursprüngliches und Objektives, als eine Forderung, die mit der Sache selbst gegeben ist, als ein »in dem Verhältnis von Seele und Welt präformiertes Sollen, das einer besonderen, aber nicht weniger übersubjektiven Logik unterliegt, wie das Sein«. Unser Bewußtsein empfindet Forderungen an sich, die es durch den Willen realisieren kann. Das Sollen schlechthin ist eine »Urtatsache«, eine »ursprüngliche Kategorie«, mag auch der Inhalt des Sollens noch so wechseln und sozial-historisch bedingt sein. Tatsächlich sind es immer »historische Zustände der Gattung, die in dem Einzelnen zu triebhaftem Sollen werden«. Der »Wille der Gattung« kommt in uns zum Ausdruck, kündigt sich imperativisch an. Ein ungeheurer Teil der an uns gestellten Ansprüche ist sozialen Inhalts, ohne daß dadurch die Unbedingtheit des idealen Sollens überhaupt, die »innere Logik ideeller Ansprüche« beeinträchtigt wird. Das sittlich Gute besteht nicht im Anstreben des Glücks u. dgl. (gegen den Eudämonismus), sondern es ist eine »unmittelbare Qualität und Lebensform des Willensprozesses«. Etwas ist gut, weil und wofern es Inhalt eines an sich guten Willens ist. Die moralischen Imperative sind »Ausmündungen, Ausformungen, Substantialisierungen des guten Willens«. Die Sittlichkeit liegt nicht im Material des Willens, sondern in diesem selbst, in dessen Funktion. Das Ideal des sittlichen Verhaltens liegt im Unendlichen. Das Sollen kann sich an den verschiedensten Inhalten verwirklichen; die Einheit des Zieles ist nicht notwendig, es genügt die Einheit der psychologisch-ethischen Funktion, die den Zweck trägt. Ursprünglich ist das sozial Erforderte die Norm des Verhaltens der Einzelnen. Den »kategorischen Imperativ« Kants kritisiert S. nach der Richtung der Versöhnung des Individualismus mit der Allgemeinheit des Handelns. Das Gewissen ist nach S. gleichsam ein »rückwärts gewandter Instinkt«; es ist die.Lust oder Unlust der Gattung über die Tat, die in uns zum Ausdruck kommt. Der Altruismus ist ebenso primär wie der Egoismus, er ist »Gruppenegoismus«, ein vererbter Instinkt. Sehr oft. »machen die Motivierungen unserer Handlungen... an Punkten Halt, die völlig und definitiv außerhalb unser selbst liegen«. Auch enthält das Ich noch eine Fülle von Motiven außer dem »Glück«. – Die Freiheit des Willens bedeutet, daß sich der Charakter des Ich ungehindert im Wollen ausprägen kann, das Vermögen, das für uns wertvolle Wollen realisieren zu können. Freiheit ist »Selbstbestimmung«, sie ist zugleich, weil das Ich nur so sein kann, wie es ist, Notwendigkeit. Die Verantwortlichkeit ist nicht aus der Willensfreiheit abzuleiten, sondern umgekehrt: »Derjenige ist frei, den man mit Erfolg verantwortlich machen kann.« Zurechnungsfähig ist jemand, wenn die strafende Reaktion auf seine Tat bei ihm den Zweck: der Strafe erreicht.
Die Grundfrage der Geschichtsphilosophie ist die: wie ist Geschichte möglich? Geschichte ist nur durch Kategorien, apriorische Verbindungsformen möglich, sie ist kategorial verbreitete Wirklichkeit und daher hat die Geschichtsphilosophie die »Aprioritäten festzustellen und zu erörtern, durch welche aus dem Erleben... Geschichte als Wissenschaft wird«. Die Kompliziertheit des historischen Geschehens gestattet nicht die Aufstellung eigener historischer Gesetze, wenn auch das Historische auf (biologisch-psychologischen) Gesetzmäßigkeiten beruht. Das ganze Spiel der Geschichte ist die Folge, Erscheinung oder Synthese dieser primären Gesetzmäßigkeiten, geht aber nicht aus einem besonderen Gesetz hervor.
Die Soziologie ist die »Wissenschaft vom Gesellschaftlichen als solchen, von den Formen der Vergesellschaftung, von den Beziehungsformen der Menschen zueinander«. Die Soziologie ist keine Universalwissenschaft vom Menschen u. dgl., sondern eine besondere Methode; sie abstrahiert vom Inhalt des Gesellschaftlichen, achtet nur auf dieses, wie der Mathematiker etwa nur auf die geometrische Form, nicht auf das Material der Körper achtet. Die Soziologie, hat die »Kräfte, Beziehungen und Formen zum Gegenstand, durch die die Menschen sich vergesellschaften«, sie ist die »Lehre von dem Gesellschaft-Sein der Menschheit«. »Gesellschaft im weitesten Sinne ist offenbar da vorhanden, wo mehrere Individuen in Wechselwirkung treten. Die besonderen Ursachen und Zwecke, ohne die natürlich nie eine Vergesellschaftung erfolgt, bilden gewissermaßen den Körper, das Material des sozialen Prozesses; daß der Erfolg dieser Ursachen, die Förderung dieser Zwecke gerade eine Wechselwirkung, eine Vergesellschaftung unter den Trägern hervorruft, das ist die Form, in die jene Inhalte sich kleiden.« Solche Formen sind Über- und Unterordnung, Konkurrenz, Arbeitsteilung usw.; wichtig sind besonders auch die kleinen, flüchtigen Wechselwirkungen von Person zu Person. Die sozialen Verbindungen erwachsen aus bestimmten Trieben oder Willenstendenzen (Zielen), sind etwas Psychisches, aber nichts Psychologisches, denn die Soziologie hat es nicht mit psychologischen Vorgängen, sondern mit Inhalten solcher zu tun, mit Kombinationen soziologischer Kategorien, mit etwas Sachlichem. Es gibt keinen Gesamtgeist, wohl aber eine seelische Beeinflussung der Individuen durch ihre Vergesellschaftung. In der Gesellschaft herrscht Arbeitsteilung und Differenzierung, verbunden mit Integrierung, indem jede Befreiung zu einer neuen Bindung führt. Die Religion wurzelt in den Gesamttendenzen der Persönlichkeit und ihrer Beziehung zum All.
SCHRIFTEN: Das Wesen der Materie nach Kants physischer Monadologie, 1881. – Über soziale Differenzierung, 1890; 3. A. 1906, – Einleit. in die Moralwissenschaft, 1892-93; 2. A. 1901. – Die Probleme der Geschichtsphilosophie, 1892; 2. A. 1905; 3. A. 1907. – Philosophie des Geldes, 1900; 2. A. 1907. – Vorlesungen über Kant, 1904; 2. A. 1905. – Die Religion, 1906. – Schopenhauer u. Nietzsche, 1906. – Soziologie, 1908. – Hauptprobleme der Philosophie, 1910. – Das Problem der Soziologie, Schmollers Jahrbücher, Bd. 18, 1894. – Skizze einer Willenstheorie, Zeitschr, f. Psychol. d. Sinnesorgane, Bd. 9, – Beitrag zur Erkenntnistheorie der Religion, Zeitschr. f. Philos., Bd. 118. – Über eine Beziehung der Selektionslehre zur Erkenntnis, Archiv f. systemat, Philos., 1895. – Über die Grundfrage des Pessimismus, Zeitschr. f. Philos., Bd. 90. – Zur Psychologie der Frau, Zeitschr. f. Völkerpsychol, 1890, u. a.
Rembrandt - Ein kunstphilosophischer Versuch
Vorwort
Den wissenschaftlichen Versuchen, das Kunstwerk zu deuten und auszuwerten, sollte die Entscheidung zwischen zwei Wegerichtungen zugrunde liegen.
Ihren Trennungspunkt bildet das Erlebnis der Kunst, die primäre, ungeteilte Tatsache, dass das Werk da ist und in dem Aufnehmenden seine unmittelbare Wirkung übt.
Von hier nun geht die analytische Richtung gleichsam abwärts.
Sie sucht einerseits nach den geschichtlichen Bedingungen, die das Werk sich in die Entwicklung der Kunst verständlich einordnen lassen; sie gewinnt andrerseits aus dem Kunstwerk seine einzelnen Wirkungsfaktoren heraus: die Straffheit oder Lockerung der Form, das Schema der Komposition, die Ausnutzung der Raumdimensionen, die Farbengebung, die Stoffwahl und vieles andere. Aber dem wissenschaftlichen Gewissen ziemt Klarheit darüber, dass auf keinem von beiden Wegen das Verständnis des Kunstwerkes als solchen oder seiner tatsächlichen seelischen Bedeutung erreicht wird.
Denn zunächst: jede historische Entwicklung setzt den Wert der Sachgehalte schon voraus, um derentwillen man sich überhaupt um ihre Geschichte kümmert.
Weshalb wir für die Kunst Rembrandts, aber nicht für die eines beliebigen Stümpers, die geschichtliche Entwicklung erkunden, ist ersichtlich aus dieser Entwicklung selbst nicht zu entnehmen, sondern gründet in Wertempfindungen, die wir an diese Kunst selbst, gänzlich unabhängig von den Bedingungen ihres Gewordenseins, knüpfen.
An sie, als gewordene oder daseiende, wendet sich nun allerdings die angedeutete ästhetische Analyse.
Hätte sie aber auch jene Komponenten des Bildes zulänglichst herausgestellt, so wäre damit weder Schöpfung noch Eindruck des Kunstwerks voll erfasst.
Denn die fertige Kunsterscheinung freilich kann man unter vielerlei formale und inhaltliche Gesichtspunkte stellen und sie damit in lauter einzelne Eindrucksfaktoren zerlegen.
Allein sie ist aus deren Zusammensetzung so wenig herstellbar und deshalb so wenig daraus verständlich, wie ein Körper als lebendiger aus den zerschnittenen Gliedern auf dem Seziertisch.
Das ästhetische Nebeneinander ist ihr so wenig äquivalent wie das historische Nacheinander; denn entscheidend für sie ist etwas ganz anderes: die schöpferische Einheit, die sich jener Faktoren vielleicht als Mittel bedient, vielleicht an diesen ihre greifbare, analytisch beschreibliche Oberfläche besitzt.
Es ist aber die grösste Selbsttäuschung, das Wesen der Kunst und den Rang ihrer Werke als die Addierung jener Kategorien begreifen zu wollen.
Ebenso wenig ist der Eindruck des Kunstwerks gleich den summierten Eindrücken all der Seiten und Qualitäten seiner, die die sondernde Ästhetik heraushebt.
Vielmehr, auch hier ist das Entscheidende etwas ganz Einheitliches, das sich aus oder über jenen Einzeleindrücken erhebt; und alle psychologische Analyse: wie diese und jene Farbe oder Farbengegensätzlichkeit wirke, wie leicht oder schwer wir gewisse Formen auffassen, welche Assoziationen sich an bestimmte Gegebenheiten anschliessen, und alles Verwandte, lässt die schlechthin zentrale, seelische Wirkung draussen, die das künstlerische Erlebnis als solches ausmacht.
Dieses Erlebnis geht nun freilich, wie ich glaube, in die Formen wissenschaftlichen Erkennens überhaupt nicht ein.
Das unmittelbare Gefühltwerden ist die einzige Art, auf die es da ist, und in ihr müssen wir es sozusagen unangerührt stehen lassen.
Es bildet die Wasserscheide, an der eben zwei Richtungen der Kunsterkenntnis sich trennen.
Während nämlich jene analytische Behandlung der einzelnen Bestimmungen des Kunstwerks und seines Aufgenommenwerdens gewissermassen vor der schöpferischen und rezeptiven Erlebniseinheit stehen bleibt, beginnt nun hinter dieser eine andere Direktive der Betrachtung, die man die philosophische nennen mag.
Sie setzt das Ganze des Kunstwerks, als Dasein und Erlebnis, voraus und sucht dieses nun in die ganze Weite der seelischen Bewegtheit, in die Höhe der Begrifflichkeit, in die Tiefe der weltgeschichtlichen Gegensätze einzustellen.
Als Gegenstand solchen Versuches erscheint die Rembrandtsche Kunst deshalb besonders geeignet, weil sich ihr gegenüber, durch ihren objektiven Charakter tief begründet, jenes irrationale Erlebnis in grösster, der Musik am nächsten kommenden Reinheit vollzieht; d. h. in der Unberührsamkeit seines eigenen Wesens durch die analysierende Ästhetik einerseits, durch das begrifflich und metaphysisch weiterführende Denken andrerseits.
Gerade dadurch aber wird das Erlebnis als ein umso ungeteilteres, umso gleichmässiger wirksames, zur Voraussetzung der Einzelprobleme, in denen auch dieses Denken sich zu bewegen hat.
Hierin liegt die Schranke von Erörterungen, die das Kunstwerk nicht historisch, technisch oder ästhetisch aufklären, sondern, als philosophische, dasjenige suchen, was man seinen Sinn nennen kann: die Verhältnisse zwischen seinem innersten Zentrum und dem äussersten Umkreis, in dem Welt und Leben von unsern Begriffen umschrieben werden.
Denn jenes primäre Erlebnis des Kunstwerks, von dem dessen philosophische Weiterführungen genährt werden, ist nicht mit objektiver Eindeutigkeit festzulegen; es bleibt, soviel Theoretisches auch von ihm ausgehen mag, in der Form der Tatsache und ist der Theorie unzugängig - zwar nicht von zufälliger Willkür bestimmt, aber von einer immerhin individuellen Gerichtetheit, die die philosophischen Linien von ihm aus in mannigfaltigster Richtung verlaufen lässt.
Von jeder Gruppe solcher Linien kann man beanspruchen, dass sie zu letzten Entscheidungen führe, aber keine darf beanspruchen, zu den letzten zu führen. - Was mir von je als eine wesentliche Aufgabe der Philosophie erschien: von dem unmittelbar Einzelnen, dem einfach Gegebnen das Senkblei in die Schicht der letzten geistigen Bedeutsamkeiten zu schicken - das soll nun an der Erscheinung Rembrandts versucht werden.
Die philosophischen Begriffe sollten nicht immer nur in ihrer eigenen Gesellschaft bleiben, sondern auch der Oberfläche des Daseins geben, was sie zu geben haben, und daran nicht, wie Hegel es tat, die Bedingung knüpfen, dass dies Dasein schon als unmittelbares in den philosophischen Adelsstand erhoben werde.
Es bleibe vielmehr ruhig in seiner schlichten Tatsächlichkeit und unter deren unmittelbaren Gesetzen, und werde erst so von dem Netzwerk der Linien umfangen, die seine Verbindung mit dem Reich der Ideen vermitteln.
Dies einfache Tatsächliche ist hier jenes Erlebnis des Kunstwerks, das ich als ein unauflöslich Primäres hinnehmen will. - Dass die daran angesetzten philosophischen Richtlinien sich durchaus in einem äussersten Punkte zu schneiden, sich also in ein philosophisches System einzuordnen hätten, ist ein monistisches Vorurteil, das dem - viel mehr funktionellen als substanziellen - Wesen der Philosophie wiederspricht.
Aus dieser methodischen Einstellung einerseits, aus jener individuellen Bestimmtheit des als Wirklichkeit vorausgesetzten Erlebnisses andrerseits ergibt sich die angedeutete Schranke für den Anspruch dieser Untersuchungen: sie können nur verlangen, neben andern Ausgangspunkten und andern Wegerichtungen zu stehen und sich mit diesen andern selbst dann zu ergänzen, wenn sie ihnen widersprechen.
Welche Erwartungen diese Blätter befriedigen oder unbefriedigt lassen, kann sich nur aus ihnen selbst, aber nicht aus ihrem Programm entscheiden; dieses soll nur, als Grenzsetzung, die Erwartungen davor schützen, der Unbefriedigtheit von vornherein zu verfallen.
1. Kapitel: Der Ausdruck des Seelischen
Die Kontinuität des Lebens und die Ausdrucksbewegung
Die praktischen Notwendigkeiten und die Arbeitsteilung unserer aufnehmenden und wirkenden Kräfte lassen uns selten das Leben in seiner Einheit und Ganzheit, sondern vielmehr seine einzelnen Inhalte, Schicksale, Zuspitzungen empfinden— Stücke und Teile, aus denen das Ganze sich zusammensetzt.
Dies ist darauf gegründet, dass unser Leben die Form eines mit wechselnden Inhalten ablaufenden Prozesses hat, die Inhalte aber, ausser dass sie in der Lebensreihe stehen, auch noch in allerhand andere: logische, technische, ideale Reihen eingeordnet werden können.
Ein angeschauter Gegenstand z. B. ist nicht nur ein Akt des Vorstellens, sondern er steht in einem System physikalischer Erkenntnis, ein Willensentschluss ist nicht nur ein inneres Tun, sondern er stellt einen bestimmten Grad in der Reihe objektiver sittlicher Werte dar, eine Ehe ist nicht nur das Erlebnis der beiden Subjekte, sondern ein Element einer historisch-sozialen Verfassung.
Indem die gesondert betonten Inhaltlichkeiten nun aber doch wiederum als "das Leben" gelten, scheint dieses eine Aneinanderreihung ihrer zu sein und als hätten sie seinen Charakter und seine Dynamik pro rata unter sich aufgeteilt.
Dieser Begriff des Lebens als der Summe aller nacheinander auftretenden Augenblicke ist indes an dem kontinuierlichen Fluss des realen Lebens gar nicht zu vollziehen, setzt vielmehr an dessen Stelle die Addition jener, nach Sachbegriffen bezeichenbaren Inhalte, der Inhalte also, insofern sie gerade nicht als Leben, sondern als irgendwie festgewordene ideelle oder dingliche Gebilde gelten.
Nun glaube ich aber noch an eine andere mögliche Betrachtungsweise des Lebens, die das Ganze und die Teile nicht derart voneinander sondert, für die überhaupt die Kategorie von Ganzem und Teil auf das Leben nicht anwendbar ist; sondern dieses ist ein einheitlicher Verlauf, dessen Wesen es ist, als lauter qualitativ oder inhaltlich unterscheidbare Momente dazusein.
Jene erste Vorstellungsart gravitiert zu dem "reinen Ich" oder zu der "Seele", die gewissermassen etwas für sich sind, jenseits der in ihnen auftauchenden, nach Sachbegriffen ausdrückbaren Inhalte.
Mir aber scheint der ganze Mensch, das Absolute von Seele und Ich, in jedem jeweiligen Erlebnis enthalten zu sein; denn die in ihm geschehende Produktion wechselnder Inhalte ist die Art, auf die das Leben lebt, und es behält sich nicht eine irgend abtrennbare "Reinheit" und Fürsichsein jenseits seiner Pulsschläge vor.
In einem ähnlichen Gedankengange, der den "Charakter" des Menschen und seine einzelnen Handlungen betrifft, sagt Goethe einmal: "Die Quelle kann nur gedacht werden, insofern sie fliesst".
Es handelt sich um Überwindung des Gegensatzes von Vielheit und Einheit, der Alternative: dass die Einheit von Mannigfaltigkeiten entweder jenseits ihrer liegt, als ein Höheres und Abstraktes — oder, in dem Gebiet der Mannigfaltigkeiten verbleibend, sich aus diesen, Stück für Stück, zusammensetzt.
Mit keiner dieser Formeln aber ist das Leben auszudrücken.
Denn es ist eine absolute Kontinuität, in der es zusammensetzende Stücke oder Teile nicht gibt, die vielmehr in sich Einheit ist, aber eine solche, die in jedem Augenblick sich als ganze in einer andern Form äussert.
Dies ist nicht weiter zu deduzieren, weil das Leben, das hiermit irgendwie zu formulieren versucht wird, eine fundamentale, unkonstruierbare Tatsache ist.
Jeder Augenblick des Lebens ist das ganze Leben, dessen stetiger Fluss — dies eben ist seine unvergleichliche Form — seine Wirklichkeit nur an der Wellenhöhe hat, zu der er sich jeweilig hebt; jeder jetzige Moment ist durch den ganzen vorherigen Lebenslauf bestimmt, ist der Erfolg aller vorangegangenen Momente, und schon deshalb ist jede jetzige Lebensgegenwart die Form, in der das ganze Leben des Subjekts wirklich ist.
Sucht man für die Rembrandtsche Lösung seiner Bewegungsprobleme, grösseren wie geringeren Umfanges, einen theoretischen Ausdruck, so steht sie völlig im Zeichen dieser Auffassung des Lebens.
Während in der klassischen und der in engerem Sinne stilisierenden Kunst die Darstellung einer Bewegung durch eine Art Abstraktion geschieht, dadurch, dass der Anblick eines bestimmten Momentes dem bis zu ihm hin und unter ihm fortströmenden Leben entrissen wird und zu einer selbstgenugsamen Form kristallisiert — scheint bei Rembrandt der dargestellte Moment den ganzen, bis zu ihm sich hinlebenden Impuls zu enthalten, er erzählt die Geschichte dieser Lebensströmung.
Er ist nicht ein zeitlich fixierter Teil einer physisch-psychischen Bewegtheit, jenseits dessen, zu künstlerischer Formung herausgehobenen Fürsichseins noch das Ganze eben dieser Bewegtheit, dieses innerlich abrollenden Ereignisses, stünde; sondern er macht anschaulich, wie der eine dargestellte Augenblick der Bewegung wirklich die ganze Bewegung ist oder vielmehr überhaupt Bewegung und nicht ein verfestigtes So und So ist.
Es ist die Umkehrung des "fruchtbaren Momentes".
Während dieser die Bewegung von ihrem Jetzt her für die Phantasie in die Zukunft führt, sammelt der Rembrandtsche ihre Vergangenheit in dieses Jetzt: nicht sowohl ein fruchtbarer, als ein erntender Moment.
Wie es das Wesen des Lebens ist, in jedem Augenblick ganz da zu sein, weil seine Ganzheit nicht die mechanische Summierung von singulären Augenblicken, sondern ein kontinuierliches und kontinuierlich formwechselndes Strömen ist — so ist es das Wesen der Rembrandtschen Ausdrucksbewegung, das ganze Nacheinander ihrer Momente in der Einmaligkeit eines einzelnen fühlen zu lassen, ihre Zerspaltung in dieses Nacheinander getrennter Momente zu überwinden.
Wie diese Bewegungen bei der Mehrzahl der Maler dastehen, scheint es, als hätte der Künstler in der Phantasie oder am Modell gesehen, wie die bestimmte Bewegung aussieht, und hätte nach diesem fertigen, zu der Vollendung seiner Oberfläche gelangten Phänomen das Bild, realistisch oder nicht, gestaltet.
Bei Rembrandt aber scheint der Bewegungsimpuls, wie er von seinem Wurzelpunkt her mit seelischer Bedeutung geladen oder von ihr geführt ist, zugrunde zu liegen, und aus diesem Keim, dieser gesammelten Potentialität des Ganzen und seines Sinnes entwickelt sich die Zeichnung Teil für Teil, wie sich entsprechend auch die Bewegung in der Wirklichkeit entfaltet.
Der Ausgangspunkt oder das Fundament der Darstellung ist bei ihm nicht das gleichsam von aussen gesehene Bild des Momentes, indem die Bewegung auf ihrem darzustellenden Höhepunkt, einem in sich abgeschlossenen Querschnitt durch ihren zeitlichen Verlauf, angelangt ist; sondern es ist von vornherein die wie in eine Einheit zusammengefasste Dynamik des ganzen Aktes in ihm. Das Ganze des expressiven Sinnes, den die Bewegung hat, liegt deshalb schon in dem allerersten Strich; mit der Schauung oder dem Gefühl, das das Äusserliche der Bewegung als eines und dasselbe enthält, ist dieser Strich schon angefüllt.
Daher wird es begreiflich, dass Gestalten seiner Handzeichnungen und der skizzenhaft-linearen Radierungen— hier noch deutlicher als auf den Gemälden — von denen nur ein Minimum von Strichen, man möchte sagen: fast gar nichts auf dem Papier steht, dennoch eine absolut unzweideutige Haltung und Bewegung und eben damit die seelische Zuständlichkeit und Intention aus deren ganzer Tiefe mit voller Überzeugungskraft vortragen.
Wo die Bewegung auf das Definitivum ihrer Darstellung hin gesehen ist, in der Ausgedehntheit ihres Erscheinungsmomentes, da bedarf es, damit sie zu ihrem vollständigen Ausdrucke komme, prinzipiell einer Vollständigkeit der Erscheinung.
Hier aber ist es, als wenn ein Mensch einen tiefsten Affekt, der ihn ganz durchschüttert, aussprechen will: er braucht gar nicht den ganzen Satz zu sagen, der den Inhalt seiner Bewegtheit logisch ausbreitet, da doch schon am ersten Worte der Stimmklang alles offenbart.
Natürlich ist damit kein vermittlungsloser Unterschied gegen alle anderen Künstler gemeint.
Es handelt sich um die Differenz von Prinzipien, die als Prinzipien freilich polar entgegengesetzt sind, zwischen denen aber die empirischen Erscheinungen eine Stufenreihe grösseren oder geringeren Teilhabens an beiden darstellen.
Das ist umso ersichtlicher, als die Ausdrucksbewegungen bei dem jüngeren Rembrandt selbst von der blossen Aussensicht ausgehen.
Wie sich z. B. — um jetzt nur bei den Bildern zu bleiben — in dem Raub der Europa von 1632 oder dem wenig späteren Mene Tekel, oder dem Ungläubigen Thomas die Gestalten bewegen, das ist ausschliesslich das fixierte Phänomen eines Bewegungsmomentes.
Dann setzt, etwa mit der Berliner Täuferpredigt, die von innen her innervierte, in der letzten seelischen Schicht vorbereitete Bewegung ein, die, mit allerhand Schwankungen noch in den vierziger, ja fünfziger Jahren, schliesslich seinen Bildern einen mit nichts anderem vergleichlichen Charakter gibt.
Seine künstlerische Vision enthält nicht einfach die Sichtbarkeit der Geste in ihrem Darstellungsmoment, ihr Sinn und ihre Intensität entsteht sozusagen nicht erst in der Ebene der Anschauung, sondern lenkt und füllt schon den ersten Strich, der also die Totalität des innerlich-äusserlichen Vorgangs (in seiner eigentümlich künstlerischen Ungeschiedenheit) vollgültig offenbart.
Wie es nun als die tiefere Formel des Lebens erschien, dass seine Totalität nichts ausserhalb seiner einzelnen Augenblicke ist, sondern dass es in jedem dieser ganz da ist, weil es eben ausschliesslich in der Bewegung durch all diese Entgegengesetztheiten hindurch besteht — so offenbart die bewegte Gestalt bei Rembrandt, dass es sozusagen in dem Sichdarleben und Sich-darbieten eines inneren Schicksals keinen Teil gibt, dass vielmehr jedes, von irgendeinem Gesichtspunkt der Anschaulichkeit herausgesonderte Stück das Ganze dieses innern und sich ausdrückenden Schicksals ist.
Dass er jedes Teilchen der bewegten Gestalt als ihre Ganzheit darzustellen vermag, das ist der ebenso unmittelbare wie symbolische Ausdruck davon, dass jeder der kontinuierlich verbundenen Augenblicke des bewegten Lebens das ganze, in dieser bestimmten Gestalt Person-gewordene Leben ist.
Sein und Werden im Porträt
Dieselbe Formel, die über das Verhältnis zwischen dem dargestellten Bewegungsmoment und dem ganzen, sich ausdrückenden Innenereignis herrscht, bestimmt Rembrandts Gestaltung des Porträts als solchen.
Die letzte und allgemeinste Intention des italienischen Porträts ist in die Wertmetaphysik des klassischen Griechentums eingeordnet: Sinn und Wert der Dinge liegt im Sein, in ihrer festumschriebenen Wesenheit, wie ihr zeitloser Begriff sie ausdrückt; das flutende Werden, der historische Wechsel der Formen, die Entwicklungen ohne definitiven Vollendungspunkt — das widerstrebte der plastischen, auf die Selbstgenugsamkeit des Formungswertes gehenden Sinnesart der Griechen.
Und auf so geschlossenes Sein, auf die zeitlos qualitative Wesenheit des Individuums geht das Renaissanceporträt.
Die Wesenszüge der Person sind wie nebeneinander in fester Geformtheit ausgebreitet; und obgleich selbstverständlich Schicksale und innere Entwicklung zu der dargebotenen Erscheinung geführt haben, so sind doch für deren Eindruck diese Momente des Werdens ausgeschaltet, wie die Stationen einer Rechnung da nicht in Frage kommen, wo nur nach ihrem Resultat gefragt wird.
Das klassische Porträt hält uns in dem Augenblicke seiner Gegenwart fest, aber dieser ist nicht ein Punkt in einer Reihe des Kommens und Gehens, sondern er bezeichnet die jenseits einer solchen Reihe stehende zeitlose Idee, die überhistorische Form der seelisch- körperlichen Existenz.
Dies entspricht einerseits dem Begriffsrealismus, der sowohl das Nebeneinander der Existenzen wie das Nacheinander der Existenz in ein einmaliges Gebilde, das übereinzeln und doch real ist, zusammenzieht, andererseits unserer Vorstellung von der äusserlich-natürlichen Wirklichkeit.
Denn so sehr in dieser jede Erscheinung durch die vorhergehende streng kausal bestimmt ist, so ist doch das Vergangene völlig und sozusagen selbstlos in seine Wirkung aufgegangen, es ist als Vergangenes verschwunden und gleichgültig geworden, schon weil andere Ursachenkombinationen prinzipiell zu dem gleichen Effekt führen konnten.
In dieser Analogie, teils mit Metaphysischem, teils mit Physischem, stellt sich die Renaissance das Problem des Porträts.
Anders aber ist die Formung des Seelischen als solchen.
In seinem Verlaufe ist die Ursache nicht in ihre Wirkung aufgelöst und in ihrer besonderen Bestimmtheit irrelevant geworden, sondern in der Gesamtentwicklung der Seele empfinden wir jede Gegenwart als gerade nur durch diese bestimmte Vergangenheit möglich (obgleich einzelne, künstlich isolierte Partialverläufe jene physische Analogie zeigen mögen).
Das Vergangene ist hier nicht nur Ursache des Späteren, sondern seine Inhalte legen sich als Erinnerungen oder als dynamische Realitäten, deren Wirkungen aber von gar keiner andern Ursache ausgehen könnten, Schicht um Schicht übereinander, und damit wird — so paradox der Ausdruck ist — das Nacheinander zur wesentlichen Form jedes Gegenwartstatbestandes der seelischen Ganzheit.
Wo also die Seele nach ihrer wirklichen Eigenart die Gestaltung bestimmt, kommt es nicht zu deren Zusammenziehung auf jene Art von anschaulicher Abstraktion, in der alle Bestimmtheiten sich in einem Ein-für-alle-Mal, in zeitloser Wesenhaftigkeit bieten.
An den Rembrandtschen Porträt-Physiognomien empfinden wir sehr deutlich, dass ein Lebenslauf, Schicksal an Schicksal fügend, dieses Gegenwartsbild erzeugt, es versetzt uns gewissermassen auf eine Höhe, von der der Weg bis zu ihr hinauf überschaubar ist — so wenig irgendein Inhalt dieser Vergangenheit naturalistisch anzugeben wäre, wie sonst wohl Porträts mit psychologischer Tendenz es nahelegen wollen.
Dies wäre ein anekdotisches oder literarisches Interesse jenseits der reinen Kunstlinie.
Wunderbarerweise trägt Rembrandt in die feste Einmaligkeit des Anblicks das ganze bewegte Leben ein, das zu ihr geführt hat, die sozusagen formale Rhythmik, Gestimmtheit, Schicksalstönung des vitalen Prozesses.
Es handelt sich nicht — wie man Rembrandt manchmal zu deuten suchte — um gemalte Psychologie.
Denn alle Psychologie ergreift einzelne, ihrem Gehalt nach begrifflich ausdrückbare Elemente oder Seiten der inneren Geschehensganzheit.
Ein sozusagen logisch fassbares Element wird von der Kunst, wo Psychologie sie beherrscht, als Vertreter dieser Ganzheit vorgetragen.
Die psychologische Gerichtetheit bewirkt immer eine Singularisierung und damit eine gewisse Verfestigung, die sich der in jedem Augenblick vorhandenen, aber kontinuierlich fliessenden Ganzheit des Lebens enthebt.
Die Darstellung des Menschen bei Rembrandt ist im äussersten Masse beseelt, aber nicht psychologisch — ein Unterschied, dessen Tiefe leicht unbemerkt bleibt, wenn man sich nicht des Lebens als jederzeitiger Totalität und stetigen Formwechsels in seinem Gegensatz zu jeder herausgesonderten, für sich logisch fixierbaren Einzelqualität bewusst wird.
Denn nur diese Lebensdynamik, nicht aber ihr mit einzelnen Begriffen anzugebender Inhalt oder Charakterzug ist der Bildner unserer Züge.
Und wie Rembrandt in die einzelne Ausdrucksbewegung die Einheit ihrer Geschichte, von der blossen Potentialität des ersten Impulses an, mit Eins zur Darstellung und Empfindung gebracht hat, so hat er — gleichsam "mit grossen Buchstaben geschrieben" — die ganze persönliche Entwicklungslinie so in das Jetzt der Anschauung gebannt, dass sie in einer eigentümlich intuitiven Weise, trotz und mit ihrer Nacheinander-Form, in diesem Jetzt unmittelbar gegeben und aus ihm ablesbar ist.
Rembrandt hat so der Lebensbewegtheit einen bis dahin unerhörten künstlerischen Ausdruck gewonnen, freilich einen, der nicht Methode oder Stil werden kann, sondern an die persönliche Genialität gebunden bleibt.
Gewiss fehlt es dem Florentiner und Venezianischen Porträt nicht an Leben und Seele.
Allein es ist eine allgemeine Formgebung da, die die Elemente der Unmittelbarkeit ihres Erlebtwerdens und damit der Ordnung des Nacheinander entreisst: die Form hat eine Geschlossenheit in sich, der sich von der seelischen Bewegtheit nur deren Resultate als Material zur Verfügung stellen.
Jener typisierende Stil braucht hier keine inhaltliche Ähnlichkeit der Individuen zu bewirken (obgleich freilich in der Sienesischen und teilweise in der Umbrischen Kunst die Menschen alle sich auch irgendwie ähnlich sehen), aber er bewirkt eine besondere Art von "Allgemeinheit", nämlich die Darstellung des ideellen Individuums, das durch die Abstraktion aus all seinen einzelnen Lebensmomenten zustandekommt.
Bei Rembrandt bedeutet die Allgemeinheit des individuellen Menschen die Akkumulation eben dieser, gewissermassen ihre historische Ordnung bewahrenden Momente.
Dieser ganz problematische Ausdruck begibt sich in die Nähe der Addition einzelner Momente, die ja als Lebensausdruck gerade verneint wird.
Er gilt nur, insofern man solche Zerlegung als eine psychologisch-technische Hergebrachtheit einmal annehmen und sie gewissermassen nachträglich wieder zur Lebenstotalität formen will.
Mit dieser Akkumulation oder als sie enthalten Rembrandts Porträts die Bewegtheit des seelischen Lebens, während das klassische Porträt nicht nur zeitlos im Sinne der Kunst überhaupt ist, d. h. unabhängig von der Einstellung zwischen ein Vorher und ein Nachher der Weltzeit, sondern in sich selbst, in der Ordnung seiner Momente, eine immanente Zeitlosigkeit besitzt.
Daher sind die reichsten und ergreifendsten Porträts Rembrandts die von alten Leuten, weil an ihnen ein Maximum gelebten Lebens zur Überschau gelangt; in Porträts von Jugendlichen hat er dasselbe nur mit einigen Titusbildern durch eine Drehung der Dimension erreicht, indem hier gewissermassen das zukünftige Leben mit seinen Entwicklungen und Schicksalen ebenso akkumuliert und als Gegenwart des zukünftigen Nacheinander erschaubar wird, wie dort die bereits abgelaufene Zeitfolge.
Die Reihen der Porträts und der Handzeichnungen
Und nun greift die Kontinuität der fliessenden Lebensganzheit, die sich im einzelnen Porträt sammelt, über dieses hin und drückt sich, real und symbolisch, in Rembrandts offenbarer Neigung aus, einen und denselben Menschen auf mehrfachen Lebensstufen malerisch zu erfassen.
Es wiederholt sich damit, in weiterem Bezirke, das Grundgefühl, dass das Leben sozusagen nicht in einem Gestaltungsmoment zu verfestigen ist; in der Reihe der Bilder einer Person, d. h. in der Tatsache, dass es eine Reihe ist, legt sich auseinander, was das einzelne Bild in der Form der Intensität zeigt.
Hier ist vor allem an die Reihe seiner Selbstporträts zu denken und wie gerade sie, als Reihe, sich in Gegensatz zu der klassischen Menschenauffassung setzt.
Tizian und Andrea del Sarto und ebenso Puvis de Chavannes und Böcklin haben je einige wenige Selbstporträts hinterlassen, in denen sie ihr unveränderliches Wesen ein für allemal niederzulegen dachten.
Wie aber bei Rembrandt in jeden als Bild erfassten Augenblick das ganze Leben einströmt, so strömt es auch weiter, bis zu dem nächsten Bild hin, sie lösen sich gleichsam in ein ununterbrochenes Leben auf, in dem sie kaum Haltepunkte bezeichnen: es ist nie, es wird immer.
Ich weiss sehr wohl, dass man die ausserordentliche Zahl dieser Selbstporträts und seiner Familienbildnisse aus rein malerischen Problemstellungen ableiten will.
Alle Argumente dafür als wahr angenommen, scheint mir diese Isolierung des "rein malerischen" Interesses angesichts der aus jedem Porträt her- ausglühenden Leidenschaft der Menschendarstellung etwas völlig Künstliches und eine ganz irreale Abstraktion zu sein - begreiflich nur aus einer Zeit, deren an sich höchst gerechtfertigte Reaktion auf eine anekdotische und irgendwelche kunstfremde 4deen" übermittelnde Kunst schliesslich den Sinn für die Einheit des Kunstwerkes schwer geschädigt hat.
Die schlechthin einzige Kraft und Tiefe, mit der diese Bildnisse jeweils den ganzen Menschen hinstellen, wäre ein gar zu merkwürdiger Zufall, wenn Rembrandt wirklich nur das gewollt hätte, was für die abstrakt artistische Auffassung heute das "rein Malerische" heisst.
Jedenfalls, wie die Bilder dastehen erscheint als ihr "malerisches" Problem einfach die Darstellung einer menschlichen Lebensganzheit, aber wirklich als malerisches, nicht als psychologisches oder metaphysisches oder anekdotisches Problem.
Wie das aber schon im einzelnen Bilde ausserhalb der kristallinischen Schranken der Klassik geschah, so wurde es expliziert oder dehnte sich gleichsam zu der Vielheit der Porträts des gleichen Modells, an der er sich gar nicht genugtun konnte.
Durch jede dieser Reihen, richtiger: als sie, vibriert je ein Leben, das in seiner Einheitlichkeit immer neu, in seiner Neuheit immer eines ist.
Es wäre ein falscher Ausdruck, dass die Bestandteile dieser Reihen sich jeweils "ergänzen", denn ein jeder ist schon - in Ungeschiedenheit - ein künstlerisches und ein Lebensganzes, weil dies eben das Geheimnis des Lebens ist: dass es in jedem Augenblick das ganze Leben und doch jeder Augenblick von jedem andern unverwechselbar verschieden ist.
Darum wird die Offenbarung seiner Lebensauffassung, für die ihm freilich diese theoretische Formulierung wohl sehr ferngelegen hätte, von der künstlerischen Tatsache dieser Reihen, zunächst seiner Selbstporträts, erst vollendet.
Und noch einmal endlich und in ganz anderer Wendung versinnbildlicht sich dieses Wissen um das Leben, das nicht in Begriffen, sondern in Schöpfungen spricht, an der Reihe seiner Handzeichnungen.
So sehr die Ausdrucksbewegungen seiner Gemälde und Radierungen die Übermomentaneität des Lebens zeigen, so sind sie als ganze doch geschlossene in sich ruhende Gebilde, die das schöpferische Leben aus diesem selbst heraus und in feste Grenzen, in die Objektivität und Inselhaftigkeit, des fertigen Kunstwerks gesetzt hat.
Die Handzeichnungen aber sind nur wie Stationen, durch die dieses Leben ohne Aufenthalt hindurchgeht, sie sind wie die einzelnen Vollzüge seines Verlaufes, statt dass es sich an ihnen, wie schliesslich doch an den Gemälden, irgendwie staute.
Sie haben in ihrer Gesamtheit — viele Ausnahmen vorbehalten — einen andern Charakter als die Handzeichnungen anderer Meister.
Diese sind entweder bildmässiger Art; ihre Intention, zu Ende gelangt oder nicht, ist das für sich stehende, von einem ideellen Rahmen umgrenzte Kunstgebilde; oder sie sind Skizzen oder Studien, Bruchstücke oder Versuche, wobei ihr Sinn auf Zusammenhängen technischer oder vorbereitender Art ruht.
Rembrandts Zeichnungen entziehen sich dieser Alternative.
Sie haben etwas eigentümlich Unabgeschlossenes, als setzte sich eine unmittelbar an die andere an, wie ein Atemzug an den andern, und doch hat keine das Über-sich-Hinausweisende der Skizze — sie hat das Zusammen von Ganzsein und Weiterfliessen, das jedem Aktus unserer Lebendigkeit und nur ihm eigen ist.
Man kann wohl sagen, dass erst Rembrandts Handzeichnungen in ihrer Ganzheit das fundamentale lebendige Wesen seiner Kunst erschliessen, das sich in seinen Gemälden und ihren Ausdrucksbewegungen in je eine einzelne Objektivierung zusammengezogen hat.
Verschlossenheit und Offenheit der Porträtgestalt
Vielleicht klärt sich jetzt noch ein eigentümlicher Unterschied gegen das Renaissanceporträt auf.
Ich sagte von diesem, dass es seinen Charakter gleichsam zeitlos ausbreite, in einer Abstraktion, die die vitale Bewegtheit seines Gewordenseins ausschalte und nur seine reinen Inhalte in sich aufnehme.
Obgleich das so Aufgenommene sich innerhalb dieses Stiles mit der grössten Deutlichkeit darstellt, so bestimmt damit das Cachet des Geheimnisvollen oder Rätselhaften der Persönlichkeit ihren Eindruck eher in höherem als in geringerem Grade.
Denn es ist in unserm innerlich-äusserlichen Sein etwas Dunkles und Verhangenes, das eine Verständlichkeit, soweit sie überhaupt dafür in Frage kommt, nur von dem Lebensprozess seines Werdens aus gewinnt.
Indem das klassische Porträt oberhalb der Ebene, in der dieser verläuft, zu einer höchst geschlossenen Einheit von Stil und Eindruck gelangt, bekommt die dargestellte Persönlichkeit jenes eigentümlich Verschlossene, das an so vielen Renaissancebildnissen auffällt.
Zweierlei ist hieran höchst merkwürdig.
Einmal, dass ein Zug, der doch nur den künstlerischen Stil charakterisiert, ein Formungsprinzip, das nur die Darstellung als solche leitet -- sich in eine Qualität des dargestellten Subjektes fortsetzt.
Die Renaissancestilisierung, in deren Gesichtswinkel das Modell nach der Zeitlosigkeit seiner reinen Form eintritt, verschliesst in einem gewissen Sinn und Mass das Verständnis dieses Modells nach seinem zeitlich entwickelten Leben; und während sonst jedes reifere Kunstbetrachten den Charakter der Darstellung und den Charakter des Dargestellten durchaus getrennt hält (die Darstellung des Sinnlichen oder des Banalen braucht keine sinnliche oder banale Darstellung zu sein), scheint sich hier Charakter oder Wirkung des Stiles als solchen unvermeidlich auf die persönliche Wirklichkeit des Objekts zu projizieren.
Dass hier der Mensch in einer Schicht seiner Erscheinung ergriffen wird, die uns einer bestimmten Intuition seines Lebens fernstellt — dies wirkt als eine Verschlossenheit dieses Menschen, die ihm, als Subjekte jenseits der Kunst, zukäme!
Und nicht weniger merkwürdig ist es, dass gerade die mit diesem Stil gewonnene Deutlichkeit und gewissermassen rationalistische Bestimmtheit der Darstellung ihre Inhalte in solche Rätselhaftigkeit und Undurchdringlichkeit rückt! Dies öffnet einen tiefen Blick in die Divergenz zwischen der zeitlos-logischen Verbindung von Inhalten (auch wenn es sich, wie hier, um die Logik der Anschaulichkeit handelt) und ihrer vitalen, im Zeitstrom sich vollziehenden Verbindung; es zeigt, wie sehr die begriffene Einheit der ersteren noch immer die letztere als ein Geheimnis bestehen lässt.
Die Wirkung von Rembrandts Bildnissen ist gerade entgegengesetzt.
Von so tiefem Leben durchschüttert, in so lang laufende Schicksalsfäden versponnen seine Figuren uns oft erscheinen — keine hat jenes eigentümlich Rätselhafte, wie die Mona Lisa oder Botticellis Giuliano Medici, wie Giorgiones Jünglingsköpfe in Berlin und Budapest oder Tizians Junger Engländer im Pitti.
Mit solchen verglichen ist Rembrandts Auffassungs- und Vortragsweise zwar unvergleichlich vibrierend, in das Dämmernde und sozusagen Unendliche sich verlaufend, der logischen Durchsichtigkeit entbehrend; aber mit alledem ist der dargestellte Mensch für uns sehr viel aufgeschlossener, bis auf den Grund durchleuchtet, ein verständlich vertrautes Wesen.
Und das wird keineswegs daran liegen, dass Rembrandts Modelle unkompliziertere, gradlinigere Menschen waren als jene differenzierten und mit allen Kulturfinessen geladenen Renaissance-Italiener.
Sondern vielmehr daran, dass Rembrandts verschlungenere, an Elementen reichere, scheinbar ungeklärtere Auffassung des Menschen die seelische Reihe von Entwicklungen und Schicksalen, die die aktuelle Erscheinung aufgeformt haben, in dieser fühlbar und dadurch sie selbst nachfühlbar und von innen her verständlich gemacht hat.
In der klaren Harmonik und Ausbalanciertheit des Renaissanceporträts tragen gleichsam die Elemente sich gegenseitig, die geistdurchdrungene Körperlichkeit wird nach den Gesetzen aktueller Anschaulichkeit geformt; im Rembrandt-Porträt werden die erscheinenden Elemente, ausser ihrer unmittelbaren Relation zueinander, gleichsam von einem dahintergelegenen Punkt her geformt, im sinnlichen Erfassen ihrer wohnen wir der Dynamik des Lebens und Schicksals bei, die sie ausgehämmert hat.
Was nach den Kategorien der Intellektualität ganz widerspruchsvoll und mit ihnen nur höchst unvollkommen ausdrückbar ist, ist hier künstlerisch gekonnt: in ein rein anschauliches Gebilde, ohne jede literarische oder ausserkünstlerische Assoziation, ist sein lebendiges Gewordensein hineingeformt, die Darstellung des aktuell Anschaulichen hat die Zeitlichkeit eines langen Lebensverlaufes, nach seiner Gewalt und Rhythmik, in sich aufgenommen, ohne dass das Nacheinander am Nebeneinander oder dieses an jenem zerbrochen wäre.