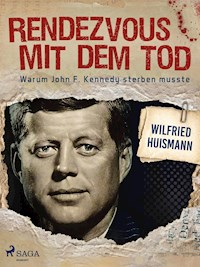
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Fesselnde Dokumentation im Stil eines Polit-ThrillersWer erschoss John F. Kennedy? Der Mord an dem amerikanischen Präsidenten zählt zu den spektakulärsten Mordfällen des 20. Jahrhunderts. Zahlreiche Verschwörungstheorien ranken sich um den Fall. Der deutsche Filmemacher und Journalist Wilfried Huismann geht in seinem Buch, zusammen mit dem ehemaligen FBI-Supervisor Laurence Keenan, auf Spurensuche. Keenan wurde nach dem JFK-Attentat zu Ermittlungszwecken nach Mexiko geschickt, kurze Zeit später von Präsident Johnson jedoch wieder zurück beordert. Zusammen mit Huismann nimmt Keenan die verlorenen Spuren wieder auf und plötzlich präsentiert sich den beiden ein völlig neues Bild der Lage. Denn Kennedey-Mörder Oswald soll keinesfalls ein einsamer Spinner, sondern vielmehr das Werkzeug von Fidel Castro gewesen sein..."Der überzeugende Beweis, dass Fidel Castro hinter dem berühmtesten Mord des zwanzigsten Jahrhunderts steckt." – Daily Telegraph"Huismanns Recherche ist dicht, sie ist plausibel und bleibt in sich logisch. Viel mehr kann ein Dokumentarfilm nicht leisten. Ganz sicher wird der Film nicht das letzte Wort zum Thema Kennedy-Mord sein. Aber seine These zu widerlegen dürfte nicht ganz einfach sein." - die tageszeitung-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 272
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wilfried Huismann
Rendezvous mit dem Tod - Warum John F. Kennedy sterben musste
Saga
Rendezvous mit dem Tod - Warum John F. Kennedy sterben mussteCoverbild / Illustration: Pixabay Copyright © 2008, 2019 Wilfried Huismann und SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788726346893
1. Ebook-Auflage, 2019
Format: EPUB 2.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit Zustimmung von SAGA Egmont gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk
– a part of Egmont www.egmont.com
Vorwort
In seinem Marmorpalast am Platz der Revolution sah sich Fidel Castro meinen Dokumentarfilm »Rendezvous mit dem Tod« an, den die ARD am 6. Januar 2006 ausgestrahlt hat. Was er sah, gefiel ihm offenbar nicht, denn prompt nutzte er einen Auftritt im staatlichen Fernsehen am 22. Januar 2006 dazu, um den Film zu kritisieren. Der Autor sei ein »schräger Vogel« aus Deutschland, der »auf Rechnung und auf Befehl der CIA« gearbeitet habe. Aus seinem Mund klingt das fast wie ein Lob. Immerhin hat der máximo lider bei seiner Schimpfkanonade mit keinem Wort meine Grundthese bestritten, nach der Lee Harvey Oswald als »revolutionärer Kämpfer« von Kuba eingesetzt wurde, um John F. Kennedy zu töten.
Auch Fidel Castros Getreue versuchten gar nicht erst, die sorgfältig zusammengetragenen Beweise, die in »Rendezvous mit dem Tod« präsentiert werden, zu widerlegen. Der kubanische KP-Funktionär Miguel de Padrón veröffentlichte am 25. Januar in der Zeitschrift Cubadebate einen noch schrilleren Verriss als den des Meisters: Autor Huismann sei ein Komplize der Terroristen und habe für sein Machwerk von der CIA eine Million Dollar bekommen. Das Drehbuch habe die exilkubanische Mafia in Miami geschrieben.
Castro brachte auch seine Diplomaten auf Trab. In mehreren Ländern erhielten die jeweiligen Fernsehanstalten Besuch vom kubanischen Botschafter, der sie mit Drohungen (Einreiseverbot für Journalisten) davon abzuhalten wollte, den Film ebenfalls zu zeigen.
All diese Bemühungen sind umsonst. Die bösen Geister der Geschichte kann man auf Dauer nicht einsperren. Kennedy starb in einem dramatischen, mit großer persönlicher Leidenschaft geführten Duell, aus dem Castro als Sieger hervorging. Vielleicht wird mancher Castros Tatmotiv ein Stück weit nachvollziehen können. Immerhin hatten die Kennedy-Brüder vor dem tragischen Finale in Dallas alles versucht, ihn ebenfalls ermorden zu lassen. Selbst nachdem Castro im Herbst 1963 eine Warnung nach Washington geschickt hatte, heuerte Justizminister Robert Kennedy einen von Castros Freunden an, um ihn zu vergiften. Lyndon B. Johnson erzählte die Tragödie texanisch schlicht in einem Satz: »Kennedy wollte Castro erledigen, aber Castro war schneller.«
Johnson trägt auch die Verantwortung dafür, dass Fidel Castro als Pate des Verbrechens ungestraft davongekommen ist. Als er wenige Stunden nach Kennedys Ermordung erfuhr, der Mörder Lee Harvey Oswald habe Kontakte zum kubanischen Geheimdienst gepflegt, war er schockiert. Wäre diese Tatsache in dem traumatisierten und aufgewühlten Amerika der damaligen Zeit bekannt geworden, hätte er Kuba militärisch angreifen und damit möglicherweise die Verantwortung für den Ausbruch des Dritten Weltkrieges tragen müssen.
Gemeinsam mit dem Bruder des toten Präsidenten, Robert Kennedy, entschloss er sich, die Hintergründe des Verbrechens zu vertuschen. Alle Ermittlungen in Richtung Kuba wurden eingestellt und auch die Warren-Kommission, die das Verbrechen untersuchen sollte, wurde absichtlich getäuscht.
Ich erfuhr zum ersten Mal davon, als ich im Sommer des Jahres 2000 den ehemaligen FBI-Agenten James Hosty kennen lernte, der Lee Harvey Oswald vernommen hatte. Seine Aussage öffnete mir die Tür zu einem der sorgsam gehüteten Staatsgeheimnisse der USA.
Wilfried Huismann, im Juli 2006
Einleitung – Unter Krokodilen
»Mit meiner Kuba-Politik habe ich eine Schlange an meinem Busen genährt, die mir sehr gefährlich werden kann.«
John F. Kennedy
Der erste Weg auf einer langen und abenteuerlichen Recherchereise führt durch ein sumpfiges Labyrinth. 100 Meilen durch den grünen flachen Dschungel der Everglades geht die Fahrt in Richtung Punta Gorda an der Westküste Floridas. Dort lebt der legendäre James Hosty, ein FBI-Agent, der Lee Harvey Oswald nach dem Mord an Kennedy persönlich vernommen hat. Ein Freund hat mir empfohlen, den alten Mann zu besuchen. Hosty habe eine unglaubliche Geschichte zu erzählen.
Links und rechts der Straße lauern Alligatoren und Krokodile. Zu hunderten liegen sie müde am Zaun, der sie davon abhält, über die vorbeiziehenden Autos herzufallen. Die Everglades sind ein sumpfiges Paradies aus Bauminseln mit Sumpfkiefern, Mangrovenwäldern, Magnolien, Lilien, Gras und Milliarden von Moskitos. Über allem ein makellos blauer Himmel. Die kaltblütigen Alligatoren blinzeln uns frustriert hinterher. Der Zaun macht all ihre Träume zunichte.
Special Agent Hosty
Er stellt sich mit »Special Agent James Hosty, FBI « vor, so als sei er noch im Dienst. Ein vierschrötiger, untersetzter Mann knapp über 80, dessen Stimme wie ein texanischer Sattel knarrt. Die Linke kann er nicht ausstehen. Sie habe den Kennedy-Mord dazu benutzt, eine »Verschwörungsindustrie« aufzubauen und die Glaubwürdigkeit der amerikanischen Institutionen zu erschüttern.
Hosty hat den 22. November 1963 als nicht enden wollenden Albtraum in Erinnerung. Immer wieder habe er mit den Tränen kämpfen müssen, denn im Gegensatz zu den meisten seiner Kollegen verehrte er den Präsidenten: »Ich war Demokrat und irischer Katholik, wie er. Es war, als sei ein Verwandter gestorben.«
Die Sonne strahlte über Dallas, als er in der Mittagspause sein Büro verließ, um dem Autokorso des Präsidenten vom Bürgersteig aus zuzusehen. Einige Dinge missfielen ihm sofort: Das Verdeck des Lincoln war heruntergeklappt und nur ein Leibwächter fuhr in Kennedys Wagen mit. Die anderen Geheimagenten fuhren in einem Begleitwagen. »Verdammter Leichtsinn«, fuhr es ihm durch den Kopf. Aber es war nicht sein Job. Nachdem er einen kurzen Blick auf John F. und Jackie erhascht hatte, ging er in sein Lieblingslokal, das Oriental Café, und bestellte sich einen Käsesandwich, dazu einen Kaffee.
Um 12:29 Uhr erreicht der Lincoln des Präsidenten die Kreuzung von Main und Houston Street. Nellie Connally, die Frau des texanischen Gouverneurs, dreht sich auf ihrem Sitz herum und sagt: »Sie können nicht behaupten, dass Dallas Sie nicht liebt, Mr. President.« Die Uhr auf dem Hertz-Gebäude zeigt 12:30, als die Schüsse fallen.
Der erste Schuss geht daneben. Lee Harvey Oswald braucht drei bis vier Sekunden zum Nachladen. Der Kopf seines Opfers ist jetzt 60 Meter von ihm entfernt. Das zweite Geschoss vom Kaliber 6,5 Millimeter dringt in den Nacken ein, verletzt die rechte Lunge, durchschlägt die Luftröhre, tritt aus der Kehle aus und durchschlägt dann, durch den Aufprall ins Trudeln geraten, in einer Zickzackbewegung den Rücken, die Brust, das rechte Handgelenk und den linken Oberschenkel des vor Kennedy sitzenden Gouverneurs Connally 1 . Der Präsident ist schwer verletzt, aber nicht tödlich.
Roy Kellermann, der persönliche Leibwächter Kennedys, sitzt auf dem Vordersitz und blickt den Fahrer der Limousine, William Greer, erstaunt an. Beide sind wie gelähmt und unfähig zu reagieren. Greer beugt sich über das Steuer und bremst sogar noch ab. Fünf Sekunden verstreichen ungenutzt, sie wären für ein schnelles Ausweichmanöver ausreichend gewesen. Fünf Sekunden sind für Oswald mehr als genug, um erneut nachzuladen und sein Opfer ins Visier zu nehmen. Er kann den Kopf Kennedys im Fadenkreuz seines Zielfernrohres deutlich erkennen, jetzt 80 Meter entfernt und nahezu unbewegt. Das Gewehr auf einer Kiste abgestützt, schießt er ruhig und sicher.
Die letzte Kugel ist tödlich. Sie durchschlägt den Schädel von hinten und reißt beim Austritt ein großes Loch in den vorderen rechten Teil des Kopfes. Jaqueline Kennedy, die sich ihrem Mann inzwischen zugewandt hat, sieht, wie sich ein gezacktes Stück von der Schädeldecke ablöst. Aus dem Loch im Kopf spritzen faustgroße Blut- und Gehirnklumpen. Der dadurch erzeugte Rückstoß schleudert den Kopf nach hinten, so dass der Eindruck entsteht, als sei Kennedy von vorn getroffen worden.
Special Agent James Hosty sitzt noch immer im Oriental Café, als die Kellnerin auf ihn zuläuft und mit Tränen in den Augen schreit: »Oh mein Gott, sie haben den Präsidenten erschossen.« Hosty hastet ins FBI-Büro zurück und bekommt den Befehl, alle stadtbekannten Rechtsradikalen zu überprüfen. Sie sind für das FBI die Hauptverdächtigen.
Um 14:15 Uhr wendet sich das Blatt. Hostys Chef packt ihn am Ellbogen und sagt: »Gerade ist ein Kerl verhaftet worden, Lee Oswald. Er hat einen Polizisten erschossen.« Agent Hosty ist schockiert, als er den Namen Oswald hört. Denn seit einigen Wochen liegt dessen Akte auf seinem Schreibtisch. Der Kommunist Lee Harvey Oswald und seine aus der Sowjetunion stammende Frau Marina gelten beim FBI als potentielle Spione. Um ihm auf den Zahn zu fühlen, war Hosty vor einigen Tagen sogar zu der Wohnung in Irving hinausgefahren, doch Oswald wohnte nicht mehr bei seiner Familie und seine Frau Marina kannte weder seine Adresse noch die Telefonnummer ihres Mannes.
Es dauert nur ein paar Sekunden, bis Hosty kombiniert hat: Oswald muss auch der Mörder Kennedys sein. Warum hätte er sonst einen Polizisten erschießen sollen, der nichts anderes getan hat, als ihn nach dem Ausweis zu fragen? Fieberhaft durchforstet Hosty jetzt die Akte Oswald noch einmal genau und entdeckt einen abgefangenen Brief, den Oswald vor wenigen Wochen an die sowjetische Botschaft in Washington geschrieben hat. Darin berichtete er von seiner Reise nach Mexico City, wo er die sowjetische und die kubanische Botschaft besucht habe. Hosty ahnt: dieser Brief ist explosiv und kann zu dramatischen internationalen Verwicklungen führen. Kurz vor 15 Uhr kommt der Befehl aus dem FBI-Hauptquartier, er solle sofort ins Polizeihauptquartier von Dallas fahren und an der Vernehmung Oswalds teilnehmen.
Kaltblütig
Um Punkt 15:15 Uhr betritt Hosty das Vernehmungszimmer. Das Verhör wird von Will Fritz, dem Chef der Mordkommission, geleitet. Oswald, der bis zu diesem Moment trotz seiner gefesselten Hände lässig auf einem Holzstuhl gesessen hat, bekommt einen Wutanfall und schreit Hosty an: »Sie sind also der Agent, der meine Frau belästigt hat. Sie ist russische Staatsbürgerin und lebt legal in diesem Land. Das FBI ist nicht besser als die deutsche Gestapo.«
Einen Tonbandmitschnitt gibt es davon leider nicht. Die Polizei von Dallas besaß kein Tonbandgerät, weil es in Texas nicht üblich war, Vernehmungen aufzuzeichnen. Hosty machte sich Notizen, während Captain Fritz die Vernehmung fortsetzte.
Hosty erinnert sich, dass Lee Harvey Oswald sehr gefasst und kaltblütig war. Er ließ die Vernehmungen ungerührt über sich ergehen, manche Fragen beantwortete er nur mit einem »höhnischen Grinsen«, so Hosty. Er bestritt, den Präsidenten und den Polizisten Tippit getötet zu haben, oder auch nur ein Gewehr zu besitzen. Als Kennedy am Schulbuchlager vorbeigefahren sei, habe er sich gerade im Lunchraum im ersten Stock aufgehalten und eine Cola getrunken. Dann fragte Captain Fritz nach Oswalds Aktivitäten im Fair-Play-für-Kuba-Komitee. Oswald nickte in Hostys Richtung und sagte: »Warum fragen Sie nicht Agent Hosty?«
Captain Fritz, der die ganze Zeit über seinen weißen Cowboyhut aufhatte, war über den Verlauf der Vernehmung frustriert und wollte von Hosty wissen, ob er noch weitere Fragen habe. Hosty ging aufs Ganze: »Ich forderte Fritz auf, Oswald zu fragen, was er vor sechs Wochen in Mexiko getan habe. Oswald wurde unruhig und sagte: ›Ich war nie in Mexico City. Wie kommen Sie überhaupt darauf? Ich bin niemals dort gewesen.‹ Ich sah, dass er zu schwitzen begann und wusste, ich hatte den wunden Punkt getroffen. Für mich war in diesem Augenblick klar: Wenn wir dieses Verbrechen aufklären wollen, müssen wir in Mexiko suchen. Was hat Oswald dort sechs Tage lang gemacht und mit wem hat er sich getroffen?«
Zum Ärger von Agent Hosty wurde die Vernehmung an dieser Stelle unterbrochen, um Oswald einigen Augenzeugen gegenüberzustellen, die ihn als Mörder des Polizisten Tippit identifizierten. Während dieser Verhörpause ging Hosty auf dem Flur auf und ab, als plötzlich einer seiner Vorgesetzten vom FBI auftauchte: »Es war Harlan Brown. Er hatte einen neuen Befehl für mich: ›Hosty, Sie werden nicht mehr in den Verhörraum zurückkehren und Sie werden der Polizei von Dallas nichts von dem mitteilen, was wir über Oswald wissen, verstanden!‹ Ich war entsetzt, aber ich gehorchte. Offenbar war die erste Anweisung des Hauptquartiers aufgehoben worden. FBI-Direktor Edgar Hoover hatte jetzt die Regie übernommen.«
Meuterei in Mexiko
Wie ging die Geschichte weiter? Hat das FBI jemals herausgefunden, was Oswald ein paar Wochen vor dem Attentat in Mexiko gemacht hat? Hosty nickt und schüttelt gleich darauf den Kopf: »Es gab sogar eine gemeinsame Gruppe von FBI und CIA, die im November 1963 in Mexiko ermittelte, um Oswalds Bewegungsprofil dort zu erstellen. Die Spuren waren noch frisch damals und es zeigte sich, dass sie nach Kuba führten. Als das klar wurde, gab die Regierung in Washington den Befehl, die Ermittlungen sofort abzubrechen. Die Ermittler waren fassungslos und meuterten. Erst als Justizminister Robert Kennedy den Befehl bestätigte, gehorchten sie und brachen ihre Mission in Mexiko ab.«
James Hosty ist ein aufrechter Mann und wirkt sehr glaubwürdig. Und doch kommt mir seine Geschichte abenteuerlich vor. Warum sind die Spuren, die nach Mexiko und Kuba führten, nicht weiterverfolgt worden? Warum sollte ausgerechnet die US-Regierung das verhasste Revolutionsregime in Havanna verschont haben? Das klingt unlogisch, denn Fidel Castro war schon damals der ausgewiesene Lieblingsfeind der USA.
James Hosty lässt sich mit einer Antwort Zeit, politische Spekulationen sind ihm nicht geheuer: »Ich glaube, in Washington hatten sie einfach Angst. Wenn Castro dahintersteckte, dann hätte die öffentliche Meinung Präsident Johnson dazu gezwungen, Truppen nach Havanna zu schicken. Chruschtschow wäre unter dem Druck seiner Generäle nichts anderes übrig geblieben, als Fidel zu helfen. Johnson wollte keinen Atomkrieg riskieren. Er sagte, dann würden Millionen Amerikaner sterben.«
Agent Hostys Geschichte ließ mir keine Ruhe mehr. Markiert sie vielleicht den letzten weißen Fleck auf der Forschungslandkarte zum Mordfall Kennedy? Andererseits: Sind nicht alle Wege und Sackgassen bei der Suche nach der Wahrheit schon tausendfach durchschritten worden? Selbst wenn es stimmt, dass Mexiko ein weißer Fleck ist, wie soll man nach über vierzig Jahren aufklären, wo sich Oswald in Mexiko herumgetrieben und wen er damals getroffen hat?
So viele Forscher und Historiker haben sich am Thema JFK die Zähne ausgebissen, manche haben dabei sogar ihren gesunden Menschenverstand verloren und sind doch zu keinem schlüssigen Ergebnis gekommen. Ein tückisches Labyrinth, dem man fernbleiben sollte, wie den Sümpfen der Everglades mit ihren gefräßigen Alligatoren.
Außerdem störte Hostys Geschichte mein Weltbild. Wie die meisten Menschen war ich davon überzeugt, dass John F. Kennedy das Opfer einer rechtsradikalen, mafiösen und irgendwie von der CIA gesteuerten Verschwörung geworden war.
Ich nahm mir fest vor, mir meine geistige Gesundheit zu erhalten und Hosty keinen Glauben zu schenken. Zwei Jahre lang klappte das auch ganz gut, aber die Neugier war stärker. Anfang 2003 brach ich auf Oswalds Spuren zu einer ersten Reise nach Mexico City auf. Voller Zweifel und Neugier. Würde es gelingen, die verlorenen Spuren des Attentäters wieder zu finden und damit der Lösung eines der großen Rätsel des zwanzigsten Jahrhunderts näher zu kommen?
1. Spuren in Mexiko
»Im Mordfall Kennedy ist Mexiko die Büchse der Pandora.«
Laurence Keenan, FBI
Unten liegt Mexico City im grau-gelben Smog. Schon seit zehn Minuten überfliegen wir ein riesiges Häusermeer. Anfang und Ende der größten Stadt der Welt sind nicht zu erkennen. 26 Millionen Menschen leben in diesem Hexenkessel. Wie soll man darin die Spuren eines schmächtigen Mannes finden, der hier vor über vierzig Jahren mit einem Bus aus New Orleans ankam, um sich als »Soldat der Revolution«, wie er beim Abschied zu seiner Frau Marina gesagt hatte, zu verdingen? Genauso gut könnte man eine Nadel im Heuhaufen suchen. Denn die FBI-Ermittler haben nicht sehr viele Erkenntnisse hinterlassen. Sie bekamen heraus, mit wem Lee Harvey Oswald im Bus nach Mexico City saß, dass er im Hotel Comercio abstieg, in der kubanischen Botschaft einen Visumantrag stellte und wahrscheinlich einen Stierkampf besuchte. Ansonsten verlieren sich Oswalds Spuren im Nichts. Sechs Tage seines Lebens, verschwunden im schwarzen Loch der Zeitgeschichte.
Mexikos Stadtbild wird von grün-weißen VW Käfern beherrscht. Es sind Taxen, hierzulande liebevoll vochos genannt. Sie quälen sich zu hunderttausenden durch die Staus, unverwüstlich und zäh, so wie ihre Besitzer. Laura, eine gute mexikanische Freundin, hindert mich erfolgreich daran, eines dieser praktischen Transportmittel zu besteigen, um auf dem schnellsten Wege zu Oswalds Hotel in der Calle Sahagún zu kommen. »Viel zu gefährlich«, behauptet sie und erzählt mir Geschichten von europäischen Touristen, die von Taxifahrern verschleppt, ausgeraubt und sogar getötet worden seien. Erst als ich ihr versprochen habe, niemals so ein Teufelsgefährt zu besteigen, lädt sie mich in ihren VW-Jetta, tritt das Gaspedal bis zum Anschlag durch und steuert zielsicher einen imaginären Punkt an, während sie gleichzeitig auf mich einredet, um mir die Gefahren der Metropole einzuschärfen. Wir fahren ungefähr eine Stunde im Kreis, bis Laura beschließt, einen Straßenpolizisten zu fragen, wo denn die Calle Sahagún zu finden sei. Der verzieht missbilligend das Gesicht und sagt: »Nach rechts und dann immer geradeaus.« Laura reißt das Steuer energisch nach links und kommentiert meinen ratlosen Blick mit den Worten: »Jeder weiß doch, dass mexikanische Polizisten rechts und links nicht voneinander unterscheiden können, also mache ich genau das Gegenteil von dem, was er sagt.«
Als das Rot der Sonne mit dem Schwarz der Nacht verschmilzt, stehen wir endlich vor dem Hotel Comercio, ganz in der Nähe der Metrostation Revolución. Ein Blick auf den Stadtplan verrät mir: Mit dem Taxi wären es höchsten 10 Minuten gewesen. »Aber«, kontert Laura, »bei meiner Methode bist du immerhin am Leben geblieben.« Dagegen ist nun wirklich kein Einwand möglich. Das Viertel voller fliegender Händler, Zuhälter, Huren und Drogendealer gilt als unsicher. Selbst der kleine Getränkekiosk neben dem Hotel ist mit dicken Eisenstangen verbarrikadiert. Nachfrage bei der verstört wirkenden Empfangsdame des Hotels. Sie zuckt mit den Schultern und wirft einen ängstlichen Blick in Richtung Treppe. Sie selbst habe Oswald nicht gekannt. Nur der Besitzer des Hotels, Herr Guerrero, dürfe zu diesem Thema Auskunft geben. Der sei schon 1963 Eigentümer des Hotels gewesen. Im Moment sei er aber auf Auslandsreise und niemand wisse, wann er wiederkomme.
Im Hintergrund lärmen ein paar Huren mit ihren Freiern. Das Comercio ist heute ein schäbiges kleines Stundenhotel, am Rande der Legalität. Ein Zimmer kostet hier 6,50 Dollar, zu Oswalds Zeiten waren es nur 1,28. Filmen und Fotografieren, so belehrt mich die Empfangsdame, seien in diesem Hotel grundsätzlich verboten. Es wird fast ein Jahr Verhandlungen und eine hübsche Stange Geld kosten, bis wir endlich das Zimmer Nummer 18 betreten und auch filmen dürfen. Die spartanische Einrichtung der sechziger Jahre: Abgewetzte Möbel in rötlichem Holz mit schwarzen, von Zigaretten eingebrannten Löchern. Das Zimmer ist dunkel, mit Fenster zum Hof. Nur die Holzvertäfelung sei neu, so die Empfangsdame. Sonst ist alles so wie zu Oswalds Zeiten. Hier also hat der Mörder Kennedys gewohnt.
Silvia Durán
Am 27. September 1963 kam er am Vormittag gegen 10 Uhr im Hotel an, um sich gleich darauf in die kubanische Botschaft aufzumachen. Dort traf er auf Silvia Durán, die seinen Visumantrag für Kuba entgegennahm. Silvia Durán war eine mexikanische Kommunistin, die für die Kubaner arbeitete und das unbedingte Vertrauen des Botschafters genoss. »Revolutionär und sexy« sei sie gewesen, so der ehemalige US-Söldner Gerry Hemming, der an Fidel Castros Seite kämpfte und Silvia Durán 1962 kennen lernte.
Silvia Durán wurde für die kubanische Regierung, aber auch für die Warren-Kommission, die das Attentat untersuchte, eine Art Kronzeugin für Oswalds Aufenthalt in Mexiko. Immer wieder erzählte sie die gleiche Geschichte: Oswald verlangte ein Visum für Kuba und zwar sofort. Er gab sich als amerikanischer Kommunist mit großen Verdiensten für die kubanische Revolution aus. Sie habe ihm gesagt: Visumsanträge werden in Havanna entschieden. Er müsse warten, wie alle anderen auch. Aber da er schon einmal in der Sowjetunion gelebt habe, könnte sie ihm den Rat geben, zur nahe gelegenen Botschaft der Sowjetunion zu gehen, um dort ein Visum zu beantragen. Sollte er es bekommen, dann würde sie ihm sofort ein Transitvisum für Kuba geben. Doch die Sowjets wollten Oswald nicht wiederhaben und sagten »njet«. Was sollte sie tun: Sie habe ihn bei seinem zweiten Besuch abweisen müssen. Als er wütend wurde, habe der Konsul ihn hinausgeworfen.
Das Drama um das Oswald verwehrte Visum scheint ein Beweis dafür zu sein, dass die Kubaner nichts mit ihm zu tun haben wollten. Die Frage ist nur, ob die Geschichte wirklich so passiert ist, oder ob sie eine geheimdienstliche Fabrikation ist. Eine falsche Spur, um von den wirklichen Vorfällen in der Botschaft abzulenken? Silvia Duráns Aussage ist nie überprüft worden. Außer den Funktionären der kubanischen Botschaft gab es keine Zeugen.
Heute wohnt Silvia Durán in einer geschlossenen gutbürgerlichen Wohnanlage in der Nähe der Autonomen Universität von Mexico City, gut bewacht von einem privaten Sicherheitsdienst. Keine Chance, auch nur in die Nähe ihrer Wohnung zu kommen. Am Telefon ist sie freundlich und abweisend. Nein, ein Interview zum Thema Oswald komme nicht in Frage. Oswald sei für sie das »größte Trauma« ihres Lebens gewesen, das sie auf keinen Fall reaktivieren wolle. Die mexikanische Geheimpolizei verhaftete sie nach dem Mord an Kennedy und die ganze Familie habe sehr darunter gelitten. Sie habe damals alles gesagt, was sie wisse: Oswald sei bei seinem zweiten Besuch in der Botschaft so unverschämt und laut geworden, dass Konsul Azcue ihn schließlich hinausgeworfen hätte. Dann fügt sie von sich aus hinzu, als ob sie sich selbst vergewissern müsste: »Ich habe keinen privaten Kontakt zu ihm gehabt, nicht den geringsten. Schließlich war ich eine verheiratete Frau und mit einem Verrückten wie Oswald hätte ich mich niemals eingelassen. Ich habe ihn nie wieder gesehen.«
Soweit Silvia Duráns Geschichte. Alle beteiligten Regierungen waren mit ihrer Erklärung zufrieden: die mexikanische, die kubanische und die der USA. Auch die Warren-Kommission, die im Dezember 1963 damit begann, den Mordfall Kennedy zu untersuchen. Genauer gesagt bemerkten die ehrwürdigen Mitglieder der von Präsident Johnson eingesetzten Kommission nicht, dass sie von der CIA in die Irre geführt wurden. Denn die Belege über mögliche Kontakte Oswalds zum kubanischen Geheimdienst wurden ihr vorenthalten. Ein inzwischen freigegebenes Geheimtelegramm beweist das. Es wurde vom Direktor der CIA am 20. Dezember 1963 an die CIA-Station in Mexiko geschickt: »Unser Plan ist es, die abgehörten Telefonate aus dem Bericht für die Warren-Kommission zu entfernen. Wir werden uns stattdessen auf die Aussagen von Silvia Durán beziehen ... Das was sie und andere (kubanische) Botschaftsfunktionäre über Oswalds Besuche gesagt haben, soll als wertvolles Beweismaterial gesehen werden.« 2
Bei den Tonbandmitschnitten, die auf Anweisung des CIA-Chefs entfernt wurden, ging es um Telefonate von Lee Harvey Oswald, die er mit der kubanischen Botschaft in Mexico City geführt hatte. Die Bänder sind bis heute verschwunden. In den siebziger Jahren, als ein unabhängiger Untersuchungsausschuss den Mordfall Kennedy noch einmal aufrollte, teilte CIA-Chef Richard Helms den verdutzten Parlamentarien kühl mit, die Bänder mit den abgehörten Telefonaten seien »aus Versehen« gelöscht worden.
Oswalds mögliche Kuba-Connection wurde in den USA zu einer Art Staatsgeheimnis. Alle Hinweise auf eine kubanische Verwicklung verschwanden und alle Zeugen, die etwas anderes zu sagen hatten als Silvia Durán, bekamen Probleme. Zum Beispiel Pedro Gutiérrez, ein mexikanischer Kreditvermittler, der zufällig an dem Tag in der kubanischen Botschaft in Mexico City zu tun hatte, als dort auch Lee Harvey Oswald auftauchte.
Unliebsame Zeugen
Vor der Reise nach Mexiko habe ich bei Recherchen im Nationalarchiv der USA einen Brief gefunden, den der Mexikaner Pedro Gutiérrez am 2. Dezember 1963 an den neuen US-Präsidenten Lyndon B. Johnson geschrieben hatte. Gutiérrez wollte eine wichtige Zeugenaussage im Mordfall Kennedy machen. Er stellte sich dem amerikanischen Präsidenten als Kreditvermittler des Kaufhauses El Palacio de Hierro vor. Im September 1963 habe er die Kreditwürdigkeit eines Angestellten der kubanischen Botschaft in Mexiko untersucht und sei deswegen mehrmals dort gewesen.
Er erinnere sich, am 30. September, vielleicht war es auch der 1. Oktober, in der Botschaft auf einen Nordamerikaner gestoßen zu sein, den er später auf den Zeitungsfotos eindeutig als Lee Harvey Oswald identifizieren konnte. Er wurde Augenzeuge, wie Oswald gemeinsam mit einem kubanischen Funktionär die Botschaft verließ. Dabei habe Oswald ein Bündel mit Dollar in der Hand gehabt, die er abzählte. Er und der Kubaner waren in ein erregtes Gespräch vertieft. Einige Wortfetzen habe er mithören können, erinnert sich der Zeuge Gutiérrez in seinem Brief an Präsident Johnson: »Es ging um Castro, Kuba und Kennedy. Die beiden gingen auf die Straße, stiegen in ein Auto und verschwanden aus meinem Blickfeld. Aus diesem Grund, sehr geehrter Herr Präsident, glaube ich, dass das Attentat gegen Präsident Kennedy nicht das persönliche Werk eines Fanatikers war, sondern dass es von Fidel Castro befohlen wurde.« 3
Abschließend bittet der Zeuge darum, seine Aussage »strikt vertraulich« zu behandeln. Es folgen die Unterschrift, ein Fingerabdruck und ein Passfoto, dass der Briefschreiber mit braunem Klebeband unter seiner Unterschrift befestigt hat.
Das Weiße Haus beauftragte das FBI, den Zeugen Gutiérrez unter die Lupe zu nehmen. Viermal wurde er von FBI-Beamten vernommen. Die Vernehmungen und auch Befragungen von Nachbarn und Kollegen brachten das FBI zu dem Urteil, der Zeuge sei »sehr glaubwürdig und ernsthaft«. 4 Trotzdem wurde die Spur nicht weiterverfolgt. Im Gegenteil. Die CIA nahm sich des Zeugen an und übergab ihn an die mexikanische Geheimpolizei. Was die mit dem Zeugen Gutiérrez angestellt hat, weiß niemand. Jedenfalls war er hinterher ein anderer Mensch und wollte sich an nichts mehr erinnern. Als der Untersuchungsausschuss Politische Morde (House Select Committee on Political Assassination, HSCA) des US-Kongresses im Jahr 1978 nach Mexiko flog, um Pedro Gutiérrez erneut zu vernehmen, widerrief der seine ursprüngliche Zeugenaussage. 5
Der Untersuchungsausschuss hakte nicht weiter nach. Er stellte sich auch nicht die Frage, warum Gutiérrez sich an nichts mehr erinnerte. Im Jahr 1978 hatte keiner der Abgeordneten und Ermittler des Untersuchungsausschusses ein ernsthaftes Interesse daran, Spuren nach Havanna zu verfolgen. Niemand konnte oder wollte sich vorstellen, dass Fidel Castro so verrückt gewesen sein könnte, Lee Harvey Oswald als Auftragsmörder anzuheuern.
Ich berate den Fall Gutiérrez mit meinem mexikanischen Kollegen Mauricio Laguna Bérber. Er gehört seit heute zum Rechercheteam, frisch rekrutiert. Ich bin durch einen seiner Artikel in der mexikanischen Zeitschrift Crisis auf ihn aufmerksam geworden. Eine brillante Arbeit über den schmutzigen Krieg des mexikanischen Geheimdienst DFS (Dirección Federal de Seguridad) gegen die Opposition in den sechziger Jahren. Mauricio ist einer der besten investigativen Journalisten Mexikos und sofort bereit, mitzuarbeiten. Wir treffen uns auf der Terrasse des Hotels Majestic, im Herzen der Stadt.
Unter uns einer der größten Plätze der Welt, der Zócalo. In seiner Mitte flattert die riesige Nationalflagge hoch im Wind. Auf der anderen Seite des Platzes der lange und flache Nationalpalast, im Jahr 1523 von den spanischen Eroberern auf den Ruinen der Aztekenhauptstadt Tenochtitlán errichtet. In der Ferne wächst aus dem grauen Dunst der Metropole 5000 Meter hoch und stolz der Vulkan Popocatepetl. Es ist noch früh am Abend, doch schon zieht die Kälte eisig in die Hosenbeine. Denn die Stadt liegt auf 2300 Meter Höhe. Um uns aufzuwärmen, bestellen wir einen sieben Jahre alten Tequila.
Wir entscheiden uns dafür, den Fall Pedro Gutiérrez noch einmal aufzurollen. Irgendetwas ist mit seinem Widerruf von 1978 faul. Lebt der Mann noch – und wie können wir ihn finden? Gleich morgen früh wollen wir zu der Adresse fahren, die Pedro Gutiérrez damals in seinem Brief an Präsident Johnson angegeben hat.
Die Calle Florida liegt gleich hinter der Stierkampfarena, mit 60 000 Plätzen die größte der Welt. Das Haus Nummer 9 ist eine Mietskaserne im Stil der fünfziger Jahre. »Untere Mittelklasse«, konstatiert Mauricio nach einem abschätzenden Blick. Am Haupteingang herausgerissene Klingelknöpfe. Die Klingeln, die noch da sind, verfügen über Außenleitungen, die wie Efeu an der Mauer in die Höhe klettern, um dann in den Fenstern zu verschwinden. Kein Klingelschild mit dem Namen Gutiérrez.
Als eine Frau mit zwei Dobermännern das Haus verlässt, können wir hineinschlüpfen. Wir finden die in Gutiérrez’ Brief angegebene Wohnungsnummer im dritten Stock. Sie liegt zum Innenhof. Die Fenster sind mit Vorhängen zugezogen. An der Tür kleben Bildchen von Heiligen und von der Jungfrau Maria. Niemand öffnet, als wir klopfen, aber drinnen sind schlurfende Schritte zu hören. Also ist jemand da, will aber nicht aufmachen. Erst als ich mich auf die christliche Barmherzigkeit und auf die weite Reise berufe, die wir hinter uns haben, öffnet sich die Tür einen winzigen Spalt. Eine Frauenstimme erklärt: »Sie haben sich geirrt. Hier wohnt kein Pedro Gutiérrez. Wir kennen ihn nicht.«
Wir gehen enttäuscht weg. Doch unten an der Treppe entdecken wir auf dem Fenstersims einen Haufen Briefe – Post für die Hausbewohner, die in Ermangelung eines Briefkastens hier abgelegt wurden. Beim Durchblättern entdecke ich einen Brief an Pedro Gutiérrez – mit der alten Wohnungsnummer. Zurück zur Tür. Diesmal verlangen wir ohne katholische Höflichkeitsfloskeln Auskunft: Wo ist Pedro Gutiérrez?
Die Frau hinter der Tür gibt kleinlaut zu, sie sei Blanca Lopez, die Enkelin des Gesuchten, ihr Großvater wohne aber nicht mehr hier. Wir erklären unser Anliegen. Sie zögert immer noch, die Tür zu öffnen. Offenbar hat sie Angst. Sie will mit der Geschichte nichts zu tun haben, denn wegen seiner Aussage über Lee Harvey Oswald habe ihr Großvater schon eine Menge »Probleme« bekommen. »Schreiben Sie ihm einen Brief. Dann bekommen Sie eine Antwort.« Das ist immerhin etwas. Doch unser Brief bleibt unbeantwortet und die Tür zu der Wohnung wird sich nicht wieder öffnen. Wir observieren das Haus wochenlang.
Eines Abends hat Mauricio Glück. Er trifft die Enkelin vor dem Haus, als sie gerade hineingehen will. Sie wirkt erschrocken und ängstlich. Doch aus Respekt vor unserer Hartnäckigkeit, oder vielleicht auch nur aus Mitleid, fasst sie sich ein Herz und erklärt, warum ein weiteres Warten keinen Sinn hat: Ihr Großvater habe sich entschieden, nicht mit uns zu sprechen. Niemand könne ihn von dieser Entscheidung abbringen. Was, so hakt Mauricio nach, hat Pedro Gutiérrez im Jahr 1978 bewogen, seine ursprüngliche Zeugenaussage zu widerrufen?
»Er bekam Probleme.«
Als Mauricio nachfragt, um welche Probleme es sich handelte, kommt eine überraschende Antwort:
»Nicht lange, nachdem er an Präsident Johnson geschrieben hatte, bekam er Besuch von kubanischen Agenten, die ihn einschüchterten. Sie wollten, dass er seine Aussage zurückzieht, sonst würde es ihm schlecht ergehen. Sie drohten damit, ihn zu töten. Er entschloss sich, das Land zu verlassen und ging in die USA, um dort unter einem anderen Namen zu leben. Ich darf Ihnen nicht sagen, wo er jetzt ist. Bitte kommen Sie nicht wieder. Mein Großvater ist über neunzig Jahre alt und möchte in Ruhe sterben.«
Oscar Contreras
Warum wurde der Zeuge Gutiérrez eingeschüchtert, was machte seine Aussage so gefährlich? Ging es anderen Mexikanern, die Kontakt mit Oswald hatten, ähnlich? Wir müssen weitere Zeugen finden. In den Akten des Untersuchungsausschusses Politische Morde aus dem Jahr 1978 taucht noch ein Name auf, der für unsere Spurensuche interessant werden könnte: Oscar Contreras, Führer einer revolutionären Studentengruppe, des Bloque Revolucionario. Als Student der Autonomen Universität Mexiko soll er angeblich Kontakt mit Lee Harvey Oswald gehabt haben. Aber der Untersuchungsausschuss zum Mord an Kennedy hat ihn nie dazu befragt.
Zwar reisten Mitglieder des Untersuchungsausschusses 1978 nach Mexiko, um diesen wichtigen Zeugen zu vernehmen, doch die US-Ermittler warteten vergebens im Hotel, bis sie von den mexikanischen Behörden die Information bekamen, der Zeuge Contreras sei nicht auffindbar. Mit dieser Auskunft ließen sich die Abgeordneten aus Washington abspeisen und reisten unverrichteter Dinge wieder zurück. Vielleicht haben wir mehr Glück.
Laura stellt Kontakt zu einigen Freunden her, die in den sechziger Jahren als Studenten in revolutionären Gruppen aktiv waren. Aus den Revoluzzern von einst sind inzwischen wohlsituierte Anwälte, Filmproduzenten und Journalisten geworden. Gerne erinnern sie sich an die Zeit der Unschuld, als die Weltrevolution in verrauchten Hinterzimmern geplant wurde, mit schönen Frauen und Litern von Tequila. Oscar Contreras? Ja, an den kann man sich erinnern. Ein ganz verwegener Bursche. Einmal kletterte er auf die Statue Miguel Alemans mit den Hosentaschen voller Sprengstoff, den er einem Bauarbeiter abgekauft hatte. Aleman war ein ehemaliger Präsident des Landes und als »Lakai des US-Imperialismus« ein Hassobjekt der Linken. Oscars Sprengladung habe der Statue auf dem Gelände der Autonomen Universität Mexikos ein formidables Loch verpasst, aber sie blieb noch einige Tage stehen, bevor ihr der Aktivist einer konkurrierenden Gruppe mit einer zweiten Ladung Dynamit den Rest gab.
Oscar Contreras sei damals in den Norden Mexikos, in die Provinz Tamaulipas, ausgewandert, um sich vor dem Terror der Geheimpolizei in Sicherheit zu bringen. Ein paar Anrufe genügen und wir haben ihn gefunden: Er arbeitet heute als Redakteur der Provinzzeitung El Mañana in Reynosa, einer Grenzstadt zu Texas. Am Telefon wird er recht wortkarg, als ich den Grund meines Besuches erwähne. »Warum kommen Sie jetzt, so viele Jahre danach? Ich will keine Probleme.« Aber nun gut, wo ich schon einmal so weit gereist sei. Dann erzählt er mir, dass er 1978 von der Polizei informiert wurde, der US-Untersuchungsausschuss sei im Anmarsch und wolle ihn vernehmen. Die Herrschaften seien dann aber doch nicht aufgetaucht. Offenbar hat irgendjemand erfolgreich versucht, die Zeugenaussage von Oscar Contreras zu hintertreiben. Das macht uns nur noch neugieriger auf das Treffen mit ihm.
Wir fliegen nach Monterrey, einer aufblühenden Industriemetropole im Norden Mexikos. Von hier aus sind es noch drei Stunden Autofahrt durch die versteppte Pampa: Flaches Buschland, ausgedehnte Ranchos, am Straßenrand bis an die Zähne bewaffnete Militärposten auf der Suche nach Drogentransporten. Dann tauchen die ersten Ölraffinerien auf: Reynosa, von der viele Mexikaner sagen, sie sei die hässlichste Stadt des Landes.
Nach Feierabend sind die Straßen leer und abgedunkelt. Die Menschen hier haben Angst vor den maras,





























