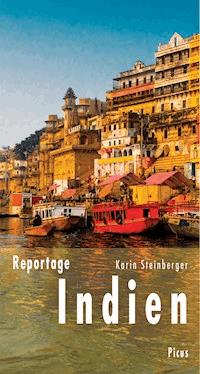
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Picus Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Picus Reportagen
- Sprache: Deutsch
Indien, schrieb der wunderbare Shashi Tharoor, sei ein hoch entwickeltes Land, aber eines im Zustand fortgeschrittenen Verfalls. Ein Gedanke, der den latent größenwahnsinnigen Westen zurechtstutzt und andererseits hart ins Gericht geht mit geschichtsvergessenen Indern, die keine Ahnung mehr vom eigenen Erbe haben. Karin Steinberger hat sich diesem großen, lauten, verrückten, überfordernden, tiefsinnigen und dann wieder erstaunlich banalen Subkontinent mit dem Wissen genähert, letztlich nichts zu wissen. Sie hat sich von einem Neunzigjährigen erklären lassen, wie man die von den englischen Kolonialherren eingeschleppte Prüderie wieder loswird, sie hat Frauen besucht, die Vergewaltigungen und Degradierungen nicht mehr einfach hinnehmen wollen, und sie war in einem Callcenter, in dem es kein größeres Vergehen gibt als das, als Inder erkannt zu werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 135
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Karin Steinberger
Reportage Indien
Karin Steinberger
Reportage Indien
Die Wut der Frauen und das beste Omelette des Subkontinents
Picus Verlag Wien
Copyright © 2017 Picus Verlag Ges.m.b.H., Wien
Alle Rechte vorbehalten
Grafische Gestaltung: Dorothea Löcker, Wien
Umschlagabbildung: © iStockphoto/shylendrahoode
Druck und Verarbeitung:
Christian Theiss GmbH., St. Stefan im Lavanttal
ISBN 978-3-7117-1075-8
eISBN 978-3-7117-5340-3
Informationen über das aktuelle Programmdes Picus Verlags und Veranstaltungen unter
www.picus.at
Karin Steinberger, 1967 bei München geboren, Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule München. Seit 1998 arbeitet sie für die »Süddeutsche Zeitung«. Ende 1999, als ein Zyklon große Teile des indischen Bundesstaats Orissa zerstörte, fuhr sie das erste Mal nach Indien. Auf diese erste, traurige Begegnung mit dem Subkontinent folgten zahllose weitere. 2003 wurde sie vom indischen Kulturrat für ihre Reportagen mit dem Gisela-Bonn-Preis ausgezeichnet.
Inhalt
Vorwort
Der goldene Schnitt
Gewaschen, gekämmt, entlaust, gewogen: Vom Tempelhaar zum Echthaarsträhnchen
Bei Anruf Schock
Nur nie auflegen – und nie sagen, dass man Inder ist. Eine Nacht in einem Callcenter am Rand von Delhi
Die Menschenmacher
Nie war es so einfach, sich ein Baby zu bestellen. Nayana Patel und das Geschäft mit den Bäuchen
Frage nicht
Warum sich manch ein Heiliger nie setzt – und warum Europäer das nie verstehen werden
Liebe ist für alle da
Wie ein Neunzigjähriger versucht, den Indern die Prüderie auszutreiben
Als Costa ausgezogen wurde
Das schmutzige Geschäft mit dem Verschrotten: Besuch auf dem größten Schiffsfriedhof der Welt
Ruhm und Eier
Ramkishan Gawlani oder die Geschichte vom besten Omelette Indiens
Tod am Ganges
Warum es für Hindus lebenswichtig ist, in Varanasi verbrannt zu werden
Baby Halder buchstabiert die Freiheit
Wie es einem Dienstmädchen gelang, aus seinem Leben Literatur zu machen
Trau dich
Was passiert, wenn ein indischer Tennisstar und ein pakistanischer Cricketheld heiraten? Pure Hysterie
Die Letzten ihrer Art
Den Nikobaresen hat der Tsunami alles genommen. Wie ein Volk versucht, trotzdem zu überleben
Du kriegst Ärger
Sampat Pal und ihre Pink Sari Gang: Zu Besuch bei Frauen, die zurückschlagen
Nachsatz
Vorwort
Am besten fängt man bei den Witwen am Ufer des Ganges an, die auf den heiligen Stufen in Varanasi kauern wie aus dem Nest gefallene Vögelchen und auf den Tod warten. Sie wurden aus ihren Häusern verscheucht, weil sie niemand mehr brauchen kann. Weil eine Frau ohne Mann keinen Wert hat. Sie gelten als Unglückswesen; wer in ihren Schatten tritt, zieht Böses auf sich. Am Manikarnika Ghat, wo Tag und Nacht die Toten brennen, vegetieren diese verhuschten Gestalten vor sich hin. Wie schmutzige Wäschehaufen liegen sie herum und betteln, um sich wenigstens das Holz für die eigene Beerdigung leisten zu können.
Neben ihnen krakeelen die Händler und treiben den Preis für das Feuer in die Höhe, das hier seit ewigen Zeiten brennt. Die ganze Stadt ist ein Krematorium. Aber man darf sich nicht täuschen lassen: Der Tod ist hier die reine Freude. Wer glaubt, dass man an so einem Ort weint, der kennt sie nicht, die Schriften aus vergangenen Zeiten. Der begreift es nicht, dieses Land.
Der Westen hat sich aus Indien schon immer das herausgenommen, was er gerade brauchen konnte: Diamanten, Exotik, Mystik, Spiritualität. Und dann hat er sich verliebt in seine eigenen Vorstellungen von Indien und hat aufgehört, sich für das zu interessieren, was er dort wirklich finden könnte. Es ist ein verzerrtes Bild, das wir uns von diesem Land machen, Teeplantagen in Kerala, Paläste in Rajasthan, Elefanten, Dreck, Staub, Cricket, wilde Partys in Goa.
Und wehe, die Inder wagen, modern zu sein oder Viskosepullover über ihre prachtvollen Saris zu ziehen, oder über ihre eigenen Heiligen zu lästern. Dann reagiert der Westen wie eine betrogene Geliebte. Als im Dezember 2012 fünf Männer in einem fahrenden Bus in Delhi über eine Studentin und ihren Freund herfielen, als sie die junge Frau missbrauchten und mehr oder weniger pfählten und sich dabei auch noch aufspielten wie eine moralische Brigade, war der Aufschrei im Westen groß. Die Erste Welt stürzte sich mit gewohnter Besserwisserei auf den Subkontinent.
Und in Indien? Gingen Tausende auf die Straßen, sangen Delhi-Gang-Rape-Rap-Songs, organisierten Men-Say-No-Blogathons, sie waren wütend, zornig, sie kämpften ihre Kämpfe. Was sie jetzt am wenigsten brauchen konnten, war die Arroganz der Ersten Welt. Als gäbe es im Westen keine Vergewaltiger, keine Mörder, keine Proleten, keine Chauvinisten. Keine Fritzls.
Es gibt in Indien schon lange Frauen wie Urvashi Butalia, Schriftstellerin, Historikerin, Gründerin des ersten feministischen Verlags in Indien. Seit vielen Jahren fordert sie härtere Strafen bei Vergewaltigungen, Mitgiftmorden oder Gewalt gegen Frauen. Sie arbeitet sich an ihrer Heimat ab, an den alten Bräuchen und Riten, an staubigen Denkweisen. Vieles ist tief verankert in diesem Volk: die Unterwürfigkeit der indischen Frau, die Verklemmtheit der Gesellschaft, die Korruption der Polizei, die Ignoranz der Politik. Sie kämpfen ihre gesellschaftlichen Kämpfe, wir unsere. In Deutschland gehen gerade Menschen auf die Straße und zünden Flüchtlingsheime an.
Und sind es nicht gerade die schaurigen Bräuche und Riten, die Touristen an Indien so faszinieren? Sie schauen sich die winzigen Handabdrücke der Sati-Frauen im Palast von Jodhpur an. Sie lesen mit leisem Schauer, dass die Briten erst 1829 verboten haben, was jahrhundertelang von einer guten indischen Frau erwartet wurde – den Kopf ihres toten Ehemanns in den Schoß zu nehmen und sich mit ihm verbrennen zu lassen: Sati, langsam, qualvoll. Und ja, früher wurden diese Frauen wie Göttinnen verehrt. Aber jetzt kommt es mehr als selten vor, dass die Polizei von einem aufgebrachten Mob daran gehindert wird, eine Witwe vom Scheiterhaufen herunterzuzerren. Und ja, Mädchen werden in Indien abgetrieben, vernachlässigt, umgebracht, sie bekommen weniger Medizin und Essen und seltener Impfungen. Diese Frauen fehlen, der Männerüberschuss verändert das soziale Klima, Politikwissenschaftler sagen die Entwicklung einer kollektiv aggressiven Männergeneration voraus.
Aber zeitgleich rast Indien in die Neuzeit. Frauen arbeiten, studieren, lehnen sich auf, sind Teil der allumfassenden Umwälzung, sie leiten Firmen oder betreuen in Callcentern die Versicherungen irgendwelcher Leute in North Dakota. Das Beunruhigende ist, die empörend arme Unterklasse und die empörend reiche Oberklasse bringt nur noch ein Sieg gegen Pakistan im Cricket zusammen. Für eine wilde Nacht. Am nächsten Morgen ist die Oberschicht dann wieder ausschließlich damit beschäftigt, sich von den Massen und dem Staub und den am Straßenrand ihre Notdurft verrichtenden Kindern abzugrenzen. Es ist eine große Anstrengung, sich ständig in heruntergekühlten Luxuslimousinen, bewachten Stadtvierteln und exklusiven Privatschulen vom eigenen Land zu distanzieren. Selbst den Strom machen sich manche selbst, um autark zu sein, wie kleine souveräne Republiken.
Andererseits: Was seit der Vergewaltigung in Delhi passiert ist in Indien, ist erstaunlich, auch erfreulich, Frauen gehen in Selbstverteidigungskurse, sie werden aufmüpfig, sie wehren sich, sie machen großen Lärm und politischen Druck.
Der Westen hat sich aus Indien schon immer das herausgenommen, was er gerade brauchen konnte. Momentan sind es also die Horrorgeschichten. Vielleicht ist das ein erster Schritt hin zur Entmystifizierung des Landes. Vielleicht ist es aber auch eine gute Gelegenheit, Indien dort zu erforschen, wo es nun mal zu finden ist: in der staubigen, stinkenden, brutalen und auch sehr faszinierenden Realität.
Der goldene Schnitt
Gewaschen, gekämmt, entlaust, gewogen: Vom Tempelhaar zum Echthaarsträhnchen
Ans Ende mag man gar nicht denken. Wenn jedes Haar gezählt, jede Nisse entfernt und jedes Strähnchen abgerechnet ist. Wenn Wärmezangen und Connectoren die Dinge aneinander schweißen und spitznagelige Friseurinnen in London oder Rosenheim Honigblondes und Dunkelschwarzes einarbeiten, wenn sich Wildfremde an seidenweicher Pracht berauschen, die hinunterhängt bis in unbezahlbare Längen.
Doch noch kein Wort davon, wie sich Hornfäden in pures Gold verwandeln, wie Göttliches in gigantische Haartürme umgearbeitet wird. Nicht hier, am heiligsten Ort, hoch oben auf den Tirumala-Hügeln in Tirupati, im Tempel des Gottes Venkateswara, in dem P. Rangaraju sitzt, Tempelfriseur Nummer 54, die Beine überkreuz, vor sich einen Kopf, nach vorne geneigt, ausgeliefert, wie ein Schaf beim Scheren. Die Frau hockt vor ihm auf kalten Kacheln, das Zettelchen in der Hand: 15.30 Uhr, Barber 54. Hält still auf nackten Füßen, Mann und Kind sind schon kahl und starren das Häufchen an, das sich in der Rinne türmt, schwarz und fettig, Mutters Haar, Mutters Schönheit, Mutters Geruch – und ihre Läuse dazu.
Rangaraju arbeitet schnell und fehlerlos, schaufelt aus einem Eimer Wasser über den Kopf, setzt an, arbeitet sich von der Schädelmitte runter zu den Ohren, vor zum Gesicht, immer der gleiche Schnitt, die gleiche Prozedur, acht Stunden am Tag, fünfzig Tonsuren pro Schicht, sagt er und nickt dem Ehemann zu. Der ganze Saal ist voller Friseure, jeder mit Nummernschild hinter sich an der Wand, jeder mit Kundschaft, jeder mit einer Bestzeit pro Kopf, die gebrochen werden will. Alles voller Haar, alles voller Mensch. Fließbandarbeit im heiligen Bezirk.
Seit siebenundzwanzig Jahren ist P. Rangaraju Tempelfriseur am heiligen Berg. »Siebenundzwanzig Jahre Service«, sagt er. Er mag das, wenn sich die Köpfe vor ihm senken, wie Gras im Wind, immer in eine Richtung, immer zu einem Zweck. Er kennt sie, die Tücken der Schädel, die Dellen und Beulen, die verwachsenen Narben, jeder Kopf ein sprechendes Relief. Es gibt hier nur einen Schnitt: Vollrasur, zwanzigtausendmal am Tag, den Göttern zum Dank, dem Tempel zum Wohle. Wenn Rangaraju etwas weiß, dann, wie man Menschen vom Haar befreit.
Die Frau vor ihm sitzt still. Dreißig Jahre ist sie alt. Sie starrt auf die Füße des Friseurs, auf seine verwachsenen Zehen, in denen sich ihre Haare verfangen, denkt an all die Stunden, die sie mit diesem Haar verbracht hat, hinunter bis zu den Hüften, dunkel wie Mahagoni, ein Kampf an jedem Tag, denkt an all das Öl, das in dieser Pracht verschwunden ist. Denkt auch an die Krankheit in ihrer Brust und die wundersame Heilung. Das Haar ist ihr Dank, ihre Bezahlung an Gott, der sie hat leben lassen. Es ist eine Erlösung, es loszuwerden.
Zwei Tage war sie mit der Familie unterwegs, um hierherzukommen, drei Stunden stand sie an, um sich am Free Tonsure Token Counter ihren Zettel zu holen mit Uhrzeit und Friseurnummer und frischer Rasierklinge. Tirupati ist ein Vierundzwanzig-Stunden-Betrieb mit vierzehntausend Angestellten. Kein anderer Tempel in Indien ist so gut organisiert, keiner so reich. Es kommen mehr Pilger als nach Mekka oder Rom, fünfzigtausend an normalen Tagen, neunzehn Millionen im Jahr, um dem mächtigsten aller Götter Geld zu bringen, oder Haar. Tonnenweise. Langes, kurzes, schwarzes, graues. Indisches Echthaar. Ohne die Götter müssten sie sich etwas anderes einfallen lassen.
Das Geschäft mit dem Haar, hier scharrt es und kratzt es, manchmal blutet es leicht. »Er ist der mächtigste aller Götter«, sagt Rangaraju, schaut hinauf ins Neonlicht, als würde er dort hocken, Lord Venkateswara, Inkarnation des Gottes Vishnu. Mehr sagt er nicht. Warum auch. Wenn der Mächtige wollte, könnte er aus Köpfen Goldfäden wachsen lassen. Aber er will nicht, er will nur ihre Schönheit, ihre Eitelkeit. Er will ihr Haar.
So fängt es an, das Geschäft, voller Ehrfurcht. Sie geben ihr Haar, weil er ihnen Gesundheit schenkt, gute Noten, einen reichen Schwiegersohn. Es gibt viele Gründe, seine Schönheit zu lassen im Tempel des mächtigen Gottes, der hier seit Jahrtausenden in ewiger Finsternis hockt, mit glühend roten Augen, von Diamanten umsäumt, eine Mähne von Haaren drumherum. Seine Augen, heißt es, werden die Erde verglühen, wenn sie das Sonnenlicht erblicken. Keiner fragt, was die Tonne Haar, die die Menschen hier jeden Tag lassen, wert ist, wenn es gewaschen und gekämmt, entlaust und gewogen wurde. Sie haben es dem Glutäugigen geschenkt. Und der Tempel investiert das Geld, das er mit den Haaren verdient, angeblich in Schulen und Universitäten, in Bibliotheken und in die Lehre des Hinduismus, er bezahlt Essen und Massenhochzeiten für die Armen.
Ein Kopf nach dem anderen neigt sich zu Rangaraju, Kinder, Frauen, Männer, Babys, die schreien, wenn er die kalte Rasierklinge auf ihren Hinterköpfen ansetzt. Die Frau steht jetzt kahl im Saal, ihr Schädel leuchtet weiß. Dann verschwindet sie mit Mann und Kind, duscht, schmiert sich Asche aufs Haupt, geht hinüber zu den Warteschlangen des Tempels, acht Stunden, zehn Stunden, manche stehen Tage, um Gott in seinem finsteren Loch zu sehen. Sie werfen sich auf den Boden, berühren Steine, Blumen, irgendwas, wenn sie vorbeigeschoben werden, Wärter treiben die Menge weiter. Hunderte, Tausende, Millionen, um ihm ihre kahlen Schädel zu zeigen.
In der feuchten Rinne vor Friseur 54 liegt es, das Haar der Frau, mahagonischwarz, ein Häuflein, zweihundert Gramm vielleicht, oder dreihundert. Das reicht am Ende für ein paar Hundert gebondete Echthaarsträhnchen.
Die Tempelfrauen schauen sich an. Sie sammeln Haar, das ist ihr Job, tonnenweise kehren sie es zusammen, Männerhaar, Frauenhaar, kurz, lang, kommt alles in Kanister, versiegelt und verschlossen, bewacht wie Tresore in der Bank of India. Von den anderen Dingen wissen sie nichts. Von Micro-rings und Shrinkies, von Echthaartressen, Glanzversiegelungen oder Single Drawn Qualität. Sie halten ihre Besen in der Hand wie Waffen, kein Haar darf liegen bleiben. Ein Zopf schon gar nicht.
Natürlich reden sie manchmal auch über die Leute, die dieses klebrige Durcheinander kaufen. Menschen aus anderen Universen, aus Amerika und Europa, Victoria Beckham, Paris Hilton, Jennifer Lopez, behängt mit Fremdhaar. »Wozu brauchen sie dort so viele Haare?«, fragt eine. »Haben sie bei euch keine eigenen am Kopf?« Dann kichern sie, kehren weiter, schütten alles in Gottes Haarsammelkanister. Was sie hier an einem Tag vom Boden kehren, ist sehr viel mehr wert, als sie in einem ganzen Jahr verdienen.
»Tempelhaar ist harte Arbeit. Es ist durcheinander, lang, kurz, mit Läusen, alles dabei.« Das sagt A. L. Kishore, jung wie er ist, und doch schon ein Profi. Er muss es wissen, er ist mitten im Haar aufgewachsen. Der Urgroßvater, der Großvater, der Vater, seit vier Generationen sind die Kishores im Geschäft. Das ganze Haus voller Haar. Göttlich ist hier nichts mehr. Die Leute in Chennai nennen Kishores Familie die »Human Hair People«. Der Vater sitzt im Zimmer und schaut dem Sohn zu, wie er Haarbündel herumträgt. Als er anfing, war das Geschäft noch ein anderes. »Haar war so billig«, sagt der Vater.
Einfach war es trotzdem nicht. Es gab immer wieder Höhen und Tiefen, 1962, als das falsche Haar kam, wollte kein Mensch mehr Echthaar haben. Bis die Kunden merkten, dass das Plastik am Kopf nicht taugt. Dann kam die indische Regierung und verbot erst das Geschäft, dann wollte sie mitverdienen. Der Vater hat sich mehrmals umgestellt, hat Barthaar nach Korea verkauft, wo sie daraus Aminosäuren herstellen für Medizin und anderes. Er verkaufte mal langes Haar, mal kurzes. Seine Auswahl war immer überschaubar. Die Kundschaft auch. Er zählt Adressen auf von damals: Salzburg, Hongkong, Kuwait. Postfach, Straßenname, hat alles noch im Kopf. Wenn Haar gerade nicht ging, verkaufte er Pfauen- und Hühnerfedern.
Der Sohn exportiert jetzt in fast alle Länder, er führt mehr als fünfhundert Haartypen: falsches, echtes, kurzes, langes, remy, non remy, in Bündeln, in Zöpfen, in hauchdünner Glanzversiegelung, jungfräulich, chemisch behandelt, gebleicht, gefärbt, aufgefädelt, gerade, lockig, dauergewellt, die Länge wie gewünscht, platinweiß, honigblond, espressobraun, tiefschwarz. Alles gestapelt in einer Kammer, in der es nach Öl und Haarconditioner und Shampoo riecht. »Wir haben unsere Methoden«, sagt Kishore und sperrt das Haarzimmer wieder zu. Mehr sagt er nicht. Betriebsgeheimnis. Jeder macht es anders, jeder wäscht das Haar anders, kämmt es anders, bleicht es anders.
Wer glaubt, man kann in diesem Geschäft nichts falsch machen, sollte es bleiben lassen. Denn Haar ist nicht gleich Haar. Es gibt Männerhaar, Barthaar, Resthaar, es gibt das Haar der Sikhs, es gibt Tempelhaar und Dorfhaar, es gibt aus Kämmen gesammeltes Haar. Und es gibt Frauenhaar, lang und seidig. Bares Geld, wenn es der Friseur zusammenknotet, bevor er es schneidet, sodass oben und unten nicht durcheinandergeraten, Haarwurzel und Haarspitze. Nur dann ist alles in einer Richtung, die Schuppenschicht gesund, gut kämmbar. Nur dann ist es remy hair.
»Remy hair.« Kishore spricht die Worte aus wie den Namen einer Geliebten. Dann breitet er seine Ware aus. Neben ihm hockt eine Arbeiterin am Boden, die seit Stunden Platinblondes auffädelt. Drei Meter Haar, in winzigen Strähnchen aufgeknüpft, mit vier Fäden verwoben, vom Tischbein zum Stuhlbein, quer durchs Zimmer. Acht Stunden braucht sie für zweihundert Gramm, das sind vier Meter. Eine Maschine schafft zehn Kilogramm am Tag. »Die Frauen sind trotzdem billiger«, sagt Kishore und fährt mit der Hand durchs aufgefädelte Blond. Auch die Arbeiterinnen werden immer teurer, aber Maschinen sind unbezahlbar. Jede Woche müssen sie repariert werden, weil die Haare alles verkleben, er leistet sich nur ein paar.





























