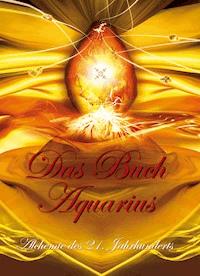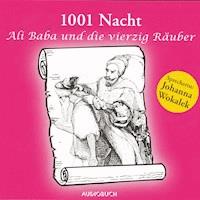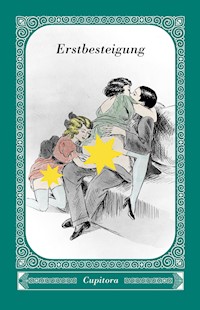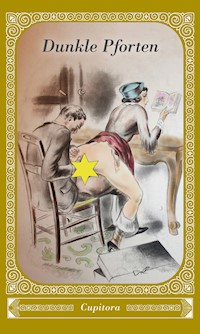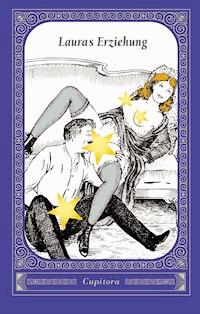Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bild und Heimat
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»So wie wir heute arbeiten, werden wir morgen leben« – laut Verfassung der DDR hatte jeder Bürger nicht nur das Recht auf einen Arbeitsplatz, sondern auch die Pflicht, als Werktätiger den Aufbau des Sozialismus zu unterstützen. Es ging hierbei nicht allein um die Erfüllung des Volkswirtschaftsplans. Bekanntlich standen Arbeit und Beruf auch viel mehr als heute im Mittelpunkt des sozialen und gesellschaftlichen Lebens. Dies zeigte sich etwa darin, dass der Berufsalltag praktisch ein Dauerthema war. Das betraf Familienfeierlichkeiten ebenso wie Kneipengespräche. Ständig schimpfte man auf Dinge, die nicht funktionierten, oder Leute, die der eigenen Meinung nach entweder zu viel taten und damit »die Norm versauten« oder sich zu wenig einsetzten und damit die Brigade in Verruf brachten. Dieser Band widmet sich dem Arbeitsleben in der DDR in seinen vielen Facetten. Was stand im Arbeitsgesetzbuch und wie war das Lohngefüge? Ermöglichte die Sozialpolitik den Frauen ein vergleichsweise selbstbestimmtes (Berufs-)Leben? Wie verhielt es sich mit den Vertragsarbeitern? Waren Generaldirektoren mächtig? Und konnte man in der DDR Millionär werden? Entstanden ist ein bild- und materialreiches Erinnerungsbuch an die Republik der Werktätigen!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 166
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Republik der Werktätigen
Alltag in den Betrieben der DDR
Bild und Heimat
eISBN 978-3-95958-814-0
1. Auflage
© by BEBUG mbH / Bild und Heimat, Berlin
Umschlaggestaltung: fuxbux, Berlin
Umschlagabbildung: picture-alliance / akg-images (Arbeiterbrigade); akg-images / ddrbildarchiv.de (Kantine); BArch Bild 183-K0608-0010-009 / Ulrich Häßler (LPG)
Ein Verlagsverzeichnis schicken wir Ihnen gern:
BEBUG mbH / Verlag Bild und Heimat
Axel-Springer-Str. 52
10969 Berlin
Tel. 030 / 206 109 – 0
www.bild-und-heimat.de
Arbeit damals und heute (Vorwort)
Klaus Blessing
(picture alliance / ZB / Paul Glaser)
Dieses Buch handelt von Menschen, die in der DDR Arbeit hatten und damit nicht nur ihren Lebensunterhalt bestreiten konnten, sondern in der Arbeit Lebensinhalt, Lebensfreude, Kollektivität und Solidarität fanden. Nicht nur haben sie 40 Jahre in der sozialistisch orientierten DDR gelebt, sondern sie haben sie mitgestaltet. Dann wurde ihnen ein anderes Gesellschaftssystem übergestülpt, das des voll entwickelten Kapitalismus eines führenden Industrielandes.
Ich bin kein Freund von Aufrechnungen der Vor- und Nachteile dieser Wiedervereinigung, die bisweilen als »größter Glücksfall der Geschichte im 20. Jahrhundert« gefeiert wird. Im Osten Deutschlands hat sie tiefe Spuren hinterlassen. Die Bundesrepublik ist nach drei Jahrzehnten immer noch wirtschaftlich, sozial und kulturell gespalten in Ost und West. Der Grundgesetzauftrag – gleichwertige Lebensverhältnisse in den Regionen zu gewährleisten – ist ein Wunschtraum geblieben. Wirtschaftsleistung und Einkommen verharren bei 75 bis 80 Prozent Westniveau, der Abstand wird wieder größer.
Zwei Ereignisse prägten diese Entwicklung: Zum einen der Raub des vom Volk der DDR erarbeiteten Eigentums. Zwei Billionen DM verschwanden in den Taschen der Glücksritter aus der BRD. Zum zweiten die Zerschlagung der ostdeutschen Wirtschaft mit der Folge einer Massenarbeitslosigkeit und Auswanderung der betroffenen Menschen. Schlagartig sank die Wirtschaftsleistung der DDR innerhalb von zwei Jahren um 45 Prozent durch Stilllegungen von DDR-Betrieben und Einrichtungen. Über zwei Millionen Menschen verloren dadurch ihre Arbeit und ihre Existenzgrundlage. Das war jeder vierte Beschäftigte. Sie wanderten aus. Inzwischen haben seit 1989 über vier Millionen Bürgerinnen und Bürger – mehr als in Zeiten der »offenen Grenzen« – das Gebiet der DDR verlassen, um in westlichen Gefilden ihr Glück zu suchen, überwiegend jung und weiblich. Glücksritter aus der BRD wanderten ein, besetzten die Führungspositionen in Wirtschaft, Politik, Justiz.
Arbeit ist inzwischen zu einem begehrten Luxusgut geworden. Millionen Menschen haben sie verloren. Diejenigen, die Arbeit haben, sind in einer Arbeitswelt angekommen, die ihnen fremd ist. Arbeit hat in der kapitalistischen BRD einen ganz speziellen Sinn. In einem Artikel stellt die Professorin Marianne Gronemeyer diesen treffend vor: »Es geht gar nicht um Arbeit und Arbeit ist auch nicht erstrebenswert. Es geht um Geld. Die Frage: ›Wie viel Arbeit braucht der Mensch?‹, und jene andere: ›Wie viel Geld braucht der Mensch?‹, sind gleichbedeutend … Vom Geld kann man halt nie genug haben. … Die Zeit, die wir in sinn- und bedeutungslosen Arbeitsvollzügen zubringen, geben wir als Lebenszeit schon verloren … Arbeitszeit fällt als Zeit sinnerfüllten Lebens aus.«
In diesen wenigen Sätzen ist das Credo nicht nur moderner Arbeitsphilosophie, sondern moderner Lebensphilosophie verankert. Eine Auffassung, die in erschreckendem Maße Eingang in die Lebensgestaltung des Einzelnen gefunden hat. Das Leben »genießen«, Konsumieren, Feiern, Verreisen wurden zunehmend zum Inhalt des heutigen Lebens.
Natürlich diente auch in der DDR die Arbeit dem Erwerb des Lebensunterhaltes. Der DDR-Bürger lebte von und durch Arbeit. Er erwarb sein Einkommen nur durch Arbeit. Einkünfte durch Nichtstun aus Börsenspekulationen jeder Art, Gewinne aus Geschäften mit Grundstücken und Immobilien gab es nicht. Die Folge war eine geringe Spreizung der Einkommen und Vermögen.
Der Durchschnittsverdienst der arbeitenden Bevölkerung lag monatlich bei 1.320 Mark brutto. Das Nettoeinkommen betrug 1.140 Mark, das waren 86 Prozent vom Brutto. In der BRD verbleiben den Arbeitenden vom Brutto lediglich ca. 65 Prozent netto. Abgaben wurden in der DDR nicht vorrangig von der arbeitenden Bevölkerung erhoben, sondern von den Volkseigenen Betrieben erwirtschaftet. Die Höhe der Entlohnung in den Betrieben hing nicht von der »Streiklust« der Werktätigen und ihrer Gewerkschaften ab. Sie war staatlich differenziert nach volkswirtschaftlicher Bedeutung und Anforderungen an die Arbeit. Die höchsten Verdienste waren in der Energiewirtschaft mit 1.470 Mark, die geringsten in der Leichtindustrie mit 1.320 Mark zu erzielen.
Ein »Spitzenmanager« – Generaldirektor eines Kombinates – erhielt monatlich brutto 3.800 Mark, ein Minister 4.250 Mark. Ein DAX-Vorstand bekam 2019 als Jahresvergütung im Schnitt 5,8 Millionen Euro.
Arbeit war aber in der DDR mehr als nur Geldverdienen. Bereits Friedrich Engels stellte in seinem Buch mit dem bezeichnenden Titel Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen fest: »Die Arbeit ist die Quelle alles Reichtums, sagen die politischen Ökonomen. … Aber sie ist noch unendlich mehr als dies. Sie ist die erste Grundbedingung alles menschlichen Lebens, und zwar in einem solchen Grade, dass wir in gewissem Sinn sagen müssen: Sie hat den Menschen selbst geschaffen.«Wer heutige Exzesse von weitgehend von vernünftiger Arbeit Ausgeschlossenen der Gattung Homo sapiens auf Straßen, Plätzen, in Stadien und Hallen randalierend erlebt, stellt fest, dass auch der Umkehrschluss zulässig ist: Ohne Arbeit kann der Mensch zum Affen werden.
Das Recht auf Arbeit ist Bestandteil der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der UNO vom 10. Dezember 1948 (Artikel 23): »Jeder hat das Recht auf Arbeit … sowie auf Schutz vor Arbeitslosigkeit. Jeder, der arbeitet, hat das Recht auf gerechte und befriedigende Entlohnung, die ihm und seiner Familie eine der menschlichen Würde entsprechende Existenz sichert, gegebenenfalls ergänzt durch andere soziale Schutzmaßnahmen.«
In der DDR wurde dieses Menschenrecht nicht nur in der Verfassung verankert, es wurde konsequent umgesetzt. Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit, Bettler, Tafeln und Suppenküchen waren Fremdworte. Ihr praktisches Erleben nach der Wende war für viele DDR-Bürger – auch für mich – ein Schockerlebnis. Mir war es glücklicherweise erspart geblieben, mich als bettelnder Arbeitnehmer bei arroganten und von Geld strotzenden Arbeitgebern anzudienen. Die heutige Arbeitswelt ist geprägt davon durch die Allmacht des Kapitals und deren Besitzer.
In der BRD, wo die Würde des Menschen nach Artikel 1 des Grundgesetzes unantastbar ist, fehlt die Umsetzung des elementaren Menschenrechtes auf Arbeit. Arbeit ist im Interesse des Kapitals Kostenfaktor und damit Quelle des Profits. Arbeit muss nach dieser Logik eingespart und die Kosten dafür müssen ständig gesenkt werden, damit der Profit steigt.
Die Auswüchse der bundesdeutschen Arbeitswelt legt nun ein Virus offen. Menschenverachtende Arbeits-, Wohn- und Lebensbedingungen in der Fleischindustrie und Landwirtschaft kommen ans Tageslicht. Es ist nur die nicht mehr zu verheimlichende Spitze eines großen Eisberges.
In Deutschland ist Schweinekönig Clemens Tönnies nicht nur wegen rassistischer Äußerungen, sondern wegen Dumpinglöhnen sowie menschenunwürdigen Arbeits- und Wohnbedingungen seiner weltweit 16 500 Mitarbeiter in Verruf gekommen. Das brachte ihm ein Vermögen von knapp zwei Milliarden Euro ein. Am Stammsitz »wohnen« die Arbeiter – vorwiegend aus Osteuropa – mit neun Personen in einer Dreizimmerwohnung in einem Hochhaus, Monatsmiete 300 Euro pro Person. Hätte man nicht in diesem Milieu aktuell weit über 1500 Coronafälle registriert, wären diese Zustände nicht an die breite Öffentlichkeit gedrungen – Kapitalismus pur zum Anfassen.
Ein Jurist namens Heinz Hermann Thiele, der durch spekulative Aktienkäufe kurzfristig das dominierende Stimmrecht erworben hatte, bestimmt 2020 über das Wohl und Wehe von weltweit 138 000 Beschäftigten der Lufthansa. Sein Führungsstil entspricht dem des klassischen autoritären Patriarchen, der den Konflikt mit Gewerkschaften nicht scheut und auch bis dato in seinem Konzern keinen Tarifvertrag schloss. Mit Stand von Mai 2020 steht er laut Wikipedia mit einem Vermögen 15,5 Milliarden US-Dollar auf Platz 74 der Liste der reichsten Menschen. Die in dieser »Weltrangliste« Platzierten bestimmen Politik, Wirtschaft und Arbeitswelt.
Ein sozialistischer Leiter unterschied sich grundsätzlich von derartigen Managertypen. Er hatte nicht vor von Geld strotzenden und nichtstuenden Großaktionären Rechenschaft abzulegen. Seine Arbeit wurde nicht daran gemessen, ob und wie viel Rendite er eingefahren hatte. Seine Rechenschaftslegung fand hinsichtlich der wirtschaftlichen Ergebnisse vor der übergeordneten Leitung statt, hinsichtlich der Arbeits- und Lebensbedingungen vor seinen Werktätigen. Diese Grundlagen waren in Betriebskollektivverträgen zwischen betrieblicher Leitung und Gewerkschaftsleitung vereinbart. Darin ging es nicht nur um Arbeitsbedingungen, sondern auch um Freizeit, Bildung, Kultur und Sport.
Der Betriebsdirektor des Stahl- und Walzwerkes Brandenburg, später Generaldirektor des Kombinates, Hans-Joachim Lauck – promovierter Ingenieur, erläutert seine Verantwortung gegenüber den Arbeitern so: »Um im Betrieb etwas bewegen zu können, musste ich mir den Respekt der Belegschaft erst erarbeiten. Ich suchte das offene Gespräch mit den Kollegen und fand unter ihnen alsbald Kameraden und Freunde. … Als frischgebackener Werkdirektor war für mich neben den volkswirtschaftlichen Anforderungen an ›meinen Betrieb‹ die Beantwortung folgender Fragen zentral: Welches Niveau hatten die Arbeits- und Lebensbedingungen? Wie war die Versorgung organisiert? Herrschten Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz und auf dem Betriebsgelände? Welche Qualität hatten Ferien- und Kindereinrichtungen? Wie ist die Poliklinik ausgestattet und wie leisten die Ärzte präventive Arbeit im Betrieb, vor Ort? Wie ist das kulturelle Angebot für Erwachsene, Kinder und Jugendliche organisiert?«
Der Generaldirektor des Gaskombinates Schwarze Pumpe, Herbert Richter – Doktor der Naturwissenschaften, berichtet: »Der Plan der Arbeits- und Lebensbedingungen war im Kombinat eine feste Größe. … Alljährlich wurde bei uns – wie in allen anderen DDR-Betrieben der Betriebskollektivvertrag (BKV) in Zusammenarbeit mit der Betriebsgewerkschaftsleitung (BGL) erstellt. Hierin wurden vor allem die Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen verankert, aber auch Festlegungen getroffen, die sich motivierend auf die Leistungen der Werktätigen auswirkten.« (Beide zitiert aus: Die Kombinatsdirektoren: Jetzt reden wir. Berlin: edition berolina, 2014)
Sozialistische Leiter waren durch ihre hohe Qualifikation und durch ihr enges Verhältnis zu ihren Arbeitern geprägt. Kein Leiter konnte es wagen, gegen deren Interessen zu regieren. Auch wir im höheren Staatsapparat Tätigen »regierten« nicht lebensfremd und abgehoben über die Köpfe der Werktätigen hinweg, sondern pflegten eine ständige und freundschaftliche Verbindung. Es war mir als Staatssekretär nicht nur ein Bedürfnis, sondern vor allem eine Bereicherung, mit Arbeitern an ihrem Arbeitsplatz zu diskutieren und in Belegschaftsversammlungen aufzutreten.
Heute träumen Linke und Gewerkschaften davon, das Wirtschafts- und Arbeitssystem des Kapitals durch Mitbestimmung besser gestalten zu können. Sie wollen eine gerechte und demokratische Wirtschafts- und Arbeitsordnung, in der die Arbeitnehmer selbst über das Was, Wofür und Wie der Produktion entscheiden. Über das Wie konnten die Werktätigen in der DDR in hohem Maße mitentscheiden. Ein weltweit einmalig arbeiterfreundliches Arbeitsgesetzbuch gab ihnen dazu die umfassenden rechtlichen Möglichkeiten. Versuche durch Selbstverwaltung der Betriebskollektive über das Was und Wofür zu entscheiden, haben sich als lebensfremde Illusion erwiesen.
Bei Stahlwerkern (Privatarchiv Klaus Blessing)
Die Träume, durch Mitbestimmung eine menschenwürdige und gerechte Arbeitswelt schaffen zu können, sind ausgeträumt. Das Coronavirus hat auf brutale Weise offengelegt, unter welchen Bedingungen weltweit – auch in Deutschland – gearbeitet werden muss. Das Leben in der Welt des Kapitals zeigt: Wer besitzt, entscheidet.
Gesellschaftliche Veränderungen hin zu einer besseren und gerechteren Welt sind deshalb nur zu erreichen, wenn die Besitzverhältnisse verändert werden. Das Grundgesetz der BRD und viele Landesverfassungen verlangen, dass Eigentum dem Allgemeinwohl zu dienen habe. Bei Verstößen kann enteignet werden. Es wird wohl kein vernunftbegabter Mensch noch behaupten können, dass heute das Privateigentum (an Produktionsmitteln) noch dem Gemeinwohl dient. Aber umgesetzt oder gar eingeklagt wurde dieses Verfassungsrecht nie. In der DDR war Volkseigentum in der Verfassung verankert und wurde mit Konsequenz, in der kleinen Privatwirtschaft und dem Handel zu konsequent, durchgesetzt.
Bei Kalikumpeln unter Tage (Privatarchiv Klaus Blessing)
Nur auf Grundlage von gesellschaftlichem Eigentum kann eine sozial gerechte Gesellschaft aufbauen und auch das Recht auf den Lebensunterhalt sichernde Arbeit garantieren. Es ist erfreulich und macht Mut, dass insbesondere große Teile der Jugend immer mehr erkennen und mutig auf den Straßen artikulieren: Dieses kapitalistische System hat keine Zukunft. Aufgabe unserer Generation ist es, sie dabei nicht bevormunden zu wollen, ihnen aber unsere Lebenserfahrungen aus zwei Gesellschaftssystemen nahezubringen und Mut für Veränderung zu machen.
Arbeit und Leben
(picture alliance / ZB / ddrbildarchiv.de / Klaus Morgenstern)
»Sozialistisch arbeiten« – Von Aktivisten und Helden der Arbeit
Klaus Behling
(Bundesarchiv Plak 100-027-007)
Ja, das Bild war gestellt«, sagt Fotograf Herbert Hensky, »aber die Stimmung war echt.«
Er schuf 1948 eine Ikone, die die DDR über 40 Jahre lang begleitete. Adolf Hennecke, der Bergmann aus dem Steinkohlenwerk »Karl Liebknecht« im erzgebirgischen Lugau. Der damals 43-Jährige schlug am 13. Oktober 1948 stolze 24,4 Kubikmeter Steinkohle aus dem Flöz und erfüllte damit seine Arbeitsnorm mit 387 Prozent. Adolf Henneckes Prämie bestand aus 50 Mark, einer Flasche Bergmannsschnaps, drei Schachteln Zigaretten, anderthalb Kilo Fettzulage auf die Lebensmittelmarken und einem Stück Anzugstoff.
Das Vorbild für die Superschicht lieferte der sowjetische Bergmann Alexei Grigorjewitsch Stachanow. Er förderte am 31. August 1935 im Bergwerk Zentral-Irmino in einer Schicht gleich das 13-Fache seiner Norm. In der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) musste ein eigener Held gefunden werden, man erkor Adolf Hennecke zum Ideal des »neuen Menschen«. Der Beginn der Aktivistenbewegung. Schnell rollte eine riesige Propagandawelle an. »Wir brauchen viele Henneckes!«, hieß die Parole. Für den fleißigen Bergmann folgte eine politische Karriere bis ins Zentralkomitee der SED.
Fünf Jahre später trübte sich die Aufbaustimmung. Am 17. Juni 1953 demonstrierten Arbeiter in Ostberlin und der ganzen DDR gegen höhere Normen bei gleichem Lohn. Der Kurs der Partei wurde korrigiert, sowjetische Panzer schlugen den Aufstand nieder, aber ein neues Leitbild musste her. Dieses Mal war es die »Meisterweberin« Frida Hockauf, 1903 geboren, die die Aktivistenbewegung wieder ankurbeln sollte. Auf einer Gewerkschaftsaktivtagung des VEB Mechanische Weberei Zittau gelobte sie, bis zum Dezember des Krisenjahres 45 Meter Stoff über den Plan zu weben. Glaubt man der zeitgenössischen Presse, erkannte Frida Hockauf: »So wie wir heute arbeiten, werden wir morgen leben.« SED-Chef Walter Ulbricht übernahm die Parole als Aufbaumotto. Die Weberaktivistin wurde 1954 mit dem Titel »Held der Arbeit« geehrt und verbrachte in ihrem Betrieb die restlichen Jahre bis zur Rente als Beauftragte für den sozialistischen Wettbewerb.
(Aktivist der Arbeit Adolf Hennecke (l.) und SED-Kader Hans Jendretzky (r.) während der ersten Hennecke-Konferenz im Februar 1949 in Ostberlin vor einem Wandbild, das Adolf Hennecke bei seiner Arbeit zeigt (picture alliance / dpa))
Für jene, die dem Weg von Adolf Hennecke und Frida Hockauf besonders engagiert folgten, gab es seit 1949 die Ehrung als »Aktivist des Zweijahrplans«, dann, ab dem 1. September 1953, den Ehrentitel »Aktivist des Fünfjahrplans« nebst Orden. Am 12. Mai 1960 löste ihn der »Aktivist des Siebenjahrplans« ab. Dann stiftete die DDR am 28. Juli 1969 eine Medaille für »Aktivisten der sozialistischen Arbeit«, die unabhängig von den aktuellen Plänen galt, denn der Siebenjahrplan war gerade in die Hose gegangen. Bei mehrmaligem Verleih gab es den »Verdienten Aktivisten« obendrauf. Die Aktivistenauszeichnung wurde relativ häufig verliehen; allein im Jahr 1988 bekamen sie von 8 979 700 Werktätigen 284 166 Frauen und Männer verliehen, 4441 Werktätige ehrte man als »Verdiente Aktivisten«.
Nach dem Ende der DDR wurde die hohe Zahl der Auszeichnungen gern spöttisch kommentiert. Wer damals dabei war, sieht es anders. Als Aktivist zu gelten machte stolz, ein paar hundert Mark Prämie waren willkommen. Und auch, wenn viele damit rechneten, einmal »dran« zu sein, entflammten um die zuvor in der Gewerkschaftsgruppe einzubringenden Vorschläge rege Diskussionen.
In einem feierlichen Staatsakt zeichnet Präsident Wilhelm Pieck die Weberin Frida Hockauf 1954 als Held der Arbeit aus. (BArch Bild 183-26921-0024 / Walter Heilig)
Die beste Chance auf eine Auszeichnung bestand seit 1959 im Kollektiv. Am 6. August des Jahres wurde der Titel »Brigade der sozialistischen Arbeit« gestiftet und anlässlich des 10. Geburtstags der Republik am 7. Oktober 1959 erstmals verliehen. Die »Brigade« wurde 1962 vom »Kollektiv« der sozialistischen Arbeit abgelöst. Am Ende der DDR arbeitete mit 4,6 Millionen Werktätigen mehr als die Hälfte aller Berufstätigen in solch einem ausgezeichneten Kollektiv. Natürlich hing an dem viereckigen Strahlenstern auch eine Prämie, die in aller Regel bei der Verleihung mit Bier, Wodka der Marke »Blauer Würger« und Grillsteaks gefeiert wurde.
Das hatten die Geehrten letztlich Nikolai Jakowlewitsch Mamai zu verdanken. Der sowjetische Bergmann initiierte 1958 eine Wettbewerbsbewegung zur täglichen Übererfüllung der Schichtnorm. Das griff – laut offizieller Propaganda auf eigene Initiative – die Jugendkomplexbrigade »Nikolai Mamai« des Elektrochemischen Kombinats Bitterfeld am 3. Januar 1959 auf und trat in den Wettbewerb um den Ehrentitel Brigade der sozialistischen Arbeit. Dazu war neben der Planerfüllung ein Kultur- und Bildungsplan nötig, gemäß der damals ausgerufenen Parole »Sozialistisch arbeiten, lernen und leben«.
Um den Ehrentitel zu erlangen, musste ein Anforderungskatalog erfüllt werden. Neben der Arbeit spielten kulturelle und politische Ansprüche eine Rolle, natürlich ging es um »sozialistische Moral und Ethik«, und dies alles hatte in »abrechenbarer Form« zu geschehen. Letzteres dokumentierte das Brigadetagebuch. Als »Mittel der Erziehung und Selbsterziehung« erzählte es von der Entwicklung der Brigademitglieder und war ihr Kummerkasten. Die Tagebücher sollten regelmäßig in den Gewerkschaftsgruppen der Betriebe »ausgewertet« werden.
In der Praxis ging es meist nicht so bierernst zu. Hatte sich erst einmal jemand gefunden, der die Schönschrift beherrschte, gern mal ein Bildchen ausschnitt oder ein Foto einklebte, womöglich noch eine Vignette malen und Schüttelreime verfassen konnte, waren der kreativen Buchführung keine Grenzen gesetzt. Kegelabende und gemeinsame Ausflüge wuchsen zu »kulturellen Höhepunkten« an, das Anpacken beim Hausbau des Arbeitskollegen zur »sozialistischen Hilfe«, und wenn mal ein Stammhalter zu begießen war, hieß es einfach »gemütliches Beisammensein«. Ein gemeinsamer Kino- oder Theaterbesuch lieferte wichtige Punkte, und den geforderten politischen Aktivitäten war Genüge getan, wenn jemand regelmäßig einen aktuellen Zeitungsartikel an die Wandzeitung pinnte oder zwei, drei Kollegen – oft zum wiederholten Mal – in die Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft eintraten.
Medaillen »Aktivist des Siebenjahrplans« und »Aktivist des Fünfjahrplans« (picture alliance / ZB / Peter Zimmermann)
Das entscheidende Kriterium blieb jedoch, dass der Plan erfüllt oder gar übererfüllt wurde. Wie man das zumindest auf dem Papier hinbekam, wussten alle. So hatten in aller Regel weder Betriebsleitung noch Betriebsgewerkschaftsleitung – bei Jugendkollektiven auch noch die FDJ-Leitung – etwas dagegen einzuwenden, den Wettbewerb um den Titel entsprechend zu honorieren. Wäre das nicht der Fall gewesen, hätten auch sie in schlechtem Licht dagestanden. Und das wollte niemand.
So gab es sozialistische Kollektive, die auf den Titel regelrecht abonniert schienen. Er musste Jahr für Jahr neu errungen werden, und konnte sogar wieder aberkannt werden. In den Jahren 1967 bis 1971 durften die Geehrten ihre mehrmaligen Auszeichnungen mittels einer Medaillenspange ausweisen, von 1971 bis 1975 gab es extra eine Ehrenspange für die »ununterbrochene Verteidigung des Titels« während des gesamten Fünfjahrplans.
Im Laufe der Zeit war der Wettbewerb zum Ritual erstarrt. Die in den frühen Jahren der DDR herrschende Aufbaustimmung, wie sie Adolf Hennecke einst symbolisierte, war erlahmt. Als seine Tochter Hannelore Graff-Hennecke im Frühjahr 2011 im Bergbaumuseum Oelsnitz die von ihr verfasste Biographie ihres Vaters vorstellte, meinte sie: »Er wusste nicht genau, worauf er sich einließ.« Das rief ein geteiltes Echo hervor – so wie es die Aktivisten und Helden der Arbeit der DDR bis heute tun.
Der Absturz – Einsatz im Studentensommer
Wolfgang Schüler
(picture alliance / imageBROKER / Michael Nitzschke)
Von 1973 bis 1977 habe ich an der Leipziger Karl-Marx-Universität Wirtschaftsrecht studiert. Ich erhielt – wie die meisten meiner Kommilitonen – 180 Mark Stipendium im Monat. Ein Internatsplatz kostete damals zehn Mark monatlich und eine Essenmarke in der Mensa etwa eine Mark. Alle Studenten waren krankenversichert, und sie konnten überdies zu stark verbilligtem Preis öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Die Grundversorgung war gesichert. Niemand musste Existenzangst haben.
Doch auch in der DDR gab es nichts umsonst. Von den Studenten wurde beispielsweise erwartet, dass sie in den Semesterferien drei Wochen lang am sogenannten FDJ-Studentensommer teilnahmen. Mit der Freiwilligkeit war das so eine Sache. In der Endkonsequenz konnten sich nur Kranke oder Fußlahme drücken.
Die Einsätze fanden zumeist in sozialistischen Großbetrieben statt und waren in der Regel sehr speziell. Die Studenten mussten beispielsweise in Brikettfabriken Kohlengruß schaufeln, für Nahverkehrsbetriebe Kabelgräben ausheben oder in Wäschereien die Lauge in den Bottichen umrühren. 1975 hatte es mich während des FDJ-Studentensommers in das Plattenwerk Neuwiederitzsch verschlagen, einen Zweigbetrieb des volkseigenen Wohnungs- und Gesellschaftsbaukombinats (WGK) Leipzig.
Bei der Einweisung wurde ich angenehm überrascht. Pro Doppelschicht sollte ich 100 Mark plus eine kostenlose Mahlzeit erhalten. Nach den drei Wochen mit ihren 15 Arbeitstagen würde ich demzufolge 1.500 Mark bar ausgezahlt bekommen und könnte völlig sorgenfrei mit meiner Freundin eine Reise nach Bulgarien antreten.
Doch wer mit dem Teufel frühstücken will, braucht einen langen Löffel. Das merkte ich, nachdem ich meine Arbeitsschutzbekleidung – Fußlappen, blaue Kombi, schwarze Gummistiefel, rote, bis an die Ellenbogen reichende Gummihandschuhe und einen gelben Schutzhelm – angelegt hatte und in meine Arbeit eingewiesen wurde.
Studenten erhalten Arbeitsaufgaben für den FDJ-Studentensommer. (picture alliance / ZB / Thomas Uhlemann)