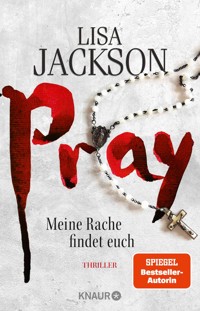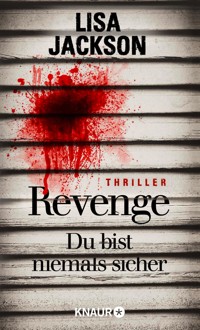
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Eiskalte Thriller
- Sprache: Deutsch
Ein eisiges Versteck in den Bergen. Eine mörderische Jagd. Mit »Revenge – Du bist niemals sicher« hat die amerikanische Bestseller-Autorin Lisa Jackson einen nervenzerfetzenden Kurz-Thriller geschrieben, der genau das Richtige für ein schnelles, atemloses Lesevergnügen ist. Als Kinder erleben Lucy und ihre Geschwister, wie ihre Mutter beinahe ermordet wird. Lucys Aussage bringt den damaligen Geliebten der Mutter, Ray, hinter Gitter – doch er beschuldigt Lucy, die wahre Mörderin zu sein. Jahre später kommt Ray frei. Lucy weiß, dass er hinter ihr her ist, und sucht Zuflucht in einer Blockhütte in den verschneiten Bergen Oregons. Aber sie ahnt, dass sie nicht länger davonlaufen kann. Nicht vor ihm – und nicht vor den grausamen Ereignissen jener Nacht, an die sie sich erst jetzt nach und nach erinnern kann … Ein Kurz-Thriller von Bestseller-Autorin Lisa Jackson, der es in sich hat und perfekte Hoch-Spannung für zwischendurch garantiert. Entdecken Sie auch die anderen Thriller von Lisa Jackson, zum Beispiel ihre Thriller-Reihen rund um das Detectives-Duo Bentz und Montoya oder das Detectives-Duo Alvarez und Pescoli. Oder den Stand-Alone-Thriller »Paranoid«, in dem Lisa Jackson von alter Schuld und später Rache in einer Highschool-Clique erzählt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 118
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Lisa Jackson
Revenge
Du bist niemals sicher
Thriller
Aus dem amerikanischen Englisch von Kristina Lake-Zapp
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Als Kinder erleben Lucy und ihre Geschwister, wie ihre Mutter beinahe ermordet wird. Lucys Aussage bringt den damaligen Geliebten der Mutter, Ray, hinter Gitter – doch er beschuldigt Lucy, die wahre Mörderin zu sein.
Jahre später kommt Ray frei. Lucy weiß, dass er hinter ihr her ist und sucht Zuflucht in einer Blockhütte in den verschneiten Bergen Oregons. Aber sie ahnt, dass sie nicht länger davonlaufen kann. Nicht vor ihm – und nicht vor den grausamen Ereignissen jener Nacht, an die sie sich erst jetzt nach und nach erinnern kann …
Ein nervenzerfetzender Kurz-Thriller für zwischendurch von Bestsellerautorin Lisa Jackson
Inhaltsübersicht
Los Angeles, Kalifornien
Cascade Mountains, Oregon
San Francisco, Kalifornien
Los Angeles, Kalifornien
Cascade Mountains, Oregon
San Francisco, Kalifornien
Los Angeles, Kalifornien
Cascade Mountains, Oregon
Ein Transatlantikflug
Cascade Mountains, Oregon
Los Angeles, Kalifornien
Salzburg, Österreich
Cascade Mountains
San Francisco, Kalifornien
Cascade Mountains
San Francisco, Kalifornien
Salzburg, Österreich
Cascade Mountains, Oregon
Central Oregon
Cascade Mountains, Oregon
San Francisco
Los Angeles, Kalifornien
Damals
Lucy erstarrte.
Versteckte sich in Mamas Badezimmer, Mamas spezielle Schere in der Hand. Die mit den extralangen Klingen. Diesmal konnte sie nicht entkommen.
Wie oft hatte sie von ihrer Mutter gehört: »Fass Mamas Sachen nicht an«, und jetzt würde man sie erwischen.
Sie biss sich auf die Lippe. Sie sollte sich nicht in Mamas Schlafzimmer aufhalten, und sie sollte schon gar nicht die Schere stehlen, aber sie brauchte sie, um sich damit die Haare zu schneiden, die laut Mama nicht geschnitten werden durften.
Sie schlich oft in Mamas Zimmer und durchwühlte ihre Sachen, spielte Verkleiden und tat so, als sei sie ein großer Filmstar wie Mama, die an dem Tag, an dem sie in Hollywood gelandet war, ihren Namen von Christy Smith in Tina Champagne geändert hatte – das hatte Lucys ältere Schwester Marilyn ihr anvertraut. Wenn sie sich unbeobachtet fühlte, schlüpfte Lucy in Mamas Schuhe mit den superhohen Absätzen, setzte die riesige Sonnenbrille mit dem Glitzergestell auf, schminkte sich die Lippen und probierte Mamas Hüte an. Lucy kannte jedes einzelne Stück von Mamas Garderobe, und sie war oft allein – weshalb sie jede Menge Zeit hatte, alles zu erkunden und anzufassen. Vor allem die Dinge, die verboten waren. Mama hatte sie gewarnt: »Das ist teuer, fass nicht Mamas Anhänger an, das ist ein Schmuck-Ei von Fabergé. O nein, nein, nein …« Oder: »Das ist ein Diamantarmband, Liebling, ein Geschenk von deinem Vater, der nicht wollte, dass ich mich von ihm scheiden lasse. Nun, das hat nicht funktioniert, aber egal. Bitte, Lucille, leg es zurück.« Oder: »Du weißt, dass du nicht Mamas Schubladen durchwühlen darfst, auch nicht die im Nachtschränkchen. Die Pistole ist geladen, also Finger weg, Fräulein. Das ist sehr, sehr gefährlich, aber Mama braucht die Waffe, um sich zu schützen. Herr im Himmel, Lucy, muss ich wirklich ein Schloss an meiner Tür anbringen lassen?«
Das hatte sie nie getan. Und jetzt würde Lucy Ärger bekommen, großen Ärger, sollte Mama das Badezimmer betreten. Sie knipste das Licht aus, zog sich lautlos von der Tür zurück, die nur einen schmalen Spalt offen stand, und versteckte sich in der geräumigen Dusche, die abgetrennt war wie ein eigenes Zimmer. Mit hämmerndem Herzen betete sie zu Gott, dass Mama gleich zu Bett gehen würde.
Wenn sie eingeschlafen war, konnte sich Lucy aus dem Bad und an Mama vorbei in ihr eigenes Zimmer stehlen.
Es raschelte im Schlafzimmer, das Himmelbett knarzte leise, als Mama es sich bequem machte. Lucy hörte leise Radiomusik und das Klirren von Eiswürfeln. Sie stellte sich vor, wie Mama ein großes Glas mit einer durchsichtigen Flüssigkeit in der Hand hielt. Mamas »Absacker« – Wodka, das hatte Marilyn ihr verraten. Gut! Wenn das Glas leer war, würde Mama einschlafen, und dann …
Sie hörte Schritte im Flur und verfluchte im Stillen ihre älteren Geschwister. Es wäre typisch, wenn Clark oder Marilyn hereinplatzten und ihre Fluchtpläne vereitelten! Geräuschvoll flog die Tür auf.
»Was zur Hölle …?«, stieß Mama erschrocken hervor. »Was willst du?«
»Ich wohne hier«, erwiderte eine schroffe Männerstimme. Lucy rutschte das Herz in die Hose. Ray. Mamas Freund, ihr »Toyboy«, wie Marilyn ihn nannte.
»Nicht mehr«, widersprach Mama fest. »Raus hier.« Ray war groß und muskulös. Er hatte schmale Lippen, gerade weiße Zähne und ein markantes Kinn, das dringend rasiert gehörte. Ray wusste, dass er gut aussah, denn er ging nicht, er stolzierte. Lucy mochte ihn nicht.
»Ich lasse mich nicht rauswerfen«, hielt er dagegen. Seine Worte klangen verschliffen. »Wir müssen reden. Wir haben Probleme, und das wissen wir beide.«
»Wir haben Probleme, weil du nicht die Finger von anderen Frauen lassen kannst. Sehr viel jüngeren Frauen.«
»Darüber will ich ja mit dir reden …«
»Geh jetzt, Ray, oder ich rufe die Polizei.«
»Komm schon, Babe, das meinst du nicht so.«
»Doch.«
Lucys Kehle wurde trocken, und obwohl sie wusste, dass es verrückt war, schob sie sich Zentimeter für Zentimeter aus der Dusche hinaus ins dunkle Badezimmer und tappte geräuschlos in Richtung Tür. Von dort spähte sie ins dämmrige Schlafzimmer, das nur von der Lichterkette an Mamas Himmelbett erhellt wurde. Mama hatte die seidene Schlafmaske auf die Stirn geschoben. Ihre roten Haare standen in alle Richtungen ab.
Ray stand neben dem Bett, ein überhebliches Lächeln auf den Lippen, einen Drink in der Hand.
Aber Mama ging nicht auf ihn ein. Lucy sah den Zorn in ihrem Gesicht. Tina Champagne wurde nicht gern gestört, wenn sie sich bettfertig gemacht und ihr Gesicht mit dieser Wundercreme gegen Falten eingekleistert hatte. Mama gestattete es keinem, sich ihr zu nähern, solange sie nicht »kamerafertig« war. Lucy wusste das, genau wie ihre Geschwister. Ray sollte es eigentlich auch wissen.
Doch Ray war aufdringlich und ungehobelt, und er dachte, er könne sich bei Mama einschmeicheln oder sie drangsalieren. Konnte er aber nicht. Das war auch Tinas anderen drei Ehemännern nicht gelungen, als sie beschlossen hatte, sich von ihnen scheiden zu lassen.
Ray ließ seinen Drink im Glas kreisen. Mit der freien Hand griff er nach Mamas Kopf, riss ihr die Maske von der Stirn und grub seine Finger in ihre Locken, um ihr Gesicht zu seinem Schritt zu ziehen. Sein T-Shirt hing aus der Levi’s.
»Lass das«, warnte sie.
Lucys Finger krampften sich um die Schere.
»Stell dich nicht so an, Babe. Entspann dich.« Er fing an, Mamas Nacken zu streicheln, wobei er sie noch näher an sich heranzog. »Du willst es, Babe, das weiß ich …«
»Hau ab, Ray, ich meine es ernst!«, stieß Mama hervor und schubste ihn von sich. Dann zog sie die Schublade ihres Nachtschränkchens auf und tastete hektisch darin herum.
»Was …?« Er war gestolpert und rutschte nun auf dem dicken, weißen Kunstfellteppich aus. Das alte Haus schien zu beben, als er mit der Schulter gegen die Wand prallte. Am anderen Ende des Flurs schrie jemand auf. Schlagartig wurde es im Zimmer stockdunkel. Nur durchs Fenster fiel spärliches Licht herein.
»Mom?«, schrie Marilyn. Lucy hörte Schritte im Flur.
»Alles okay?«, rief Clark vor der Zimmertür.
»Raus jetzt! Sofort!«, zischte Mama in die Dunkelheit.
»Du verfluchtes Miststück«, knurrte Ray, und Lucy, deren Augen sich langsam an die Dunkelheit gewöhnten, sah, wie er sich aufrichtete und wieder aufs Bett zuging. Geräuschlos schlüpfte sie ins Schlafzimmer, die Schere in der Hand.
»Bleib weg von mir!«, warnte Mama. »Ray, ich habe eine Pistole, und ich zögere nicht, sie zu benutzen. Das weißt du!«
»Ich dachte, du wolltest die Polizei rufen«, höhnte er. Jetzt war Ray bei Mama. Beugte sich über sie.
Lucy erstarrte.
Mama schnappte erschrocken nach Luft, als plötzlich die Schlafzimmertür aufflog. Das Flurlicht fiel ins Zimmer.
»O Gott!«, kreischte Marilyn und rannte zu Mama.
Clark folgte ihr dicht auf den Fersen. »Was zum Teufel …« Lucy schrie auf, hob die Schere mit der Spitze nach vorn über ihren Kopf und sprang. Wie in Zeitlupe flog sie in Richtung Bett und versenkte die Schere tief in Rays Fleisch.
Cascade Mountains, Oregon
Jetzt
»Los geht’s! Nun komm schon! Beeil dich!« Schwer atmend warf Lucy einen Blick über die Schulter. Ihre siebenjährige Tochter trödelte wieder einmal, fasziniert von dem winterlich verschneiten Wald, blind gegenüber der Tatsache, dass ein Schneesturm im Anmarsch war. Schlimmer noch: dass er im Anmarsch war. »Jetzt mach endlich, Liebes«, drängte Lucy. Sie ruckte am Seil des Schlittens, der das trug, was ihr in der nächsten Zeit zum Leben genügen musste. »Es ist nicht mehr weit.«
Das war gelogen. Von der Stelle, an der sie ihren geländegängigen Toyota geparkt hatte, war es noch eine halbe Meile bergauf bis zu dem Blockhaus tief in den Wäldern von Oregon. Und selbst das lag nicht abgeschieden genug. Kein Ort auf dieser Erde würde jemals weit genug weg von ihm sein, aber es musste genügen. Fürs Erste. Bis sie etwas anderes fand.
Die kalte Furcht, die sie hierhergetrieben hatte, zwang sie, sich immer weiter den steilen Hang hinaufzuschleppen, durch die dicht stehenden Kiefern und Tannen, deren Zweige sich unter einer weißen Schneedecke bogen. Die Ahornbäume hatten ihre herbstlich bunten Blätter längst verloren und erinnerten mit ihren kahlen Ästen an Skelette.
Unter anderen Umständen wären Renee und sie über die Weihnachtstage hergekommen, um den Frieden und die Einsamkeit der Kaskadenkette im Winter zu genießen, und sie hätte sich auf das urige Blockhaus gefreut. Genau wie ihre Tochter wäre Lucy ab und an stehen geblieben und hätte die atemberaubende Landschaft auf sich wirken lassen, die sanfte Berührung der Schneeflocken auf ihren Wangen gespürt und den eisigen Hauch des Windes, der die Haare aus ihrer Mütze wehte.
Doch das war nicht möglich. Nicht jetzt. Vielleicht nie.
»Jetzt komm endlich!«, drängte sie erneut, schärfer diesmal, weil ihre Tochter so langsam durch den Schnee bummelte. »Leg einen Zahn zu, Grace.«
Grace, unter deren weißer Mütze kleine braune Löckchen hervorlugten, runzelte die Stirn. »So heiße ich nicht.«
»Im Augenblick schon. Mein neuer Name ist Elle, und du bist Grace.«
»Du bist nicht Elle. Du bist Lucy.«
»Elle ist der zweite Teil meines Namens. Lucille-Elle. Und Grace ist dein zweiter Vorname.«
Ihre Tochter bedachte sie mit einem finsteren Blick.
»Ich habe dir doch erklärt, dass das ein Spiel ist.«
»Blödes Spiel. Ich bin Renee«, beharrte das Mädchen.
»Wie auch immer du heißt – beeil dich einfach.«
Mach kein Drama daraus, sie ist nur ein Kind. Sie kann das unmöglich verstehen. Wahrscheinlich war das Ganze ohnehin übertrieben, das mit den Decknamen, damit man sie nicht sofort erkannte, falls sie in dieser entlegenen Gegend tatsächlich jemandem begegneten. »Weißt du, was? Wenn wir zwei allein sind, dann bin ich Mom oder Lucy, und du bist Renee, aber wenn wir irgendwen treffen, bist du Grace. Einverstanden?«
»Einverstanden.« Renee zog die Nase kraus, aber sie widersprach nicht und stapfte hinter dem Schlitten her, wobei sie in die Spuren trat, die ihre Mutter in dem fünfzehn Zentimeter tiefen Schnee hinterließ. Während Lucy weiter eine schmale Schneise in die weiße Decke zog, warf sie einen skeptischen Blick zum Himmel. Nichts als Millionen winziger Flocken. Gut so. Je mehr ihre Spuren verdeckt wurden, desto wahrscheinlicher, dass sie entkommen konnten.
Doch für wie lange? Er wird niemals lockerlassen, wird dich niemals in Ruhe lassen.
Doch daran durfte sie jetzt nicht denken. Eins nach dem anderen. Das war ihr Mantra.
Und fürs Erste würde ihnen das Blockhaus hoffentlich ein Versteck bieten.
Bitte, lieber Gott, bitte.
»Komm weiter«, sagte sie bestimmt.
»Wo ist Merlin?«, rief ihre Tochter und spähte angestrengt umher, doch der Hund war nirgendwo zu sehen.
»Er wird schon nachkommen«, beruhigte Lucy die Kleine, ohne stehen zu bleiben. »Er ist zur Hälfte ein Alaskischer Malamute, die lieben den Schnee und die Kälte. Beeil dich!« Lucy zerrte weiter den Schlitten mit dem Lebensnotwendigsten hinter sich her: genug zu essen für zwei Wochen, Kleidung und Schlafsäcke, Handy und iPad – auch wenn es im Blockhaus kein WLAN gab. Falls die elektronischen Geräte überhaupt funktionierten, waren sie für Notfälle gedacht. Wem willst du etwas vormachen? Dein ganzes Leben ist ein einziger Notfall!
»Ziehst du mich?«, fragte Renee und beäugte den bereits vollen Schlitten.
Wenn es dann schneller ging – gern. »Sicher.«
Renee sprang auf, und Lucy musste noch mehr Kraft aufbringen, um sich den steilen Pfad hinaufzukämpfen. Eigentlich durfte sie das Blockhaus gar nicht benutzen, hatte nur zufällig davon erfahren, als sich eine ihrer Kolleginnen am Junior College mit einer anderen darüber unterhielt.
»… und die idyllische Hütte gehört meinem Onkel«, hatte sie die blonde Cindy sagen hören, die gerade am Drucker stand. Lucy kannte die Kollegin recht gut, sie hatten mehrere Jahre zusammengearbeitet. Cindy hatte auch nach der Hochzeit ihren Mädchennamen behalten. »Das ist eine Machtfrage«, hatte Cindy behauptet, als sie gemeinsam an einer Konferenz teilnahmen und sich deshalb ein Zimmer in den Holiday Suites in Reno teilten. »Ich mag meinen Namen. Cynthia Jacoby. Ich hätte sonst Cynthia White geheißen – das klingt wie eine Figur aus einem Disneyfilm. Meinem Mann macht das nichts aus. Er ist da ziemlich modern.«
»Wo ist denn diese Hütte?«, fragte die andere Kollegin.
»In Oregon. In der Nähe des Mount Hood, aber sie ist so abgelegen, dass man nur zu Fuß hinwandern kann. Da oben gibt es wirklich gar nichts. Die Hütte ist recht groß, hat fließendes Wasser und auch Strom. Mein Onkel sagt aber, wenn es stürmt, fällt der Strom häufig aus. Er hat mir angeboten, das Blockhaus jederzeit zu benutzen – im Sommer soll man dort herrlich wandern und fischen können, und im Winter ist die Gegend wohl ein Paradies für einsame Schneeschuhwanderungen oder Langlauftouren. Stell dir vor: Er hat sogar einen Schlüssel für mich versteckt. Anscheinend hat er ihn an einen Baum mit einem geborstenen Stamm genagelt, das muss man sich mal vorstellen! Als würde ich jemals …«
Den Rest des Gesprächs hatte Lucy nicht mehr mitbekommen, da ihre beiden Kolleginnen in Richtung Cafeteria schlenderten. Später hatte sie ein bisschen im Internet recherchiert, in den Behördenregistern gestöbert und herausgefunden, dass es sich bei dem Besitzer um einen gewissen Winston Jacoby handeln musste. Anschließend war es leicht gewesen, den genauen Standort des Blockhauses zu ermitteln. Jetzt, da sie mit ihrer Tochter und dem Hund dorthin unterwegs war, hoffte sie inständig, dass diese Koordinaten stimmten.