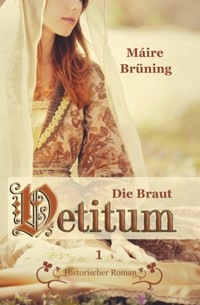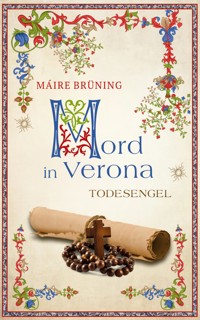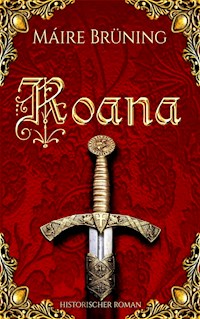
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Sizilien 1254 Als ihr Onkel Gandar auf unerklärliche Weise verschwindet, bricht für Roana eine Welt zusammen. Schnell wird ihr klar, dass sie etwas unternehmen muss, wenn sie ihren Onkel lebend wiedersehen will. Doch niemand glaubt ihr. Ihr bleibt nichts anderes übrig, als Rafael um Hilfe zu bitten, einen Mann, dem man nachsagt, ein skrupelloser Mörder zu sein. Rafael hat überhaupt kein Interesse daran, sich mit der unnahbaren Grafentochter abzugeben, doch Herzog Gandars Verschwinden ist in der Tat ein Notfall. Gemeinsam gehen sie auf Spurensuche, aber schnell gerät Roana in einen Strudel aus Intrigen, Missgunst, Eifersucht und roher Gewalt. Ihr Leben ist in Gefahr - und während Rafael sich aufmacht, um sie zu retten, muss er erkennen, wie sehr Roana sich schon in sein Herz geschlichen hat ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Das Buch:
Sizilien 1254 Als ihr Onkel Gandar auf unerklärliche Weise verschwindet, bricht für Roana eine Welt zusammen. Schnell wird ihr klar, dass Eile geboten ist, wenn sie ihren Onkel lebend wiedersehen will. Ihr bleibt nichts anderes übrig, als Rafael um Hilfe zu bitten, einen Mann, dem man nachsagt, ein skrupelloser Mörder zu sein. Rafael hat überhaupt kein Interesse daran, sich mit der unnahbaren Grafentochter abzugeben, doch Herzog Gandars Verschwinden ist in der Tat ein Notfall. Gemeinsam gehen sie auf Spurensuche, aber schnell gerät Roana in einen Strudel aus Intrigen, Eifersucht und roher Gewalt. Ihr Leben ist in Gefahr - und während Rafael sich aufmacht, um sie zu retten, muss er erkennen, wie sehr Roana sich schon in sein Herz geschlichen hat ...
Die Autorin:
Máire Brüning, geboren 1966 wuchs in einer Region auf, die reich an Zeugnissen staufischer Baukunst ist. Dadurch begeisterte sie sich schon als Kind für alte Ruinen, Sagen und Ritterrüstungen; ihre Leidenschaft für Geschichte und das Mittelalter führte sie schließlich zum historischen Roman. Nach einigen Wanderjahren als Floristin quer durch Deutschland lebt und arbeitet Máire Brüning in der Nähe von Frankfurt. Von Máire Brüning sind bereits erschienen:Roana Tage der Trauer (Sequel 1 zu Roana) Wie ein Siegel auf dein Herz Teil 1 Wie ein Siegel auf dein Herz Teil 2 Die Braut des Medicus Der Schatz des Venezianers Vetitum Teil 1
Dramatis Personae
Historische Personen sind mit einem * gekennzeichnet.
Die Hauptpersonen
Roana Isabella von Morra
Rafael, gen. Malik al Maut (Engel des Todes)
Gefährten und Freunde
Gandar von Rodéna, Herzog von Rodi, Roanas Oheim und Rafaels Ziehvater
Ahmad ibn Asher Halewi, Gandars sarazenischer Freund
Peire, Sänger, Rafaels Freund und Diener
Bewohner von Rodéna
Omar, Haushofmeister von Rodéna
Zippora seine Frau, Ahmads Schwester
Amaro, Ahmads Bruder,
Lauris von Segeste, Ritter
Julian von Ora, Ritter
Manfred, Ritter
Roanas Familie
Graf Léon Carl von Morra, ihr Vater
Gräfin Judith von Morra, ihre Mutter, Gandars Schwester
Diotima, Iliane, Hilda, Helene, Roanas Schwestern
Rafaels Familie
Fra Lucca, sein leiblicher Vater
Ravena, seine Schwester
Nael, Medicus, sein Halbbruder
Die Glouburger
Richard von Glouburg, Gandars Zwillingsbruder
Gwenfrewi von Glouburg, Gemahlin Richards, Gandars heimliche Geliebte
Sonstige
Lorenzo di Bora, Sklavenhändler
Manfred von Sizilien*
Konrad IV von Hohenstaufen*
Friedrich II *
Causa (Ursache, Grund)
Lagerstadt Victoria, in der Nähe von Parma, Italien
An einem Februarmorgen des Jahres 1248, kurz vor Sonnenaufgang, begann das Töten.
Im Westen der Po-Ebene war der Himmel noch dunkel, doch im Osten glühte er bereits orange und violett. Die Nacht wich langsam aus den Straßen der kaiserlichen Stadt Victoria zurück, während das erste Licht des Tages wie eine siegreiche Streitmacht über die Dächer kroch. Die Zinnen der Wehrmauer standen als schwarze Umrisse vor dem flammenden Horizont.
Drei in dunkles Tuch gekleidete Gestalten huschten verstohlen durch die Gassen und näherten sich einem der Stadttore. Lautlos meuchelten sie die Torwächter, wischten ihre Dolche ab und öffneten die Mannpforte neben dem Tor. Mehr und mehr finstere Gesellen sickerten in die Stadt, eilten zu den Stadttoren und begannen ihr Vernichtungswerk. Nur wenige Herzschläge später brach die Hölle los.
Der Besatzung von Victoria blieb keine Zeit, sich auf den Angriff vorzubereiten. Ein Gutteil der Männer wurde vom Dröhnen der Sturmglocke aus weinseligem Schlummer gerissen. Schlaftrunken griffen sie nach ihren Waffen und stolperten halb bekleidet auf die Straßen. Andere wiederum hielten den Alarm für eine Übung und verabschiedeten sich erst umständlich von ihren Dirnen, bevor sie ihren Kameraden zur Hilfe eilten. Doch da war es schon zu spät. Der Ansturm der Soldaten und Bürger aus Parma kannte kein Zögern und überrollte die Stadt Kaiser Federicos mit der Wucht einer Lawine.
In seinem Versteck hinter der Kirche verzog Rafael höhnisch die Lippen, während er zusah, wie der Marktplatz sich binnen Kurzem in ein Schlachtfeld verwandelte. Wenigstens brauchte er sich dieses Mal keine Gedanken zu machen, was er mit der Leiche tun sollte. Ein Toter mehr oder weniger fiel in diesem Gedränge nicht auf. So weit das Auge reichte, waren Ritter und Soldaten in erbitterte Zweikämpfe verwickelt und Rafael beobachtete gleichgültig, wie sie dabei über die reglosen Leiber der ersten Gefallenen stolperten.
Harun stieß ihm das stumpfe Ende seines Wurfspießes in den Rücken. »Warum bleibst du stehen, Wurm?«, rief er über das Waffenklirren hinweg. »Vorwärts, geh weiter.«
Rafael fuhr mit einem so wilden Blick zu seinem Herrn herum, dass dieser unwillkürlich zurückwich. Harun ließ sich jedoch nicht so leicht überraschen. Er versetzte Rafael einen heftigen Stoß mit dem Spieß und fegte ihm gleichzeitig mit einem Fußtritt die Beine weg. Rafael schlug schwer auf dem Boden auf.
»Willst du dich mit mir anlegen, elendes Stück Dreck?«, spottete Harun. »Nur zu! Nichts bereitet mir mehr Freude, als dir eine Lektion in Demut zu erteilen.«
Rafael lag bäuchlings im Staub. Seine Rippen schmerzten und er konnte spüren, wie sein Herz wild in seiner Brust zu trommeln begann. Wenn er doch nur …
Aber dann presste er die Kinnladen zusammen und würgte seinen Zorn hinunter. Demütig kroch er vorwärts und berührte mit der Stirn Haruns Schuhspitze. Die vergangenen fünf Jahre hatten ihn schmerzhaft gelehrt, dass ein Sklave keine Würde mehr besaß, keinen eigenen Willen. Für ihn gab es keine Gerechtigkeit, niemanden, bei dem er sich beschweren konnte, keine Hilfe. Es gab nur Erniedrigung, Knechtschaft des Körpers und des Geistes, Unterjochung und Scham.
»Nun mach schon. Hoch mit dir!« Sein Herr versetzte ihm einen aufmunternden Fußtritt und Rafael erhob sich eilig.
»Du weißt, was du zu tun hast«, sagte Harun und reichte ihm einen Dolch und ein Wurfmesser. »Töte den Herzog und du erhältst eine Woche lang Essensreste vom Tisch des Scheichs.«
Rafael starrte seinen Herrn ungläubig an. Sich sieben Tage lang nicht mit den Ratten um die mageren Küchenabfälle balgen zu müssen, die man ihm für gewöhnlich zugestand, erschien ihm wie das Paradies auf Erden. Dafür würde er tun, was immer Harun von ihm verlangte.
Rafael nahm die Waffen und schob sie in seinen Gürtel. Einen kurzen Moment verweilte sein Blick dabei auf seinen Händen. Es besaß die Finger eines Musikers feingliedrig und beweglich, dafür gemacht, über die Saiten einer Laute zu tanzen. Doch er hatte mit diesen Händen solche Taten begangen, dass es nichts gab, was seine Seele noch vor der Hölle bewahren konnte. Eigentlich hätte ihm das etwas ausmachen müssen. Aber das tat es nicht. Entschlossen schob Rafael diese Gedanken beiseite und konzentrierte sich auf seine Aufgabe. Hörner wurden geblasen. Gruppen von Feldkämpfern und Sarazenenkriegern in den kaiserlichen Farben kreuzten sein Blickfeld, alle liefen zielstrebig zum Palast. Einer Eingebung folgend, eilte er hinter den Männern her und mischte sich unter die Feldkämpfer. Sein Augenmerk galt jedoch den Sarazenen. Wenn sein Plan aufging, würden sie ihn direkt zu seinem heutigen Opfer führen.
Der Palast war so groß und prunkvoll, dass Rafael einen Augenblick zu träumen glaubte. Doch die Zerstörung war echt. Alle Türen waren aufgebrochen und hingen zersplittert in ihren Angeln. Polternder Lärm verriet, wo die Plünderung noch in vollem Gange war. Rafael zögerte. Sollte er hineingehen? Nein, entschied er. Hier war nichts mehr zu holen. Der Herzog würde sich mit einem so aussichtslosen Unterfangen nicht aufhalten. Wohin also?
Die Schatzkammer, schoss es Rafael durch den Kopf. Kaiser Federico würde von seinen Getreuen erwarten, dass sie wenigstens den Kronschatz in Sicherheit brachten, wenn schon der Palast nicht mehr zu retten war.
Sein Blick erfasste eine plötzliche Bewegung und er riss den Kopf herum. Geschosse mit brennendem Pech prasselten auf die Straße nieder. Rafael spürte den Luftzug an seinem Gesicht und hörte das seufzende Zischen des Schaftes, als ein Pfeil dicht an ihm vorbei surrte. Weg hier!
Wie ein Kaninchen auf der Flucht rannte er durch die Straßen, bog wahllos ab, duckte sich in Hauseingänge oder wartete atemlos, mit dem Rücken an eine Hauswand gepresst ab, bis die stampfenden Füße einer Gruppe Bewaffneter sein Versteck passiert hatten. Schließlich erreichte er die Schatzkammer. Aus den Türen schlug ihm Grölen entgegen. Junge Kerle durchwühlten die Räume, rafften Prunkgewänder, Goldschmuck und Zierrat zusammen.
»Verschwinde! Wir waren zuerst hier!«
Rafaels Anspannung schlug um in Panik. Zur Hölle. Wohin jetzt? Der Harem? Wenn der Herzog auch dort nicht war …
Nun mach schon, ermahnte er sich. Du willst dir doch eine Woche lang den Bauch vollschlagen ...
Inzwischen stand beinahe die halbe Stadt in Flammen. Beißender Rauch und Hitze erfüllten die Luft und machten das Atmen zur Qual. Schwerfälliger als zuvor setzte Rafael sich wieder in Bewegung und trabte eine Gasse mit dicht beieinanderstehenden Häusern entlang. Plünderer warfen unbrauchbaren Hausrat aus den Fenstern auf die Straße, und etwas schlug ihm wie ein gigantischer Hammer von hinten gegen die Beine. Er fiel vornüber, kam, durch die Wucht des Aufpralls weitergerissen, noch einmal auf die Füße und stürzte ein zweites Mal. Sein Kopf schlug gegen etwas Hartes, Unnachgiebiges und alles wurde dunkel.
Als Rafael aus seiner Ohnmacht erwachte, lag er bäuchlings im stinkenden Morast einer Gosse und hatte Schwierigkeiten, in die Realität zurückzufinden. Von allen Seiten drangen Geräusche auf ihn ein; kreischende Stimmen, Gelächter, splitterndes Holz. Das dröhnende Sturmgeläut einer Glocke quälte sein Trommelfell. Trotzdem war es immer noch besser, als die Schreie der Verletzten und Sterbenden, die durch die Straßen gellten.
Mühsam richtete Rafael sich auf Hände und Knie auf und kroch wie ein Tier auf den nächsten dunklen Hauseingang zu. Seine Glieder fühlten sich seltsam an – taub und gleichzeitig leicht und er zitterte vor Überanstrengung und Müdigkeit.
Wahrscheinlich bemerkte er deshalb die vier Kriegsknechte in abgerissenen Lederharnischen auch erst, als sie sein Versteck schon eingekreist hatten. Dem Ersten schleuderte er sein Wurfmesser entgegen und zerfetzte ihm mit einem tödlichen Treffer die Kehle. Aber da er nicht genug Fleisch auf den Knochen und zu wenig Kraft in seinem mageren Körper hatte, war es den drei verbleibenden Männern ein Leichtes, ihn zu überwältigen.
Innerhalb kürzester Zeit hing er mit dem Kopf nach unten über einem halbhohen Mauervorsprung. Seine Arme wurden von je einem Mann festgehalten, während der Dritte mit der flachen Hand auf seinen Hintern klatschte, spielerische Klapse, die dennoch in Rafaels Ohren widerhallten wie Donner.
»Sieh einer an, was haben wir denn da für ein Vögelchen?«, sagte der Mann, der seinen linken Arm festhielt. »Was meinst du, Tadeo, ist so ein hübsches Kerlchen nicht genauso gut wie die Kaiserhuren, die sie uns weggenommen haben?«
»Na und ob!« Die Männer brachen in grölendes Gelächter aus.
Rafael stieß einen animalischen Laut voller Wildheit und Zorn aus und begann, sich wie eine in die Ecke gedrängte Wildkatze zu wehren. Trotzdem spürte er, wie Tadeo ihm die Lumpen vom Körper riss, schwielige Hände gierig über seine nackte Haut strichen. Er wusste, was passieren würde. Wenn er nur ein bisschen mehr Kraft gehabt hätte … Aber so gab es kein Entkommen. Seine Schreie würden ungehört verhallen, Rufe um Hilfe unbeachtet bleiben. Niemand würde zuhören. Niemand würde es kümmern.
Der Mann zu seiner Rechten kicherte. »Nun mach schon, Tadeo!«, sagte er mit zittriger Stimme. »Gib es dem kleinen Bastard.«
Tadeo warf seinen Leibriemen auf den Boden und ließ Beinlinge und Bruche fallen, sein Atem ging in schweren Stößen, Schweiß triefte von seiner Stirn. Seine Hand sauste noch einmal klatschend auf Rafaels Hinterteil nieder, bevor er mit einem einzigen, harten Stoß in ihn eindrang.
Rafael blieb stumm. Doch etwas Dunkles, Schweres, Brodelndes schien aus den Tiefen seiner Seele emporzuschießen, seine Gedanken hinwegzufegen und ihn mit Kraft zu erfüllen. Der Schmerz erlosch, verschwand und wurde von etwas Neuem, Fremden und Bösen abgelöst. Mit einem gellenden Schrei bäumte er sich auf und versuchte, seinen Peiniger abzuschütteln.
Tadeo versetzte ihm einen heftigen Schlag auf den Hinterkopf und steigerte das Tempo seiner Bewegungen. Bei jedem schmerzhaften Stoß schrammte Rafaels ungeschützter Bauch über die raue Kante der Mauer, bis er das Gefühl hatte, sein ganzer Körper stünde in Flammen. Schweiß lief ihm in die Augen. Ihm wurde schwindelig. Dunkelheit griff nach ihm. Rafael war es recht.
Ein Kampfschrei ertönte, begleitet vom Geräusch donnernder Hufe. Einer der Kriegsknechte stieß einen Warnruf aus und ließ hastig Rafaels Arm los. Seine Hand fuhr an den Griff seiner Waffe.
Tadeo grunzte, zog sich hastig zurück und riss sein Schwert aus der Scheide.
Ein dunkler Schatten glitt über die Gruppe hinweg. Der dritte Mann griff ebenfalls nach seiner Waffe und Rafael war plötzlich frei. Er wälzte sich von der Mauer und ließ sich in den Staub fallen, wo er keuchend nach Atem rang.
Wütende Schreie erfüllten die Luft. Rafael sah einen Mann in der grünen Kluft eines Jägers vom Pferd springen, das Schwert in der Hand. Das gut trainierte Tier trabte noch aus der Gefahrenzone, bevor es stehen blieb und seinem Herrn einen Blick zuwarf.
Benommen starrte Rafael den fremden Mann an. Wo kam dieser so plötzlich her? Und was noch viel wichtiger war – auf wessen Seite stand er?
Tadeo riss seine Waffe hoch, aber er war zu langsam. Der Jäger legte die linke Hand hinter der Rechten ans Heft und schwang die Klinge. Es war eine einzige fließende Bewegung – so schnell, dass Rafaels Blick ihr kaum zu folgen vermochte. Alles, was er sah, war ein Blitzen von Stahl. Im nächsten Moment flog der Kopf Tadeos mit einigem Schwung nach links und landete auf der Erde, wo er holpernd weiterrollte, bis er mit einem unangenehmen Plock an eine Hauswand stieß und liegen blieb. Rafael starrte entgeistert auf seinen kopflosen Peiniger, dessen Leib blutüberströmt im Staub lag – der Arm mit dem Schwert immer noch drohend erhoben.
Die beiden anderen Fußknechte erwachten mit einem Ruck aus ihrer Erstarrung, tauschten einen Blick und griffen den Jäger von zwei Seiten gleichzeitig an. Rafael reagierte, ohne zu denken. Er robbte vorwärts, umklammerte die Beine eines Knechtes und brachte ihn aus dem Gleichgewicht. Neben ihm wich der Jäger mit einem verzweifelten Satz der Waffe des dritten Angreifers aus und ließ gleichzeitig sein Schwert auf Rafaels Gegner niedersausen. Funken stoben, als die Klinge gegen die Metallbeschläge seines Lederharnischs prallte. Der Getroffene schrie auf, ließ seine Waffe fallen und ging in die Knie. Rafael sprang auf seinen Rücken und umklammerte mit dem rechten Arm seinen Hals, während seine Linke nach dem Dolch am Gürtel des Mannes tastete. Der Fremde konzentrierte sich ganz auf den dritten Fußknecht und durchbohrte ihn im gleichen Augenblick mit dem Schwert, in dem auch Rafael den Dolch in den Hals seines Gegners stieß. Er drehte die Klinge, schlitzte die Kehle auf und durchtrennte die Hauptschlagader. Der Mann starb auf den Knien.
Für einen langen Augenblick starrten sich der magere, mit Schrammen übersäte Junge und sein Retter über die Leichen der Männer hinweg an.
Rafael wusste nicht genau, was er von dem Mann halten sollte. Er trug die einfache Kleidung eines Jägers, aber sein Schwert war kostbar. Und er wusste besser damit umzugehen, als man es von einem einfachen Waidmann erwarten durfte.
Der Jäger stieß einen lauten Pfiff aus. Der Rappe trabte heran und sein Besitzer schwang sich in den Sattel. In diesem Moment entdeckte Rafael das Wappen. Erregung packte ihn. Sein Retter war der Herzog, den er töten sollte!
Los jetzt! Eine Woche lang anständiges Essen! So leicht kannst du es dir nie mehr verdienen!
Mit einem verzweifelten Satz schwang er sich hinter dem Reiter aufs Pferd und presste ihm die Klinge seines Dolches an die Kehle.
»Eine falsche Bewegung und du stirbst.«
Der Rappe tänzelte nervös, aber Rafael ließ sich davon nicht beirren. Der Herzog dagegen wirkte wie erstarrt. »Was willst du?«, fragte er gepresst.
Rafael zögerte. Eine berauschende Idee formte sich in seinem Kopf. Dieser Mann war mächtig genug, um seinem Herrn Furcht einzuflößen. Vielleicht konnte er ihm helfen, der Sklaverei zu entkommen.
»Freiheit«, sagte Rafael.
»Freiheit?«
»Ja. Wenn du mir hilfst, sie zu erlangen, werde ich dir treu dienen, solange du es verlangst.«
»Und wenn ich mich weigere?«
»Dann töte ich dich und stehle dein Pferd.«
»Meine Männer werden dich ergreifen und dich umbringen.«
Langsam schüttelte Rafael den Kopf. »Sie werden mich nicht fangen.«
Jetzt lachte der Mann kurz und trocken: »Junge, du weißt nicht, mit wem du dich anlegst.«
Im nächsten Moment schoss stechender Schmerz durch Rafaels Handgelenk. Sein Dolch flog in hohem Bogen davon und er landete unsanft auf dem Boden. Verblüfft starrte er Pferd und Reiter an. Er hätte schwören können, dass sich die Vorderhufe des Rappen eben noch in der Luft befunden hatten. Aber nun stand er da, ließ den Kopf hängen wie ein müder Karrengaul und sah aus, als könne ihn kein Wässerchen trüben.
Der Herzog musterte ihn unter zusammengezogenen Brauen und in seinem Blick lag eine Härte, die zuvor noch nicht da gewesen war.
»Steh auf«, befahl er.
Unsicher kam Rafael auf die Füße. Er begriff immer noch nicht so recht, wie es diesem Fremden gelungen war, ihn derart zu übertölpeln.
»Du bist dünn wie eine Weidenrute, Junge. Kommst du aus Parma?«
»Nein. Ich bin …« Rafael verstummte. Die Haut an seinem Hals war gerötet, wund gescheuert und blutig und verriet deutlicher als jedes Wort, dass er für gewöhnlich einen eisernen Sklavenring trug.
Der Reiter sah ihn wortlos an. Aber die Schärfe in seinem Blick war einem Schmerz gewichen, den Rafael nicht zu deuten wusste.
»Ich kann dir helfen, die Stadt zu verlassen«, sagte der Herzog. »Aber für deine Dienste habe ich keine Verwendung.«
Rafael kämpfte zähneknirschend gegen das Aufwallen hilfloser Wut an, das diese Worte in ihm auslösten. Aus der Stadt zu entkommen, war nicht genug. Harun würde ihn finden. Er fand ihn jedes Mal, wenn er floh und dann …
»Ich werde sein, was immer mein Herr wünscht.« Rafael brachte die Worte über seine steifen Lippen, selbst überrascht, wie leicht sie ihm fielen, wie einfach er die letzten Fetzen seines Stolzes abzuschütteln vermochte. »Ich werde tun, was immer mein Herr von mir verlangt.«
»Hast du keine Familie, zu der ich dich bringen könnte?«
Rafael schüttelte den Kopf, obwohl es gelogen war. Aber sein eigener Vater hatte ihn an Harun verkauft und er wollte nie mehr im Leben etwas mit dem Mann zu tun haben.
Der Herzog seufzte. »Du versuchst besser nicht noch einmal, mich umzubringen.«
»Nein.«
»Gut denn«, sagte der Reiter und streckte ihm die Hand entgegen. »Steig auf. Ich bringe dich erst einmal von hier fort. Vielleicht können sie am kaiserlichen Hof etwas mit dir anfangen.«
Rafael wagte kaum, zu atmen. Mit wild pochendem Herzen ergriff er die dargebotene Hand und ließ sich auf das Pferd heben. Freiheit, dachte er benommen. Der vage, flüchtige Traum dieses Wortes hatte ihn zu jeder Stunde seiner Gefangenschaft verfolgt. Jetzt hielt seine Zukunft auf einmal wieder Möglichkeiten und Aussichten bereit, die über den einfachen Wunsch hinausgingen, seinen nächsten Auftrag zu überleben. Die Erkenntnis traf ihn mit zu Kopfe steigender Macht.
Ja, dieses Mal würde er seine Freiheit finden. Und nicht einmal der Teufel persönlich sollte versuchen, ihn daran zu hindern.
Rodéna, Sizilien, drei Monate später
»Roana Isabella von Morra! Himmel, Herrgott! Was glaubst du eigentlich, was du da tust?«
Gandar von Rodéna starrte entgeistert seine knapp dreizehnjährige Nichte an, die ihn gerade mit der Rücksichtslosigkeit und Gewandtheit eines erfahrenen Straßenräubers entwaffnet hatte. »Das war gegen alle Regeln!«
»Oh«, machte Roana. »Immer, wenn du verlierst, berufst du dich auf irgendwelche unsinnigen Regeln, Mon Dom. Freut es dich nicht, dass ich inzwischen mit dem Dolch wirklich gut bin? Dass mir die Männer endlich den Respekt zollen, den sie mir schuldig sind?«
Gandar wischte sich mit dem Ärmel seiner gepolsterten Schutzkleidung den Schweiß von der Stirn. »So war das nicht gedacht, Bella.«
»Aber du hast doch selbst vorgeschlagen, mich zu trainieren, Oheim.«
»Ich weiß.«
»Und? Bereust du den Entschluss?«
»Ja und nein. Ich wollte, dass du in der Lage bist, dich zu verteidigen, für den Fall dass …«
»Sprich weiter«, sagte Roana. »Sprich es aus.«
»Lieber nicht.«
»– dass mich ein Mann wieder einmal mit einem Loch verwechselt, in das er brutal sein Ding reinstecken und so lang drin herumstoßen und herumwackeln darf, bis er endlich kommt und seinen ganzen Samen in mich hinein spritzt. Wolltest du das sagen?«
»Bella …«, setzte Gandar an und wusste plötzlich nicht mehr weiter. Er forschte in diesem feingeschnittenen, ansprechenden Gesicht. Es war ein hübsches, ein wirklich hübsches Gesicht – bis auf die Augen.
Diese zu hellen, wilden Augen, die immer, auch bei schwächstem Licht, zu glitzern schienen. Wie eine blank polierte Schwertklinge, dachte Gandar, oder schillerndes undurchsichtiges Wasser, an dessen glatter Oberfläche alles abprallt, und auf dessen Grund man nie sehen kann.
»Inzwischen bin ich in der Lage, mich zu verteidigen.«
»Verteidigen nennst du das?«, fragte Gandar aufgebracht. »Deine Reflexe sind völlig außer Kontrolle geraten!«
»Inwiefern?« Roana sah ihn abwartend an und ihre Augen waren kalt und still. Sie hatte eine Art, einen Menschen, ohne zu blinzeln, so unergründlich und ausdruckslos anzustarren, dass es Gandar plötzlich schwerfiel, ihr das zu sagen, was er zu sagen hatte.
»Die … Reaktion setzt nicht ein, solange du siehst, wer auf dich zukommt; wenn es den Überraschungseffekt nicht gibt. Aber du kannst nicht immer dafür sorgen, dass du mit dem Rücken zur Wand stehst, wenn du unter Menschen gehst. Ich wage kaum, mir auszumalen, was geschehen könnte, sollte jemand den Fehler machen, von hinten an dich heranzutreten.«
Roana sah ihn an. »Er würde es bereuen.«
Ich werde meine Augen nicht senken!, wütete Gandar im Stillen. Ich nicht! Auf keinen Fall!
Aber er tat es doch; und musste alle seine Willenskraft einsetzen, um Roana wieder ins Gesicht zu schauen. »Aber dann könnte es schon zu spät sein. Und es wäre genauso gut möglich, dass du es bist, Roana, die dabei umkommt.«
»Aber Mon Dom! Wie, um Christi willen, kommst du auf die Idee, dass mir das etwas ausmachen würde?«
Nexus (Verbindung, Verpflichtung)
Rodéna, Sizilien, Ende März 1254
Gandar von Rodéna legte die Schreibfeder beiseite und überflog noch einmal den Brief, den er gerade beendet hatte.
Worte wie Schwerter, dachte er bekümmert. Aber er wusste nicht, wie sich dass, was er seiner Nichte Roana mitzuteilen hatte, abmildern ließ.
Er ließ das Pergament auf seinem Schreibpult liegen, damit die Tinte trocknen konnte, und trat ans Fenster seines Schlafgemachs. Der Morgenhimmel war muschelgrau und wolkenlos. Zartes Rot verkündete bereits den Sonnenaufgang. In Kürze würde der bestellte Bote erscheinen, um die Nachricht abzuholen, die er in der Nacht bereits gesiegelt hatte und die für seinen Ziehsohn bestimmt war. Gandar lächelte wehmütig. Rafael würde ihn ganz sicher aus tiefstem Herzen verfluchen, sobald er den Brief in Händen hielt. Er hasste jede Art von Zwang.
Und der Brief enthielt eine Bitte, die an Erpressung grenzte. Auf eine Weise formuliert, die es Rafael unmöglich machte, sie abzulehnen.
Worte wie Schwerter, fürwahr.
Was seine Gedanken wieder zu Roana zurückbrachte. Er hatte versucht, ihr die Gründe für sein Handeln zu erklären. Aber diesen Brief hatte er zerrissen und im Kamin verbrannt, weil er zu sehr wie ein Abschiedsbrief geklungen hatte. Roana kannte ihn gut. Er konnte es sich nicht leisten, dass sie Verdacht schöpfte. Sie besaß die Eigenschaft, sich wie ein Bluthund in eine Sache zu verbeißen, sobald ihr Argwohn erst einmal geweckt war.
Er wollte nicht, dass irgendjemand ihn vermisste, wenn er für immer aus Rodéna fortging. Seine Beweggründe würde ohnehin niemand in vollem Maße begreifen können. Wie sollte er auch in Worte fassen, was er empfand?
Mit geschlossenen Augen lehnte er seinen Kopf an den steinernen Fensterbogen. Bald Gwen, dachte er. Bald bin ich bei dir und dann soll kein böses Schicksal uns jemals wieder auseinanderreißen.
Und wie so oft in all den einsamen Jahren die hinter ihm lagen, glaubte er, durch Zeit und Raum, ihre Stimme zu hören, die ihm zuflüsterte: Verlass mich nicht …
Sizilien, Ende Mai 1254
»Was soll das heißen, wir reiten nicht nach Rodéna?« Peire sah seinen Freund fassungslos an. »Der Herzog verlässt sich auf dich, Rafael!«
Das erste Wurfmesser sauste, ein Zweites, ein Drittes, federnd fuhren sie der Reihe nach in den Stamm einer Palme, ein Viertes landete links der Linie, das Fünfte prallte mit Funken am Eisengriff seines Vorgängers ab.
»Ich habe nicht vor, den Leibwächter für ein verwöhntes Edelfräulein zu spielen«, sagte Rafael und ging, seine Messer einzusammeln. In Augenblicken wie diesen bedauerte er, seinem Freund und Diener Peire jemals von der Bitte seines Ziehvaters erzählt zu haben.
Ich hätte Gandars Nachricht verbrennen sollen, dachte Rafael. Aber etwas hatte ihn davon abgehalten. Eine nagende kleine Stimme in seinem Hinterkopf, die ihm einflüsterte, dass an diesem Brief etwas nicht stimmte.
Normalerweise mischte sich der Herzog nicht in sein Leben ein. Schon gar nicht mit einem als Wunsch verkleideten Befehl, der jede Logik entbehrte. Warum also jetzt? Konnte er von dem Attentat erfahren haben, das man auf ihn, Rafael, verübt hatte?
Nur Peire und Nael, der Medicus, dem er sein Leben verdankte, wussten, wie knapp es für ihn gewesen war. Nael ritt zweimal die Woche zum Markt, um Vorräte einzukaufen. Falls er es versäumt hatte, den Mund zu halten …
Rafael weigerte sich, diesen Gedanken zu Ende zu denken. Er würde keine Einmischung in seine Pläne dulden. Nicht einmal vonseiten des Herzogs.
Unwillkürlich schlossen sich seine Finger um das Kreuz, das er an einer Lederschnur um den Hals trug. Das Schmuckstück hatte seinem Angreifer gehört. Rafael musste es ihm während ihres entsetzlichen Ringens in der Dunkelheit einer mondlosen Nacht abgerissen haben. Zumindest hatte er es in der Faust gehalten, als Peire ihn schwer verletzt und blutend gefunden hatte.
Es war ein Kreuz aus Silber, mit schimmernden Edelsteinen verziert. Auf der Rückseite war zu erkennen, dass der mittlere Teil mit dem Reliquienfach ausgebessert worden war. Und diese Tatsache war es, die ihm einfach keine Ruhe ließ. Denn er war sich sicher, dass er genau diese Art von Flickwerk schon einmal gesehen hatte. Rafaels Herzschlag beschleunigte sich.
Himmel, er ertrug es nicht, daran zu denken, wo das gewesen war. Aber er irrte sich nicht. Er konnte sich nicht irren. Er wusste, wem das Kreuz gehörte.
Er starrte Peire an, während er verzweifelt versuchte, gleichmäßig und ruhig zu atmen. Denn sonst würde er unter der grausamen Wucht der Erkenntnis zusammenzubrechen. Und das kam nicht infrage.
Er brauchte kein Mitleid. Schon gar nicht von Peire, dessen naiver Glaube an das Gute in ihm, ihn oft genug bis an den Rand seiner Beherrschung trieb. Nein, Peires Mitgefühl war das Letzte, was er jetzt ertragen konnte.
Es war einfacher – und sicherer – den Freund im Unklaren zu lassen, was die Herkunft des Kreuzes betraf. Denn dieses Kreuz war nicht irgendein Schmuckstück, sondern das Crux pectoralis seines leiblichen Vaters Lucca.
Luccas Absicht, ihn zu töten, war eindeutig gewesen. Und Rafael hatte nicht vor, dazusitzen und abzuwarten, bis ihm das gelang. Nein, diesmal würde er Rache nehmen an dem Mann, dem er jedes Übel verdankte, das ihn in seinem Leben befallen hatte.
»Schäm dich, Rafael«, sagte Peire. »Herzog Gandar bittet dich selten genug um etwas. Warum willst du seinen Wunsch nicht erfüllen?«
Rafael zog die Messer aus dem Stamm. »Weil es ein unsinniger Wunsch ist«, erwiderte er schroff. »Meine bloße Anwesenheit würde Madonna Roanas Ruf irreparabel schädigen. Ich weiß gar nicht, was sich Gandar dabei gedacht hat, mich darum zu bitten. Er kennt mich doch.«
»Eben deshalb hat er dich gebeten, du sturer Ochse.«
Peire hockte im Schatten eines verwilderten Myrtenhains, den Rücken an den Sockel einer zerbröckelnden antiken Statue gelehnt, und musterte ihn mit jenem störrischen Blick, den Rafael nur zu gut kannte. Der Sänger war keineswegs bereit, das Thema fallen zu lassen.
»Ich glaube, dein Ziehvater macht sich große Sorgen um dich und die Bitte ist seine Art, dir zu helfen«, bemerkte er.
»Helfen? Wobei?«
»Wünschst du dir nicht manchmal, das Leben, das du führst, hinter dir zu lassen?«
»Nein.«
»Lügner.«
Wie beiläufig ließ Rafael sein Wurfmesser von einer Hand in die andere gleiten. Dabei blickte er dem Sänger so gerade und eisig ins Gesicht, dass dieser unwillkürlich zurückzuckte.
»Schon gut«, rief Peire beschwichtigend. »Ich wollte dich nicht beleidigen. Das schwöre ich.«
Rafael verharrte vollkommen reglos. Seine Augen waren von einem silbrigen Grau und wurden von leicht geschwungenen, schwarzen Brauen eingerahmt, die ihm ein eher träges Aussehen verliehen. Aber niemand hielt Rafael von Rodéna für träge. Er galt als einer der gnadenlosesten und gefährlichsten Männer auf der Insel, ja, vielleicht sogar im gesamten Königreich beider Sizilien.
»So?«, fragte Rafael und seine Stimme war noch kälter als sein Blick.
Peire sprang wie von einer Tarantel gestochen auf und funkelte seinen Freund wütend an. »Himmel, Rafael, du hast gerade mit Mühe und Not einen Mordanschlag überlebt und du bist dickköpfig wie ein Maulesel! Diese Reise wäre die Gelegenheit, für eine Weile aus der Schusslinie zu kommen!«
»Es war nicht der erste Versuch, mich umzubringen«, gab Rafael trocken zurück.
»Oh nein, nur beinahe der Letzte. Du solltest dem Herrn auf Knien danken, dass er dir im rechten Augenblick einen so guten Medicus wie Nael geschickt hat … Ich hätte nichts gegen dein Fieber tun können.«
In der Nähe ihres Rastplatzes stampften die Pferde in einem provisorischen Pferch. Rafaels brauner Hengst schnaubte und schüttelte die Mähne, um die lästigen Fliegen zu vertreiben.
Eine leichte Brise trug von irgendwoher den süßen Duft blühender Orangen heran.
»Was den Attentäter angeht …«, fuhr Peire fort. »Das war keiner von diesen ehrgeizigen jungen Rittern, die versuchen, sich einen Namen zu machen, indem sie sich mit dir messen. Dieser Mann war auf Rache aus – oder aber …«
»Oder was?«
»… es war sein Auftrag, dich umzubringen. Manchmal frage ich mich, ob nicht längst ein Preis auf deinen Kopf ausgesetzt ist.«
Rafael zuckte mit den Schultern, ohne Peire anzusehen. Er kannte die Summen, die unter der Hand genant wurden und sie waren hoch genug, um selbst einen loyalen Freund wie Peire in Gewissensnöte zu bringen.
Er war Malik al Maut, der Engel des Todes. Ein gefürchteter und gleichzeitig verachteter Mann. Dass er seine schmutzigen Aufträge im Namen der Krone ausführte, hob sein Ansehen um keinen Deut.
»Sorge dafür, dass unsere Sachen gepackt werden«, sagte Rafael. »Ich möchte aufbrechen, sobald Meister Nael vom Markt zurück ist.«
Peire seufzte. »Und wohin reiten wir?«
»Wir werden sehen«, sagte Rafael.
Im Pferch hörte Rafaels Hengst auf zu grasen und spitzte die Ohren. Braune und schwarze Köpfe kamen hoch. Ohren spielten und Mähnen wurden geschüttelt. Der Braune wieherte.
Rafael sah über den Bach zum anderen Ufer hin. Jetzt hörte er auch das schwache Pochen von Hufschlag. Ein Mann in einer schwarzen Djellabah ritt über die Wiese auf ihr Lager zu.
Nael.
Im Lager angekommen, stieg der Medicus vom Pferd, führte seinen Rappen zu ihrem improvisierten Zelt im Palmenschatten und band ihn dort an.
Er zog eine versiegelte Hülle aus seiner Gürteltasche und streckte sie Rafael entgegen. »Dein Gewährsmann in Enna hat mir eine dringende Nachricht für dich mitgegeben«, sagte er.
Rafael streifte das Siegel mit einem kurzen Blick, durchbrach es dann und überflog die wenigen Zeilen. Als er aufschaute, war seine Miene ernst. »Von Ahmad«, erklärte er an Peire gewandt. »Er bittet mich, so schnell es geht, nach Triormani zu kommen.« Er ließ den Brief sinken. »Seltsam. Dieser Tage scheint jedermann meine Hilfe zu brauchen. Nun, jetzt hast du dein Ziel, Peire. Bereite alles zum Aufbruch vor.«
Mit gerunzelter Stirn sah Nael ihn an. »Du bist noch nicht vollständig genesen«, sagte er. »Als verantwortlicher Medicus dürfte ich dir gar nicht erlauben, schon aufzubrechen.«
»Mir geht es gut.«
»Das kommt dir nur so vor, Rafael. Du wirst einen Rückfall riskieren, wenn du dich zu sehr anstrengst. Aber damit will ich dann nichts zu tun haben.«
»Ich betrachte mich als gewarnt, Medicus«, sagte Rafael. Er versuchte zu lächeln, aber er spürte selbst, dass es bei einem Versuch blieb. Er empfand eine tiefe Verwirrung – und so etwas wie Zorn auf das Schicksal. Rafael kannte sich gut genug, um zu wissen, dass seine zur Schau gestellte Gleichgültigkeit nichts als Fassade war.
Selbst für seine Verhältnisse war es mehr als schäbig, Gandars Bitte abzuschlagen. Aber er hatte zwei Jahre damit verbracht, nach Lucca zu suchen, in der Hoffnung, durch ihn etwas über den Verbleib seiner Schwester Ravena zu erfahren. Ravena und er waren als Kinder gewaltsam getrennt und an Sklavenhändler verkauft worden. Damals war er zu jung gewesen, um etwas dagegen tun zu können.
Als freier Mann jedoch hatte er die Sklavenhändler gejagt, einen nach dem anderen. Dabei hatte er herausgefunden, dass er die ganze Zeit der falschen Spur gefolgt war, dass Lucca seine kleine Schwester nicht verkauft, sondern in seiner Obhut behalten hatte.
Als er seinen Fehler erkannt hatte, war das Töten bereits ein Teil seines Lebens geworden. Das Einzige, was er kannte. Es war, als habe er in dem Augenblick, in dem er den ersten Sklavenhändler getötet hatte, seine Seele endgültig verloren; das Bedürfnis Rache zu nehmen, war immer stärker, dunkler, drängender geworden.
Bei aller Beharrlichkeit war es ihm jedoch nie gelungen, seinen Vater aufzuspüren. Jetzt endlich hatte er zum ersten Mal eine Spur, der er folgen konnte.
Dass Ahmad ihn zu sich gerufen hatte, war nicht einmal schlecht. Er musste seine Ausrüstung ergänzen und neue Vorräte einkaufen. Dafür war Triormani genau der richtige Ort. Auf dem dortigen Markt bekam man alles, was man sich nur wünschen konnte – vorausgesetzt, man kannte die richtigen Händler.
Ja, dieses Mal würde er die Sache mit Lucca zu Ende bringen. Das war er seiner Schwester und sich selbst schuldig.
»Ich war noch nie in Triormani«, unterbrach Nael seine Gedanken. »Glaubst du, ein guter Medicus wäre dort willkommen?«
»Oh, ganz bestimmt«, erwiderte Rafael. »Es fragt sich nur, ob es dir gefallen würde. Ungefähr die Hälfte der Bewohner sind Schmuggler und Hehler, bei dem Rest weiß nur der Teufel, womit sie ihren Lebensunterhalt verdienen.«
Nael verzog das Gesicht. »Scheint ja ein nettes Fleckchen Erde zu sein.«
»In Ahmads Haus sind wir sicher. Sein Wort gilt etwas in Triormani. Niemand würde es wagen, ihn zu verärgern.«
Zweifelnd blickte der Medicus zu Rafael. »Ich hoffe, du weißt, was du tust. Für mich ist dieser Ort jedenfalls nichts. Ich denke, ich werde noch ein paar Tage im Landesinneren verbringen und mich dann zur Küste aufmachen. Taormina vielleicht ...
»Ich wollte, ich könnte dich überreden, in den Dienst des Herzogs zu treten«, sagte Rafael.
»Ich danke dir für das Angebot, aber ich bleibe lieber mein eigener Herr.«
»Wie du willst. Nun, bei allem war es gut, dass wir uns begegnet sind.«
Peire führte die gesattelten Pferde heran und Rafael bestieg seinen Braunen. Nach einem kurzen Gruß an Nael schlug er dem Hengst die Fersen in die Flanken und trabte davon.
Dubium (Zweifel)
Triormani, Sizilien, Anfang Juni 1254
Wut. Verzweiflung.
Roana wusste nicht, welches dieser beiden Gefühle stärker war und sie schließlich dazu bewogen hatte, wie eine Besessene nach Triormani zu galoppieren. Vielleicht war es die dümmste Idee, die sie je gehabt hatte. Vielleicht auch nicht. Aber es gab keine Alternative. Sie musste einfach wissen, warum ihr Oheim sie so plötzlich aus seinem Haus verbannte. Hatte sie etwas getan, um ihn zu erzürnen? Sie war sich keiner Schuld bewusst.
Roana ließ ihr Pferd in einem Mietstall zurück und ging zu Fuß die Hauptstraße entlang, vorbei an tief verschleierten Frauen und wild gestikulierenden Maultiertreibern.
Jetzt stand sie am Rand des lärmerfüllten Marktviertels, starrte in die engen Gassen hinein, in denen fast alles feilgeboten wurde, was es auf Erden gab, und spürte, wie die Übelkeit in Wellen aus ihrem Magen in ihre Kehle stieg.
Nur wenig Licht fiel zwischen die Häuser. Das Dämmerlicht zauberte Bewegungen, Schatten ins Nichts. Ihr Herz hämmerte. Um sie herum war Stimmengewirr. Es schwoll an und wurde wieder schwächer. Roana glaubte, Satzfetzen zu hören, die aus dem Halbdunkel zu ihr herüberwehten.
Lauf weg, Mädchen! O Gott. Lauf doch weg!
Ein Mundwinkel verzog sich zu einem grimmigen Lächeln. Sie wusste, dass sie die Worte nicht wirklich hörte, wusste, dass es sich nur um eine Einbildung handelte. Aber seit sie von Rodéna aufgebrochen war, saß dieses Angstgefühl in ihrem Magen und ließ sich nicht mehr vertreiben.
Ihre Hand tastete nach dem Dolch in ihrem Ärmel, führte die Bewegung aber nicht zu Ende. Sie würde die Waffe nicht brauchen – nicht brauchen dürfen, wenn sie keinen Aufruhr verursachen wollte.
Sie glitt in den Strom der Käufer und ließ sich tiefer in die Gassen hineintragen. Brennende Lampen glommen in den Gewölben der Händler wie die roten Augen hungriger Ratten. Berauschende Dämpfe stiegen aus Räuchergefäßen. Damaszenerklingen blitzten, Goldschmuck funkelte.
Dunkelhäutige Krieger in kurzem Lederharnisch und Männer in Djellabah und Turban fluteten in einem ständigen Strom an den Auslagen der Handwerker und Händler vorbei. An den Ecken hockten Schlangenbeschwörer und Geschichtenerzähler, deren Darbietungen ganze Trauben von Zuhörern angelockt hatten. Roana wich hastig bis an die Hauswände zurück, sorgsam darauf bedacht, dass keiner der Passanten ihr zu nahe kam. Sie konnte die Berührung von Männern nicht mehr ertragen. Seit man ihr das – angetan hatte.
Roana, die Ausgestoßene.
Es gab nur einen Mann, der sie in den Arm nehmen durfte, wenn der Schmerz zu übermächtig wurde, um ihn noch allein aushalten zu können.
Instinktiv glitt ihre Hand in den Almosenbeutel an ihrem Gürtel und tastete nach dem Pergament. Ein Blatt, von Knickstellen zerfurcht, mit verwischter Schrift, so oft hatte sie es hervorgeholt, entfaltet und gelesen. Gandars Nachricht.
Ein kurzer, unpersönlicher Brief, in dem sie aufgefordert wurde, ihre Truhen zu packen.
Wenigstens hätte Gandar es mir persönlich sagen können.
Aber das hatte er nicht getan. Was völlig untypisch für den Herzog war. Roana hatte gefühlt, dass etwas nicht stimmte. Sie war auf ein Pferd gesprungen und nach Rodéna, dem Stammsitz ihres Oheims galoppiert, um ihn zur Rede zu stellen. Aber niemand wusste, wo Herzog Gandar sich aufhielt.
Wut.
Verzweiflung.
Gandar war ein Mann von neunundzwanzig Jahren, sie eine Frau von achtzehn. Vor der Vergangenheit liefen sie beide davon. Aber gemeinsam war es erträglich.
Alleine nicht.
Deshalb musste sie Gandar finden. Egal, welche Konsequenzen sich daraus ergeben mochten. Sie wusste, was es bedeutete, ohne Begleitritter hierherzukommen. Trotz ihrer Männerkleidung war sie nur … eine Frau. Jämmerlich schwach. Freiwild.
Aber ihr war niemand anderes eingefallen, den sie fragen konnte. Gandars Freund Ahmad würde wissen, wohin der Herzog verschwunden war.
Sie schlüpfte in die schmale Gasse zwischen zwei Häusern, sah sich verstohlen um. Schummrige Lampen beleuchteten in offenen Gewölben untergebrachte Läden. Händlergehilfen huschten im Inneren umher und brachten Sitzkissen und geeiste Getränke für die Käufer, die schon in den Präliminarien des Handels waren. Niemand nahm von der schlanken Gestalt in Tunika und Bundhaube Notiz. Sie lief bis ans Ende der Gasse, blieb vor einer schlichten Holztür stehen und bewegte den bronzenen Türklopfer in einem bestimmten Rhythmus. Die Tür wurde augenblicklich geöffnet. Ein Diener in langem Kaftan ließ sie wortlos herein. Roana ging an ihm vorbei, den von Lampen erhellten Flur entlang. Mit einem leisen Luftzug wurde die Holztür zugezogen, gefolgt von einem harten metallischen Klicken.
Ahmads oberster Diener Ridwân kam auf sie zu, sorgfältig darauf bedacht, in ihrem Gesichtsfeld zu bleiben. Er empfing sie auf der Schwelle, berührte, sich tief verneigend, zum Gruß Stirn, Lippen und Brust und fragte nach ihren Wünschen.
Roana befahl, den Hausherrn Ahmad ibn Ascher Halewi von ihrer Ankunft zu unterrichten.
»Ich bedaure«, erwiderte der Diener. »Herr Ahmad befindet sich auf Reisen.«
Die Worte trafen Roana wie ein Peitschenhieb.
Wut.
Verzweiflung. Beide streckten die Hand nach ihr aus und drohten, sie zu übermannen. Es war ihr nicht in den Sinn gekommen, dass Ahmad nicht da sein könnte. Sie begann, Ridwân auszufragen, aber er wusste nicht, wohin sein Herr geritten war, noch, wann er zurückerwartet wurde.
»Ich möchte warten«, sagte Roana. »Vielleicht kommt Herr Ahmad bald zurück. Hast du Platz im Stall? Dann sorge bitte dafür, dass mein Pferd vom Mietstall hierher gebracht wird.«
»Wie du befiehlst, Herrin«, sagte der Diener. »Ich bringe dich in dein Gemach.«
In Ahmads Haus waren die Fußböden aus buntem Marmor, die Wände belegt mit edlen Hölzern, Metall und Gestein; Mosaiken zierten den Hof mit den Palmen und dem großen Brunnen; Inschriften in arabischen Buchstaben liefen als Fries um die Wände der Zimmer. Die Teppiche an den Mauern und am Boden waren dick und leuchtend bunt, Vorhänge verdeckten Nischen und Alkoven voller Polster und Kissen.
Der Diener öffnete eine Tür, ließ Roana eintreten und blieb wartend auf der Schwelle stehen, um ihre weiteren Wünsche entgegenzunehmen. Mit einer ungeduldigen Handbewegung schickte sie den Mann fort. Sie musste nachdenken. Wenn die Rechnung stimmte, die sie für sich angestellt hatte, dann war Gandar vor zwei Tagen aufgebrochen. Es musste nichts zu bedeuten haben, dass er bisher nicht nach Rodéna zurückgekehrt war. Er hatte auf der halben Insel Besitzungen und war vielleicht irgendwo aufgehalten worden … es gab tausend Wenn und Aber, die zwischen einem Plan und seiner Ausführung lagen.
Aber vielleicht war auch schon alles zu spät; das Unheil, das sie insgeheim befürchtete, längst eingetreten. Dabei war ihr eigenes Schicksal nicht der Grund für ihre Sorge. Was sie beschäftigte, war vielmehr das, was gerade in ihrem geliebten Oheim vorging. Hatte sie irgendein Zeichen übersehen? War er in den letzten Wochen anders gewesen als gewöhnlich? Verunsichert biss Roana sich auf die Unterlippe. Was hatte das alles zu bedeuten?
Der Wind trug das dünne Bimmeln einer Glocke heran, und Roana schrak abrupt aus ihren Gedanken. Mit einem Mal erinnerte sie sich eines Details, an das sie bisher nicht gedacht hatte. Im Brunnenhof gab es einen losen Stein in der Mauer, hinter dem Gandar oder Ahmad zum Spaß geheime Nachrichten für sie versteckt hatten. Vielleicht hatte Ahmad sich daran erinnert und dort einen Hinweis hinterlassen.
Sie verließ ihr Gemach und eilte in den Hof. Sie fand den Stein auf Anhieb. Er ließ sich so leicht entfernen wie früher, doch der Hohlraum dahinter war leer. Enttäuscht schob Roana den Stein wieder in die Öffnung zurück. Wie dumm von ihr, auf eine derart einfache Lösung zu hoffen!
Von irgendwoher drangen die Töne einer Laute an ihr Ohr. Roana lauschte. Jetzt erhob sich auch eine Stimme dazu, doch der Gesang war mehr ein Summen und Probieren als ein ausgeführtes Singen. Roana blieb mitten im Schritt stehen. Es war Gandars Lied … aber nicht seine Stimme.
Die Musik kam aus dem ummauerten Garten, der sich ans südliche Ende des Brunnenhofes anschloss. Roana eilte über die farbenprächtigen Mosaike zum anderen Ende des Hofes, stieß das eiserne Gartentor auf und betrat den Garten. Die Sonne stand schräg über den Palmen und malte ein lebhaftes Muster auf den Marmor der Wege. Roana sah sich um, ohne jedoch eine Spur von dem unbekannten Sänger zu entdecken. Mit ärgerlichen Bewegungen zog sie sich die Haube vom Kopf und schüttelte ihr blondes Haar aus. Noch einmal ließ sie ihren Blick durch den Garten wandern, ohne etwas Auffälliges zu bemerken.
Mit einem leisen Seufzer sank sie auf eine der zahlreichen Ruhebänke und barg das Gesicht in den Händen. Wahrscheinlich machte sie sich ganz unnötig Sorgen. Gandar war kein Mann, der sich aus seiner Verantwortung davonstahl. Sicher war er inzwischen längst wieder zu Hause in Rodéna und verfluchte sie für ihr eigenmächtiges Handeln. Aber der Gedanke nutzte gar nichts. Plötzlich hatte sie das Bedürfnis, zu schreien. Tief in ihr setzte ein Zittern ein. Der Atem stockte ihr in der Kehle.
Einatmen. Ausatmen. Und wieder ein.
Es war nicht wie damals, als Gandar schon einmal verschwunden war. Es gab keinen Kardinal Valo mehr, der sie beide zu einem Leben in der Hölle verdammen konnte. Sie richtete sich auf, zwang sich zu tiefen, beruhigenden Atemzügen. Die Erinnerung an das durchlebte Entsetzen, an ihre Hilflosigkeit, drohte sie zu überfluten wie eine riesige Woge. Das durfte nicht geschehen. Ahmads Garten war zu öffentlich, um sich gehen zu lassen.
So sehr war sie in diesem Moment gefangen – so tief in der Vergangenheit versunken, dass sie den Mann nicht bemerkte, der lautlos wie ein Schatten hinter ihr auftauchte.
Peire hatte darauf bestanden, in Ahmads Haus eine Ruhepause einzulegen, wo es genügend bequeme Gästekammern gab, die sie benutzen konnten. Rafael hielt es jedoch nie lange in seiner Kammer aus und verbrachte seine Zeit lieber im parkähnlichen Garten des Hauses. An den Stamm einer Palme gelehnt, studierte er zum wiederholten Male Gandars Brief.
»Hast du herausgefunden, was dich an dem Brief stört?«, fragte Peire mit mäßigem Interesse. Er saß im Schatten der Palme und hatte auf seiner Laute gespielt, aber nun ließ er die Seiten verstummen.
»Weiß der Teufel«, murmelte Rafael abwesend. »Was hier steht, klingt völlig normal. Und doch werde ich das verdammte Gefühl nicht los, etwas zu übersehen.«
»Zeig mal her.« Peire streckte die Hand aus.
Rafael löste sich von der Palme, rieb sich den schmerzenden Rücken und brachte dem Sänger die Nachricht. Peire beugte den Kopf darüber und bewegte lautlos die Lippen, während er langsam buchstabierte.
Rafael lief währenddessen ungeduldig auf und ab. Er brannte darauf, die Verfolgung seines Vaters aufzunehmen, bevor sich dessen vage Spur wieder verlor. Aber der Ritt nach Triormani hatte ihn mehr angestrengt, als er wahrhaben wollte. Er hasste es, einsehen zu müssen, wie recht Nael mit seiner Einschätzung gehabt hatte. Er war noch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte und seine Ungeduld vermochte daran nichts zu ändern.
»Also ich finde an diesem Brief nichts Ungewöhnliches«, sagte Peire und gab das Schreiben zurück.
Rafael schüttelte den Kopf. »Es passt nicht zu Gandar, so etwas von mir zu verlangen. Er hat Ritter genug, die besser geeignet sind, eine Dame von Stand zu eskortieren. Ich bin eher ein Mann fürs Grobe …«
»Tja.« Peire überlegte einen Moment. »Vielleicht bevorzugt die Dame ja einen groben Klotz wie dich«, spöttelte er. »Ist sie hübsch?«
»Was weiß ich«, gab Rafael achselzuckend zurück. »Ich bin ihr nie begegnet.«
Wenn man von dem einen, beinahe flüchtigen Blick absah, den er vor Jahren auf die junge Roana hatte werfen können – einem Kind, das Angst vor dem eigenen Schatten gehabt hatte und fast nie von Gandars Seite gewichen war. Mühsam forschte er in seinem Gedächtnis nach einer Erinnerung an die Gesichtszüge des Mädchens. Die Farbe ihrer Haare hatte ihn an ein reifes Weizenfeld erinnert, das wusste er noch. Ihr Gesicht dagegen hatte eher einer Ansammlung von Knochen geglichen, mit Augen, die fast so farblos und kalt waren, wie Millionen Jahre altes Gletschereis.
Peire seufzte ungeduldig. »Wozu streiten wir eigentlich? Ich weiß, dass du Herzog Gandars Wunsch nicht erfüllen wirst. Es ist dir peinlich, einer Edeldame erklären zu müssen, warum du auf vielen Burgen nicht willkommen bist. Dir graut davor, dass sie erfahren könnte, woher dein schlechter Ruf rührt. Lieber stößt du deinen Ziehvater vor den Kopf …«
»Schön«, unterbrach Rafael brüsk. »Wenigstens hast du jetzt begriffen, warum ich Gandars Bitte nicht erfüllen kann.«
Er wandte sich ab, ehe sein Gesicht seine widersprüchlichen Gefühle preisgeben konnte. »Und nun kein Wort mehr zu diesem Thema. Verstanden? Ich werde nicht länger …« Er brach ab, ging bis zur Gartenmauer und spähte mit verengten Augen um die Ecke.
»Ridwân?«, fragte Peire.
»Nein. Ein Unbekannter. Im vorderen Garten. Warte hier auf mich, bis ich herausgefunden habe, wer das ist.«
Rafael schlich davon, tief in den Palmenschatten geduckt, näherte er sich dem unbekannten Jüngling, der neben einer Bank stand und sich anscheinend im Garten umsah. Die erste Überraschung erlebte er, als der vermeintliche Jüngling die Bundhaube vom Kopf zog, und sich eine Flut goldener Locken über seinen – ihren Rücken ergoss. Rafael starrte die junge Frau an. Etwas an ihrem Profil kam ihm vertraut vor, ohne dass er sagen konnte, woher. Sie musste zu dem kleinen Kreis von Personen gehören, die Ahmads geheimes Klopfzeichen kannten. Niemand kam an Ridwân vorbei, der nicht Bescheid wusste. Wer war sie?
Rafael trat lautlos näher. Und erlebte seine zweite Überraschung.
Roana spürte die Kühle in ihrem Nacken, wo eben noch Wärme gewesen war. Sie dachte nicht mehr. Etwas, das stärker war als ihr bewusstes Denken, übernahm die Kontrolle über ihren Körper; Reflexe, die sie so lange geschärft und trainiert hatte, bis sie zu eigenständigem Leben erwacht waren, lenkten ihre Bewegungen. Der Dolch glitt in ihre Hand, noch während sie von ihrem Sitz hochfuhr und herumwirbelte. Der Schrei aus ihrer Kehle mischte sich mit dem überraschten Ausruf eines Mannes. Eine Hand schoss auf sie zu, versuchte, den Dolch wegzuschlagen.
Roana fühlte, wie die scharfe Klinge abrutschte, durch ein Gewand drang und dann in das weiche Fleisch darunter schnitt.
Der Mann wich hastig zurück und verlor das Gleichgewicht. Er prallte mit dem Rücken gegen den Stamm einer Palme und stürzte zu Boden. Ein dunkler Fleck erschien auf dem Ärmel seiner Tunika und breitete sich rasch aus.
Roana dagegen verharrte absolut reglos, zu Stein geworden wie Lots Weib. Unbewaffnet schrie es in ihrem Inneren, in ihrem Kopf, ja sogar in ihrem vor Schrecken wild schlagenden Herzen. Unbewaffnet, unbewaffnet, unbewaffnet.
Langsam, ganz langsam hob sie ihre Hände, Handflächen nach oben und starrte auf ihren Dolch.
»Oh!«, flüsterte sie. »Oh mein Gott!«
Dann befiel sie ein Zittern. Sie schwankte wie eine Weide im Wind. Ihre Augen weiteten sich. Sie hatte beinahe einen Mann getötet, der gar nicht vorgehabt hatte, sie anzugreifen, und den sie nicht einmal kannte.
Sie warf ihren Dolch von sich und sank neben dem Mann in die Knie. Eine bebende Stimme murmelte unverständliche Worte, ihre eigene stellte sie fest, obwohl sie selbst nicht verstehen konnte, was sie sagte. Er sah zu ihr auf und die mörderische Wut in seinen silbergrauen Augen ließ sie zurückzucken.
»Du Wahnsinnige, was hast du getan!«, kreischte jemand.
Roana, die damit beschäftigt war, den Saum ihrer Tunika in Streifen zu reißen, hob überrascht den Kopf. Bevor sie sich auch nur bewegen konnte, war der zweite Mann an ihrer Seite. Breitbeinig stellte er sich über den Verletzten. »Rühr ihn nicht an!«
»Siehst du nicht, dass ich ihn verbinden will?«, fauchte sie zurück.
Der Mann packte zu. Roana wehrte sich wie eine Besessene. Wehrte sich so lange und heftig, dass der Fremde endlich die Hand zur Faust ballte und sie ihr gegen die Schläfe schlug. Sie brach zusammen und blieb liegen.
Als Peire sich ihm zuwandte, saß Rafael aufrecht im Gras, die unverletzte Schulter an den Stamm der Palme gelehnt. Vorsichtig betastete er mit der rechten Hand seinen linken Oberarm und starrte ungläubig auf das Blut, das seine Finger besudelte.
Peire sagte: »Oh Gott!«, und ließ sich neben dem Freund auf die Knie fallen. Mir aschfahlem Gesicht zog er ihm die Tunika über die Schulter herunter.
»So viel Blut«, jammerte der Sänger. »Ich glaube, mir wird gleich schlecht!«
Rafael rollte mit den Augen. Ohne Peires Protest zu beachten, schlüpfte er vollends aus dem zerrissenen Gewand und versuchte, zu erkennen, wo genau ihn der Dolch eigentlich getroffen hatte. Arm und Schulter brannten, als habe jemand glühende Kohlen darauf gepackt.
»Stillhalten!«, befahl Peire. Mit fahrigen Bewegungen riss er ein Stück aus Rafaels Gewand, ballte es zusammen und presste es auf die Wunde, um die Blutung zu stillen.
»Du hast verdammtes Glück gehabt«, beantwortete er Rafaels unausgesprochene Frage. »Diese Verrückte hat nichts Lebenswichtiges getroffen. Obwohl sie es bestimmt vorgehabt hat. Nicht auszudenken, wenn sie geschafft hätte, was … ach verdammt.«
»Diese Verrückte – ist Madonna Roana«, sagte Rafael.
Der Sänger hob überrascht den Kopf.
»Ich glaube es zumindest.«
»Gott bewahre.« Peire warf den blutigen Gewandfetzen beiseite und presste einen frischen Stoffknäuel auf die Wunde.
Rafael hörte kaum, dass Peire ihm erklärte, die Wunde müsse dringend genäht werden. Der Himmel helfe ihm – eine Frau, deren Instinkte so schnell reagierten wie seine? So etwas konnte es doch nicht geben – oder? Es war ein Fehler gewesen, sich an sie heranzuschleichen, das wusste er nur zu gut. Bei allen Heiligen, seit wann war er so fahrlässig geworden?
»Hilf mir auf, Peire«, verlangte er.
»Das werde ich nicht tun«, widersprach Peire entschlossen und verknotete sorgfältig die Enden des provisorischen Verbandes, den er aus Rafaels Tunika angefertigt hatte.
Rafaels Rechte umklammerte Peires Arm so fest, dass dieser noch tagelang blaue Flecken hatte. Aber er kam auf die Beine, machte einen unsicheren Schritt und dann einen Zweiten.
Das war der Moment in dem Roana ein großes, eisblaues Auge aufschlug und um sich sah. Dann öffnete sie beide Augen und kam mit einem Aufschrei auf die Füße.
Rafael hatte das Gefühl, als habe sich das Universum gedreht und ihn an einem anderen Platz zurückgelassen als dem, an dem er sich noch einen Augenblick zuvor befunden hatte. Er stand reglos da und betrachtete ihr Gesicht, das jetzt keine Ansammlung von Knochen mehr war, sondern ein sanftes Oval. Es war ein hübsches, ein wirklich hübsches Gesicht – bis auf die Augen. Basiliskenaugen, schoss es ihm durch den Kopf. Ein Gorgonenhaupt. Das Antlitz der Medusa – oder?
Seine seltsamen Gefühle irritierten ihn. Er war sich nicht sicher, ob er wirklich etwas für sie empfinden wollte. Konnte er sich Gefühle überhaupt leisten? Vielleicht nicht, aber alles war besser als die Gleichgültigkeit der vergangenen Jahre, die Dunkelheit, die begonnen hatte, ihn vollkommen auszufüllen.
Rafael deutet eine nachlässige Verbeugung an. »Du hast schon eine interessante Art, Bekanntschaften zu schließen, Madonna. Machst du das immer so?«
Roana starrte Rafael mehrere Herzschläge lang schweigend an. Rafael versuchte vergeblich, zu erraten, was hinter ihrer Stirn vorging. Ihr Blick konnte ebenso gut Zorn wie Schuldbewusstsein ausdrücken.
»Du bist Roana von Morra, nicht wahr?«
»Das geht dich nichts an, Herr«, erwiderte sie missfällig.
Er lächelte. Die Wirkung war seltsam anzusehen. Roana wich zurück, fahl und zitternd. Sie sah sich hektisch um, so als versuchte sie, abzuschätzen, ob sie es bis zum Eingang des Gartens schaffen konnte, bevor er sich auf sie stürzte.
Rafael machte einen Schritt auf sie zu und stolperte beinahe über die eigenen Füße. Peire sprang ihm zur Seite und packte seinen Arm. »Von mir aus kannst du ja hier auf der Stelle verbluten, du verdammter Dickschädel«, schimpfte er. »Aber ich fände es doch sehr bedauerlich, dabei auch noch Ahmads kostbaren Marmor zu verderben. Also hilf mir gefälligst, dein Gemach zu erreichen, bevor das passiert.«
»Die Wunde muss genäht werden«, bemerkte Roana sachlich. »Da es in Triormani keinen Medicus gibt, erkläre ich mich bereit, das zu übernehmen.«
Rafael sah Roana an. »Du erklärst dich bereit?«, fragte er höhnisch. »Wie überaus großzügig von dir, Madonna. Wobei ich doch stark bezweifle, ob du weißt, wie man mit einer Nähnadel umgeht.«
Roanas Fäuste ballten sich so heftig, dass die Knöchel hörbar knackten. »Es tut mir leid«, murmelte sie. »Aber ich mag es nicht, wenn sich jemand von hinten an mich heranschleicht.«
Als Rafael in ihr Gesicht sah, erlosch alles in ihm schlagartig; er fühlte noch immer Zorn, einen brodelnden hilflosen Zorn, über die Störung seiner Pläne. Aber er wusste auch, dass er ungerecht war. Er hatte sich ihr tatsächlich von hinten genähert und sie zu Tode erschreckt. Das konnte er sehen, auch wenn sie sich die größte Mühe gab, es nicht merken zu lassen.
»Ich hatte keinerlei böse Absichten«, sagte er.
»Oh ja, ich weiß. Das haben Männer, die sich von hinten anschleichen ja nie.«
Rafael hob den Kopf und musterte sie. Sein Blick wanderte einmal von oben nach unten und dann von unten nach oben, blieb bei ihren Augen hängen. »Du hast Glück, Madonna, dass du Ahmads Gast bist und das Gastrecht in seinem Haus etwas gilt, sonst müsste ich dich jetzt übers Knie legen, um meine Ehre zu retten.«
»Oh«, spöttelte Roana. »Danke. Deine Zurückhaltung freut mich.«
»Und deine Unterstellung verletzt mich«, gab Rafael zurück.
»Hört auf, zu streiten«, verlangte Peire. »Du hast gar keine andere Wahl, als deine Wunde von Madonna Roana versorgen zu lassen. Du weißt, dass ich soviel Blut nicht ertragen kann.«
Rafael drehte sich mit einer abrupten Bewegung um und wandte sich dem Haus zu.
Roanas Miene verdüsterte sich. »Gut«, sagte sie mit einem resignierenden Seufzen. »Anscheinend willst du meine Hilfe nicht.« Sie bückte sich nach ihrem Dolch, wischte ihn im Gras sauber und ließ ihn wieder in ihrem Ärmel verschwinden. Die Haube stopfte sie nachlässig hinter ihren Gürtel.
Es geschah in diesem Moment, dass Rafael das bisher so zäh festgehaltene Bewusstsein entglitt. Peire konnte ihn gerade noch auffangen, bevor er auf den Boden aufschlug.
»Schaff ihn in sein Gemach«, befahl Roana mit einem Blick auf den Bewusstlosen. Während Peire vorauseilte, rief sie einen Diener und bestellte in fließendem Arabisch Wasser, Verbandszeug und Ahmads Medizinkasten.
In Rafaels Kammer war es dunkel und stickig. Roana trat zum Fenster und stieß den Fensterladen auf, auch wenn die hereinschlagende Glut ihr augenblicklich den Schweiß aus allen Poren trieb.
»Nun beweg dich!«, fuhr sie Peire an. »Wir haben genug Zeit verloren.«
Behutsam ließ Peire den Freund auf einen Diwan gleiten.
»Du kannst mir beim Säubern der Wunde zur Hand gehen«, sagte Roana, während sie die Ärmel ihrer Tunika bis zum Ellenbogen hoch rollte.
»Äh … ich muss noch einmal hinaus in den Garten«, murmelte Peire. »Ich habe meine Laute dort vergessen. Es ist nicht gut, wenn sie zu lange in der Sonne …«
Roana brachte ihn mit einem missbilligenden Blick zum Verstummen. »Männer«, sagte sie verächtlich. »Große Reden führen, aber dahinter ist nichts als Luft.«
»Ich kann nun mal kein Blut sehen«, murmelte Peire noch, bevor er sich mit einem erstickten Laut die Hand vor den Mund schlug und aus dem Gemach flüchtete.
Coniuratio (Verschwörung)
Dienerinnen brachten Wein, Tücher und mehrere Schüsseln mit dampfendem Wasser. Roana wusch sich sorgfältig die Hände und trocknete sie ab.
An dieser Stelle folgte bei Ahmad immer ein kurzes Gebet zu Allah um Hilfe, aber Roana vermochte sich weder auf die lateinischen noch auf die arabischen Worte zu konzentrieren. Ihr war schlecht vor Aufregung. Gandars Freund hatte sie wohl in der Behandlung von Wunden unterrichtet, aber noch nie war sie dabei ganz auf sich allein gestellt gewesen.
Ein weiterer Diener brachte Verbandszeug, Ahmads Medizinkasten und einen Eimer für Abfälle und stellte alles neben ihr ab. Nachdem sie den Diener noch angewiesen hatte, ein Kissen unter Rafaels Rücken zu schieben, damit die Wunde höher zu liegen kam, schickte sie ihn aus dem Gemach.
Aber dann war es mit ihrer selbstsicheren Haltung erst einmal vorbei. Am liebsten hätte sie sich in eine dunkle Ecke verkrochen und den Kampf gegen ihre Tränen einfach aufgegeben.
In was für eine Lage hatte sie sich da nur wieder gebracht? Hatte Oheim Gandar sie nicht genau davor gewarnt?
Sie hatte über seine ständigen Predigten gelacht, aber nun zeigte sich, wie recht er gehabt hatte. Ihr war ein schrecklicher Fehler unterlaufen und es geschah ihr nur recht, wenn sie die Buße dafür auf sich nehmen musste.
Sie beugte sich über den Verletzten und schnitt ihm den blutgetränkten Verband vom Körper. Unter ihren vorsichtigen Berührungen zuckte er zusammen, öffnete zögernd die Augen und wollte sich abrupt aufsetzen.
»Nicht!« Sie streckte die Hand aus, um ihn daran zu hindern, zog sie jedoch hastig wieder zurück, bevor sie mit seinem Körper in Berührung kam, und wandte sich von ihm ab. Er sank auf das Kissen zurück und blieb ruhig liegen. Aber sie konnte spüren, dass er sie beobachtete. Sie warf den blutigen Stoff in den Eimer und bückte sich nach der Kiste mit den säuberlich gerollten Scharpiebäuschen. Mit zitternden Fingern begann sie, die Wunde zu reinigen. Sie ging dabei nicht eben sanft vor und binnen Kurzem standen Schweißperlen auf Rafaels Stirn.
Aber ihr war alles recht, was ihr helfen konnte, die schreckliche Unsicherheit zu vertuschen, die sie in seiner Gegenwart empfand. Für gewöhnlich reichte schon der Anblick einer nackten Männerbrust, um einen heftigen Widerwillen in ihr hervorzurufen. Aber hier …
Verstohlen ließ sie ihren Blick über seinen athletischen Körper wandern. Bei ihm empfand sie – nichts. Zumindest nicht die Art von Übelkeit, die ihr die Vorstellung, einen Mann berühren zu müssen, immer verursachte. Vielmehr spürte sie eine gewisse Erregung. Ein sanftes Flattern in der Magengrube. So wie damals, als Gandar ihr die Götterstatuen im Tempel von Segeste gezeigt hatte. Sie hatte ihre Finger über den kalten, glatten Marmor gleiten lassen und …
Himmel, was für Gedanken habe ich da, schoss es ihr durch den Kopf. Das hier ist nun wirklich kein Standbild aus Marmor. Dieser Mann ist lebendig – ein Raubtier, das nur darauf wartet, in einem Moment der Schwäche über dich herzufallen …
Sie warf die besudelten Bäusche in den Eimer, wandte sich Ahmads Medizinkasten zu und suchte eine Weile darin herum. Schließlich nahm sie eine kleine Amphore heraus, zog den Stöpsel aus der Öffnung und ließ violett glänzende Kristalle auf ihre Hand rollen.