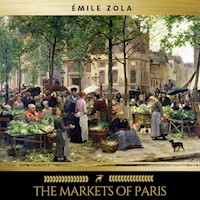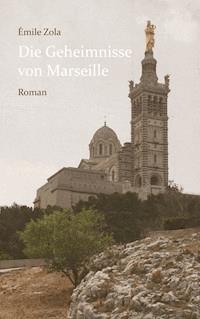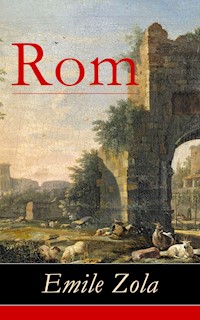
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dieses eBook: "Rom" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Émile Zola (1840-1902) war ein französischer Schriftsteller und Journalist. Zola gilt als einer der großen französischen Romanciers des 19. Jahrhunderts und als Leitfigur und Begründer der gesamteuropäischen literarischen Strömung des Naturalismus. Zugleich war er ein sehr aktiver Journalist, der sich auf einer gemäßigt linken Position am politischen Leben beteiligte. Zola engagierte sich immer für soziale, künstlerische oder literarische Ziele, die ihm gerecht erschienen, und blieb dabei Beobachter der Personen und Ereignisse seinerzeit. Das erzählerische Werk Zolas ist, ähnlich wie das der Goncourts, eine Fundgrube für Sozialhistoriker. Allerdings sind die vom Autor geschilderten Verhältnisse eher die der 70er/80er Jahre, d. h. die der Entstehungszeit der Romane, und weniger die der 50er/60er, in denen die Handlungen spielen. Aus dem Buch: "Am nächsten Morgen, um drei Viertel auf zehn begab sich Pierre in den ersten Stock des Palastes, um zur Audienz beim Kardinal Boccanera zu erscheinen. Er war wieder voll Mut, voll der naiven Begeisterung seines Glaubens - und von seiner seltsamen gestrigen Niedergeschlagenheit, den Zweifeln und dem Mißtrauen, das ihn bei der ersten Berührung mit Rom, nach der Ermüdung der Reise ergriffen hatte, war nichts zurückgeblieben. Es war so schon, der Himmel so rein, daß sein Herz wieder hoffnungsvoll klopfte."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1196
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rom
Übersetzer: Adele Berger
Inhaltsverzeichnis
Rom, Band 1
Inhaltsverzeichnis
Inhalt
I.
Inhaltsverzeichnis
Während der Nacht hatte der Zug zwischen Pisa und Civita-Vecchia große Verspätung gehabt, und es ging bereits auf neun Uhr morgens, als der Abbé Pierre Froment nach einer anstrengenden, fünfundzwanzigstündigen Reise endlich in Rom anlangte. Er hatte nur einen Handkoffer bei sich. Rasch sprang er aus dem Coupé, mitten in das Gedränge der Ankommenden hinein, wies, da er gern allein sein und Umschau halten wollte, die dienstfertigen Träger ab und belud sich selbst mit seinem leichten Gepäck. Gleich darauf stieg er vor dem Bahnhof, auf dem Platz der Fünfhundert, in einen der längs des Trottoirs stehenden offenen Wagen und legte den Handkoffer neben sich, nachdem er dem Kutscher die Adresse zugerufen hatte:
»Via Giulia, Palazzo Boccanera.«
Es war am dritten September, an einem Montag, und der Himmel war klar, von einer bewunderungswürdigen Durchsichtigkeit und Milde. Der Kutscher, ein kleiner, rundlicher Mann mit glänzenden Augen und weißen Zähnen, lächelte, als er am Accent einen französischen Priester erkannte. Er peitschte sein mageres Pferd, und der Wagen fuhr in dem raschen Trab der reinlichen und freundlichen römischen Fiaker dahin. Aber fast gleich darauf, nachdem sie an dem Grün des kleinen Squares vorbeigefahren und auf dem Thermenplatz angelangt waren, drehte sich der Kutscher noch immer lächelnd um und deutete mit der Peitsche auf die Ruinen.
»Die Thermen des Diokletian,« sagte er in schlechtem Französisch. Er gehörte zu den artigen Kutschern, die den Fremden gefallen wollen, um sich ihre Kundschaft zu sichern.
Der Wagen fuhr in raschem Trab den steilen Abhang der Via Nationale hinab, die sich von der Höhe des Viminal, wo sich der Bahnhof befindet, herabzieht. Von nun an hörte er nicht mehr auf, bei jedem Monument den Kopf zu drehen und mit derselben Geberde darauf hinzuweisen. An diesem Ende der breiten, neuen Straße befanden sich nur Neubauten; aber seine Peitsche beschrieb einen weiteren Kreis, und seine Stimme hob sich, wenn auch etwas ironisch, als er den Namen eines ungeheuren, noch frischen und feuchten Baues auf der linken Seite nannte. Es war eine wahre Riesenpastete aus Steinen, überladen mit Skulpturen, Giebeln und Statuen.
»Die Nationalbank.«
Pierre hatte, seit seine Reise vor einer Woche beschlossen worden war, den ganzen Tag damit zugebracht, die Topographie Roms aus Plänen und Büchern zu studiren. Er hätte sich daher zu orientiren vermocht, ohne zu fragen, und die Erklärungen des Kutschers fanden ihn vorbereitet. Was ihn jedoch störte, das waren die plötzlichen Abhänge, die fortwährenden Steigungen, die gewisse Stadtviertel in Terrassen teilten. Nun kam auf der rechten Seite grünes Laubwerk, auf dessen Höhe sich ein endloses, gelbes und kahles Gebäude, ein Kloster oder eine Kaserne, hinzog.
»Der Quirinal, der Palast des Königs,« sagte der Kutscher.
Weiter unten, als der Wagen auf einen dreieckigen Platz einbog, bemerkte Pierre, den Blick hebend, zu seinem Entzücken einen von einer hohen, glatten Mauer getragenen hängenden Garten, aus dem das elegante und kräftige Profil einer hundertjährigen Pinie in den klaren Himmel aufstieg. Er empfand den ganzen Stolz und die ganze Anmut Roms.
»Die Villa Aldobrandini.«
Darauf kam, noch weiter unten, eine flüchtige Vision, die ihn vollends begeisterte. Die Straße beschrieb von neuem einen jähen Bug, als sich plötzlich im Winkel, am dunklen Ende eines Gäßchens, eine leuchtende Oeffnung zeigte. Der Platz sah von oben gesehen ganz weiß aus, wie ein Sonnenschacht, gefüllt mit blendendem Goldstaub. Und in dieser Morgenpracht erhob sich eine riesige Marmorsäule, die auf der Seite, wo das Gestirn sie bei seinem täglichen Aufsteigen seit Jahrhunderten bestrahlte, wie vergoldet war. Er war überrascht, als der Kutscher ihm ihren Namen nannte; denn er hatte sich nicht vorgestellt, daß sie in einer so leuchtenden Bucht, inmitten von solchen Schatten stehe.
»Die Trajanssäule.«
Am Fuß des Abhangs beschrieb die Via Nazionale eine letzte Krümmung. Der Kutscher nannte während der raschen Fahrt immer wieder neue Namen: den Palazzo Colonna, dessen Garten von mageren Cypressen begrenzt wird, den Palazzo Torlonia, den man behufs neuer Verschönerungen halb niedergerissen hatte, den Palazzo di Venezia mit seinen Mauerzinnen, seiner tragischen Strenge, kahl und schrecklich, wie eine mittelalterliche Festung aussehend, die da in dem bürgerlichen Leben von heut vergessen wurde. Die Ueberraschung Pierres wuchs, denn er hatte etwas ganz anderes erwartet. Besonders aber ward er betroffen, als der Kutscher mit seiner Peitsche ihm triumphirend den Corso zeigte. Das war eine lange, schmale Straße, kaum so breit wie die Rue Saint-Honoré; die linke Seite lag im hellen Sonnenlicht, die rechte im schwarzen Schatten, und am Ende bildete die Piazza del Popolo etwas wie einen leuchtenden Stern. Das also war das Herz der Stadt, die berühmte Promenade, die Hauptader, der alles Blut von Rom zuströmte?
Der Wagen fuhr bereits auf dem Corso Victor Emanuel, der die Fortsetzung der Via Nazionale bildet. Das sind die zwei Oeffnungen, die von einem Ende der alten Stadt zum andern, vom Bahnhof bis zur Engelsbrücke, geschnitten wurden. Links sah der runde Chor der Kirche Il Gesù in der Morgensonne ganz hellgelb aus. Dann, zwischen der Kirche und dem schwerfälligen Palazzo Altieri, den man nicht niederzureißen gewagt hatte, verengerte sich die Straße, und sie gerieten in einen feuchten, eisigen Schatten. Aber jenseits, auf dem Platze vor der Fassade der Kirche Il Gesù, schien wieder blendend und goldig die Sonne, während in der Ferne, im Hintergrunde der Via d’Aracoeli, die gleichfalls in Schatten getaucht war, die sonnenbeglänzten Palmen erschienen.
»Da drüben ist das Kapitol,« sagte der Kutscher.
Der Priester beugte sich lebhaft zum Wagen hinaus, aber er sah nichts als einen grünen Fleck am Ende eines finstern Ganges. Dieser plötzliche Wechsel von warmem Licht und kalten Schatten machte ihn frösteln. Vor dem Palazzo di Venezia, vor der Kirche Il Gesù war es ihm, als laste die ganze Nacht vergangener Tage eisig auf seinen Schultern, dann aber, auf jedem neuen Platz, bei jeder Erweiterung der neuen Straßen meinte er wieder ins Licht, in die heitere, milde Wärme des Lebens zurückzukehren. Die Strahlen der gelben Sonne fielen längs der Fassaden herab und durchschnitten scharf die bläulichen Schatten. Zwischen den Dächern waren Streifen des tiefblauen, ganz klaren Himmels sichtbar, und die Luft, die er einatmete, schien ihm einen besonderen, noch unbestimmten Geschmack zu haben, einen Fruchtgeschmack, der sein Reisefieber noch steigerte.
Der Corso Victor Emanuel ist trotz seiner Unregelmäßigkeit eine sehr schöne, moderne Straße, und Pierre konnte sich in irgend eine andere große Stadt mit riesigen Mietskasernen versetzt denken. Als er jedoch bei der Cancellaria, dem Meisterwerk Bramantes, dem typischen Monument der römischen Renaissance, vorbei kam, wurde sein Erstaunen abermals wach, und er kehrte im Geist wieder zu den bereits gesehenen Palästen zurück, zu dieser kahlen, schwerfälligen und kolossalen Architektur, diesen ungeheuren Steinwürfeln, die Hospitälern oder Gefängnissen glichen. Nie hatte er sich die berühmten römischen Paläste so ohne alle Grazie und Phantasie, so ohne jede äußerliche Pracht vorgestellt. Das alles war entschieden sehr schön, und zuletzt würde er es gewiß verstehen, aber es gehörte längeres Nachdenken dazu.
Plötzlich verließ der Wagen den belebten Korso Victor Emanuel und drang in gewundene Gassen ein, in denen er nur mühsam vorwärts gelangte. Nach der hellen Sonne und dem belebten Treiben der neuen Stadt kam die Ruhe, die Einsamkeit, die schlafende und kalte alte Stadt. Er erinnerte sich an die Pläne, die er studirt hatte, und sagte sich, daß er sich jetzt der Via Giulia nähere; aber seine fortwährend zunehmende Neugierde wurde nun so groß, daß er beinahe darunter litt. Er war ganz verzweifelt, weil er nicht gleich mehr sehen, mehr erfahren konnte. Sein Erstaunen, daß alles so ganz anders war, als er erwartet hatte, die Erschütterungen, die seine Einbildungskraft erlitt, steigerten noch den fieberhaften Zustand, in dem er sich seit seiner Abreise befand, und ließen in ihm den heftigen Wunsch entstehen, seine Neugierde unverzüglich zu befriedigen. Es war noch kaum neun Uhr, er hatte also den ganzen Vormittag vor sich, um sich im Palazzo Boccanera vorzustellen – warum sollte er sich nicht sofort an den klassischen Ort, auf die Höhe führen lassen, von wo man das gesamte, auf den sieben Hügeln lagernde Rom überblickte? Als dieser Gedanke einmal von ihm Besitz ergriffen hatte, beunruhigte er ihn so, daß er ihm zuletzt nachgeben mußte.
Der Kutscher drehte sich nicht mehr um; Pierre erhob sich daher, um ihm die neue Adresse zuzurufen.
»Nach S. Pietro in Montorio.«
Der Mann war anfangs erstaunt und schien ihn nicht zu verstehen. Er deutete mit der Peitsche an, daß das sehr weit, ganz dort drüben sei. Als jedoch der Priester auf seinem Wunsch bestand, fing er wieder gefällig zu lächeln an und schüttelte freundschaftlich den Kopf. Schön, schön, er hatte ja nichts dagegen!
Und das Pferd trabte inmitten des Labyrinthes der engen Straßen noch rascher dahin. Nun kam eine, die von hohen Mauern ganz erdrückt wurde und wo das Tageslicht wie auf dem Grund eines Grabens schien. Dann, am Ende dieser Straße, wurde es plötzlich wieder hell, und der Wagen fuhr auf der alten Brücke Sixtus’ IV. über den Tiber. Rechts und links zogen sich die neuen Quais mit all der Verheerung demolirter und dem frischen Gipsbewurf neuerstandener Häuser hin. Auch in Trastevere, auf der andern Seite, war viel niedergerissen, und der Wagen fuhr den Janiculus auf einer breiten Straße hinan, die, wie große Tafeln verkündeten, den Namen Garibaldi trug. Der Kutscher machte zum letztenmal seine gutmütig stolze Geberde, als er den Namen dieser Triumphstraße nannte.
»Via Garibaldi.«
Das Pferd mußte nun langsamer gehen. Pierre, von einer kindlichen Ungeduld ergriffen, wandte sich, um die sich hinter ihm ausbreitende und sich immer mehr enthüllende Stadt zu betrachten. Der Aufstieg dauerte lange, immer wieder tauchten andere Stadtteile auf, bis zu den fernen Hügeln reichend. Dann auf einmal fand er in der wachsenden Aufregung, die sein Herz klopfen machte, daß er sich die Erfüllung seines Wunsches verderbe, indem er ihn durch diese langsame, teilweise Eroberung des Horizontes zerstückelte. Und er hatte, trotz seines heftigen Verlangens, die Kraft, sich nicht mehr umzudrehen.
Oben befindet sich eine riesige Terrasse. Dort steht die Kirche von S. Pietro in Montorio, auf der Stelle, wo, wie es heißt, der heilige Petrus gekreuzigt wurde. Der Platz ist kahl und von der heißen Sommersonne rot gebrannt, während etwas weiter hinten das klare, rauschende Wasser der Acqua Paola sprudelnd in ewiger Frische aus den drei Becken des Monumentalbrunnens strömt. Längs der Brüstung, die die senkrecht auf Trastevere herabschauende Terrasse begrenzt, ziehen sich immer ganze Reihen von Touristen hin, dünne Engländer, breitschulterige Deutsche, die in traditioneller Bewunderung gaffen und den Reiseführer in der Hand halten, den sie zu Rate ziehen, um die Monumente zu erkennen.
Pierre sprang leicht aus dem Wagen, ließ seinen Handkoffer auf dem Sitz liegen und machte dem Kutscher ein Zeichen, daß er warten möge; dieser reihte sich neben den anderen Fiakern auf und blieb in philosophischer Ruhe auf seinem Platz sitzen, mitten in der Sonne, den Kopf gesenkt wie sein Pferd, das sich gleich ihm im voraus in das lange, gewohnte Warten ergab.
Pierre aber stand schon in seiner engen, schwarzen Sutane, die bloßen, fieberheißen Hände nervös zusammenpressend, neben dem Geländer und schaute, schaute von ganzer Seele. Rom, Rom! Die Stadt der Cäsaren, die Stadt der Päpste, die Ewige Stadt, die zweimal die Welt eroberte, die prädestinirte Stadt des feurigen Traumes, den er seit Monaten träumte! Endlich war sie da, endlich sah er sie! Die Stürme der vorhergehenden Tage hatten die große Augusthitze vertrieben. Dieser wunderbare Septembermorgen blaute frisch von einem fleckenlosen, unendlichen Himmel hernieder. Es war ein Rom voller Lieblichkeit, ein Traum-Rom, das sich bei der klaren Morgensonne zu verflüchtigen schien. Ein feiner, bläulicher Nebel, aber kaum sichtbar, zart wie Gaze, schwebte über den Dächern der niedriger gelegenen Stadtteile, während die ungeheure Campagna, die fernen Berge, sich in einem blassen Rosa verloren. Anfangs konnte er nichts unterscheiden, wollte auch keine Einzelheiten festhalten, sondern gab sich dem gesamten Rom hin, dem lebenden Koloß, der da vor ihm lag, auf diesem von dem Staub von Generationen gebildeten Boden. Jedes Jahrhundert hatte wie durch die Kraft einer unsterblichen Jugend seinen Ruhm erneuert. Was ihn aber bei diesem ersten Erblicken am meisten packte, was sein Herz noch stärker klopfen machte, das war, daß er Rom so fand, wie er es ersehnt hatte: morgenfrisch und verjüngt, leicht und heiter, fast unkörperlich und in dieser reinen Dämmerung eines schönen Tages hoffnungsvoll einem neuen Leben entgegenlächelnd.
Und da durchlebte Pierre, unbeweglich vor dem erhabenen Horizont stehend, die brennenden Hände noch immer fest zusammengepreßt, in wenigen Minuten die drei letzten Jahre seines Lebens. Ach, wie schrecklich war das erste Jahr gewesen, das er in seinem kleinen Hause in Neuilly verlebte! Thüren und Fenster waren immer verschlossen, er hatte sich eingegraben wie ein wundes Tier, das im Todeskampfe liegt. Mit erstorbener Seele, mit blutendem Herzen war er von Lourdes zurückgekehrt; nichts war in ihm übrig geblieben als Asche. Schweigen und Nacht hatten sich über die Ruinen seiner Liebe und seines Glaubens herabgesenkt. Tag auf Tag verstrich, ohne daß er den Pulsschlag seiner Adern hörte, ohne daß sich ein Licht erhob, um das Dunkel seiner Verlassenheit zu erhellen. Er lebte maschinenmäßig dahin und wartete auf die Wiederkehr seines Mutes, um das Leben im Namen der erhabenen Vernunft, der zu liebe er alles geopfert, wieder aufzunehmen. Warum war er nicht widerstandsfähiger und kräftiger, warum paßte er nicht sein Leben ruhig seinen neuen Ueberzeugungen an? Warum gab er sich, da er, einer einzigen Liebe treu und vom Meineid angeekelt, den priesterlichen Stand nicht verlassen wollte, nicht einer Wissenschaft hin, die Priestern gestattet ist, der Astronomie oder der Archäologie. Aber etwas regte sich in ihm, zweifellos das Blut seiner Mutter – eine ungeheure, rasende Zärtlichkeit, die noch niemals gestillt worden war, die verzweifelt war, weil sie niemals Befriedigung finden konnte. Das war der beständige Schmerz seiner Einsamkeit, die offene Wunde in seiner Seele, trotz der hohen Selbstachtung, die seine wieder eroberte Vernunft ihm schenkte.
Da, an einem Herbstabend, während eines traurigen Regens, führte ihn der Zufall mit einem alten Priester, dem Abbé Rosé, Vikar an der Kirche Sainte-Marguerite in der Vorstadt Saint-Antoine, zusammen. Er suchte ihn in seiner Wohnung in der Rue de Charonne auf; es war ein finsteres, aus drei Zimmern bestehendes Erdgeschoß, das er in ein Asyl für verlassene kleine Kinder, die er in den benachbarten Straßen auflas, verwandelt hatte. Von diesem Augenblick an änderte sich Pierres Leben; ein neues, mächtiges Interesse hatte ihn ergriffen, und er wurde allmälich der leidenschaftlich-eifrige Gehilfe des alten Priesters. Der Weg von Neuilly bis in die Rue de Charonne war weit. Anfangs ging er bloß zweimal wöchentlich hin, dann alle Tage, gleich am frühen Morgen, und kehrte erst spät abends in seine Wohnung zurück. Da die drei Zimmer nicht mehr genügten, mietete er den ganzen ersten Stock, behielt ein Zimmer für sich und blieb dann oft über Nacht dort. Alle seine kleinen Renten gingen für diese armen Kinder auf; der alte Priester, entzückt und von dem Opfermut dieses vom Himmel gefallenen jungen Helfers bis zu Thränen gerührt, umarmte ihn weinend und nannte ihn ein Kind Gottes.
Nun lernte Pierre das Elend, das schändliche und abscheuliche Elend kennen. Zwei Jahre lebte er an seiner Seite mit ihm zusammen. Er fing mit den kleinen Wesen an, die er selbst auf dem Pflaster auflas oder mitleidige Nachbarn ihm zuführten; denn jetzt war das Asyl im ganzen Stadtteil bekannt. Es waren kleine Jungen und Mädchen, die allerkleinsten, die auf die Straße gerieten, während die Eltern arbeiteten, tranken oder im Sterben lagen. Oft war der Vater verschwunden, die Mutter gab sich preis, Trunkenheit und Ausschweifung waren zugleich mit der Arbeitseinstellung in die Wohnung eingekehrt. Dann blieb die junge Brut dem Elend überlassen; die Kleinsten starben auf dem Pflaster vor Hunger und Kälte, die anderen flogen davon, dem Laster und dem Verbrechen entgegen. Eines Abends zog Pierre in der Rue de Charonne unter den Rädern eines Lastwagens zwei kleine Knaben hervor; es waren zwei Brüder, die ihm nicht einmal eine Adresse anzugeben vermochten, nicht wußten, woher sie kamen. Ein andermal brachte er ein kleines Mädchen heim, ein blondes, kaum dreijähriges Engelchen, das er auf einer Bank gefunden hatte; es sagte weinend, daß die Mama es dort allein gelassen habe. Später wandte er sich von diesen mageren, kläglichen, aus dem Neste gestoßenen Vögeln notgedrungen auch den Eltern zu, drang von der Straße in die dunklen Kammern, versenkte sich immer tiefer in diese Hölle und lernte zuletzt ihr ganzes Grauen kennen. Sein Herz blutete vor Angst, vor Entsetzen, im trauervollen Bewußtsein, daß seine Hilfe vergeblich sei.
Ach, was für furchtbare Wanderungen machte er während dieser zwei Jahre, die sein ganzes Wesen erschütterten, durch die jammervolle Behausung des Elends, den grundlosen Abgrund menschlichen Verfalles und menschlicher Leiden! In diesem Viertel Sainte-Marguerite, mitten im Herzen der thätigen und arbeitsamen Vorstadt Saint-Antoine, entdeckte er schmutzige Häuser, ganze Gassen von luftlosen, lichtlosen, kellerartigen Gelassen, wo eine ganze Bevölkerung von Unglücklichen faulte und mit dem Tode rang. Auf der wackeligen Treppe glitt der Fuß auf dem aufgehäuften Kehricht aus. In jedem Stockwerk wiederholte sich dieselbe Armut, zum Schmutz, zur niedrigsten Gemeinschaftlichkeit herabgesunken. Ueberall fehlten die Fenster, der Wind fegte durchs Zimmer, der Regen strömte hinein. Viele schliefen auf dem nackten Fußboden, ohne sich jemals auszukleiden. Keine Möbel, keine Wäsche! Das lebte wie die Tiere, suchte Befriedigung und Trost, wie es konnte, wie der Zufall und der Instinkt es mit sich brachten. Alle Geschlechter, alle Lebensalter waren da zusammengedrängt, die Menschlichkeit kehrte durch den Mangel am Notdürftigsten, durch eine solche Armut, daß man sich die von den Tischen der Reichen heruntergefegten Krumen mit den Zähnen streitig machte, zum Tierischen zurück. Ja, das Schlimmste dabei war diese Erniedrigung der menschlichen Natur; es war nicht mehr der freie Wilde, der, nackt durch den Urwald streichend, die Beute jagt und verzehrt, sondern der zivilisirte, wieder zum Tier gewordene Mensch, mit allen Fehlern seines Falles befleckt, entstellt, geschwächt. Rings um ihn her aber herrscht der Luxus und das Raffinement einer Stadt, die die Königin der Welt ist.
In jeder Wohnung fand Pierre dieselbe Geschichte wieder. Anfangs war Jugend und Frohsinn vorhanden, und das Gesetz der Arbeit ward mutig anerkannt. Dann kam die Erschöpfung. Wozu immer arbeiten, da man ja doch nie reich wird? Der Mann fing an zu trinken, um auch sein Teil am Glück zu haben; die Frau vernachlässigte die Sorge um den Haushalt, trank manchmal ebenfalls und ließ die Kinder wild aufwachsen. Die jammervolle Umgebung, die Unwissenheit und das Zusammengepferchtsein thaten das übrige. Häufiger noch war der Arbeitsmangel an allem schuld gewesen. Er begnügt sich nicht bloß damit, alle Ersparnisse zu verzehren, er erschöpft auch den Mut, gewöhnt an die Trägheit. Während die Werkstätten wochenlang feiern, werden die Arme schlaff. In dem so fieberhaft thätigen Paris ist auch nicht die kleinste Beschäftigung zu finden. Weinend kehrt der Mann abends heim; er hat überall seine Arme angeboten, und es ist ihm nicht einmal gelungen, als Straßenkehrer anzukommen, denn diese Beschäftigung ist viel begehrt. Man bedarf dazu der Protektion. Ist das nicht ungeheuerlich? In dieser großen Stadt, auf deren Pflaster Millionen funkeln und klingeln, sucht ein Mensch Arbeit, um zu essen, und findet keine und hat nichts zu essen. Die Frau hat nichts zu essen, die Kinder haben nichts zu essen. Dann kommt die schwarze Not, die Stumpfheit, zuletzt die Empörung; alle sozialen Bande zerreißen unter der furchtbaren Ungerechtigkeit gegen arme Wesen, die ihre Schwäche zum Tod verurteilte. Aus was für ein Jammerlager, in was für einem Verschlag wird der alte Arbeiter niedersinken, um zu sterben, nachdem fünfzig Jahre harter Arbeit seine Knochen abgenützt haben, ohne daß er einen Sou beiseite legen konnte? Oder sollte man ihn an dem Tage, wo er, da er nichts mehr arbeitet, auch nichts mehr zu essen hat, mit einer Axt erschlagen wie ein abgenütztes Lasttier? Beinahe alle sterben im Hospital. Andere verschwinden, ohne daß jemand sich um sie bekümmert; die schlammige Flut der Straße trägt sie fort. Eines Morgens fand Pierre in einer schändlichen Baracke auf verfaultem Stroh einen, der verhungert war; er lag seit einer Woche vergessen da, und die Ratten hatten ihm das Gesicht zerfressen.
Aber eines Abends im letzten Winter strömte sein Erbarmen vollends über. Im Winter, in diesen ungeheizten Löchern, wo der Schnee durch die Ritzen eindringt, werden die Leiden der Unglücklichen noch furchtbarer. Die Seine ist zugefroren, der Boden mit Eis bedeckt, alle möglichen Industriezweige müssen ruhen. In den Quartieren der Lumpensammler, die notgedrungen feiern, gehen ganze Banden von Burschen bloßfüßig, nur notdürftig bekleidet, hungernd und hustend davon. Eine plötzliche rapide Schwindsucht rafft sie hin. Er fand ganze Familien, Frauen mit fünf und sechs Kindern, die, an einander geschmiegt, zusammen kauerten, um sich warm zu halten, und seit drei Tagen nichts gegessen hatten. Und dann kam jener schreckliche Abend, da er als erster in das am Ende eines finstern Ganges gelegene Schreckensgemach drang, in dem sich soeben eine Mutter samt ihren fünf kleinen Kindern aus Hunger und Verzweiflung getötet hatte. Dieses Drama ließ ganz Paris wahrend einiger Stunden erschauern. Kein Möbel mehr im Zimmer, kein Stück Wäsche, alles, Stück für Stück hatte bei dem nächsten Trödler verkauft werden müssen. Nur das Kohlenfeuer rauchte noch. Auf einem halbleeren Strohsack war die Mutter niedergesunken, sie hatte bis zuletzt ihr Jüngstgeborenes, einen drei Monate alten Säugling, genährt, und ein Blutstropfen perlte noch auf der Brust, der sich die Lippen des kleinen Toten gierig entgegenstreckten. Auch die beiden kleinen Mädchen, drei und fünf Jahre alt, zwei hübsche Blondköpfe, schlummerten dort, Seite an Seite, den ewigen Schlaf. Von den beiden etwas älteren Knaben war der eine, den Kopf in die Hände gedrückt, neben der Wand kauernd zu Grunde gegangen, während der andere auf dem Fußboden ausgerungen hatte, als wenn er sich auf den Knieen hatte zum Fenster schleppen wollen, um es zu öffnen. Die herbeigeeilten Nachbarn erzählten die alltägliche, die schreckliche Geschichte: ein langsamer Ruin, der Vater fand keine Arbeit, verfiel vielleicht dem Trunk; der Hausbesitzer wollte nicht mehr warten, drohte mit Exmission; da verlor die Mutter den Kopf, beschloß zu sterben und bestimmte auch ihre Brut, mit ihr zu sterben, während ihr Mann sich seit dem frühen Morgen vergebens die Füße auf dem Pflaster wund lief, um Arbeit zu finden. Als der Polizeikommissär kam, um Erhebungen anzustellen, kehrte auch der Unglückliche heim. Und als er gesehen, als er alles begriffen hatte, da schlug er zu Boden wie ein mit der Keule geschlagener Stier. Er fing an zu heulen und ein so unaufhörliches Wehklagen, solche Todesschreie drangen aus seinem Munde, daß die ganze Gasse, von Entsetzen ergriffen, mitweinte.
Dieser furchtbare Aufschrei einer zum Tode verurteilten Rasse, die in Not und Hunger untergeht, klang immer wieder in Pierres Ohren, in seinem Herzen wider, er nahm ihn überall mit sich mit. An jenem Abend konnte er weder essen noch einschlafen. War es möglich, daß ein solcher Greuel, eine so vollständige Armut, ein so schwarzes, nur mit dem Tode endigendes Elend mitten in dem vor Reichtum strotzenden, genußtrunkenen Paris, das für Vergnügungen Millionen auf die Straße streute, vorkommen konnte? Wie, auf der einen Seite so ungeheure Vermögen, so viele unnütze, befriedigte Launen, so viele mit Glücksgütern überschüttete Existenzen – und auf der andern Seite eine so wütende Armut, daß es sogar am bloßen Brot mangelte und alle Hoffnung geschwunden war, so daß die Mütter samt ihren Säuglingen sich töten mußten, da sie ihnen nichts mehr zu geben hatten als das Blut ihrer versiegten Brüste! Eine wilde Empörung stieg in ihm auf. Einen Augenblick kam es ihm zum Bewußtsein, wie nutzlos und trügerisch die Wohlthätigkeit war. Wozu thun, was er that, wozu die Kleinen von der Straße auflesen, den Eltern Hilfe bringen, die Leiden der alten Leute verlängern? Das soziale Gebäude war in seinen Grundfesten verfault, alles mußte in Kot und Blut zusammenbrechen. Nur ein einziger, großer Akt der Gerechtigkeit konnte die alte Welt hinwegfegen, um dann die neue wieder aufzubauen. In dieser Minute erkannte er den ewigen Bruch, die unheilbare Krankheit, den todbringenden Krebs so deutlich, daß er die Anwendung und Gewaltmaßregeln begriff. Ja, er selbst war bereit, anzuerkennen, daß ein vernichtender und reinigender Orkan kommen, die Erde durch Eisen und Feuer regenerirt werden müsse wie einst, da der schreckliche Gott den Brand vom Himmel herabsandte, um die verfluchten Städte wieder neu gesunden zu lassen.
Als der Abbé Rose ihn an jenem Abend schluchzen hörte, kam er zu ihm ins Zimmer und schalt ihn väterlich aus. Dieser Mann war ein Heiliger, von unendlicher Sanftmut und Hoffnungsfreudigkeit. Wie, verzweifeln, da doch das Evangelium existirt! Genügt die göttliche Grundregel »Liebet einander« nicht zur Rettung der Welt? Ihm graute vor Gewaltthaten. Wie groß das Uebel auch sei, sagte er, man würde ihm rasch ein Ende machen, sobald man umkehren, zu der Zeit der Demut, Einfachheit und Reinheit zurückkehren wollte, die bestand, da die Christen als unschuldige Brüder mit einander lebten. Welch köstliches Bild entwarf er von dieser evangelischen Gesellschaft, deren Wiederkehr er mit so ruhiger Heiterkeit schilderte, als müsse sie sich schon am nächsten Tage verwirklichen. Pierre mußte zuletzt lächeln. In dem Bedürfnis, dem furchtbaren Alpdruck dieses Tages zu entgehen, fand er an diesem schönen, tröstlichen Märchen Gefallen. Sie sprachen bis spät in die Nacht darüber und setzten auch an den folgenden Tagen dieses Thema fort, das dem alten Priester so lieb war. Er breitete sich fortwährend über neue Einzelheiten aus und sprach von der nahen Herrschaft der Liebe und Gerechtigkeit mit der rührenden Ueberzeugung eines guten Menschen, der weiß, daß er nicht sterben wird, ohne Gott noch auf Erden gesehen zu haben.
Und da fand in Pierre eine neue Umwälzung statt. Die Ausübung der Wohlthätigkeit in diesem armen Stadtteil hatte ihn unendlich weich gestimmt; sein Herz ward durch den Anblick dieses Elends, an dessen Heilung er verzweifelte, schwach, erschüttert, zerrissen. Durch dieses Wiedererwachen seiner Empfindsamkeit wurde seine Vernunft manchmal in den Hintergrund gedrängt; er kehrte zu der Kindheit zurück, zu jenem Bedürfnis nach alles umfassender Zärtlichkeit, das seine Mutter ihm ins Herz gepflanzt. Er träumte von chimärischen Linderungen, erwartete Hilfe von unbekannten Mächten. Seine Furcht, sein Abscheu vor der Brutalität der Thatsachen steigerte noch seinen Wunsch nach einer Rettung durch die Liebe. Es war hohe Zeit, die unvermeidliche, furchtbare Katastrophe, den Bruderkrieg der Klassen, zu beschwören, der die alte Welt wegraffen würde, die dazu bestimmt war, unter der angehäuften Last ihrer Verbrechen zu verschwinden. Fest überzeugt, daß die Ungerechtigkeit ihren Gipfel erreicht habe, daß bald die rächende Stunde schlagen werde, da die Armen die Reichen zur Teilung zwingen wurden, gefiel er sich fortan in dem Traum von einer friedlichen Lösung, vom Bruderkuß, den alle Menschen mit einander tauschen würden, von der Rückkehr zu der reinen Moral des Evangeliums, so wie Jesus es predigte. Anfangs quälten ihn Zweifel. War diese Verjüngung des antiken Katholizismus möglich, würde man ihn zur Jugend, zur Reinheit des ursprünglichen Christentums zurückfuhren können? Er begann Studien zu machen, zu lesen, Erkundigungen einzuziehen und erhitzte sich immer mehr und mehr für diese große Frage des katholischen Sozialismus, die seit einigen Jahren so vielen Lärm machte. In seinem erschauernden Mitleid mit den Unglücklichen und da er auf das Wunder der Brüderlichkeit vorbereitet war, verloren sich nach und nach die Zweifel seiner Intelligenz, bildete er sich ein, daß Christus ein zweitesmal kommen müsse, um die leidende Menschheit loszukaufen. Zuletzt formulirte sich das alles in seinem Geiste zu der festen Gewißheit, daß der Katholizismus, der geläuterte, auf seinen Ursprung zurückgeführte Katholizismus der einzige Pakt, die letzte Macht sein könne, welche die gegenwärtige Gesellschaft retten würde, indem sie die drohende, blutige Krise beschwor. Als er vor zwei Jahren Lourdes voll Empörung über jene niedrige Abgötterei verlassen hatte, als sein Glaube für immer erloschen, aber sein Herz doch von der ewigen Sehnsucht nach dem Göttlichen, das alle Kreaturen quält, beunruhigt war, da hatte sich aus seiner tiefsten Seele ein Schrei losgerungen: »Eine neue Religion! Eine neue Religion!« Und heute glaubte er diese neue Religion, besser gesagt, diese erneute Religion gefunden zu haben. Ihr Ziel war die soziale Rettung; zum Glücke der Menschheit sollte sie die einzige, noch aufrecht stehende moralische Autorität, die weitgreifende Organisation des wunderbarsten Werkzeuges verwenden, das jemals zum Regieren der Völker geschmiedet ward.
Während Pierre diese langsame Entwicklungsperiode durchmachte, gewannen außer dem Abbé Rose noch zwei Männer großen Einfluß auf ihn. Ein gutes Werk hatte ihn mit Monseigneur Bergerot, einem Bischof, bekannt gemacht, den der Papst zum Lohn für ein ganzes Leben bewunderungswürdiger Wohlthätigkeit eben zum Kardinal erhoben hatte, trotzdem seine Umgebung sich heimlich widersetzte; denn sie witterte in dem französischen Prälaten, der seine Diözese wie ein Vater regierte, einen Freigeist. Durch den Verkehr mit diesem Apostel, diesem Seelenhirten, ward Pierre noch mehr entflammt; das war einer jener einfachen und guten Führer, wie er sie der künftigen Gemeinde wünschte. Aber als er in den Versammlungen der katholischen Arbeiter dem Vicomte Philibert de la Choue begegnete, war dies für sein Apostelamt noch entscheidender. Der Vicomte war ein schöner Mann mit militärischen Manieren und einem langen, edlen Gesicht, das aber durch eine zerdrückte und zu kleine Nase entstellt war, was den schließlichen Echec einer schlecht gefestigten Natur anzudeuten schien. Er war einer der thätigsten Agitatoren des französischen katholischen Sozialismus und besaß große Güter, ein großes Vermögen. Freilich ging das Gerücht, daß er sich durch mißlungene landwirtschaftliche Unternehmungen bereits um beinahe die Hälfte desselben gebracht habe. In seinem Departement hatte er Musterwirtschaften eingerichtet, auf denen er seine Ideen bezüglich des christlichen Sozialismus in Anwendung brachte. Aber der Erfolg schien ihn auch dort nicht zu ermutigen. Es hatte ihm jedoch zu einem Abgeordnetenmandat verholfen. Er sprach oft in der Kammer und setzte das Programm seiner Partei in langen, tönenden Reden aus einander. Auch im übrigen war er von unermüdlichem Eifer, geleitete Pilgerzüge nach Rom, führte den Vorsitz bei Versammlungen, hielt Konferenzen und gab sich vor allem mit dem Volk ab. Nur die Eroberung des Volkes, sagte er zu seinen Vertrauten, könne den Sieg der Kirche sichern. Auf diese Weise übte er eine große Wirkung auf Pierre aus; dieser bewunderte naiv an ihm alle die Eigenschaften, deren er selbst entbehrte, den Organisationsgeist, den streitbaren, etwas unruhigen Willen, der einzig und allein darauf gerichtet war, die christliche Gesellschaft in Frankreich umzuschaffen. Der junge Priester lernte durch diesen Verkehr sehr viel, aber er blieb doch der Empfindsame, der Träumer, der seinen Flug geradenwegs nach der künftigen Wohnung des allgemeinen Glückes nahm, ohne der politischen Notwendigkeiten zu achten. Der Vicomte hingegen beabsichtigte, die Zerstörung der liberalen Idee von 1789 zu vollenden, indem er die Enttäuschung und den Zorn der Demokratie für die Rückkehr in die Vergangenheit ausnützte.
Pierre verlebte einige zauberhafte Monate. Noch niemals hatte ein Neophyt so gänzlich für das Glück anderer gelebt wie er. Er war ganz Liebe, er brannte für sein Apostelamt. Seine Besuche bei dem unglücklichen Volke, bei den Männern, die keine Arbeit fanden, den Müttern, den Kindern, die kein Brot hatten, flößten ihm die jeden Tag wachsende Gewißheit ein, daß eine neue Religion entstehen müsse, um der Ungerechtigkeit ein Ende zu machen, derentwegen die empörte Welt eines gewaltsamen Todes sterben müßte. Und bei diesem Eingreifen des Göttlichen, dieser Wiedergeburt des ursprünglichen Christentums wollte er mitarbeiten. Alle Kräfte seines Wesens beschloß er einzusetzen, um sie zu beschleunigen. Sein katholischer Glaube blieb tot; er glaubte nicht mehr an Dogmen, Mysterien, Wunder. Aber eine Hoffnung genügte ihm. Es war die Hoffnung, daß die Kirche noch Gutes thun könne, indem sie die unaufhaltsame, moderne, demokratische Bewegung in die Hand nahm, um von den Nationen die drohende soziale Katastrophe abzuhalten. Seit er sich die Mission gestellt hatte, dem Herzen des verhungerten, murrenden Volkes der Vorstädte das Evangelium wiederzugeben, war Ruhe in seine Seele eingezogen. Thätig, wie er war, litt er nun weniger unter dem furchtbaren Gefühl des Nichts, das er von Lourdes mitgebracht hatte, und da er nicht mehr in sich forschte, verzehrte ihn die Qual der Ungewißheit nicht mehr. Mit der Heiterkeit, welche die einfache Pflichterfüllung mit sich bringt, fuhr er fort, die Messe zu lesen. Zuletzt kam er zu dem Schlusse, daß dieses Mysterium, daß überhaupt alle Mysterien und alle Dogmen eigentlich nur Symbole seien, kirchliche Gebräuche, die für die Kindheit der Menschheit unerläßlich waren. Wenn die Menschheit erwachsen, geläutert, gebildet, wenn sie im stande sein würde, den blendenden Glanz der nackten Wahrheit zu ertragen, dann konnte man sich ihrer wieder entledigen. Und eines Morgens setzte sich Pierre, in seinem Drang, sich nützlich zu machen, in dem leidenschaftlichen Verlangen, seine Ueberzeugung laut in die Welt hinaus zu schreien, an den Tisch und schrieb ein Buch. Das war ganz natürlich gekommen. Dieses Buch war ein Aufschrei seines Herzens; jedwede literarische Absicht stand ihm fern. Der Titel des Buches war eines Nachts, als er nicht schlafen konnte, jählings aus dem Dunkel aufgeflammt: » Das neue Rom«. Und damit war alles gesagt. War es denn nicht Rom, das ewige und heilige Rom, von wo die Erlösung der Völker kommen mußte? Die einzige, noch bestehende Autorität befand sich dort; die Verjüngung konnte nur auf der heiligen Erde stattfinden, auf der die alte Eiche des Katholizismus gekeimt war. In zwei Monaten schrieb er das Buch fertig, das er durch seine Studien über den zeitgenossischen Sozialismus bereits seit einem Jahr unbewußt vorbereitet hatte. Wie eine dichterische Aufwallung war es über ihn gekommen; manchmal schien es ihm, daß er wie im Traum schreibe, und eine innere, ferne Stimme diktirte ihm die Worte. Oft las er dem Vicomte Philibert de la Choue das tags zuvor Geschriebene vor. Der billigte es lebhaft vom praktischen Standpunkte aus, indem er sagte, daß man das Volk rühren müsse, um es leiten zu können. Man müßte auch fromme, aber zugleich unterhaltende Lieder komponiren, die dann in den Werkstätten gesungen werden würden. Was den Monseigneur Bergerot betraf, so war er, ohne das Buch vom Standpunkt des Dogmas zu prüfen, von dem aus jeder Seite desselben wehenden innigen Hauch der Nächstenliebe tief gerührt. Er beging sogar die Unvorsichtigkeit, dem Autor einen Zustimmungsbrief zu schreiben und ihn zu ermächtigen, diesen Brief dem Werke als Vorwort voranzusetzen. Dieses Werk nun, das im Juni erschienen war, hatte die Indexkongregation mit dem Interdikt belegt, und zur Verteidigung dieses Werkes war der junge Priester voll Ueberraschung und Begeisterung nach Rom geeilt. Er brannte vor Verlangen, seiner Ueberzeugung zum Siege zu verhelfen, und war fest entschlossen, sich selbst vor dem heiligen Vater zu verteidigen, denn er war überzeugt, bloß dessen eigene Ideen ausgesprochen zu haben.
Während Pierre solcherart die drei letzten Jahre durchlebte, hatte er sich nicht von der Stelle gerührt; er stand noch immer neben der Brüstung, vor dem Rom seiner Träume und seiner Sehnsucht. Hinter ihm fuhren immer wieder Wagen vor und plötzlich wieder fort; magere Engländer und schwerfällige Deutsche gingen an ihm vorüber, nachdem sie dem klassischen Ausblick die fünf im Reiseführer vorgemerkten Minuten gewidmet hatten; der Kutscher und das Pferd seines Fiakers harrten gefällig mit gesenkten Köpfen in der Sonne aus, die den auf dem Sitz liegenden Handkoffer erhitzte. Pierre in seiner schwarzen Sutane schien noch schlanker, feiner, zarter geworden zu sein, während er unbeweglich, ganz dem erhabenen Schauspiel hingegeben, dastand. Er war nach Lourdes abgemagert; sein Gesicht war schmäler geworden. Seit seine Mutter wieder den Sieg über ihn davontrug, schien die hohe, gerade Stirn – der geistige Turm, den er seinem Vater verdankte – abzunehmen; der gütige, etwas starke Mund, das zarte, unendlich zärtliche Kinn beherrschten jetzt das Gesicht und verrieten die Seele, die auch in der milden Flamme der Augen brannte.
Ach, mit wie zärtlichen und feurigen Augen betrachtete er sein Rom, das Rom seines Buches, das neue Rom, von dem er träumte! Wenn ihn anfangs in der etwas verschleierten Milde des wunderbaren Morgens bloß das Gesamtbild gepackt hatte, so vermochte er setzt schon Einzelheiten zu unterscheiden. Mit kindlicher Freude erkannte er alle Monumente; er hatte sie lange genug auf Plänen und in photographischen Sammlungen studirt. Dort, zu seinen Füßen, am Grunde des Janiculus, breitete sich Trastevere aus, das Chaos seiner alten, rötlichen Häuser, deren sonnenverbrannte Dächer den Lauf des Tiber verbargen. Das flache Aussehen der Stadt überraschte ihn etwas. Von der Höhe der Terrasse, aus der Vogelperspektive gesehen, sah sie wie nivellirt aus; die sieben berühmten Hügel bildeten nur schwache Wölbungen, eine fast unmerkliche Schlagwelle in dem breiten Meer der Fassaden, Ja, das da unten, rechts, in dunklem Lila von der bläulichen Ferne der Albanerberge abstechend, das war der Aventin mit seinen drei unter Laubwerk halbversteckten Kirchen. Da war auch der entkrönte Palatin, den eine Reihe von Cypressen wie eine schwarze Franse begrenzte. Dahinter lag der Caelius; man sah von ihm nichts, als die vom Goldstaub der Sonne entfärbten Bäume der Villa Mattei. Gegenüber, ganz in der Ferne, am andern Ende der Stadt, bezeichneten der schlanke Turm und die beiden kleinen Kuppeln von Santa Maria Maggiore den Gipfel des Esquilin. Auf der Spitze des benachbarten Viminal bemerkte er jedoch nichts als ein in Licht gebadetes Gewirre von weißlichen, mit dünnen braunen Streifen durchzogenen Blöcken, etwas wie einen verlassenen Steinbruch; zweifellos waren das Neubauten. Lange spähte er nach dem Kapitol aus, ohne es entdecken zu können. Er suchte sich zu orientiren und redete sich zuletzt ein, daß er ganz deutlich den Campanile sehe, da unten, vor Santa Maria Maggiore, diesen viereckigen Turm, der so bescheiden aussah, daß er sich inmitten der umgebenden Dächer verlor. Links kam dann der Quirinal; er erkannte ihn an der langen Fassade des königlichen Palastes, die der einer Kaserne oder eines Hotels glich, von einem harten Gelb, stach und von unzähligen, regelmäßigen Fenstern durchlöchert. Als er sich jedoch dann vollends umdrehte, ließ ihn ein plötzlicher Anblick erstarren. Vor der Stadt, über den Bäumen des Corsinigartens erschien der Dom von Sankt Peter. Er schien aus dem Grün zu ruhen und sah bei dem reinen, blauen Himmel selbst so zart himmelblau aus, daß er sich mit dem unendlichen Azur vermischte. Die Steinlaterne, die ihn krönt, schien weiß und leuchtend in der Luft zu hängen.
Pierre konnte sich nicht satt sehen. Seine Blicke schweiften unaufhörlich von einem Ende des Horizontes zum andern. Er betrachtete lange die edlen Zacken, die stolze Anmut der mit Städten besäten Sabiner-und Albanergebirge, deren Gürtel den Horizont abschloß. Kahl und majestätisch, gleich einer toten Wüste, und seegrün wie ein stagnirendes Meer breitete sich die ungeheure römische Campagna aus. Zuletzt unterschied er den niedrigen, runden Turm des Grabes der Cäcilia Metella, hinter dem eine dünne, weiße Linie die antike Via Appia bezeichnete. Trümmer von Wasserleitungen bestreuten den Rasen mit dem Staube zusammengebrochener Welten. Seine Blicke schweiften wieder zurück – und da war wieder die Stadt, das Durcheinander der Gebäude, wie das Auge eben darauf fiel. Hier, ganz in der Nähe erkannte er an der dem Strom zugekehrten Loggia den ungeheuren, rotgelben Würfel des Palastes Farnese. Jene niedrige, kaum sichtbare Kuppel mußte die des Pantheon sein. Dann erkannte er, die Entfernungen mit dem Blick jäh überspringend, die frisch geweißten Mauern von S. Paolo fuori le Mura, die den Mauern einer kolossalen Scheune glichen, dann die Statuen, die S. Giovanni in Laterano krönen. Sie erschienen aus der Ferne winzig, kaum insektengroß. Dann kamen die unzähligen Dome, der von del Gesu, der von S. Carlo, der von S. Andrea Della Valle, der von S. Giovanni de Fiorentini, hernach noch so viele andere, von Erinnerungen erfüllte Gebäude: die Engelsburg mit ihrer funkelnden Statue, die Villa Medici, die die ganze Stadt beherrschte, die Terrasse des Pincio, wo zwischen seltenen Bäumen weiße Marmorgruppen leuchteten, und in der Ferne die tiefen Schatten der Villa Borghese, mit ihren grünen Höhen den Horizont abschließend. Vergebens suchte er das Kolosseum, obwohl ein leichter Nordwind sich erhoben hatte und den Morgennebel zu zerstreuen begann. In der dunstigen Ferne zeichneten sich ganze Stadtteile kräftig ab, gleich Vorgebirgen auf einem sonnenbeschienenen Meer. Da und dort leuchtete zwischen der undeutlichen Masse der Häuser eine weiße Mauer auf; eine Reihe von Fenstern blitzte, ein Garten bildete einen schwarzen Fleck und alles war von überraschender Farbenpracht. Das übrige, das Durcheinander der Straßen, Plätze, der auf allen Seiten zerstreuten, endlosen Häuserinseln vermischte sich und verschwamm in der lebendigen Pracht der Sonne, während von den Dächern hohe, weiße Rauchsäulen aufstiegen und langsam die unendliche Reinheit des Himmels durchzogen.
Bald aber bewog ein geheimer Instinkt Pierre, sich nur noch für drei Punkte des ungeheuren Horizontes zu interessiren. Die Linie der schlanken Cypressen, die den Gipfel des Palatin schwarz umsäumte, bewegte sein Herz. Dahinter war nichts als der leere Raum; die Paläste der Cäsaren waren verschwunden, zerfallen, die Zeit hatte sie hinweggefegt. Er beschwor sie im Geiste wieder herauf und meinte zu sehen, wie sie sich gleich goldenen Phantomen, vage und zitternd, in das Purpurlicht des herrlichen Morgens erhoben. Dann kehrten seine Blicke wieder zu Sankt Peter zurück. Dieser Dom stand noch und beschützte den Vatikan, der, wie Pierre wußte, daneben dicht an der Flanke des Kolosses ruhte. Er sah so triumphirend, fest und riesig aus, daß er Pierre wie ein Riesenkönig vorkam. Er beherrschte die ganze Stadt, war überall und ewig sichtbar. Dann gingen seine Augen wieder hinüber zu dem andern Berge, dem Quirinal, wo der Palast des Königs stand, der ihm wie eine gewöhnliche, gelbgestrichene Kaserne vorkam. Und die ganze hundertjährige Geschichte Roms, mit ihren fortwährenden Umwälzungen, ihrem wiederholten Aufschwung schien sich in diesem symbolischen Dreieck, in diesen drei Berggipfeln zu verkörpern, die einander über den Tiber hinweg anschauten: das aufblühende, antike Rom mit seinen Palästen und Tempeln, der monströsen Blüte kaiserlicher Macht und Pracht; das päpstliche Rom, das im Mittelalter siegreich die Welt beherrschte und diese kolossale Kirche in all ihrer wiedererstandenen Schönheit auf der Christenheit lasten ließ; das jetzige Rom, das er nicht kannte, das er bisher noch nicht studirt hatte, dessen kalter, kahler Königspalast ihm aber einen dürftigen Eindruck machte. Er erschien wie ein frevelhafter Modernisirungsversuch an dieser einzigen Stadt, die man lieber den Träumen von der Zukunft hätte überlassen sollen. Dieses beinahe peinliche Gefühl einer unbequemen Gegenwart unterdrückte er; er verschmähte es, sich bei einem neuen Viertel aufzuhalten, das er ganz deutlich neben Sankt Peter, am Rande des Flusses erblickte. Es war eine ganze farblose Stadt und zweifellos noch im Baue begriffen. Er hatte von einem andern neuen Rom geträumt und träumte noch davon, selbst angesichts des im Staube der Jahrhunderte vernichteten Palatin, angesichts des Domes von Sankt Peter, in dessen weiten Schatten der Vatikan schlummerte, angesichts des frisch hergerichteten und angestrichenen Palastes auf dem Quirinal, der gut bürgerlich die neuen Viertel beherrschte, die überall aufschossen und große Lücken in den Leib der alten Stadt mit ihren roten, in der hellen Morgensonne schimmernden Dächern rissen.
Das neue Rom! Vor den Augen Pierres flammte abermals der Titel seines Buches auf und versenkte ihn in eine neue Träumerei. Er durchlebte sein Buch, so wie er vorhin sein Leben durchlebt hatte. Er hatte es in der Begeisterung niedergeschrieben und die aufgehäuften Notizen aufs Geratewohl verwendet. Und die Einteilung in drei Teile hatte sich sofort von selbst ergeben: die Vergangenheit, die Gegenwart, die Zukunft.
Die Vergangenheit war die außerordentliche Geschichte des ursprünglichen Christentums, der langsamen Entwicklung, die aus diesem Christentum den jetzigen Katholizismus gemacht hatte. Sie bewies, daß sich hinter jeder religiösen Evolution eine ökonomische Frage verbirgt, kurz, daß das ewige Uebel nichts anderes ist als der ewige Kampf zwischen den Armen und den Reichen. Bei den Juden bricht gleich nach dem Aufhören des Nomadenlebens, gleich nach der Eroberung Kanaans und dem Entstehen des Besitzes der Klassenkrieg los. Es gibt nun Reiche und es gibt Arme; daraus entspringt die soziale Frage. Der Uebergang geschah jählings, der neue Stand der Dinge verschlimmerte sich so rasch, daß die Armen, die sich der goldenen Zeiten des Nomadenlebens noch erinnerten, nun doppelt darunter litten und Abhilfe forderten. Bis zu Jesus waren die Propheten nie etwas anderes als Empörer, die aus dem Elend des Volkes auftauchten, seine Leiden klagten und die Reichen verwünschten, denen sie zur Strafe für ihre Ungerechtigkeit und Härte alles Böse prophezeien. Jesus selbst ist nur der letzte dieser Empörer; er erscheint als die verkörperte Forderung der Rechte der Armen. Die Propheten, lauter Sozialisten und Anarchisten, haben die soziale Gleichheit gepredigt; wenn die Welt nicht mehr gerecht wäre, so müßte sie zerstört werden. Er bringt den Unglücklichen ebenfalls den Abscheu vor dem Reichtum. Seine ganze Lehre ist eine Drohung gegen den Reichtum, gegen den Besitz; und wenn man unter dem himmlischen Reich, das er verheißt, den Frieden und die Brüderlichkeit auf dieser Erde versteht, dann braucht man nur zu dem goldenen Zeitalter des Hirtenlebens, zu dem Traum von der christlichen Gemeinde zurückzukehren, so, wie ihn nach Jesus seine Jünger verwirklicht zu haben schienen. In den drei ersten Jahrhunderten war jede Kirche ein kommunistischer Versuch, eine ausgesprochene Genossenschaft, deren Mitglieder alles gemeinsam besaßen, mit Ausnahme der Frauen. Die Apologeten und die ersten Kirchenväter stellen die Gemeinschaftlichkeit zum Gesetz auf. Damals war das Christentum nur die Religion der Armen und Einfältigen, ein Demokratismus und Sozialismus, der die römische Gesellschaft bekämpfte. Und als diese endlich, vom Gelde angefault, zusammenbrach, da hatten diesen Zusammenbruch weniger die anstürmende Flut der Barbaren und die heimliche Termitenarbeit der Christen bewirkt, als das Agio, die wurmstichigen Banken, der finanzielle Krach. Die Geldfrage liegt allem zu Grunde. Dafür ergab sich ein neuer Beweis, als das Christentum endlich, dank der Zusammenwirkung historischer, sozialer und menschlicher Verhältnisse, den Sieg davontrug und zur Staatsreligion erklärt wurde. Es sah sich, um sich den Sieg vollständig zu sichern, gezwungen, es mit den Reichen und Mächtigen zu halten; und da muß man sehen, mit welchen Spitzfindigkeiten, mit welchen Sophismen die Kirchenväter zuletzt dahin gelangten, in dem Evangelium Christi eine Verteidigung des Besitzes zu entdecken. Für das Christentum war das ein dringendes politisches Lebensbedürfnis; nur um diesen Preis ward es der Katholizismus, die Universalreligion. Von da ab richtet sich die mächtige Maschine als Eroberungs-und Regierungswaffe immer mehr in die Höhe: oben befinden sich die Mächtigen, die Reichen, deren Pflicht es ist, mit den Armen zu teilen, die es aber nicht thun; unten sind die Armen, die Arbeiter, die man Ergebung und Gehorsam lehrt und ihnen dafür das künftige Reich, das göttliche, ewige Entschädigung verspricht. Es ist ein wunderbares Monument, das Jahrhunderte gedauert hat; alles daran baut sich auf die Verheißung des Jenseits, auf den unauslöschlichen Durst nach Unsterblichkeit und Gerechtigkeit, der den Menschen verzehrt.
Pierre hatte diesen ersten Teil seines Buches, die Geschichte der Vergangenheit, durch eine in großen Zügen entworfene Studie des Katholizismus bis auf die Jetztzeit ergänzt. Da war zuerst Sankt Petrus. Ein unwissender, unruhiger Geist, gelangte er durch einen Geniestreich nach Rom und verwirklichte die antiken Orakel, die dem Kapital die Ewigkeit geweissagt hatten. Dann kamen die ersten Päpste, einfache Leiter von Leichenbestattungsvereinen. Hierauf begann das langsame Aufsteigen des allmächtigen Papsttums. Es befand sich im fortwährenden Eroberungskrieg mit der gesamten Welt und bestrebte sich unablässig, seinen Traum von der Weltherrschaft zu verwirklichen. Im Mittelalter, als die großen Päpste regierten, glaubte es einen Augenblick, sein Ziel, die Oberherrschaft über die Völker, erreicht zu haben. Läge denn nicht die absolute Wahrheit bei einem Papst, der Pontifex und König der Erde zugleich ist, der über die Seelen und über die Körper der Menschen herrscht, wie Gott selbst, dessen Stellvertreter er ist? Dieser ungemessene, aber vollkommen logische Ehrgeiz erfüllte sich in Augustus, dem Kaiser und Pontifex, dem Herrn der Welt. Ja, die immer wieder aus den Ruinen des antiken Rom erstehende, glorreiche Gestalt des Augustus hat die Päpste heimgesucht, das Blut des Augustus war es, das in ihren Adern pochte. Aber bei dem Zusammenbruch des römischen Kaiserreiches hatte sich die Macht halbirt; das Papsttum mußte dem Kaiser die weltliche Herrschaft überlassen und behielt sich nur das Recht vor, ihn im Auftrag Gottes zu salben. Das Volk gehörte Gott. Der Papst gab das Volk im Namen Gottes dem Kaiser und konnte es wieder zurücknehmen. Das war eine grenzenlose Macht, deren furchtbare Waffe der Bann bildete; das war die Oberherrschaft, die dem Papsttum den Weg zur wirklichen und definitiven Besitzergreifung des Reiches bahnte. Kurz, der ewige Kampf zwischen Kaiser und Papst drehte sich um das Volk, das sie einander streitig machten, um die unthätige Masse der Einfältigen und Leidenden, um den großen Stummen, dessen unheilbares Leid nur manchmal durch ein dumpfes Murren verraten wird. Man sprang zu seinem Wohle mit ihm um, wie mit einem Kinde. Aber die Kirche unterstützte thatsächlich die Zivilisation, erwies der Menschheit viele Dienste und spendete reichliche Almosen. Der alte Traum von der christlichen Gemeinde kehrte immer wieder, zum mindesten in den Klöstern: ein Drittel der aufgehäuften Reichtümer wurde für den Kultus bestimmt, ein Drittel für die Priester, ein Drittel für die Armen. Wurde dadurch nicht das Leben vereinfacht? Wurde den Gläubigen nicht durch den Verzicht auf irdische Wünsche, aber die Erwartung der unerhörten, himmlischen Freuden die Existenz ermöglicht? Gebt uns also die gesamte Erde! Wir werden alle Güter hienieden in solche drei Teile teilen und dann werdet ihr sehen, was für ein goldenes Zeitalter herrschen wird, wie alle ergeben und gehorsam sein werden!
Alsdann zeigte Pierre, wie das Papsttum am Ausgange des Mittelalters, der Zeit seiner Allmacht, von den größten Gefahren bedroht wurde. Die Renaissance mit ihrem Luxus und ihrer Sittenverderbnis, mit der überschäumenden Lebenskraft, die aus der ewigen, so lange verachteten und für tot liegen gebliebenen Natur hervorbrach, riß es beinahe mit sich fort. Noch drohender war das Erwachen des Volkes, des großen Stummen, dessen Zunge sich zu lösen schien. Die Reformation brach los, wie ein Protest der Vernunft und Gerechtigkeit, eine Mahnung an die verkannten Wahrheiten des Evangeliums. Um Rom vor dem vollständigen Verschwinden zu retten, bedurfte es der rauhen Verteidigung der Inquisition, der langsamen, hartnäckigen Arbeit des Konzils von Trient, das das Dogma stärkte und die weltliche Macht befestigte. Damals trat das Papsttum in zwei Jahrhunderte des Friedens und in den Schatten; denn die festen, absoluten Monarchien, die Europa unter sich geteilt hatten, konnten seiner entbehren. Sie zitterten nicht mehr vor dem unschädlich gewordenen Bannstrahl und anerkannten die Päpste nur noch als einen mit gewissen Riten betrauten Zeremonienmeister. Unter den Besitzern des Volkes war das Gleichgewicht verrückt worden: die Könige behielten wohl noch das Volk Gottes, aber der Papst mußte sich darauf beschränken, das Geschenk ein für allemal zu registriren; er hatte sich in die Regierung der Staaten bei keiner Gelegenheit einzumischen. Niemals war Rom der Verwirklichung seines uralten Traumes von der Weltherrschaft ferner gewesen. Und als dann die französische Revolution ausbrach, da konnte man glauben, daß die Verkündigung der Menschenrechte das Papsttum, den Bewahrer des göttlichen Rechtes, das Gott ihm über die Nationen übertragen hatte, töten würde. Was war da auch anfangs im Vatikan eine Angst, ein Zorn, wie verzweifelt wehrte er sich gegen die Idee der Freiheit, gegen dieses neue Credo der befreiten Vernunft und der wieder Herrin ihrer selbst gewordenen Menschheit! Es war eine scheinbare Lösung des langen Kampfes, den Kaiser und Papst um den Besitz des Volkes mit einander geführt hatten. Der Kaiser verschwand, und das Volk, das ihn fortan absetzen konnte, wollte auch dem Papst entschlüpfen. Es war eine unvorgesehene Lösung, und das ganze, uralte Gerüst des Katholizismus schien dabei in Trümmer gehen zu müssen.
Hiermit beendete Pierre den ersten Teil seines Buches; er schloß, indem er angesichts des gegenwärtigen Katholizismus, welcher der Triumph der Reichen und Mächtigen ist, auf das ursprüngliche Christentum verwies. Jesus war gekommen, um die römische Gesellschaft im Namen der Armen und Einfältigen zu zerstören. Hat das katholische Rom nicht nach Jahrhunderten diese selbe Gesellschaft mit seiner Geld-und Hochmutspolitik neu aufgebaut? Welch traurige Ironie, wenn sich nach achtzehn Jahrhunderten des Evangeliums konstatiren ließ, daß die Welt abermals durch das Agio, durch wurmstichige Banken, durch den finanziellen Krach, durch die furchtbare Ungerechtigkeit, daß ein paar Menschen sich im Reichtum wälzen konnten, während Tausende ihrer Brüder Hungers sterben, dem Zerfalle nahe war! Das ganze Rettungswerk müßte wieder von Anfang an begonnen werden. Pierre sagte diese schrecklichen Dinge mit sanften, mitleidsvollen, so hoffnungsreichen Worten, daß sie ihre revolutionäre Gefährlichkeit verloren. Uebrigens griff er nirgends das Dogma an. Sein Buch war in der sentimentalen Form einer von Nächstenliebe durchglühten Dichtung nichts als der Ruf eines Apostels.
Dann kam der zweite Teil des Werkes: die Gegenwart, eine Studie der aktuellen katholischen Gesellschaft, hier entwarf Pierre ein furchtbares Bild von dem Elend der Armen, dem Elend einer Großstadt. Er kannte es; sein Herz blutete davon, denn er hatte seine vergifteten Wunden berührt. Die Ungerechtigkeit war nicht mehr erträglich, die Wohlthätigkeit war ohnmächtig, die Leiden so groß, daß im Herzen des Volkes alle Hoffnung starb. Hatte das monströse Schauspiel, das die Christenheit der Welt bot, nicht dazu beigetragen, den Glauben im Volk zu töten? Ihre Greuel verdarben es, erfüllten es mit Haß und Rachelust. Gleich nach diesem Bilde einer verfaulten, in Zerfall begriffenen Gesellschaft knüpfte Pierre wieder an die Geschichte der französischen Revolution an. Die Idee der Freiheit hatte der Welt eine ungeheure Hoffnung eingeflößt. Als das Bürgertum, die große liberale Partei, zur Macht gelangte, nahm es sich vor, endlich alle glücklich zu machen. Aber leider scheint die Freiheit, wie die Erfahrung eines Jahrhunderts zeigt, den Enterbten nicht mehr Glück geschenkt zu haben. Auf dem politischen Gebiet greift die Enttäuschung um sich. Auf jeden Fall steht fest: wenn auch der dritte Stand sich, seit er zur Herrschaft gelangt ist, befriedigt erklärt – der vierte Stand, die Arbeiter, leiden noch immer und fordern noch immer ihr Recht. Man hat sie für frei erklärt, man hat ihnen die politische Gleichheit aufoctroyirt; aber das sind nur trügerische Geschenke, denn jetzt wie früher haben sie nur die Freiheit, Hungers zu sterben. Daraus stammen alle sozialistischen Ansprüche; von nun an tritt das schreckliche Problem, dessen Lösung die gegenwärtige Gesellschaft zu vernichten droht, zwischen der Arbeit und dem Kapital auf. Als die Sklaverei aus der antiken Welt verschwand, um der Löhnung Platz zu machen, war die Revolution ungeheuer. Und ganz gewiß war das Christentum einer der mächtigsten Faktoren, die die Sklaverei zerstörten. Heute handelt es sich darum, die Löhnung durch etwas anderes, vielleicht durch Beteiligung des Arbeiters am Gewinn, zu ersetzen. Warum sollte das Christentum nicht eine neue Aktion versuchen? Dieses verhängnisvolle, bevorstehende Emporkommen der Demokratie ist eine neue Phase der menschlichen Geschichte; die Gesellschaft von morgen ist in der Schöpfung begriffen. Rom konnte sich dagegen nicht ganz interesselos verhalten; das Papsttum mußte in dem Streit irgend eine Partei ergreifen, wenn es nicht wie ein gänzlich nutzlos gewordenes Räderwerk von der Welt verschwinden wollte.
Daraus ging die Legitimität des katholischen Sozialismus hervor. Wenn die sozialistischen Sekten sich von allen Seiten mit ihren Lösungen um das Glück des Volkes stritten, mußte die Kirche mit der ihrigen hervortreten. Hier nun erschien das neue Rom; hier schwang sich die Entwicklung zu einem Frühling unbegrenzter Hoffnung auf. Es stand fest, daß die katholische Kirche im Prinzip nichts gegen die Demokratie hatte. Im Gegenteil, sie brauchte nur zu der evangelischen Tradition zurückzukehren, um wieder die Kirche der Armen und Einfältigen zu werden, um die christliche Universalgemeinde wieder einzusetzen. Ihr Wesen ist demokratisch. Wenn sie sich, als das Christentum zum Katholizismus ward, auf Seite der Reichen und Mächtigen stellte, so gehorchte sie, indem sie ihre erste Reinheit opferte, nur der Notwendigkeit der Selbstverteidigung. Falls sie daher die zum Untergang verurteilten herrschenden Klassen verlassen würde, um zu dem Volke der Unglücklichen zurückzukehren, würde sie sich einfach Christus wieder nähern; sie würde sich verjüngen und sich von den politischen Kompromissen, in die sie sich ergeben mußte, wieder reinigen. Zu allen Zeiten verstand es die Kirche, sich vor den Verhältnissen zu beugen, ohne im geringsten auf ihre Unumschränktheit zu verzichten: sie behält ihre Alleinherrschaft, sie duldet bloß, was sie nicht hindern kann, und wartet geduldig – wenn es auch Jahrhunderte dauern sollte – auf die Stunde, da sie wieder die Herrin der Welt werden wird. Sollte diese Stunde nicht jetzt, in der nahenden Krisis schlagen? Von neuem streiten sich alle Mächte um den Besitz des Volkes. Seit Freiheit und Bildung es zu einer Macht, zu einem seine Rechte mit Bewußtsein und Willenskraft fordernden Wesen gemacht haben, wollen alle Regierenden es besitzen; sie möchten durch das Volk, und wenn es sein muß, mit dem Volk regieren. Der Sozialismus ist die Zukunft, das neue Regierungswerkzeug. Und alles macht in Sozialismus: die auf ihren Thronen schwankenden Könige, die bürgerlichen Oberhäupter unruhiger Republiken, die ehrgeizigen Parteiführer, die von Macht träumen. Alle sind darin einig, daß der kapitalistische Staat die Rückkehr zur heidnischen Welt, zum Sklavenhandel ist; alle sprechen davon, daß man das abscheuliche eiserne Gesetz brechen müsse, das die Arbeit zu einer den Gesetzen von Angebot und Nachfrage unterworfenen Ware macht, das den Lohn genau nach dem berechnet, was der Arbeiter unumgänglich nötig hat, um nicht Hungers zu sterben. Allein das Uebel wächst, die Arbeiter werden von Not und Verzweiflung gequält, während über ihre Köpfe hinweg die Diskussionen fortgesetzt werden, die Systeme sich kreuzen, der gute Wille sich im Versuchen trügerischer Heilmittel erschöpft. Das ist das Herumtrippeln auf einer Stelle, das ist die närrische Bestürzung, die nahen, großen Katastrophen voranzugehen pflegt. Und zugleich mit den anderen tritt der katholische Sozialismus ebenso feurig wie der revolutionäre Sozialismus auf den Plan und trachtet zu siegen.
Nun folgte eine Studie über die Anstrengungen des katholischen Sozialismus in der ganzen Welt. Dabei war besonders auffallend, daß der Kampf um so lebhafter und erfolgreicher ward, wenn er in einem Lande stattfand, das dem Christentum noch nicht völlig unterworfen war. So zum Beispiel bei den Nationen, wo der Katholizismus dem Protestantismus gegenüberstand. Dort kämpften die Priester mit außerordentlicher Leidenschaft für ihr Leben und machten den Pastoren den Besitz des Volkes durch kühne Handstreiche, durch verwegen demokratische Theorien streitig. In Deutschland, dem klassischen Lande des Sozialismus, war Bischof Ketteler einer der ersten, der davon sprach, den Reichen Steuern aufzulegen; und später schuf er eine ausgebreitete Agitation, welche heute mit Hilfe der Vereinigungen und zahlreicher Zeitungen von dem ganzen Klerus geleitet wird. In der Schweiz verteidigte Msgr. Mermillod die Armen so energisch, daß die dortigen Bischöfe jetzt fast gemeinsame Sache mit den demokratischen Sozialisten machen; zweifellos hoffen sie, sie am Tage der Teilung zu bekehren. In England, wo der Sozialismus so langsam durchdringt, errang Kardinal Manning bedeutende Siege; er ergriff während eines gewaltigen Strikes die Partei der Arbeiter und veranlaßte eine volkstümliche Bewegung, die durch häufige Bekehrungen gekennzeichnet ward. Vor allem aber triumphirte der katholische Sozialismus in Amerika, in den Vereinigten Staaten, in dieser rein demokratischen Umgebung, welche Bischöfe wie Msgr. Ireland zwang, sich an die Spitze der Forderungen der Arbeiter zu stellen. Dort scheint eine ganz neue Kirche im Keimen begriffen zu sein; sie ist noch unklar, aber überquellend vor Kraft und von ungeheurer Hoffnung geschwellt, als stehe sie schon vor der Morgendämmerung des verjüngten Christentums. Wenn man dann zu Oesterreich und Belgien, katholischen Nationen, übergeht, so sieht man, daß in dem ersteren der katholische Sozialismus sich mit dem Antisemitismus vermischt, und daß er in dem letzteren keine ausgesprochene Färbung besitzt. Hingegen stockt und verschwindet sogar alle Bewegung, so wie man nach Spanien und Italien, diesen alten Ländern des Glaubens, gelangt. Spanien ist ganz den Gewaltthaten der Revolutionäre überantwortet; seine störrischen Bischöfe begnügen sich damit, die Ungläubigen mit dem Bannstrahl zu treffen, wie in den Tagen der Inquisition. Italien wird von der Tradition, die eine Initiative unmöglich macht, zum Schweigen und Respekt zwingt, rings um den Heiligen Stuhl immobilisirt. In Frankreich jedoch wurde der Kampf lebhaft weiter geführt, aber es war hauptsächlich ein Ideenkampf; der Krieg richtete sich mit einem Worte gegen die Revolution, und es schien, daß man nur die einstige Organisation der monarchischen Zeiten wieder herzustellen brauche, um ins goldene Zeitalter zurückzukehren. So ward die Frage der Arbeiterkorporationen die Angelegenheit, um die sich alles drehte, als sei sie das Panacee für alle Uebel der Arbeiter. Aber man war weit davon entfernt, sich zu einigen: diejenigen Katholiken, welche die Einmischung des Staates zurückwiesen, welche eine rein moralische Aktion priesen, forderten freie Korporationen; die anderen hingegen, die Jungen, Ungeduldigen, zum Handeln Entschlossenen verlangten obligatorische, vom Staat anerkannte und geschützte Korporationen mit gehörigem Kapital. Besonders der Vicomte Philibert de la Choue hatte mit dem Wort und mit der Feder einen eifrigen Feldzug zu Gunsten dieser obligatorischen Korporationen geführt. Zu seinem großen Kummer hatte er bisher den Papst noch nicht bestimmen können, sich offen darüber auszusprechen, ob die Korporationen offene oder geschlossene sein müßten. Seiner Ansicht nach hing das Schicksal der Gesellschaft, die friedliche Lösung der sozialen Frage oder die furchtbare, alles mit sich fortreißende Katastrophe nur davon ab. Im Grunde war der Vicomte, obwohl er es nicht zugestehen wollte, schließlich beim Staatsozialismus angelangt.