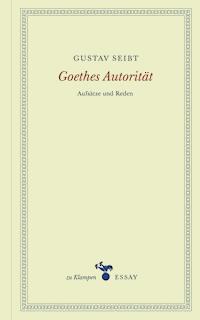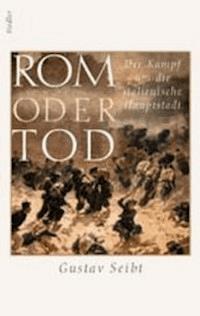
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Siedler
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Zehn Jahre sind zwischen dem Hauptstadtbeschluss des Parlaments und dem Umzug der Regierung verstrichen: Nicht von Berlin ist die Rede, nicht vom heutigen Deutschland, sondern von Rom und Italien im neunzehnten Jahrhundert. Italien wurde 1861 geeinigt, 1871 bezog es seine Hauptstadt Rom. Es gab lange Hauptstadtdebatten davor und einen ebenso langwierigen Umbau der Stadt danach.Darum hatte es einen Krieg gegeben: Italien hatte die Stadt Rom dem Papst mit militärischen Mitteln entreißen müssen. Und neben dem Krieg der Waffen fanden andere Kämpfe auf den Schlachtfeldern der Presse, der Diplomatie, der Geschichtswissenschaft und der Theologie statt: Gestritten wurde um Fortschritt und Legitimität, Religion und Revolution, Kirche und Nation. Schriftsteller und Gelehrte aus ganz Europa beteiligten sich daran und erörterten dabei Grundsatzfragen der Moderne: nationale Identität, Gewissensfreiheit, Selbstbestimmungsrecht der Völker.Gustav Seibt erzählt die Geschichte dieses vergessenen Kampfes, der damals Millionen Menschen bewegt hat, mit ihren vielfältigen Bezügen und Ebenen: der militärischen, der diplomatischen, der weltanschaulichen und der stadthistorischen. Dabei entsteht ein farbiges Bild vom Übergang Alteuropas zum Europa der Nationen zwischen der Revolution 1848 und den Lateranverträgen 1929. Seibts Buch ist ein Abgesang auf das alte Rom der Päpste und eine Liebeserklärung an das freiheitliche Italien des Risorgimento.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 502
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
für Carl
Inhaltsverzeichnis
DIE EROBERUNG
Vom Hauptstadtbeschluss bis zum ersten Besuch des Königs 1861 – 1870
Bild 14
20. September 1870: Ab 15 Uhr ziehen die italienischen Truppen durch Porta Pia in Rom ein.
Einmarsch in den Kirchenstaat
Die Gewehre des Papstes knallten nur schwach, und ihre Kugeln waren ohne Durchschlagskraft. So stellt es der italienische Augenzeuge dar, der die erste Kampfhandlung in diesem Feldzug überliefert hat. Es war der 12. September 1870. In der Nacht hatte das Vierte Armeecorps des Königreichs Italien bei Ponte Felice im Tibertal südlich von Orte die Grenze zum Kirchenstaat überschritten. Gegen neun Uhr am Vormittag erreichte die Vorhut des italienischen Heeres die Stadt Civita Castellana; in einer auf steilen Felsen errichteten Festung aus dem sechzehnten Jahrhundert wartete dort eine päpstliche Garnison auf die Invasoren. Die Morgennebel haben sich verzogen, die Luft ist noch frisch; es ist ein leuchtender Sommertag. »Nichts von den Schrecken des Krieges ist zu sehen: die trockenen Schüsse der Artillerie klingen wie Freudensalven, und ihr Widerhall verliert sich feierlich in den Schluchten und Klüften der waldigen Flanken des Soracte. Bei jedem Schuss sehen wir, wie sich eine Staubwolke aus den Zinnen und Bleidächern des alten Mauerrings erhebt, darunter dann und wann zarte Rauchsäulen, welche von der Morgenbrise sogleich zerstreut werden und die wirkungslose Schüsse aus Remingtongewehren anzeigen, von denen nicht einmal das Geräusch zu uns dringt. Doch gelangt manche müde Kugel bis zu unseren Geschützen. Trotzdem glaubt man, bei einem Manöver zu sein, nicht in einem Krieg.«1
Der Waffengang, mit dem das Königreich Italien sich im Jahre 1870 seine Hauptstadt Rom und das Patrimonium Petri, den Rest des Kirchenstaats, eroberte – fast zehn Jahre, nachdem der Hauptstadtbeschluss gefallen war –, gehört nicht zu den Heldentaten der Welthistorie. Man kann kaum von einem Krieg sprechen, eher von einem Kriegstheater, bei dem das Ergebnis schon festliegt. Das dreifach überlegene italienische Heer besiegte eine längst in die Enge getriebene geistliche Macht – das Papsttum –, der ein Blutbad schlecht angestanden hätte. Und auch Italien musste daran interessiert sein, selbst kleinere Opfer zu vermeiden, denn im Heer der Kirche kämpften nicht nur Italiener, künftige Mitbürger, sondern auch Freiwillige aus allen europäischen Nationen und aus vielen anderen Ländern der ganzen Welt, mit denen das junge Königreich jeden Streit vermeiden wollte. Vor allem die moralischen Folgen einer Schlacht mit der Kirche musste Italien fürchten, die internationale Empörung und den Zwiespalt im eigenen Land, der dabei entstehen konnte.
Trotzdem ist der römische Feldzug von 1870 eines der großen Ereignisse in der Geschichte Europas. Er machte nach über tausend Jahren der ältesten Herrschaft des Kontinents ein Ende, der Regierung des Papstes über Rom und Latium. Er verwandelte die Ewige Stadt in die profane Kapitale eines modernen Staates. Er ist eine vor allem symbolisch bedeutsame Episode in den Auseinandersetzungen des neunzehnten Jahrhunderts, bei denen die Prinzipien des revolutionären Zeitalters noch einmal sichtbar und dramatisch mit den alten Mächten zusammenstießen. Es ging um Staat und Kirche, Nation und Religion, Fortschritt und Legitimität. Die Leidenschaften, die von der Kampagne entfacht wurden, waren vor allem auf italienischer Seite gewaltig. Wenn man erfahren will, was der Nationalismus als positive Gefühlsmacht in aller Unschuld einmal gewesen ist – eine Emotion, die die Individuen über sich selbst hinaushob in die Sphären von Vaterland und Geschichte – , dann findet man die lebendigsten Zeugnisse in den Berichten und Erinnerungen der Journalisten und Augenzeugen des italienischen 1870.
Das rosige Hochgefühl, das die Berichte vermitteln, ist eigentümlich gemischt aus Ferienstimmung und Feierlichkeit. Ferienstimmung herrschte, weil dieser Marsch auf Rom alle erregenden Strapazen des Krieges ohne seine Gefahren mit sich brachte, das Biwakieren im Freien, die nächtliche Feuchtigkeit, den dicken Morgennebel und die glühenden Tage, an denen die Sonne nie mehr vom Himmel verschwinden zu wollen schien. Doch war das Ganze nur ein militärischer Spaziergang, eine Art Abenteuerurlaub, in dem die Zeitungskorrespondenten und Geschichtstouristen zuweilen sogar Avantgarde spielen konnten und ins Niemandsland zwischen den Armeen ausschwärmten. Die einzige wirkliche Unbequemlichkeit war, dass es oft nicht genügend zu essen gab: Die römische Campagna war dünn besiedelt; kaufen oder requirieren ließ sich fast nichts, und der Nachschub der Armee litt unter akutem Pferdemangel. Die beauftragten Firmen erwiesen sich als unzuverlässig, und an einer Zollstelle zwischen Italien und dem Kirchenstaat wurde von unverständigen Beamten tagelang das steuerpflichtige Salz zurückgehalten, als sei die Grenze nicht durch den Einmarsch aufgehoben worden. Außerdem war der anspruchsvolle Journalistenschwarm natürlich nicht eingeplant in der logistischen Disposition des Heeres, wie der den Oberbefehl führende General, Raffaele Cadorna, noch Jahrzehnte später in seinem Feldzugsbericht bemerkte.
Das hatte die in Florenz erscheinende Zeitung Fanfulla nicht daran gehindert, in großen Lettern anzukündigen, auch sie habe einen Teil ihrer Kräfte mobilisiert und einen ihrer Mitarbeiter an die Front geschickt, mit dem Auftrag, »Rapport über unsere Soldaten zu geben und mit ihnen in Rom einzumarschieren«.2 Der Korrespondent der Zeitung Italia Militare – es war der später durch sein patriotisches Kinderbuch Cuore (»Herz«) weltberühmt gewordene Edmondo de Amicis – unterbrach seine Kriegsberichte immer wieder mit farbigen Schilderungen von der eigenen Arbeit. »Als Büro wurde uns der Kornspeicher zugeteilt«, berichtete er aus der Umgebung von Civita Castellana, »und ein Backtrog ist unser Tisch.«3 Staunend betrachteten die Einheimischen die dicken, über und über mit Briefmarken bedeckten Kuverts, die ein Mitarbeiter englischer Blätter Tag für Tag auf die Post brachte. Vor den Türen der überfüllten Gasthöfe stapelten sich die verschiedensten Kopfbedeckungen und Accessoires, Zylinder, Spazierstöcke, gefiederte Bersaglierihüte, Koffer, Mäntel, Schirme, Patronentaschen. Wer schlau war und Glück hatte, sicherte sich rechtzeitig eine der raren Kutschen, die zur Not auch als Nachtquartier dienen konnten und die man geschwind zwischen den gemächlich voranrückenden Armeecorps hin und her dirigieren konnte, um überall da zu sein, wo etwas los war.
Ganz Italien fieberte mit, und auch die gebildeten Schichten der anderen europäischen Nationen ließ das Schicksal Roms nicht gleichgültig, die Katholiken der ganzen Welt erregte es leidenschaftlich, obwohl in jenen Wochen der deutsch-französische Krieg den größten Teil der Aufmerksamkeit auf sich zog. Die Stimmung derer, die dabei sein durften, war gehoben, denn sie waren sich bewusst, an einem Vorgang der Weltgeschichte teilzunehmen. »Diesmal kommen wir hin«, riefen Offiziere und Zivilisten einander an den Bahnhöfen der Strecke Florenz – Rom zu, wo unentwegter Verkehr bis zur Grenze herrschte, um Truppen, Diplomaten und Beobachter in Stellung zu bringen: »Auf Wiedersehen in Rom. Gott will es.«4 Ugo Pesci, jener Mitarbeiter, den der Florentiner Fanfulla mobilisiert hatte, und der fünfundzwanzig Jahre später das schönste Buch über die Eroberung Roms schreiben sollte, wollte sich zusammen mit einem Kollegen das Vergnügen machen, mit den ersten Soldaten die Grenze zum Kirchenstaat zu überschreiten. Am 12. September 1870 um 5 Uhr morgens war es soweit: »Niemand spricht; in der Luft liegt etwas Feierliches und eine Feuchtigkeit, die bis auf die Knochen geht.«5
Nun ging es voran, durch wunderschöne Landschaften, die wie gemalt wirkten und voller Geschichtszeichen waren. Am Wegrand taten sich tiefe dunkle Täler auf, Dörfer erhoben sich auf den Gipfeln der Berge, aus den Wäldern ragten die Überreste alter Burgen, mal war die Landschaft verdorrt und weit, eine Weide für Büffelherden, und die voranmarschierende Armee wurde von riesigen Staubwolken eingehüllt, mal aber zeigte sie sich anmutig wie im Winkel zwischen Via Cassia und Via Flaminia vor den Toren Roms: Dort durchzogen Bäche die grünen Wiesen, jahrhundertealte Bäume spendeten Schatten, und Felsen und Ruinen verzierten wie auf alten Gemälden die Landschaft. »Während wir vorrückten«, so berichtete später ein Hauptmann der Kavallerie, »wuchs die Verzauberung, denn die römische Campagna spricht die Sprache des Lebens und des Todes, der Größe und des Untergangs, eine Sprache, die den Geist in die erhabenen Sphären einer höheren Welt versetzt, in den Halbschatten der Dinge, die gewesen sind, und ins Licht derer, die da kommen werden.«6
In diesen heroischen Landschaften fanden die ersten Begegnungen der alten und der neuen Italiener statt, der Soldaten und der Landleute der Campagna. Die Soldaten waren, so vermeldeten es die patriotischen Berichterstatter ihrer meist norditalienischen Leserschaft, glänzend gelaunt, in ausgezeichneter körperlicher Verfassung, gut ernährt, gebräunt, diszipliniert und doch fröhlich. Abends breiteten sie sich mit den zahllosen Feuern ihrer Biwaks über die Felder am Rande der römischen Konsularstraßen aus, auf denen die Truppen untertags marschierten. Gesang, Musik und ausgelassenes Geschrei schwebten über den nächtlichen Lagern. Die einheimische Bevölkerung der Dörfer und Landstädtchen schien zuerst etwas zurückhaltend, fast mißtrauisch zu sein, wurde beim weiteren Vorrücken der Armee aber immer zutraulicher. Die Bauern und Hirten mit ihren breiten Calabreserhüten und bunten Jacken, ihren Bärten und ihrem herkulischen Körperbau glichen den Figuren der zeitgenössischen Genremalerei. Allen Beobachtern war es wichtig zu vermelden, dass überall, wo die Italiener einmarschierten, bald Trikoloren auftauchten – in der Hafenstadt Civitavecchia, die ein separates Heerescorps am 16. September besetzte, sogar derart viele, dass der mitmarschierende Korrespondent von unzähligen häuslichen Verschwörungen sprach: Die italienischen Nationalfarben waren im Kirchenstaat verboten gewesen, und das massenhafte Zusammennähen von Grünweißrot kam so einem vorweggenommenen heimlichen Plebiszit gleich. Rührender noch wirkte die Papiertrikolore, die an einem einsamen Gasthof im römischen Hinterland hing und von den vorbeiziehenden Bersaglieri mit einem heiseren »Viva l’Italia« begrüßt wurde, worauf die Büffelhirten am Wegrand mit starkem Dialekt »Hoch leben die Bersaglieri« antworteten.7
Unbeschreiblich seien, so schrieb am 13. September De Amicis für die Italia militare fassungslos und »mit zitternder Hand«, die Freudenszenen in der Kleinstadt Nepi am Abend des zweiten Kriegstages gewesen. »Ich habe niemals ein vergleichbares Schauspiel gesehen. Es war so, dass man weinen mußte. Man kann es nicht schildern, ohne den Zweifel zu wecken, man übertreibe. Diese Freude, dieses so heitere Weitwerden der Herzen, dieser so einmütige und machtvolle patriotische Schwung – das gibt es nur bei den Soldaten eines großen Heeres, die eines der liebsten Länder der Heimat betreten, nach langer und schmerzlicher Wartezeit, nach großen Opfern, und die einziehen mit dem Bewusstsein von Bürgern, von Befreiern, durchdrungen von der Heiligkeit ihrer Sache, Brüder, die sich aufmachen, Brüder in ihre Arme zu schließen, Italiener, die seit langem den Ruf von Rom hören und sich an den Busen ihrer großen ewigen Mutter werfen wollen.«8 Rom war der mythische Name, der in diesen vaterländischen Festtagen alle Klassen vereint haben soll, die gebildeten Berichterstatter im Felde, ihre Leser daheim und jene vielen einfachen Soldaten, die nie eine Schule besucht hatten und oft nicht einmal schreiben konnten. »In meiner Schwadron«, so schrieb ein Rittmeister später, »gab es einen Lanzenreiter, einen Analphabeten, der Nord und Süd nicht unterscheiden konnte, ein wilder Baum, rauh und roh, unberührt von patriotischen Ideen: Doch auch er war bewegt von Rom, und von Rom hatte er sich eine ganz eigene Vorstellung gemacht, als einer strengen, gerechten, sehr mächtigen Königin, Herrin der ganzen Erde und des Himmels, eine wunderschöne Kaiserin, die Abend für Abend in die Kasernen oder unters Volk ging, um den schönsten Soldaten oder Mann aus dem Volk auszusuchen und ihn für eine Nacht zum Herren der Welt zu machen.«9
All das wirkt in seinem oft schwülen Pathos so exaltiert, dass man gern an Selbstüberredung und ideologische Verblendung unter den Berichterstattern glaubt. Aber man begreift auch, was die Funktion der Journalisten und der Presse bei diesem Vorgang war, einem wichtigen Augenblick in der emotionalen Konstitution Italiens zu einer Nation. Die Presseleute stifteten den Zusammenhang von Volk, Armee und Bürgern, sie stellten die Gegenwart des großen Gefühls her, in dem jenes abstrakte neue Gebilde, genannt Vaterland, Wirklichkeit werden konnte. Das Moment von Selbstüberredung, von Autosuggestion bis zum Hysterischen, widerlegt diese Wirklichkeit nicht, es ist sogar ihr Kern.
Am Abend des 14. Septembers tauchte ganz fern am Horizont zum ersten Mal Rom vor den Truppen auf, die sich noch auf der Via Cassia voranbewegten. Der Umriss der Peterskirche zeichnete sich im schweren Dunst ab, vor dem Hintergrund eines violetten Himmelsstrichs im brennenden Feuer des Sonnenuntergangs; Rom lag da, ragte wie ein Riesenschiff über dem toten Meer der Campagna empor, verband seinen Gipfel mit dem Himmel, lockte mit der unverwechselbaren Form von Michelangelos Kuppel – die Berichte überbieten sich an diesem Punkt in poetischen Bildern. Die Soldaten bestiegen einen Hügel und schwiegen ergriffen oder taten einen begeisterten Ausruf. In allen Äußerungen lag, wenn wir Ugo Pesci glauben dürfen, etwas Zusammengenommenes, etwas Feierliches. Doch es dauerte noch einmal fünf Tage, bis die Truppen vor der Stadt in Stellung gebracht waren und der Angriff beginnen konnte – Tage, in denen die Ungeduld und die Anspannung unerträglich wurden. Als die Truppen, die Civitavecchia erobert hatten, zusammengerufen wurden, um beim Sturm auf Rom dabei zu sein, da seien, so der Berichterstatter Giuseppe Guerzoni, ein in die Jahre gekommener Garibaldi-Anhänger, der seinen samtbeschlagenen Parlamentssitz noch einmal mit dem Pferdesattel vertauscht hatte, Hunger und Müdigkeit mit einem Schlag vergessen worden: »Die Beine tanzen, die Reihen formieren sich von Zauberhand, die Waffen werden blitzartig ergriffen, die Division steigt von allen Seiten in geschlossenen Säulen auf die Straße hinab, die Kavallerie geht voran, die Artillerie reiht sich an ihrer Stelle ein und die Infanterie marschiert geschlossen – Viva Roma!«10
Als Zeitpunkt für den Angriff war 5 Uhr morgens am 20. September bestimmt worden. In der Nacht davor fand Ugo Pesci keinen Schlaf. »Die nach 1870 geborenen jungen Leute«, schrieb er ein Vierteljahrhundert später, »werden die Ursache dieser Schlaflosigkeit nicht begreifen. Das tut mir leid für sie; die Erinnerungen an jene Nacht, die dem größten Ereignis des Jahrhunderts vorausging, sind in mein Gedächtnis gemeißelt, als sei es gestern gewesen; und weil ich die Nacht an dieser Stelle verbrachte und am Tag danach durch Porta Pia Rom betrat, glaube ich sagen zu können, dass mir wenigstens einmal im Leben eine tiefe Genugtuung zuteil geworden ist. Ich erinnere mich, dass ich, nachdem ich mich eine Weile auf dem Heu hin- und hergedreht hatte, ohne Ruhe zu finden, endlich hinausging, um zu rauchen. Es war gegen Mitternacht. Eine Linie von Feuern umgab die ganze Seite der Stadt, die ich nicht sah, aber in der Dunkelheit jener Stunde doch ahnte. Andere Feuer brannten weit weg auf den Bergen von Tivoli und Tusculum. Das Schweigen war tief und feierlich, obwohl ringsum dreißigtausend Männer auf verhältnismäßig engem Raum vereint waren.«11
In auffälligem Gegensatz zu der hochschlagenden nationalen Leidenschaft, die den römischen Feldzug begleitete, steht die fast ängstliche Umsicht, mit der das Kabinett in Florenz – damals die Hauptstadt Italiens – ihn vorbereitete und ins Werk setzte. Die Öffentlichkeit hatte wochenlang den Eindruck, dass man die liberal-konservative Regierung des Ministerpräsidenten Giovanni Lanza, des Außenministers Emilio Visconti Venosta und des mächtigen Finanzministers Quintino Sella zum Jagen tragen müsse. Die Chance zur Eroberung Roms hatte sich unvermittelt am 19. Juli 1870 aufgetan, als der Krieg zwischen Frankreich und Preußen-Deutschland ausbrach. Frankreich war die Macht, die den Kirchenstaat, die Herrschaft des Papstes in Rom und seinem Umland, in den letzten zwei Jahrzehnten aufrechterhalten hatte, seitdem französische Truppen im Jahre 1849 die aufständische römische Republik zerschlagen und dem 1848 von der Revolution verjagten Papst Pius IX. die Rückkehr an seinen Amtssitz ermöglicht hatten. Nun war Frankreich in eine gefährliche Auseinandersetzung mit der mächtigsten und in zwei vorangehenden siegreichen Feldzügen – 1864 und 1866 – erprobten Militärmacht Europas verwickelt. Und es war bündnispolitisch isoliert, es stand allein. Für Italien ergaben sich in dieser Lage, so schien es der Öffentlichkeit, zwei Optionen: entweder an der Seite Frankreichs in den Krieg einzutreten und als Preis dafür Rom zu verlangen; oder Rom gegen den Willen Frankreichs, das gewiss keinen zweiten Kriegsschauplatz eröffnet hätte, zu erobern – in einem Moment, in dem ganz Europa gebannt auf den Kampf der beiden zentraleuropäischen Großmächte blickte und sich wohl kaum irgendwo eine Hand für den Papst gerührt hätte.
Die Tür zur Wiedervereinigung Italiens mit Rom stand offen – aber wie lange? Musste man nicht rasch handeln und die Gunst der Stunde nutzen? Eine fiebrige Erregung ergriff die politisch aktiven Teile der italienischen Nation. Doch die Regierung tat wochenlang fast nichts, so jedenfalls schien es. Zwar wurden schon Ende Juli Truppen mobilisiert und an den Grenzen des Kirchenstaats aufgestellt, aber offiziell nur zur Beobachtung und zur Aufrechterhaltung der Sicherheit. Hinter den Kulissen allerdings wurde ohne Unterlass verhandelt, zwischen den Regierungen in Florenz und Paris, zwischen Regierung und Hof, und lange Rund-schreiben des Außenministers gingen an alle europäischen Kanzleien. Doch davon erfuhr die Öffentlichkeit zunächst nur wenig. Als nach den ersten schweren Niederlagen Frankreichs im August noch immer nichts geschah, begann die parlamentarische Linke, damals in der Opposition und in allen nationalen Fragen das weit erhitztere Lager, die Nerven zu verlieren. Sie drohte mit dem Auszug aus dem Parlament, und ihre Anhänger hielten überall im Lande an den Wochenenden stürmische »Meetings« ab, mit denen die Regierung unter Druck gesetzt werden sollte. Die Leitartikel der oppositionellen Presse schäumten. Nur mühsam gelang es, das Auseinanderbrechen des Parlaments zu verhindern. Am 2. September 1870 wurde das französische Heer bei Sedan vernichtend geschlagen, das Zweite Kaiserreich brach zusammen, und Napoleon III. geriet in preußische Gefangenschaft; die Kaiserin Eugénie floh aus Paris, wo die Republik ausgerufen wurde. Doch zwischen Sedan und dem Einmarsch Italiens in den Kirchenstaat vergingen noch einmal zehn Tage, Tage, die dem nationalen Lager wie eine Ewigkeit erschienen. Nichts beweist so sehr wie dieses letzte Zaudern, mit welcher Furchtsamkeit die Regierung sich an die Eroberung des wertvollsten Stücks Italiens machte, die militärisch doch eine so leichte Sache scheinen musste. Der Moment war überaus prekär. Er hat eine verwickelte und leidvolle Vorgeschichte.
Bild 18
Emilio Visconti Venosta (1829 – 1914), italienischer Außenminister von 1869 bis 1876.
»Rom oder den Tod«
Den Beschluss, dass Rom die Hauptstadt Italiens werden müsse, fasste das italienische Parlament in Turin am 27. März 1861, indem es nahezu einmütig den folgenden Tagesordnungspunkt annahm: »Die Kammer, nachdem sie die Erklärungen des Ministeriums angehört hat, sowie im Vertrauen darauf, dass die Würde, die Ehre und die Unabhängigkeit des Pontifex und die vollständige Freiheit der Kirche gesichert sind, dass im Einklang mit Frankreich das Prinzip der Nichtintervention gelte, und dass Rom, die durch die Meinung der Nation akklamierte Hauptstadt, Italien angeschlossen werde, geht zur Tagesordnung über.«12 Diese komplizierte Formel enthält alle Sonderbarkeiten und Widersprüche in der Situation des gerade erst halbwegs geeinten Landes. Das Parlament Italiens beschließt etwas, was die öffentliche Meinung der Nation bereits entschieden haben soll; es erwähnt eine fremde Macht (Frankreich) und zugleich ein Prinzip der internationalen Beziehungen (die Nichteinmischung oder Nichtintervention, also das, was man später das Selbstbestimmungsrecht der Völker nennen sollte), und es sichert dem Papst und seiner Kirche Freiheit zu – jenem Papst, dessen Stadt dieses Parlament soeben zur Kapitale der Nation und damit zu seinem eigenen Sitz erklärt hat, obwohl Rom und der Kirchenstaat noch gar nicht zu Italien gehören. Das ist fürwahr ein sehr merkwürdiger Hauptstadtbeschluss, der die chaotische Weise spiegelt, in der das Königreich Italien zu Stande gekommen ist.
Italien wurde 1859 und 1860 durch ein Reihe überstürzter Feldzüge und nicht weniger überraschender Revolutionen geeint. Der Dirigent dieses erstaunlichen Geschehens war der Premierminister des nicht besonders starken norditalienischen Königreichs Piemont-Savoyen, der Graf Camillo Benso di Cavour. Cavour ist einer der größten Politiker, die je gelebt haben; er kam Bismarck an taktischer Raffinesse gleich und übertraf ihn an Weisheit und gesellschaftlicher Einsicht bei weitem. Cavour war 1810 in Turin als Sohn einer alten Adelsfamilie mit französischen und schweizerischen Verbindungen geboren worden, zu einer Zeit, als Italien Teil von Napoleons Imperium war. Dessen Regime hatte seine Familie nahegestanden. Gleichwohl nahm Cavour die übliche adlige Laufbahn in der piemontesischen Monarchie: Kadettenanstalt, Kammerherr, Dienst in der Provinz. Doch der junge Herr tat sich bald um in der Welt, reiste nach Paris und London und wurde zu einem Anhänger des Neuen, von Freihandel, technischem Fortschritt und liberaler Verfassung. Das rückständige Italien interessierte ihn zunächst nicht. Er wurde daheim politisch verdächtig und musste sich daraufhin der Bewirtschaftung von Familiengütern widmen. 1848, im Revolutionsjahr, begann seine politische Karriere, erst als Publizist, dann als Parlamentarier. Ende 1847 hatte Cavour mit dem liberalen Grafen Cesare Balbo die Zeitschrift Risorgimento begründet. Ihr Name – »Wiederauferstehung« – wurde bald zum parteiübergreifenden Begriff für die Bewegung zur Erneuerung Italiens, später zum Epochenbegriff. Nach der Revolution – in Piemont keine Restaurationszeit, sondern eine Reformära – stieg Cavour zum Minister auf und beherrschte als Vertrauensmann des Königs und als brillanter parlamentarischer Taktiker bald die Politik seines Landes. Cavour war eine nüchterne Spielernatur, ein klarsichtiger Phantast, ein Hasardeur mit festen liberalen Prinzipien. Mit zweiundzwanzig Jahren schrieb er in einem Brief, es habe eine Zeit gegeben, »wo ich es für ganz natürlich hielt, eines schönen Morgens als leitender Minister des Königreichs Italien aufzuwachen«.13 Zu diesem Zeitpunkt gab es Italien noch gar nicht; es war in mehrere Staaten aufgeteilt und nicht mehr als ein geographischer Begriff. Der kleine, dickliche, bebrillte Junggeselle mit seiner unermüdlichen Arbeitskraft, seinem raschen kombinatorischen Verstand und seiner Fähigkeit, Politik nicht nur in Situationen, sondern in langfristigen Kräfteverhältnissen zu konzipieren, machte sich daran, seinen Traum zu verwirklichen; nicht, wie Bismarck, im Interesse einer rückständigen Klasse und der Monarchie, sondern als Sachwalter jenes juste milieu dynamischer Bürger und Unternehmer, die aus Italien endlich wieder ein modernes Land machen wollten.
Cavour verführte den französischen Kaiser Napoleon III., einen ruhmsüchtigen, aber auch generösen Monarchen, der die Italiener fast romantisch liebte, 1859 zum Krieg gegen Österreich. Österreich beherrschte damals Oberitalien bis zum Kirchenstaat mit Ausnahme Piemont-Savoyens, teils direkt, wie die Lombardei und Venezien, teils indirekt durch Satellitenregime, wie in der Toskana, teils durch Besatzungstruppen wie in den nördlichen Teilen des Kirchenstaats. Schon diese Dominanz Österreichs musste dem Kaiser der Franzosen den Versuch zu einer Neuordnung Italiens lohnend erscheinen lassen; außerdem hatte Cavour ihm für die Waffenhilfe die Abtretung Nizzas und des savoyischen Stammlandes der piemontesischen Monarchie in den Westalpen zugesagt. Napoleons Politik in Italien folgte darüber hinaus einem allgemeinen Gesichtspunkt: Sie sollte eine Neuordnung Europas in Nationalitäten anstoßen – und war so gegen die Grundlagen der Staatenordnung von 1815 gerichtet. Insgeheim plante Napoleon außerdem, einen italienischen Thron für seine Dynastie zu gewinnen. Für beide Partner ging es um eine Umwälzung, wenn auch mit unterschiedlicher Zielrichtung. Bald zeigte sich, dass Cavour die Revolution besser in seinem Sinne zu lenken verstand als Napoleon III. Im Juni besiegten die vereinten Armeen Piemonts und Frankreichs die Österreicher bei Magenta und Solferino. Sofort traten in den ober- und mittelitalienischen Kleinstaaten revolutionäre Bewegungen hervor, die den Anschluss dieser Provinzen an das Königreich Savoyen betrieben. Napoleon III. versuchte, diese revolutionäre Sturzflut einzudämmen, indem er die Seite wechselte und mit Österreich einen Separatfrieden schloss. Doch das half nichts mehr, die nationale Bewegung war unaufhaltsam geworden. Ein Jahr später gelang den Norditalienern ein noch erstaunlicherer Coup. Der Freiheitskämpfer Giuseppe Garibaldi, einer der erfolgreichsten Berufsrevolutionäre aller Zeiten, brach im Mai 1860 mit einer Schar von tausend Freiwilligen von Genua nach Sizilien auf – Cavour und sein König waren Mitwisser dieses revolutionären Unternehmens. Garibaldi brachte das Königreich Neapel innerhalb weniger Wochen zum Einsturz. Bereits am 7. September zog der Freischärler als umjubelter Diktator in Neapel ein, während der letzte König Süditaliens sich in den Kirchenstaat flüchtete. Am 11. September 1860 schrieb Garibaldi an den piemontesischen König Viktor Emanuel II.: »Ich werde auf die Hauptstadt Italiens mit der ganzen Schnelligkeit zumarschieren, welche die Umstände mir erlauben. «14 Die Hauptstadt Italiens, das war für Garibaldi Rom.
Es war der gefährlichste Moment im italienischen Einigungsprozess. Eine Welle von patriotischem Kampfgeist war durch das ganze Land gegangen und hatte mit den überlebten und verhassten Regimen aufgeräumt. Oberitalien war dem einzigen einheimischen König von selbst in den Schoß gefallen, Unteritalien war von einem Revolutionär erobert worden, dessen Popularität auf das Jahr 1849 zurückging. Damals war Garibaldi der Feldherr der römischen Republik gewesen, und er hatte mit beispiellosen Opfern und großem militärischen Geschick diesen Revolutionsstaat gegen eine erdrückende Übermacht mehrere Wochen lang verteidigt. Bereits dieser heldenhafte Kampf war eine nationalitalienische Angelegenheit gewesen, denn die römische Republik hatte sich als Hauptstadt und Vorkämpferin eines zu gründenden republikanischen Nationalstaats verstanden. Ohne die Erinnerung an die römischen Kämpfe von 1849 wäre der stürmische Siegeslauf von 1859/60 nicht möglich gewesen. Er hatte das Tempo und den Schwung einer hinreißenden Opernstretta, entzündet nicht nur von nationalem Furor, sondern beschwingt auch von menschheitsbeglückender Hochherzigkeit.
Doch nun musste die Regierung in Turin das Tempo abrupt drosseln. Die Eroberung Roms wäre in diesem Moment militärisch mühelos zu bewerkstelligen gewesen; politisch hätte sie eine Katastrophe bedeutet. Sie hätte unweigerlich zum Krieg mit Frankreich geführt, in den unvermeidlich auch Österreich wieder eingegriffen hätte, und alles wäre wieder verloren worden. Aber noch schlimmer als ein weiterer Nationalkrieg wäre eine gewaltsame Auseinandersetzung mit dem Papst gewesen. Denn selbstverständlich waren die Italiener in jener Zeit in überwältigender Mehrheit zutiefst katholisch. Außerdem war der Papst das Oberhaupt von annähernd zweihundert Millionen Gläubigen in der ganzen Welt. Ihn in seiner Wehrlosigkeit anzugreifen und mit einer erdrückenden Übermacht zu besiegen, in Rom mit brutaler Gewalt einzumarschieren oder auch nur eine Revolution dort zu provozieren – das hätte in die Fundamente der Nation, die da soeben errichtet wurde, unheilbare Zwietracht gesenkt und sie bei allen übrigen katholischen – und selbst bei den nichtkatholischen – Nationen moralisch auf ewig ins Unrecht gesetzt. Garibaldi wollte Viktor Emanuel auf dem Kapitol zum König von Italien ausrufen. Das hätte den Sieg der Revolution über die konstitutionelle Monarchie Savoyens bedeutet und eine Staatsgründung von vornherein vereitelt. Fremde Mächte wären unverzüglich eingeschritten, und alles wäre in Scherben gegangen.
Die Regierung Cavour und der König ließen reguläre Truppen Garibaldi entgegenmarschieren und die mittelitalienischen Gebiete des Kirchenstaats besetzen – gegen den vergeblichen Widerstand einer eilends zusammengetrommelten päpstlichen Armee. Dem Papst verblieb nun nur noch Rom und dessen Umland. Doch noch einmal war er in letzter Minute vor der Nation gerettet worden. Mit Plebisziten wurde der Anschluss der neuen Provinzen von Sizilien bis zu den Marken im Oktober und November 1860 besiegelt und so notdürftig legitimiert. Am 17. März 1861 nahm Viktor Emanuel II. (Vittorio Emanuele II.) den Titel des Königs von Italien an – in voller Länge lautete seine Amtsbezeichnung: »Viktor Emanuel II., durch göttliche Vorsehung und das Votum der Nation König von Italien«.15 Der König zählte sich weiter nach seinen Vorfahren, berief sich also auf das Geblütsrecht; zugleich war er der Verfassung und dem Volk verpflichtet. Seine Legitimität kam aus zwei Quellen, einer alteuropäischen und einer modernen. Diese doppelte Legitimität hat in den folgenden Jahren bis 1871 die Außenpolitik Italiens stark geprägt. Das Land war eine neue Macht, nicht vorgesehen in der seit 1815 immer wieder erneuerten europäischen Ordnung, die das Zusammenleben der Staaten auf dem Kontinent regelte. Italien war die Frucht einer Revolution. Doch diese Revolution, so lautete die Botschaft der italienischen Diplomatie an Europa, war in konservative und legitime Bahnen gelenkt worden durch die piemontesische Monarchie. Das konstitutionell monarchische Italien wollte ein Faktor der Stabilität werden. Die nationale Monarchie beendete die jahrzehntelangen Unruhen auf der von fremden Mächten besetzten Halbinsel, indem sie das nationale Selbstbestimmungsrecht der Italiener mit den Sicherheitsbedürfnissen der europäischen Staatenpolitik versöhnte. Doch gleichzeitig konnte das neue Land Europa gegenüber immer wieder auf die Kraft seiner revolutionären Partei verweisen und diese so auf seine eigenen Mühlen lenken: Denn besser sei es, so verkündete die italienische Diplomatie, die noch offenen nationalen Forderungen – Venedig und sein Hinterland waren noch österreichisch, und Rom eine durch fremde Soldaten geschütze Enklave – mit der neuen monarchisch-konstitutionellen Regierung zu lösen, als einer revolutionären Bewegung die Initiative zu überlassen. Zudem erklärten sich der König und seine gemäßigten Minister außer Stande, der Wucht der öffentlichen Meinung in diesen nationalen Grundanliegen auf Dauer widerstehen zu können.
Cavour, der Minister einer bescheidenen Mittelmacht, hatte über Nacht einen neuen Staat geschaffen. Er hatte dies mit zwei Helfern vollbracht: mit Napoleon III. und mit Garibaldi, mit Frankreich und der Revolution. Beide helfenden Mächte, das katholische Frankreich und die nationale Revolution, waren leidenschaftlich interessiert an Rom; sie waren geradezu besessen davon. Aber auch das neue Königreich glaubte nicht ohne Rom auskommen zu können. Das ist der Kern der »Römischen Frage« bis zum Sommer 1870, zumal der legitime Besitzer der Ewigen Stadt, der Papst, nicht im Mindesten daran dachte, freiwillig auf die Urbs zu verzichten. Dies ist der Knoten, den die verschlungene Formulierung des italienischen Hauptstadtbeschlusses vom März 1861 bezeichnet.
An den vier Enden des Doppelknotens – italienische Monarchie, italienische Aktionspartei, Frankreich, Papsttum – wurde in den folgenden Jahren so hartnäckig gezogen, dass er schon bald unauflösbar schien. Daran trugen neben den objektiven Gegebenheiten viel Kurzsichtigkeit und Unvernunft, vor allem auf päpstlicher und französischer Seite, die Schuld. Jedenfalls hat es in der europäischen Geschichte kaum eine Frage gegeben, die von der Diplomatie über so lange Zeit so ergebnislos hin und her gewälzt worden ist wie die Römische Frage. Dass es ein Stellungskrieg werden würde, war im Frühjahr 1861, als der Hauptstadtbeschluss fiel, bereits entschieden. Am 18. März hatte der Papst in einer Ansprache die Versöhnung der katholischen Kirche mit dem liberalen Staat grundsätzlich für unmöglich erklärt. Diese sehr allgemein gehaltene Stellungnahme war der Schlusspunkt unter Geheimverhandlungen, die Cavour im Winter 1860/61 mit dem Vatikan geführt hatte, um zu einem friedlichen Einvernehmen zu kommen. Dass die Römische Frage nicht zu jenen gehöre, die man mit dem Schwert lösen könne, hatte Cavour im Parlament bereits am 2. Oktober 1860 verkündet – eine deutliche Festlegung gegen die revolutionäre Partei, die der Kurie jene Entlastung geben sollte, die ihr Verhandlungen sinnvoll erscheinen ließ. Tatsächlich wurden Cavours Vorschläge von der Kurie angehört, jedoch bald verworfen. Cavour verlangte Rom und den restlichen Kirchenstaat für Italien und bot dafür materielle Sicherheit und geistig-geistliche Freiheit für den Papst; er sicherte ihm die Ehrenstellung eines Souveräns ohne Territorium, freien Verkehr nach außen sowie Besitztümer zu, die seine Unabhängigkeit gewährleisten sollten. Sein wichtigstes Argument war: Der verbleibende Kirchenstaat kann diese Sicherheit und Unabhängigkeit nicht garantieren, denn er lässt sich nur durch die Intervention einer fremden Macht aufrechterhalten, in dessen Abhängigkeit der Papst somit steht. Warum sollte nicht die einheimische Macht Italien dieselbe Funktion übernehmen und damit zugleich der Friede zwischen dem Papsttum und dem modernen Nationalstaat hergestellt werden?
Cavours Versöhnungsversuch steht im Zusammenhang eines weit gespannten Ideengebäudes, das auf Versöhnung von Kirche und modernem Staat, ja von Religion und liberaler Kultur abzielte – seine berühmte Formel, die er noch auf seinem Totenbett im Juni 1861 auf den Lippen hatte, lautete libera chiesa in libero stato (eine freie Kirche in einem freien Staat). Die Kurie sagte bald in definitiver Weise nein – gewiss geleitet von starken ideologischen Motiven, aber auch von der Hoffnung, der rasch entstandene feindliche Staat werde ebenso rasch wieder zerfallen. Sie ließ sich auch in den folgenden Jahren nicht mehr zu einer Modifikation ihrer Haltung bewegen. Die Argumente des Papsttums waren von so wuchtiger Einfachheit, dass an ein Verrücken dieser Klötze zu einem Kompromiss kaum zu denken war: Erstens seien die Eroberungen der Kirchenterritorien illegitim gewesen, ein Bruch der internationalen Rechtsordnung; zweitens sei der Kirchenstaat notwendige Voraussetzung für die Freiheit des Papstes bei der Ausübung seinen spirituellen und administrativen Pflichten, und diese Freiheit wiederum liege im Interesse der gesamten katholischen Kirche mit ihren Millionen Gläubigen. Außerdem, so fügte Pius IX. hinzu, widerspreche es seinem Amtseid, den Besitz der Kirche, der ihm als Wahlmonarchen nur treuhänderisch überlassen worden sei, zu vermindern. Mit diesem letzten Argument hatte die Kurie sich jeden Ausweg selbst versperrt, denn ein eidbrüchiger Papst war gewiss keine erträgliche Vorstellung.
Definitiv und in seiner Feierlichkeit festlegend war allerdings auch der italienische Hauptstadtbeschluss vom 27. März 1861. Und ebenso wenig zu einem Kompromiss bereit war naturgemäß die Partei der italienischen Revolution, deren Volksheld Garibaldi und deren intellektueller Kopf Giuseppe Mazzini war. Die beiden, der scharfsinnige, fanatische und alle Argumente überspitzende Berufsagitator Mazzini und der großherzige, tapfere, aber intellektuell engstirnige, von seiner Mission selbstgerecht durchdrungene Freiheitskämpfer Garibaldi, kannten einander aus der heroischen Zeit der römischen Republik von 1849, deren Diktator Mazzini und deren Feldherr Garibaldi gewesen war. Sie und ihre Anhänger machten unentwegt Druck und drohten mit neuen Freischärleraktionen nach dem Muster des Zugs der Tausend. Im Sommer 1862 startete Garibaldi den nächsten Versuch: In Sizilien sammelte er 1300 Freiwillige, die er in Marsala, dem Ort, an dem er 1860 gelandet war, den pathetischen Schwur Roma o morte (»Rom oder den Tod«) ablegen ließ und setzte nach Süditalien über, um nach Rom zu marschieren. Am 29. August kam es am Aspromonte zu einer Schlacht zwischen den Freischaren und der italienischen Armee, bei der auch Garibaldi verwundet wurde. Italiener hatten auf Italiener geschossen, und dabei ging es um eine Sache, die bei allen Parteien eigentlich gar nicht umstritten war: dass Rom Hauptstadt Italiens werden solle. Roma o morte blieb der bittere Schlachtruf des linksradikalen nationalen Lagers in all diesen Jahren bis zu den erhitzten »Meetings« im August und September 1870, als die Regierung sich nicht zu bewegen schien.
Die Schlacht am Aspromonte zeigt die extreme Konsequenz jenes Zwiespalts zwischen Legitimität und Revolution, den die italienische Regierung auszugleichen hatte. Doch sie konnte den Druck, unter dem sie stand, weitergeben, indem sie sich als Ordnungsmacht empfahl, die am Ende auch für Rom die bessere Lösung hätte. Schwankend und undeutlich blieb die Haltung Napoleons III., des Schiedsrichters in der römischen Angelegenheit. Er hielt an der Okkupation der Ewigen Stadt fest, teils aus Furcht vor den französischen Katholiken, auf die er seine Herrschaft zunehmend stützte; teils weil der französische Fuß auf der italienischen Erde das neu geeinte Land in seiner Abhängigkeit hielt. Gleichzeitig jedoch war ihm die Intransigenz der Kurie lästig und peinlich, und mehr als ein Mal hat er sie zu Reformen in ihrem Staat gedrängt, was diese beharrlich zurückwies. Die französische Diplomatie produzierte unentwegt neue Kompromissvorschläge, deren Scharfsinn in krassem Missverhältnis zu ihrer Durchführbarkeit stand. Peinlich für Frankreich war, dass die Anwesenheit französischer Truppen in Rom jenem großen Prinzip der internationalen Beziehungen widersprach, das gerade Napoleon zur Richtschnur seiner Außenpolitik erklärt hatte: dem Prinzip der Nichteinmischung (non-intervento) beziehungsweise des Selbstbestimmungsrechts der Völker. Italien war auf diesem Prinzip gegründet worden; warum sollte es den Römern versagt bleiben? Die Römische Frage erschien bald grundsätzlich unlösbar, denn in ihr trafen nicht nur reale Interessen aufeinander, sondern Prinzipien: auf der einen Seite die Selbstbestimmung der Kirche, auf der anderen das Bürgerrecht der Römer und das Recht der italienischen Nation, sich ihre Gestalt ohne fremde Einmischung zu geben.
Um das vorerst unauflösbare Patt der Interessen und Prinzipien erträglich zu machen, griffen Frankreich und Italien im Sommer 1864, als eine Krankheit des Papstes die Möglichkeit einer Sedisvakanz mit allen Unvorhersehbarkeiten und Gefahren heraufbeschwor, auf einen Kompromissvorschlag zurück, den Cavour wenige Wochen vor seinem Tod entworfen hatte. Er sah vor, dass Frankreich seine Truppen aus dem Kirchenstaat zurückziehen, Italien sich aber im Gegenzug verpflichten solle, das Territorium des Papstes nicht nur nicht anzugreifen, sondern dessen Grenzen sogar zu garantieren und jedenfalls vor Angriffen der revolutionären Partei zu schützen. Außerdem sollte Italien die Aufstellung einer eigenen päpstlichen Verteidigungsarmee tolerieren, für die die Kurie auch Söldner aus dem katholischen Ausland anwerben durfte. Hinzu kam die Bestimmung, dass Italien die Schulden des Kirchenstaats gemäß dem Anteil der von ihm okkupierten Territorien übernehmen solle. Für beide Parteien bot diese Neufestlegung des Status Quo – mehr war es nicht – beträchtliche moralische und reale Vorteile. Frankreich wurde die diskreditierende und kostspielige Besetzung eines fremden Gebiets los, ohne doch den Papst einfach seinem Schicksal zu überlassen; Italien konnte sich rühmen, dass mit dem Vertrag die letzten Soldaten einer fremden Macht den Boden des Landes verließen und sich zugleich als jene konservative Macht empfehlen, die es im Interesse seines immer noch unsicheren internationalen Ansehens unbedingt darstellen wollte. Und in Rom wurde nach anderthalb Jahrzehnten jener Zustand hergestellt, den gemäßigte und radikale Patrioten immer verlangt hatten: Der Papst und seine Regierung waren wieder allein zu Hause, en face mit den Untertanen, und mussten zeigen, ob sie imstande waren, ihr Gebiet mit friedlichen und zivilisierten Mitteln zu regieren. Ein italienischer Parlamentarier nannte das »jenes große Experiment, ob die Regierung des Papstes sich selbst auf den Füßen halten kann«.16 Den Römern waren damit noch nicht die Rechte eines liberalen Staats eingeräumt, aber immerhin war ihnen der Druck einer militärischen Besatzung, die jeden Aufstandsversuch erstickt hätte, genommen worden.
Doch verbanden die beiden Vertragsparteien gerade mit jenem »großen Experiment« unterschiedliche Hintergedanken: Die Franzosen bauten darauf, dass Rom ruhig bleiben würde, während die Italiener im Stillen hofften, dass sich das Regime des Papstes nicht würde halten können, dass also früher oder später eine innere Revolution ausbrechen und eine neue Situation schaffen würde. Einem »großen Experiment« war allerdings auch das Königreich Italien ausgesetzt: ob es nämlich selbstbeherrscht und verantwortlich genug wäre, nach dem Abzug der Franzosen die Existenz eines päpstlichen Roms zu garantieren. Für den Fall, dass beide Vertragsparteien zwar ihren Verpflichtungen nachkämen, aber die päpstliche Regierung gleichwohl zusammenbräche, für den Fall einer Revolution in Rom also, behielten sich Frankreich und Italien volle Handlungsfreiheit vor – Letzteres allerdings außervertraglich, in diplomatischen Noten. Diese Aktionsfreiheit in einer neuen Situation sollte 1870 noch eine Rolle bei der diplomatischen Vorbereitung des Feldzugs nach Rom spielen.
Napoleon III. wollte auf jeden Fall die Möglichkeit ausschließen, dass das Regime des Papstes in unmittelbarer Folge des Vertragsabschlusses mit Italien zusammenbräche. Daher wurde der Abzug der französischen Truppen auf zwei Jahre nach Vertragsabschluss terminiert. Außerdem verlangte der französische Kaiser von den Italienern noch eine zusätzliche Garantie für den Verzicht auf eine gewaltsame Eroberung Roms. Italien sollte ein halbes Jahr nach der Ratifizierung des Vertrags seine Hauptstadt an einen anderen Ort verlegen. Diese Bestimmung war in dem ursprünglichen Cavourschen Entwurf nicht enthalten, und sie stellte ein umstürzendes Element in dem neuen Vertrag dar. Seit dem Hauptstadtbeschluss zu Gunsten Roms von 1861 war Turin, die Residenz des Königreichs Piemont-Savoyen, die provisorische Hauptstadt des italienischen Königreichs – provisorisch konnte sie schon deshalb nur sein, weil das rasch geeinte Land auf Dauer kaum bereit gewesen wäre, sich von einer so peripher gelegenen Residenzstadt ohne nationale Traditionen aus regieren und oft genug dominieren zu lassen. Vor allem im Süden war die piemontesische Verwaltung mit ihrem an Frankreich geschulten Schematismus und den ungewohnten Steuerlasten sowie der allgemeinen Wehrpflicht schnell derart verhasst, dass es den nach Rom geflohenen neapolitanischen Bourbonen leicht gelang, mit Hilfe Tausender entlassener Offiziere der aufgelösten neapolitanischen Armee einen regelrechten Bürgerkrieg zu entfesseln, der das junge Königreich jahrelang in Atem hielt. Im Interesse der inneren Einheit war eine rasche Verlegung des Regierungssitzes wünschenswert, denn sie konnte den gesamtitalienischen Charakter des neuen Systems stärken. Napoleon hoffte, durch Forcierung einer neuen Hauptstadt einen späteren Umzug nach Rom überflüssig zu machen. Welchen neuen Regierungssitz die Italiener wählen würden, war ihm dabei gleichgültig.
Die Hauptstadtklausel des Vertrags wurde in einen Anhang des italienisch-französischen Vertrags verbannt, da sie eine inneritalienische Angelegenheit betraf. Sie war eine schwer zu schluckende Kröte für Italien, denn sie schien auf einen Widerruf des Hauptstadtbeschlusses von 1861 hinauszulaufen. Als die Septemberkonvention – so genannt nach ihrem Unterzeichnungsdatum am 15. September 1864 – in der Öffentlichkeit bekannt wurde, löste sie sogleich wütende Reaktionen aus. In Turin kam es zu tagelangen Aufständen, deren Niederschlagung mehr als dreißig Todesopfer forderte, und die nationalistische Linke tobte noch Wochen später in den Parlamentskammern gegen die Hauptstadtklausel der Konvention. Der König, der schweren Herzens zugestimmt hatte – er hing an seiner Heimatstadt Turin und brach in Tränen aus, als ihm das Resultat der Geheimverhandlungen zwischen seiner Regierung und dem französischen Kaiser mitgeteilt wurde –, entschied sich im Einklang mit den führenden Generälen, die nach einem gut zu verteidigenden Ort Ausschau hielten, für Florenz und gegen Neapel. Von Florenz aus, so glaubte er, würde man später einmal leichter nach Rom gehen als von Neapel, das auf eine vielhundertjährige Tradition als Residenz eines großen Königreichs zurückblickte und an dem bleischwer der eigensinnige und schwer zu gewinnende Süden hing. Die moderate Regierung versuchte wohl oder übel und sehr zum Ärger Frankreichs, den Umzug nach Florenz als Schritt nach Rom zu verkaufen – als mache die Hauptstadt auf halbem Wege von Turin nach Rom eben für ein paar Jahre Rast in der schönen Toskana.
Die Septemberkonvention ist eines der missverständlichsten Vertragswerke der Diplomatiegeschichte, in seiner Doppeldeutigkeit die präzise Fixierung eines kalten Krieges der Prinzipien. Frankreich hoffte damit, die Römische Frage erst einmal aus der Welt geschafft zu haben, für Italien war die Konvention nur eine neue Form des Provisoriums. Für die Italiener galt: Frankreich zieht seine Truppen aus Rom zurück, also rücken wir die Hauptstadt schon einmal etwas näher an Rom heran. Für die Franzosen aber war es umgekehrt: Italien wählt sich endlich eine neue Hauptstadt, also können wir uns aus Rom zurückziehen. Auf jeden Fall bedeutete es für das ungefestigte Selbstbewusstsein der Nation eine schwere Demütigung, dass die Wahl des neuen Regierungssitzes auf auswärtigen Druck hin zu Stande kam. Italien war, wie sich bald zeigte, nicht wirklich bereit, sich an die Konvention zu halten; das ahnte man auch in Frankreich, und deshalb hielt man sich auch dort nicht ganz ehrlich an sie. Trotzdem blieb die Septemberkonvention bis zum Hochsommer 1870 der einzige internationale Vertragstext, auf den man sich in der Römischen Frage beziehen konnte; und immerhin enthielt er die diplomatische Selbstverpflichtung Italiens auf Cavours Versprechen, nach Rom keinesfalls mit Gewalt und nur im Einklang mit Frankreich zu gehen.
»Den Tod ja, aber Rom nie!«
Die Kurie, unbeteiligte Dritte und zweite Hauptbetroffene des Vertragswerks, war nicht gefragt worden und reagierte mit äußerstem Misstrauen. Der Leiter der päpstlichen Außenpolitik war seit 1849 der Kardinal Giacomo Antonelli, ein schlauer, aber engstirniger Diplomat, der seine große Geschicklichkeit bedingungslos in den Dienst der glaubensstarken Starrheit seines Herrn setzte. Er war ein Kabinettspolitiker alten Stils, zu dem die Außenwelt fast ausschließlich in Gestalt von Tischvorlagen, Relationen, Depeschen, Zeitungsausschnitten, Geheimberichten drang.
Bild 31
Giacomo Antonelli (1806 – 1876), Kardinalstaatssekretär unter Pius IX.
Der unermüdliche Arbeiter verließ Rom nie, er kannte keine Sommerfrische; die Vertreter der europäischen Mächte, die ihn besuchten, mussten sich über viele Treppen in ein hoch gelegenes Turmzimmer bemühen, so dass es hieß: »Wenn die Diplomaten beim Kardinal eintreten, kommen sie immer mit klopfendem Herzen. «17 Antonelli war liebenswürdig, aber nie offen; hinter galanten Umgangsformen – sein modisches Tabakschnupfen und seine koketten Schnallenschuhe fielen auf – verbarg er die Verbitterung und das Misstrauen, das der verzweifelten Lage der Kurie in jenen Jahren entsprach. An irgendwelche italienische Zusagen wollte sie nicht glauben, und so sondierte Antonelli bei den katholischen Mächten, um neue Garantien zu erhalten – ohne greifbares Ergebnis.
Immer noch hoffte Rom auf den Zerfall Italiens, das damals mit Finanz- und Sicherheitsproblemen zu kämpfen hatte. Am 8. Dezember 1864 publizierte der Papst seine Enzyklika Quanta cura mit ihrem berüchtigten Anhang, dem Syllabus, der die Auflistung der wichtigsten Irrtümer des Liberalismus enthielt, darunter auch die These, »die Diener der heiligen Kirche und der Römische Pontifex sind von aller Sorge für weltliche Dinge und Herrschaft auszuschließen«18. In Frankreich löste der Syllabus weithin Entsetzen aus, bei Kaiser Napoleon einen Wutanfall; der Kirche wurde seine Verbreitung untersagt. Italien blieb gelassener, war man durch die Generalverurteilung der modernen Welt doch plötzlich in einer großen respektablen Gesellschaft und nicht mehr allein als Kirchenräuberstaat. Außerdem erlaubte die prinzipielle Verdammung des Liberalismus dem Papst Kompromisse in Einzelfragen, denn nun konnten Verhandlungen mit Italien nicht mehr als Öffnung für einen innerkirchlichen Liberalismus verstanden werden. So schrieb Pius IX. im März 1865 einen persönlichen Brief an den italienischen König (die nie anerkannte Regierung wurde damit umgangen) und bat um Gespräche vor allem über eine Bereinigung der vielen Vakanzen auf italienischen Bischofssitzen. Es bedurfte allerdings zweier Verhandlungsphasen mit unterschiedlichen Bevollmächtigten, bevor die Gesprächspartner sich zwei Jahre später auf die Neubesetzung von 37 Bistümern, darunter Turin und Mailand, einigen konnten.
Unterdessen war die Umsetzung der Septemberkonvention längst in Gang gekommen: Italien bezog seine neue Hauptstadt. Am 3. Februar 1865 verließ König Viktor Emanuel Turin, um seine Residenz in Florenz zu nehmen. Im Sommer folgten die Regierung und das Parlament. Bald begann auch der Abzug der französischen Truppen aus Rom und der Aufbau einer eigenen kleinen Armee des Papstes. Die Kurie befürchtete gleichwohl das Schlimmste, und als im Dezember 1866 die letzten französischen Truppen Rom verließen, zitierte Pius IX. zum Abschied den Apostel Paulus: »Wenn ihr hinweggenommen sein werdet, wird mein Haus von wilden Tieren überfallen werden.«19 In den Augen vieler Offiziere will man nach der Ansprache Tränen gesehen haben.
Allerdings ließ Frankreich den Papst nicht ganz allein, und dies war die erste der vielen Verletzungen der Septemberkonvention. In Civitavecchia blieb ein Corps von zweitausend französischen Freiwilligen aus Antibes zurück, in Italien die Antiboini genannt; die Franzosen ließen bald erkennen, dass deren Position halbamtlich zu verstehen sei, denn schon im Juli 1867 erklärte ein durchreisender französischer General den Legionären, Deserteure würden nach französischem Kriegsrecht bestraft. Regierung und Presse in Florenz empörten sich, und nicht ohne Recht sprach man von einer maskierten Fortsetzung der Okkupation. Allerdings hatte schon im Frühjahr 1867 die revolutionäre Agitation Garibaldis wieder eingesetzt, die auf einen neuen Freischärlerzug nach Rom abzielte. Ein heftiger Notenwechsel zwischen Paris und Florenz setzte ein, und in Rom befürchtete man völlig zu Recht, dass die Aktionspartei innere Aufstände provozieren würde, um der europäischen Öffentlichkeit die Unfähigkeit des Papstes, mit seinen Untertanen in Frieden zu leben, zu beweisen.
Garibaldi stand damals auf einem neuen Höhepunkt seines militärischen und politischen Ansehens, denn eine von ihm aufgestellte Freiwilligenarmee hatte sich ganz im Gegensatz zum offiziellen italienischen Heer im Krieg von 1866 beachtlich geschlagen. Garibaldi hatte die Österreicher zweimal besiegt. Italien dagegen, das im Bündnis mit Preußen in das österreichische Gebiet im Veneto einmarschiert war, wurde zwei Mal vernichtend geschlagen, zu Lande in Custozza, dann aber auch noch in einer Seeschlacht im Adriatischen Meer, wo die Landmacht Österreich unter Admiral Tegetthoff bei Lissa das alte Seefahrervolk souverän besiegte. Zwar erhielt Italien durch die preußischen Siege trotzdem den versprochenen Lohn – Venedig und sein Hinterland –, doch unter äußerst demütigenden Bedingungen: Österreich trat seine letzten italienischen Provinzen erst an Frankreich ab, das sie dann an Italien weitergab. Vor diesem Hintergrund war Garibaldis Agitation 1867 überaus ernst zu nehmen, nicht nur militärisch, sondern vor allem durch den psychologischen Druck, den sie auf die italienische Regierung ausübte. Garibaldi reiste überall in Italien herum, hielt von allen Balkonen große Reden und berief sich auf seine Funktion als Oberbefehlshaber der römischen Republik von 1849, die er nie aufgegeben habe, und die ihn zum einzigen »legitimen« Herrscher Roms mache. Zwischen ihm und den parlamentarischen Vertretern der Linken gab es bald keine Uneinigkeit mehr darüber, dass man nach Rom marschieren müsse, sondern nur noch über die Frage, ob man nicht besser zuvor auf eine Revolte in Rom selbst warten solle.
Die Regierung wiegelte zunächst ab, allerdings im Verlauf des Sommers immer halbherziger. Als Grenzzwischenfälle sich häuften, rechtfertigte sie sich mit der Unübersichtlichkeit und Länge der kurvenreichen, oft durch Gebirgszonen führenden Grenze des Kirchenstaats, die mit letzter Sicherheit nicht zu schützen sei. Im September verstand sie sich dazu, Garibaldi zu verhaften, doch wurde er bald auf die ihm gehörende Insel Caprera verfrachtet, wo man ihn zu überwachen versprach. Inzwischen aber neigte sich bei König und Kabinett in Florenz die Meinung zur revolutionären Lösung. Ministerpräsident war damals der gemäßigte Linke Luigi Ratazzi – derselbe, der 1862 am Aspromonte bei dem ersten Versuch Garibaldis, Rom auf eigene Hand zu erobern, auf den Volkshelden hatte schießen lassen müssen. Ratazzi sah nun die Möglichkeit, diese Scharte auszuwetzen; außerdem war er unzutreffend informiert über die Entschlossenheit in Paris, einem italienischen Versuch zur Eroberung Roms entgegenzutreten. Seine Frau, eine Verwandte Napoleons III., war damals wegen eines von ihr verfassten Skandalromans über die florentinische Gesellschaft – Les chemins du paradis (Die Pfade des Paradieses) war sein Titel – nach Paris ausgewichen, von wo aus die schöne Romanschreiberin ihrem Gemahl ebenso flammende wie verkehrte Berichte über Napoleons angebliche Sympathien für die italienische Sache schickte. Ratazzi und König Viktor Emanuel hofften, das Rezept Cavours von 1860 wiederholen zu können: erst die Revolution marschieren und die Proteste über der Regierung herabregnen zu lassen, um dann die Früchte einzusammeln und anschließend diplomatisch zu legitimieren. Die beste Sicherung Roms sei dessen Eroberung, schrieb im Oktober 1867 der König in aller Unschuld an Napoleon III. und fügte hinzu: »Was die politische Frage betrifft, können wir uns hinterher verständigen. «20 Eine Woche später entwich Garibaldi aus Caprera und begab sich, teilweise in Sonderzügen der italienischen Eisenbahn, zur Grenze des Kirchenstaats, obwohl er mit einem offiziellen Haftbefehl gesucht wurde. Ratazzi war am 19. Oktober zurückgetreten, doch die Ministerkrise zog sich trotz der nationalen Notlage über acht Tage hin, während derer die alte Regierung im Amt blieb und sich aufgeregt unentschieden verhielt: Weder stoppte sie die Garibaldiner, noch vermochte sie sich rechtzeitig zu einem Einmarsch im Kirchenstaat durchzuringen. Unterdessen gingen in Rom zwei Bomben hoch, und es fanden vereinzelte Krawalle statt, die von zwei miteinander konkurrierenden Befreiungskomitees organisiert wurden, doch als revolutionäre Legitimationskulisse für ein italienisches Eingreifen reichte das gewiss nicht.
Die unprofessionelle Komödie – im Norden der päpstlichen Provinzen wurden schon Plebiszite für den Anschluss an Italien abgehalten – endete in einem verdienten Desaster. Am 26. Oktober 1867 ließ Napoleon neue Truppen in Richtung Kirchenstaat einschiffen. Sie kamen gerade noch rechtzeitig, um Garibaldis Freiwilligenheer, das schon mit der Armee des Papstes focht, am 3. November bei Mentana nordöstlich von Rom mit den nagelneuen Repetiergewehren von Chassepot niederzuschießen. Die bunt zusammengewürfelte Schar – darunter elegante junge Männer im Frack, aber auch viele armselige Gestalten, deren Schuhe aus allen Sohlen lachten, wie die Italiener damals sagten – stob auseinander. Ratazzi war endlich am 27. Oktober ersetzt worden, womit auch die Rolle von Madame Ratazzi als Sonderbotschafterin beendet war. Politisch-diplomatisch bedeutete der italienische Bruch mit allen Bestimmungen der Septemberkonvention einen schweren Rückschlag für das Land. Es hatte seinen Ruf als Ordnungsmacht erst einmal verspielt. Die Franzosen standen wieder in Rom und dachten nicht mehr ans Fortgehen. Und in Frankreich waren die Sympathien, ja selbst die Geduld für Italien restlos aufgebraucht. Am 5. Dezember 1867 sprach der französische Staatsminister Rouher im Parlament unter donnerndem, minutenlangem Applaus: »Wir erklären im Namen der französischen Regierung, Italien wird sich Roms nie bemächtigen, niemals! Niemals wird Frankreich dulden, dass seiner Ehre und dem Katholizismus solche Gewalt angetan wird. Niemals, niemals haben wir Italien zu glauben gestattet, dass es sich Roms bemächtigen dürfe.«21 Die vielen Jamais dieser Rede dröhnten den italienischen Politikern noch lange in den Ohren, und ihr Nachhall war auch 1870 noch nicht verklungen. Die spitzzüngige und papstfreundliche Kaiserin Eugénie erklärte in Anspielung auf Garibaldis Parole »Rom oder den Tod«: »Den Tod ja, aber Rom nie!«22
Die nächsten zweieinhalb Jahre wurden glanzlos und unerfreulich. Das italienische Parlament versuchte, die schmachvolle Niederlage in einer Debatte zu verarbeiten, die sich nicht weniger als achtzehn Tage hinzog – allein die Rede Rattazzis dauerte drei Tage – und nur durch das Weihnachtsfest überhaupt ein Ende fand. Die Regierung wurde übernommen von dem ältlichen und unbrillanten piemontesischen General Menabrea, dessen Amtsführung schnell unbeliebt wurde, weil er zur Sanierung des Staatshaushalts eine Mahlsteuer einführte, die die ärmsten Schichten besonders traf, weil sie deren Grundnahrungsmittel, das Brot, belastete. Die Folge waren Aufstände, die mit Waffengewalt erstickt wurden. Menabrea kehrte zu einer perspektivlosen außenpolitischen Korrektheit zurück, und etwas anderes blieb Italien auch nicht übrig. Als die Franzosen wieder in Rom eingezogen waren, hatte ihr Oberbefehlshaber in einer Proklamation an die Bevölkerung erklärt: »Ihr kennt uns seit langer Zeit. Wie immer kommen wir, um eine rein moralische Mission ohne eigene Interessen zu erfüllen.«23 Das klang nach langer Zeit auch für die Zukunft, und wirklich war es so, als sei die französische Trikolore über der Hafenfestung von Civitavecchia nie heruntergezogen worden. In Rom begann eine drückende Zeit. Die Schuldigen der Aufstände und Anschläge vom Oktober 1867 wurden nach einem offenkundig manipulierten Strafprozess hart bestraft, und trotz der Gnadengesuche des italienischen Königs wurden mehrere Todesurteile ausgesprochen und vollstreckt; Hass war in Italien die Folge, Entrüstung in Europa.
Die Florentiner Regierung führte derweil wieder einmal Geheimverhandlungen mit der Kurie – über praktische Probleme wie die Besetzung vakanter Bistümer sowie über Pass- und Eisenbahnfragen an der italienisch-pontifikalen Grenze (die Bahnstrecken zwischen dem Norden und Süden Italiens kreuzten mehrfach das kirchliche Gebiet). Doch selbst diese Gespräche blieben ergebnislos. Und als der König Viktor Emanuel im Winter 1868 so schwer erkrankte, dass man um sein Leben fürchtete, da wollte der zuständige Priester ihm zunächst die Absolution verweigern, bis der König die antikirchlichen Gesetze seiner Regierung zurückgenommen habe; erst der Erzbischof von Pisa beendete auf Druck der Regierung diesen geistlichen Eingriff in das Verfassungsleben der Monarchie. Allerdings sollte man sich die Verhältnisse unterhalb der höchsten Ebene zwischen Italien und Rom nicht allzu verbiestert vorstellen: Die kurialen Grenzbeamten winkten Züge und Fahrgäste, darunter auch italienisches Militär, auch ohne Abkommen durch; und ein bedeutender italienischer Politiker aus der Richtung Cavours, Bettino Ricasoli, der mehrfach Ministerpräsident gewesen war, besaß in dem von ihm geliebten Rom eine Villa, in der er sich als Privatmann unbehelligt aufhalten konnte (nur die Gerüchte, dass es in seinem Hause spuke, wollten nicht verstummen). Längst kursierte italienisches Geld frei in Rom. Und als der italienische Thronfolger im Frühjahr 1868 seine Kusine heiratete, entschloss sich eine Gruppe von Damen des römischen Hochadels, der künftigen Königin Italiens einen Kranz aus goldenen Ölbaumblättern zu schenken.
Italien bestand gegenüber Frankreich auf der Wiederherstellung der Septemberkonvention, also Abzug der französischen Truppen gegen italienische Garantie des Kirchenstaats. Doch Napoleon III. und seine Minister dachten nicht daran. Dabei hatte die Regierung in Paris nach dem preußischen Sieg über Österreich, durch den die kleindeutsche Einigung in Sichtweite gekommen war, ein verstärktes Interesse an Italien als möglichem Bündnispartner. 1868 und 1869 wurde monatelang zäh und am Ende ergebnislos über eine Dreierallianz zwischen Frankreich, Österreich und Italien verhandelt. Der König wollte das Bündnis schließen. Doch Frankreich war nicht zur geringsten Konzession in der Römischen Frage bereit. Die Lage der italienischen Regierung war demütigend: Sie hielt sich wieder an die Septemberkonvention, hielt still an den Kirchenstaatsgrenzen und zahlte die übernommenen päpstlichen Schulden ab, aber der andere Partner des Vertrags wollte nicht zu ihm zurückkehren und blieb so bei seinem permanenten Misstrauensvotum gegen die italienische Politik. Das Desaster von Mentana und des darauf folgenden Stillstands bewirkte, dass alle Herzlichkeit aus den italienisch-französischen Beziehungen verschwand, und das hieß auf italienischer Seite, dass die Dankbarkeitsgefühle für die französische Hilfe bei der italienischen Einigung erstarben. Nun zählten nur noch die eigenen Interessen. Diese realpolitische Abkühlung im Verhältnis der beiden Länder sollte sich allerdings schon bald als großer Vorteil für Italien herausstellen. Denn sie sicherte der noch immer nicht ganz selbstständigen Nation in der Krise von 1870 zum ersten Mal die volle diplomatische Handlungsfreiheit und trug so dazu bei, dass Italien nicht in die Katastrophe des zweiten Kaiserreichs gezogen wurde.
Vorerst aber änderte sich an der Blockade nichts, auch nicht, als in Frankreich und Italien neue Regierungen an die Macht kamen; am Jahresende 1869 wurde Menabrea abgelöst von dem moderat rechten Giovanni Lanza, dessen Außenminister, der sehr vorsichtige Emilio Visconti Venosta, ein Garant der Stabilität war. Und in Frankreich kam ein liberales Ministerium unter Émile Ollivier an die Regierung. Doch auch er blieb beim französischen Jamais: Nie würde die französische Flagge aufhören, über Civitavecchia zu flattern, um den Papst zu schützen, erklärte er im Gespräch mit einigen klerikalen Parlamentsabgeordneten noch im Juli 1870, als die preußisch-französische Kriegsgefahr schon am Horizont stand. Selbst der milde Visconti Venosta ließ daraufhin in Paris mitteilen, dass Italien einen Vertrag auf Dauer nicht einhalten könne, den die andere Partei nicht erfülle – irgendwann werde Italien sich an die Septemberkonvention nicht mehr gebunden fühlen und daher auch die Bezahlung der päpstlichen Schulden einstellen.
Jedem Beobachter hätte klar sein müssen, dass die Gewinnung Roms als Hauptstadt schon auf mittlere Sicht eine Lebensfrage für die Monarchie in Italien werden würde. Die nationale Partei auf der Linken fing wieder an, sich zu regen. Garibaldi war nach der Niederlage von Mentana verhaftet und auf seine Insel Caprera abgeschoben worden. Er hatte auf seinen Parlamentssitz verzichtet, weil er nicht in die Nähe einer Regierung kommen wollte, »die man die Leugnung Gottes nennen könnte«24. Die Parlamentsopposition hatte danach die abwartende Haltung der gemäßigten Kabinette zunächst mitgetragen. Im Frühjahr 1870 kam es allerdings in norditalienischen Städten wie Pavia, Piacenza, Bologna und Ravenna wieder zu Unruhen, bei denen Mazzini-Anhänger
eISBN 978-3-641-03721-5
© 2001 by Siedler Verlag, Berlin einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH
Alle Rechte vorbehalten, auch das der fotomechanischen Wiedergabe. a a a
Kartenzeichnungen: Ditta Ahmadi, Berlin Satz und Reproduktionen: Bongé+Partner, Berlin a a
www.randomhouse.de
Leseprobe