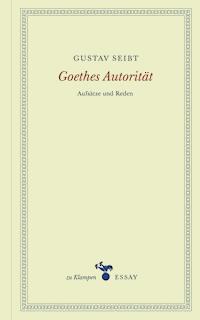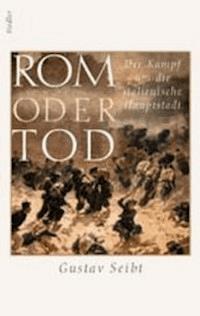19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Gustav Seibt erweitert seit vielen Jahren in brillant formulierten Essays für die «Süddeutsche Zeitung» den Horizont seiner Leserinnen und Leser, indem er das Besondere des Augenblicks in die größeren Zusammenhänge einordnet und die historischen Tiefendimensionen hinzufügt. Wer seine luziden Texte liest, der entkommt der temporalen Platzangst der Zeitgenossenschaft zumindest für die Dauer der Lektüre durch das befreiende Gefühl, die «Lage» besser verstanden zu haben. «In außerordentlichen Zeiten» vereinigt die besten Texte Seibts zu einer Vermessung der Gegenwart – vom Umgang mit Flüchtlingen bis zum prekären Verhältnis zu Russland. Gustav Seibt gehört zu den angesehensten deutschen Publizisten. Der vielfach für seine Arbeiten ausgezeichnete Historiker und Journalist ist bekannt für seine unbeirrbar humanistisch-liberale Grundhaltung, die weitgespannten historischen Kenntnisse und vor allem für seine stets klug durchdachten Argumentationen. In der «Blindheit des Moments», in der wir alle gefangen sind, gelingt es Seibt immer wieder, über die tagespolitische Stellungnahme hinaus das Grundsätzliche einer Situation aufzuzeigen und durch historische Betrachtungen oder Vergleiche ein besseres Verständnis dessen zu ermöglichen, was gerade geschieht oder auf dem Spiel steht. Dieser Band gibt die Gelegenheit, sich in makelloser Prosa über die Grundfragen unseres Zeitalters – Flüchtlinge, Islam und Islamismus, die Fliehkräfte der EU oder das prekäre Verhältnis zu Russland – zu informieren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Gustav Seibt
IN
AUSSERORDENTLICHEN ZEITEN
Politische Essays
C.H.Beck
ZUM BUCH
«Fabelhaft. Mit diesem Buch komme ich thematisch locker bis zur nächsten Zeitenwende.»
Harald Schmidt
Gustav Seibt erweitert seit vielen Jahren in brillant formulierten Essays für die «Süddeutsche Zeitung» den Horizont seiner Leserinnen und Leser, indem er das Besondere des Augenblicks in die größeren Zusammenhänge einordnet und die historischen Tiefendimensionen hinzufügt. Wer seine luziden Texte liest, der entkommt der temporalen Platzangst der Zeitgenossenschaft zumindest für die Dauer der Lektüre durch das befreiende Gefühl, die «Lage» besser verstanden zu haben. «In außerordentlichen Zeiten» vereinigt die besten Texte Seibts zu einer Vermessung der Gegenwart – vom Umgang mit Flüchtlingen bis zum prekären Verhältnis zu Russland.
ÜBER DEN AUTOR
Gustav Seibt ist Essayist, Historiker und Literaturkritiker. Er arbeitet seit 2001 für die Süddeutsche Zeitung. Zu den zahlreichen Ehrungen, mit denen er ausgezeichnet wurde, gehören der Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa und der Hildegard-von- Bingen-Preis für Publizistik. Bei C.H.Beck sind von ihm erschienen: «Goethe und Napoleon. Eine historische Begegnung» (52010) und «Mit einer Art von Wut. Goethe in der Revolution» (2014).
INHALT
1: GUTE GEISTER
DIE UNENTBEHRLICHEN – HELFER OHNE STAAT
23. 09. 2015
SIEBZIG, VERWEHT – UNSERE JAHRE MIT HELMUT SCHMIDT
12. 11. 2015
FÜRCHTEN MÜSSEN WIR NUR DIE FURCHT – FRITZ STERN IN SEINEM JAHRHUNDERT
19. 05. 2016
KOMMUNIST FÜR DREI TAGE – VORTEILE DES ABSTANDS: MARTIN MOSEBACH
30. 07. 2021
UND DAS ROMANTISCHE IST DAS GESUNDE – KARL HEINZ BOHRERS VERMÄCHTNIS
09. 09. 2021
EIN GROSS GESTRÖM VON SPRACHE – OH YEAH! IM KOSMOS VON ECKHARD HENSCHEID
13. 09. 2021
PAPA ERKLÄRT DIR SEINEN ISLAM – GOTT IST GRÖSSER: NAVID KERMANIS RELIGION
24. 01. 2022
WELTTHEATER ZUM FRÜHSTÜCK – 1972: GOLO MANN ALS ERZIEHER
28. 01. 2022
2: KIPPPUNKTE DER DEMOKRATIE
DER VERRAT DER KAVIARLINKEN – FRANZÖSISCHER SCHICKSALSROMAN
21. 05. 2016
DIE UNBEHERRSCHTHEIT DES HERRSCHERS – DIE RÜCKKEHR DES TYRANNEN
16. 11. 2016
DER KULT DES EIGENEN – WARUM NATIONEN NICHT VÖLKISCH SIND
14. 09. 2016
STÄMME UNTER SICH – DAS GIFT DES SEPARATISMUS
09. 10. 2017
AM ANFANG STAND DAS NEIN – VON PARLAMENTARISCHER VERANTWORTLICHKEIT
22. 11. 2017
ENTHEMMUNG – DIE AFD IST KEINE BÜRGERLICHE PARTEI
03. 09. 2019
TRIUMPH DER FRECHHEIT – DIE GRENZEN DES ZIVILEN UNGEHORSAMS
23. 11. 2020
ALLES UMSONST – KONSERVATIVISMUS ALS SPEKTAKEL
22. 10. 2022
AKTIVISMUS FÜR ANFÄNGER – POLITIK OHNE BERUF
25. 10. 2022
MEHR SOFORTISMUS WAGEN – DIE STAATSFORM DER UNZUFRIEDENHEIT
16. 02. 2023
3: WAS IST FREIHEIT?
SPENDEN FÜR DEN WIRT – VOM ALTERN DES LIBERALISMUS
20. 01. 2010
UNSERE ART ZU LEBEN – KAMPF DER WERTE, KAMPF DER KULTUREN?
17. 11. 2015
DAS MANTRA DER MITTE – DAS FALSCHE BILD VOM HUFEISEN
12. 02. 2020
MÜSSEN WIR WÄHLEN? – PANDEMISCHE KOSTENRECHNUNGEN
26. 03. 2020
MUT, SICH DES EIGENEN GESCHMACKS ZU BEDIENEN – LIBERALISMUS ALS LIFESTYLE
22. 04. 2020
ABSTAND SCHAFFEN – MASKEN UND DIE GRENZEN DER GEMEINSCHAFT
25. 04. 2020
GEWITTER IN ZEITLUPE – KATASTROPHEN OHNE PLÖTZLICHKEIT
26. 10. 2020
NIMM DAS, FDP – BÜRGERSEIN IST EINE POLITISCHE ROLLE
18. 03. 2021
HEISST «FREIHEIT» NUR NOCH «ICH WILL»? – VOM TROTZKÖPFCHEN-LIBERALISMUS
15. 11. 2021
4: VOM EINWANDERN
DER ISLAM IM STIMMBRUCH – AUS DEM IRRGARTEN DER ANALOGIEN
31. 05. 2007
SCHAFFT VIEL MEHR ÖZDEMIRS! – EIN AUFSTIEG: TÜRKEN IN DEUTSCHLAND
19. 11. 2008
MINARETT UND HAKENKREUZ – VON DEN GRENZEN DER TOLERANZ
14. 12. 2009
KOMMEN UND GEHEN – DEUTSCHE MIGRATIONSGESCHICHTEN
04. 12. 2014
KONSERVATIVE TUGENDEN – EINE NOTWENDIGE KLÄRUNG
31. 01. 2015
DEUTSCHLAND, STUNDE NULL – MARTIN AMIS BLICKT AUF UNSER LAND
02. 01. 2016
WILDE GEWALT – VOM EWIGEN THEATER DER GRAUSAMKEIT
19. 06. 2018
DAS VOLK UND SEINE GRENZEN – DIE DOLCHSTOSSLEGENDE UNSERER TAGE
08. 05. 2019
5: DU BIST DEUTSCHLAND
DEUTSCHE, JUDEN, ISRAEL – FREMDE FREUNDE
05. 02. 2005
DEUTSCHE WELTEN – KEIN MUFF, NIRGENDS
26. 11. 2005
JENE MENSCHEN – DAS JAHRHUNDERT DER HOMOSEXUELLEN
11. 01. 2014
GUTES GEFÜHL – HEIMAT IST NIE SELBSTVERSTÄNDLICH
23. 12. 2017
DAS ERB-ÜBEL – DIE VIELEN ANTISEMITISMEN
12. 10. 2019
RIESENMOBILIAR – VOM ALTERN DER DENKMÄLER
29. 06. 2020
EIN AMBIVALENTER TAG – 9. NOVEMBER: ERPRESSTE VERSÖHNUNG
09. 11. 2021
NAMEN SIND AUCH NUR TRÜMMER – UMBENENNUNG ÜBERFLÜSSIG: PREUSSEN OHNE BOTSCHAFT
18. 01. 2023
6: DAS RECHT DES STÄRKEREN
PUTIN, NAPOLEON UND DIE ANDEREN MUSSOLINIS – DAS VÖLKERRECHT BRAUCHT KEINE ANALOGIEN
04. 04. 2014
VON DANZIG NACH DONEZK – PUTIN VERSTEHEN, AUF POLEN HÖREN
02. 09. 2014
STOLZE VÖLKER – NATIONALISMUS AUS VERLORENER EHRE
03. 07. 2015
DER KÖRPER DES HERRSCHERS – VON DESPOTIE UND GESUNDHEIT
06. 10. 2020
DIE ANGST VOR DEM UNBERECHENBAREN DIKTATOR – DIE ADRESSATEN DES PAZIFISMUS
28. 02. 2022
AM ENDE – STAATSFORM UND NIEDERLAGE
16. 03. 2022
DAS HEILIGE RECHT DES BELEIDIGTEN – GAR NICHT ARKAN: DIPLOMATIE UND ÖFFENTLICHKEIT
03. 05. 2022
7: EUROPAS CHANCEN
DIE INSEL DER UNBETEILIGTEN – ENGLANDS NAHE FERNE ZU EUROPA
28. 01. 2013
CIVIS EUROPAEUS SUM – DIE VORFAHREN DES SANFTEN MONSTERS
08. 05. 2014
STÄRKE AUS VERWUNDBARKEIT – VON DEN VORTEILEN DER SCHULD
17. 04. 2015
DANKE, ENGLAND! – DER BREXIT UND DAS EUROPA DER BÜRGER
10. 12. 2018
WAHN UND WERTE – DIE ZWEI PROJEKTE DES WESTENS
13. 06. 2020
IM WELTGARTEN – EINE PLANETARISCHE HOFFNUNG
10. 06. 2022
AUSSERORDENTLICH SIND DIE ZEITEN IMMER – EIN NACHWORT
1
GUTE GEISTER
DIE UNENTBEHRLICHEN
HELFER OHNE STAAT
23. 09. 2015
Erinnert sich noch jemand an die Oderflut von 1997? Damals drohte eine vollständige Überschwemmung des erst 250 Jahre alten Bruchs mit seinen von Friedrich dem Großen angelegten Dörfern. Die Hilfe kam schnell und beherzt. Matthias Platzeck machte sich einen Namen als «Deichgraf». Die Bundeswehr half, Sand zu verteilen und stopfte die Löcher an den zerbröselnden Schutzwällen. Mit dabei waren Hunderte Freiwillige, die sich in die Reihen stellten, in denen Sandsäcke weitergereicht wurden. Man sprach von einer zweiten, «inneren» Wiedervereinigung – der im Osten neue Staat, vor allem sein Heer, hatte sich mit der Gesellschaft solidarisch gezeigt.
Und so ging es bei allen folgenden Flutkatastrophen, auch der den Bundestagswahlkampf entscheidenden von 2002: Die staatlichen Verwaltungen, die Bundeswehr, das Technische Hilfswerk waren zur Stelle, um Bürgern zu helfen, die selbst schon anpackten. Live-Sendungen transportierten die Solidarität in alle trockenen Wohnzimmer.
Ist es nicht auch jetzt wieder so? Die Züge mit Flüchtlingen kommen an, und am Bahnhof stehen nicht nur Polizei und Rotes Kreuz, sondern auch die helfenden Bürger, die Spenden verteilen und den Geschundenen Mitleid und Sympathie bekunden – selbst wenn der Alltag danach steinig wird, diese Momente bleiben im Gedächtnis. Inzwischen müssen die verantwortlichen Bürgermeister landauf, landab bekennen: Ohne die geballte Hilfe von Freiwilligen wäre der Ansturm nicht zu bewältigen gewesen. Selbst der Bundesinnenminister rang sich einen schmallippigen Dank ab, der allerdings die Bürger erst an dritter Stelle, nach der Polizei und der Verwaltung, nannte.
Wenn er sich da mal nicht in der Rangfolge täuscht. Freiwillige Bürger sind unentbehrlich, das werden sie gern hören. Aber beunruhigend bleibt doch eine bis jetzt nicht recht ins Bewusstsein getretene Tatsache: Bevor der Flüchtlingsansturm zu jener «Krise» wurde, von der die Bundeskanzlerin behauptete, «wir schaffen das», hat keine staatliche Instanz die Bürger zur Mithilfe auch nur ermuntert, sie gar aufgerufen. Die Bürger waren, wie von Zauberhand, schon da, als die Zehntausende anrollten.
Berlin ist das eklatanteste Beispiel. Als die deutsche Öffentlichkeit noch fast ausschließlich von Griechenland sprach, brach die Flüchtlingsverwaltung in Berlin zusammen – eine erst regional bemerkte Katastrophe, die bis heute etwas Unglaubliches hat. Tausende im Freien wartende Flüchtlinge blieben im heißesten Sommer seit Jahrhunderten wochenlang ohne Wasser, ohne Schatten, ohne Toiletten, ohne medizinische Notversorgung. Darunter waren Kriegsversehrte, Traumatisierte, schwangere Frauen, zahllose Kleinkinder. Die örtlichen Stellen – das «Landesamt für Gesundheit und Soziales» (Lageso) und der Bezirkbürgermeister von Mitte – verkündeten allabendlich im RBB-Fernsehen, man «arbeite» an den Problemen. Viel ist davon bis heute nicht zu spüren.
Da organisierte die Initiative «Moabit hilft», die es übrigens schon seit 2013 gibt, eine der spektakulärsten Hilfsaktionen der deutschen Geschichte. Über Nacht wurde eine Grundversorgung für Tausende aufgebaut, man eröffnete eine Spendenkammer, richtete eine Behelfsküche ein, und als diese vom Gesundheitsamt, dem die vorherige Katastrophe egal gewesen war, untersagt wurde («aus hygienischen Gründen»), sprangen private Caterer oder Restaurants der Umgebung ein, um täglich mehrere Tausend Mahlzeiten zu verteilen – ohne dass die Stadt Berlin einen Finger gerührt hätte.
Eine riesige Spendenwelle rollte vor das Lageso, bald gesteuert durch täglich erneuerte Bedarfslisten. Wer helfen wollte, stellte auf Facebook fest, dass es heute an Rasierschaum, Flipflops oder frischer Unterwäsche mangle, fuhr zu einem Großmarkt und besorgte das Nötige. Wenn er dann die von der Verwaltung aggressiv verteidigten Parkverbote vor dem Lageso überwunden hatte, konnten die Artikel sortiert und verteilt werden. Ähnliche Initiativen arbeiten längst in allen Berliner Bezirken. Jeder, der diesen atemberaubenden Vorgang in Echtzeit verfolgen will, kann dies über die sozialen Netzwerke von Stunde zu Stunde tun.
Am vergangenen Samstag etwa mussten nachts 250 Flüchtlinge in einer Lagerhalle in Prenzlauer Berg untergebracht werden. Bevor die Busse ankamen, stand die Bundeswehr zum Bettenaufbau bereit. Allerdings hatte niemand einen Schlüssel zu dem Gelände – also wurde ein Bolzenschneider über Twitter organisiert. Um Mitternacht lagen die Flüchtlinge wenigstens auf Matratzen, denn für den Aufbau von Betten war es zu spät geworden. Getwittert hatte aber nicht etwa die staatliche Verwaltung, sondern die Initiative «Lichtenberg hilft», die zusammen mit dem DRK in Karlshorst ein äußerst effizient organisiertes Notaufnahmeheim betreut.
So begeisternd diese digital vernetzte, dem globalen Kapitalismus abgeschaute «Just-in-time»-Produktion von Hilfe momentan ist, so beunruhigend ist die Umkehrung der Verhältnisse zwischen Freiwilligenhilfe und staatlicher Initiative für den Fernblick. Warum hat die riesenhafte Verwaltung der Stadt Berlin nicht kommen sehen, was ein paar Dutzend erschütterte Bürger zu unverzüglichem Handeln veranlasste? Gewiss, zwischen Verwaltung und Bürgern in Berlin hat sich ein Ton der Gereiztheit eingespielt, der dazu führt, dass selbst der schrillste Alarm nur noch als Gequengel verstanden wird. Berlin ist buchstäblich taub geworden.
Aber Bayern, Sachsen – die konservativen Musterländer? Sachsen hatte schon Schwierigkeiten, das Gewaltmonopol und die Grundrechte in Heidenau zu sichern. Und natürlich war es dieses Staatsversagen, das die Bürgerhilfe in weiten Teilen Deutschlands erst befeuert hat. Die Willkommensinitiativen sind die wirksamste politische Demonstration seit Menschengedenken, der «Aufstand der Anständigen», der als Demo auf dem Marktplatz außer den Teilnehmern niemanden erreicht hätte. Sie versammelt sich nicht unter Spruchbändern und vor Mikrofonen, sondern in Zelten, Kleiderkammern, hinter Kuchentischen und an Bahnsteigen, sie organisiert sich nicht durch offizielle Aufrufe, sondern in den Netzwerken, die auf ihre Weise auch die Flüchtlinge nutzen.
Dieser Kontrast von staatlichem Phlegma – um es freundlich zu formulieren – und zivilgesellschaftlicher Initiative ist etwas Neues in der deutschen Geschichte. Noch 1989/90, als die Massen aus dem Osten Deutschlands strömten, lag die Initiative eindeutig beim bundesdeutschen Staat. Er sorgte für die Verteilung des Begrüßungsgelds, für Notfahrpläne, für Sonderöffnungszeiten bei den Geschäften, für Willkommen aller Art. Die Bürger machten gern mit, klatschten zu Trabi-Paraden und tranken singend «diese Kleinigkeit auf die deutsche Einigkeit». Aber organisiert hat die ganze Sause die öffentliche Verwaltung, bis hin zu logistischen Großleistungen wie der Einführung eines neuen Geldes.
So war es auch bei den Ausnahmezuständen im Zweiten Weltkrieg und den Notzeiten danach gewesen, bei der Unterbringung von Ausgebombten und Vertriebenen. Die Nazi-Diktatur versuchte ohnehin, den Schein einer effizienten Gemeinschaft zwischen Verwaltung, Parteistellen und Volk zu erzeugen, von der Feuerwehr nach dem Luftangriff bis zum Ortsgruppenleiter oder Bürgermeister, der die Einquartierungen organisierte. Diese mit Nachweisen und Marken auch papiergestützte Organisation wurde in der Nachkriegszeit bruchlos fortgesetzt – die Entnazifizierung scheiterte ja auch daran, dass die weiterschnurrende Verwaltung auf die bewährten Kräfte nicht verzichten wollte.
Selbst in der Revolution von 1919 sah der Beobachter Ernst Troeltsch vor allem Pensionsberechtigte durch die Sonntage spazieren, was in seinen Augen die Aussicht auf eine fundamentale Veränderung stark verringerte. 1945 funktionierten die S-Bahn-Netze und die Zugfahrpläne im Rahmen des Möglichen unverzüglich weiter, auch die Post wurde rasch wieder zugestellt. Die Idee, man könne ein paar Tausend Menschen fremder Herkunft unversorgt und ohne Auskünfte vor einem Amt einfach liegen lassen, hätte der klassische deutsche Beamte bis gestern für unvorstellbar gehalten. Aber in der Hauptstadt Deutschlands ist es bis zu dieser Stunde achselzuckend akzeptierte Realität mit präziser Adresse: Turmstraße, Moabit.
Wird Deutschland also auch administrativ ein «Hippie-Staat», um die britische Kritik am moralischen deutschen Herbstmärchen zu variieren? Freuen kann man sich darüber jedenfalls auf Dauer nicht. Berlin leistet sich seit Jahren in Kreuzberg und Friedrichshain große Zonen manifester Rechtlosigkeit: Weder im Görlitzer Park noch im RAW, der Partyzone im ehemaligen Reichsbahnausbesserungswerk, ist man zu nächtlichen Uhrzeiten vor Diebstahl und Überfall gefeit, ganz zu schweigen von dem geduldeten Dauerverstoß gegen die Betäubungsmittelgesetze.
Gerade läuft eine Kampagne gegen geschmuggelte Zigaretten über deutsche Plakatwände: «Klar rauch ich für die Mafia». Aber die Drogenmafia kontrolliert weite Teile von Kreuzberg und Neukölln, und jeder, vom Innensenator bis zur Bezirksbürgermeisterin, weiß es. Am Südrand des Mittelmeers beginnt eine Völkerwanderung – aber der deutsche Staat verlässt sich auf Bürgersinn und Antifa, auf eine Volksbewegung namens Willkommenskultur. Nein, Deutschland schafft sich nicht ab, aber es ist schon dabei, sich neu zu erfinden.
SIEBZIG, VERWEHT
UNSERE JAHRE MIT HELMUT SCHMIDT
12. 11. 2015
Die Jahre des Kanzlers Helmut Schmidt begannen mit den «Grenzen des Wachstums» – der Club of Rome erhielt für seine Studie 1973 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels –, mit dem Ölschock samt autofreien Sonntagen. Sie endeten mit den bis dahin größten Demonstrationen der deutschen Geschichte, die sich gegen die von Schmidt angestoßene Nachrüstung richteten. Ölschock und Raketenwinter rahmen die «bleierne Zeit» des westdeutschen Terrorismus, der mit einer Serie von Morden und Entführungen zwischen 1975 und 1977 einen blutigen Höhepunkt erreichte und das Land in eine Bürgerkriegsstimmung versetzte.
In der zeitdiagnostischen Debatte kursierten alarmistische Krisenbegriffe wie «Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus» und «Unregierbarkeit», die von links und von rechts die Funktionsfähigkeit eines politischen Systems anzweifelten, das damals, vor der späteren Hochschätzung des Verfassungspatriotismus, durchaus höhnisch mit einem Kürzel bezeichnet wurde: FDGO, freiheitlich-demokratische Grundordnung. Der Hohn entstand, weil sich Anwärter auf den Staatsdienst seit 1972 regelmäßige Überprüfungen ihrer Verfassungstreue gefallen lassen mussten.
Das galt als «Überwachungsstaat» und «Gesinnungsterror». Wer abgelehnt wurde, sah sich einem «Berufsverbot» ausgesetzt. Im Kampf gegen den linksradikalen Terrorismus, der sich mit dem Kürzel RAF auf die Rote Armee Stalins und die Bomberflotten der Royal Airforce im Zweiten Weltkrieg berief, griff der Staat zu so hässlichen Maßnahmen wie «Rasterfahndung» und «Kontaktsperre». Gemeint waren generalisierter Verdacht mit Straßen- und Wohnungskontrollen sowie Behinderungen in der Kommunikation zwischen Untersuchungshäftlingen und ihren Anwälten.
Kein Zweifel also, Schmidt regierte ein hysterisches, stark polarisiertes Land. 1976 setzten die Unionsparteien ihren Wahlkampf unter das Zeichen von «Freiheit statt Sozialismus». 1980, als Franz Josef Strauß Kanzlerkandidat war, konterten Schmidt und seine SPD mit dem Vorwurf autoritärer Unkontrolliertheit. In anthologischen Filmen wie «Deutschland im Herbst» und «Der Kandidat» zeigten Meisterregisseure wie Alexander Kluge und Rainer Werner Fassbinder das depressive Bild eines Landes am Rande zur Diktatur.
Dabei hatten die neuen sozialen Bewegungen, die sich für Umweltschutz, gegen Atomkraft, für Frauen- und Schwulenrechte einsetzten, längst zu einer Umsteuerung des Protests von Systemopposition zu alternativen Lebensformen geführt. Unter Helmut Schmidt, dem leitenden Angestellten der BRD (so beschrieb er sich selbst), wurde die deutsche Gesellschaft bunt. Die Pilzköpfe der Hippiezeit wuchsen zu wilden Haargebirgen, und Schmidt musste sich schon als Verteidigungsminister mit einem umstrittenen «Haarerlass» für die Bundeswehr an die neue Mode anpassen – dass sein eigener Scheitel dabei penibel blieb, verstand sich von selbst.
Man muss an den aufgeregten Zeithintergrund erinnern, um eine der wichtigsten Leistungen des Bundeskanzlers Schmidt zu würdigen: Er ließ sich nicht verrückt machen. Nach dem Mord an Generalbundesanwalt Siegfried Buback im April 1977 sagte er: «Die Mörder wollen ein Gefühl der Ohnmacht erzeugen. Sie wollen die Organe des Grundgesetzes verleiten, sich von freiheitlichen und rechtsstaatlichen Grundsätzen abzukehren. Sie hoffen, dass ihre Gewalt eine bloß emotional gesteuerte, undifferenzierte, unkontrollierte Gegengewalt hervorbringe, damit sie unser Land als faschistische Diktatur denunzieren können. Diese Erwartungen werden sich nicht erfüllen. Der Rechtsstaat bleibt unverwundbar, solange er in uns lebt.»
Das war in einer Kirche gesprochen, und es antwortete auch auf besorgte Anfragen von ausländischen Intellektuellen wie Alfred Grosser und Jean-Paul Sartre, die im bundesdeutschen Abwehrkampf gegen den Terrorismus totalitäre Gefahren erkannten. Es reagierte aber auch auf Versuchungen, den Terror mit kurzen Prozessen zu beantworten. Schmidts damals altmodisch anmutendes, kirchlich geprägtes Staatsethos bewährte sich in der Krise der Schleyer-Entführung und bei der Befreiung der Lufthansa-Maschine Landshut in Mogadischu. Dass Schmidt fest blieb, war das eine; dass er glaubhaft unzynisch handelte, als er ein Menschenleben opferte und andere in Gefahr brachte, das andere, vielleicht wichtigere. Denn natürlich wusste Schmidt, dass er durch den Befehl, die Landshut zu stürmen, das Leben Hanns-Martin Schleyers aufs Spiel setzte. Eine Entscheidung ohne Schuld konnte es nicht geben. Wenige Tage später saß er beim Trauergottesdienst mit versteinerter Miene neben der Witwe und den Söhnen.
In der Epoche des auslaufenden politischen Radikalismus berief sich Schmidt, der anders als Willy Brandt Distanz zu den Schriftstellern des Landes hielt, auf Verantwortungsethik. Sie leitete ihn beim schwersten Kampf seiner Kanzlerschaft, der sicherheitspolitischen Grundentscheidung des von ihm angestoßenen Nato-Doppelbeschlusses von 1979.
Durch die deutschen Ostverträge und die Schlussakte von Helsinki war der Sowjetunion ihre mittelosteuropäische Vormachtstellung international garantiert worden. Da lag es nahe, auf dem Weg zu einer rein europäischen Sicherheitsordnung weiterzugehen, um die Blockkonfrontation, die Deutschland teilte, schrittweise aufzulösen. Das wollten Vordenker der Entspannungspolitik wie Egon Bahr.
In dieser Logik dachte allerdings auch die Sowjetunion, als sie sich Atomwaffen zulegte, die nur noch Westeuropa bedrohten. Der europäischen Friedensverlockung entsprach auf einmal auch eine innereuropäische Bedrohungslage. Es war Schmidt zu verdanken, dass die pazifistische Verlockung und die europäische Drohung die Nato nicht spalteten. Ihr von Schmidt formuliertes Angebot an die Sowjetunion lautete: Beiderseitiger Verzicht auf Mittelstreckenraketen oder westliche Nachrüstung, innerhalb von vier Jahren, bis 1983.
Um das durchzusetzen, musste sich Schmidt gegen eine Friedensbewegung bewähren, die zwei Jahre lang die Straßen und Plätze des Landes mit Hunderttausenden füllte und dabei neue expressive Protestformen wie Sitzblockaden, Menschen- und Lichterketten, Freiluftgottesdienste und sogar öffentlich nachgestellten Atomtod entwickelte. Der Weltweise Schmidt, den wir aus den vergangenen Jahrzehnten in Erinnerung haben, war am Ende seiner Kanzlerschaft kein allgemein beliebter Staatsmann; bei vielen war er geradezu verhasst. Sein Ton galt als schneidend, junge Parteigenossen wie Lafontaine sprachen von «Sekundärtugenden», mit denen man auch ein KZ betreiben könne.
Schmidts Primärtugend hieß Realpolitik. Als in der Raketenfrage eine neue Eiszeit drohte, hielt er weiter Kontakt mit Moskau und Ostberlin. Er wagte im Winter 1981 sogar einen Besuch in der DDR, der nicht nur freundliche Bilder mit Honecker aus Schloss Hubertusstock am Werbellinsee hervorbrachte, sondern auch die gespenstische Szenerie der von Einwohnern geräumten Stadt Güstrow, wo Schmidt, der Liebhaber des deutschen Expressionismus, Barlach-Skulpturen sehen wollte.
In denselben Tagen wurde in Polen das Kriegsrecht ausgerufen, um die katholische Arbeiterbewegung Solidarność zu bändigen. Besser so, als ein Einmarsch der Russen, befand Schmidt kühl. Den Menschenrechtsforderungen der Helsinki-Schlussakte, die später eine so zerstörerische Wirkung auf die Regime im Ostblock ausübten, schenkte Schmidt kaum Beachtung. Hier unterschätzte der Realpolitiker die Sprengkraft von Ideen.
Im Kampf um die Nachrüstungspolitik wurde Schmidt einsam in seiner Partei. Eine seiner besten Reden musste er 1983, schon nach seiner Kanzlerschaft, im Bundestag ohne Beifall halten. Da verteidigte er noch einmal den Doppelbeschluss und die Aufstellung der Pershing-Raketen, und dabei wandte er sich besonders an die jugendlichen Pazifisten außerhalb des Parlaments, deren Friedenssehnsucht der Weltkriegssoldat teilte. Schmidt, akkurat gekleidet wie immer, ohne das Gewicht eines Amtes, nachdenklich, fast leise sprechend, wirkte im großen Plenarsaal des bei seiner Rede meist schweigenden Bundestages auf einmal fast fragil; umso beeindruckender war die Entschiedenheit seiner Argumente.
Schmidts politisches Schicksal entschied sich allerdings nicht beim Kampf gegen den Terrorismus oder in der Sicherheitspolitik, sondern auf dem Feld der Ökonomie. Die Ölschocks von 1973 und 1978/79 hatten zu einer Vollbremsung des Nachkriegsaufschwungs geführt. Gleichzeitig hatten sie die Abhängigkeit der Exportnation Deutschland aufgezeigt. Die Zeiten heimischer Wirtschaftssteuerung schienen vorbei zu sein. Schmidt musste sparen und zugleich die deutsche Verantwortung als internationale Konjunkturlokomotive wahrnehmen. Er wurde zu einem zeitweise gefeierten «Weltökonomen», der mit Rambouillet und dem europäischen Währungssystem, der Einrichtung von Weltwirtschaftsgipfeln für Deutschland erstmals globale Aufgaben übernahm. Schmidts Ansehen auf diesem Gebiet kontrastierte aber stark mit ausbleibenden Erfolgen im Inneren: In den späten Siebzigerjahren mussten sich die Deutschen an eine konstant hohe Sockelarbeitslosigkeit von fast fünf Prozent gewöhnen, und das bei erstaunlich hohen Inflationsraten. Schmidt verkündete, ihm sei höhere Inflation lieber als hohe Arbeitslosenzahlen, aber er bekam beides, und das hässliche Wort «Stagflation» bereicherte in den Jahren des «Waldsterbens» das Vokabular des gesellschaftlichen Pessimismus, der Schmidts Kanzlerschaft grundierte. In einem Land, das den Erfolg der Demokratie am wirtschaftlichen Wohlergehen maß, war das eine ungemütliche Erfahrung.
Inzwischen hatten in England und Amerika neoliberale Revolutionen begonnen. Hier konnte Schmidt und wollte vor allem die SPD nicht mitziehen, und das wurde zum Grund seines Sturzes. Wie er ihn inszenierte, indem er die sich davonschleichende FDP des Verrats überführte, war noch einmal eine Meisterleistung des Taktikers Helmut Schmidt. Die dabei entfesselten Redeschlachten des Bundestags beendeten glanzvoll das Jahrzehnt der Polarisierungen, dem Schmidt mit so kühlem Verstand vorgesessen hatte.
Als Schmidt am 9. September 1982 seinen letzten «Bericht zur Lage der Nation» vortrug, wusste er, dass er für die Nachwelt sprach: «Politisches Handeln ergibt sich nicht schon ohne weiteres aus Moral, Ethik oder Theologie. Politisches pragmatisches Handeln bedeutet die vernunftgemäße Nutzung von Mitteln zu einem moralisch gerechtfertigten Ziel, und die Mittel dürfen auch nicht unmoralisch sein. Ich denke oft, dass Politik die Anwendung feststehender sittlicher Grundsätze auf wechselnde Situationen sein muss. Deshalb darf es kein pragmatisches, kein praktisches Handeln ohne die Pflicht, die Bindung an sittliche Grundsätze und Grundwerte geben.»
Hier antwortete der Kant-Bewunderer auf den Vorwurf, er verkörpere nur Sekundärtugenden. Der Pragmatiker, der sich auch gern auf den liberalen Denker Karl Popper berief, zeigte sich, wie schon öfter in seinen letzten Regierungsjahren, als Mann von Prinzipien. Schöner trat kein Kanzler zurück.
Draußen im Lande hatte gerade die Party der Achtzigerjahre begonnen. «German Angst» wurde zum Punk, die neuen sozialen Bewegungen zum generalisierten Pop, während das Bürgertum sich Landhäuser in der Toskana kaufte und historische Bestseller verschlang. Die immer wählerischer werdende Öffentlichkeit trauerte dem Redner Helmut Schmidt nach, bis Richard von Weizsäcker sie von ihren Leiden an der Peinlichkeit Helmut Kohls erlöste. Erst in diesen Jahren wurde Schmidt zum Zeit-Orakel, viel später dann zu einem hanseatischen Konfuzius, der Sentenzen in die Welt entließ wie Rauchkringel.
FÜRCHTEN MÜSSEN WIR NUR DIE FURCHT
FRITZ STERN IN SEINEM JAHRHUNDERT
19. 05. 2016
Am Ende schloss sich in Fritz Sterns langem und in jedem Sinn erfüllten Leben ein Kreis, und zwar kein guter. Als er im Februar, zu seinem 90. Geburtstag, wie so oft zuvor zur Lage der Welt befragt wurde, warnte er vor einem «neuen Zeitalter der Angst». Er erkannte es im Aufstieg einer verjüngten, geradezu erfrischten Rechten in Europa, in der rasanten Drift zu autoritären Regimen, die erst Ungarn und nun Polen erlebten. Das sei «furchtbar», schon die Geschwindigkeit, mit der sich der polnische Szenenwechsel vollzogen hatte, erschreckte diesen großen Zeugen des 20. Jahrhunderts.
Angst als politische Macht stand am Beginn von Sterns wissenschaftlicher Laufbahn. Der Titel seines ersten Buches wurde sprichwörtlich: «Kulturpessimismus als politische Gefahr» («The Politics of Cultural Despair», 1961 erschienen). Der schmale Band analysierte die Kulturpanik der deutschen Rechten im Kaiserreich vor 1914, das Syndrom aus Massenverachtung und Demokratiefurcht, Dekadenzhysterie und Rassenhass, das alle politischen Fehlentscheidungen bis 1945 mitbestimmte, obwohl es sich bei den Urhebern, Paul de Lagarde, Julius Langbehn und Arthur Moeller van den Bruck eher um Ästheten und Kulturkritiker als um politische Denker handelte. Aber sie bestimmten das Klima eines Irrationalismus, der später als «konservative Revolution» verharmlost wurde und heute gern wieder zitiert wird.
Stern interpretierte dieses Denken nicht nur als Ideenhistoriker. Wirksam konnte es werden wegen tiefer Spaltungen und ungeklärter Verfassungslagen im Bismarckschen Reich, das ganze Bevölkerungsgruppen ausschloss und unter Verdacht stellte. Als amerikanischer Staatsbürger sah sich Stern schon durch den Antiterrorkampf seit 2001 zu ähnlichen Analogien und Warnungen gedrängt. Im Herbst 2008 debattierte der kleine, quirlige Mann darüber hitzig mit Karl Heinz Bohrer, der 2003 den Irak-Krieg noch befürwortet hatte. Den Ruin der politischen Kultur Amerikas, der sich in diesen Wochen vollzieht, erkannte Stern hellsichtiger und früher als andere, als unmittelbare Folge des auch inneren «Krieges gegen den Terror» mit seinen Feinderklärungen.
Die düstere Rundung dieses Lebens schien noch zur Jahrtausendwende unvorstellbar. Stern war der Friedenspreisträger des Jahres 1999, und damals konnte er einen gelassen optimistischen Rückblick auf die Epoche werfen, die mit seinem eigenen Leben weitgehend zusammenfiel. Wenn ihn etwas an der neuen «Berliner Republik» störte, dann nicht die Besorgnis vor neuen deutschen Eskapaden, sondern der Name: Berlin sei nicht gerade bekannt für seine leisen Töne. Da sprach ein Landsmann.
Stern wurde im Februar 1926 in Breslau in eine Familie jüdischer Wissenschaftler geboren, die in der Mitte der deutschen Gesellschaft angekommen zu sein schien. Sein Patenonkel war Fritz Haber, der Chemiker und Nobelpreisträger, der am Ende des ersten Weltkriegs für sein Vaterland, das Deutsche Reich, die neuartigen Chemiewaffen entwickelt hatte, deren Einsatz bald als Kriegsverbrechen galt. Diese bürgerliche patriotische Herkunft konnte wie bei unzähligen anderen deutschen Juden Verfolgung und Vertreibung nicht verhindern. Zeit seines Lebens sprach Fritz Stern, der 1938 mit seinen Eltern nach New York flüchtete, eine unverwechselbare Mischung aus schlesischem Zungenschlag und amerikanischem Akzent.
Dass er nach dem Krieg in Amerika blieb, hat Stern mit Zufällen der akademischen Laufbahn, nicht mit einer Grundsatzentscheidung erklärt. Doch machten ihn seine Forschungen und Stellungnahmen bald zum Bürger beider Welten, mit den Vorzügen der souveränen Überschau. Sein Hauptthema blieb die deutsche Geschichte seit Bismarck, zu der er nach dem Kulturpessimismus-Buch eine Fülle von ideengeschichtlichen und sozialhistorischen Forschungen beisteuerte. Sein Meisterwerk wurde die Doppelbiografie von Bismarck und seinem jüdischen Bankier Gerson Bleichröder, dem ersten Juden, der seinem Glauben treu blieb und doch ein preußisches Adelsdiplom erhielt. Das 1978 nach über zwanzig Jahren Archivforschung erschienene, fast tausendseitige Werk erzählt die Finanzgeschichte der Bismarckschen Staatsgründung ebenso wie die prekäre Assimilations- und Abstoßungsgeschichte des bürgerlichen Judentums im 19. Jahrhundert.
Hatte Sterns Erstling die realpolitische Kraft von Ideen in den Mittelpunkt gerückt, so zeigte sein Hauptwerk die nur relative Macht der Finanz im politischen Kampf: Ohne Bleichröder hätten die Kriege von 1866 und 1870 nicht finanziert werden können, ohne ihn wäre Bismarck kein reicher Mann geworden, allein sein politischer Einfluss blieb gering, seine Stellung als verachteter «Hofjude» und «schmieriger Börsenjobber» veränderten weder Geld noch Adelstitel.
Trotzdem sah Stern in der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts keine schicksalhafte Notwendigkeit, so viele Ursachen und Voraussetzungen er in der Vorgeschichte der Katastrophe erkannte. Neben der Neigung zur kulturellen Panik nannte Stern, vielleicht überraschend, am Ende seiner Forschungslaufbahn einen schwer fassbaren Faktor, den er «das feine Schweigen» nannte. Das bezog sich auf ein Zitat Nietzsches, der damit Goethes vornehme Zurückhaltung bei seinem Urteil über die Deutschen bezeichnet hatte.
Diese aristokratische Weigerung, mit offenem Visier und freiem Wort am Meinungsstreit teilzunehmen, die Neigung, sich lieber zurückzuhalten und den Lauten, Frechen und Fanatischen das Feld zu überlassen, erkannte Stern als Grundgebrechen einer Gesellschaft, die nie gelernt hatte, liberal nicht bloß zu denken, sondern auch zu leben. Stern war dankbar für jeden Widerständler, den er ehren konnte, aber die Verdruckstheit der besseren Stände, die lieber kulturell übelnahmen als debattierten, blieb ihm, mehr als einzelne Ansichten, ein Hauptfaktor des deutschen Problems im 20. Jahrhundert.
Darum war er seit dem Mauerfall so dankbar für das Neue, das er in Deutschland und Europa erlebte. 1987 hielt er im Bundestag in Bonn die Rede zum Gedenken an den 17. Juni 1953. Er analysierte den Arbeiteraufstand in der DDR nicht als nationales Aufbegehren, sondern als Freiheitskampf, und damit nahm er die friedliche Revolution der Bürgerrechtsbewegung von 1989 hellsichtig vorweg – denn auch sie begann ja nicht als Wiedervereinigungsaufstand, sondern als Kampf um geheime Wahlen, um Meinungs- und Reisefreiheit. Dass sie dann in die Wiedervereinigung, und zwar demokratisch legitimiert, führte, hat Stern nicht nur begrüßt, er hat es aktiv befördert.
Dass er zu den vier Historikern gehörte, die 1990 nach Chequers, auf den Landsitz der englischen Premierministerin eingeladen wurden, um Margaret Thatcher über Deutschland aufzuklären, hat Stern bis zum Schluss mit Stolz erfüllt – zu schwachen Witzen von seiner Sternstunde kicherte er begeistert. Da nämlich gab er bei der äußerst misstrauischen Lady, die persönlich die Cocktails mischte, energisch Entwarnung: Die Deutschen hätten sich geändert, nichts spreche gegen ein vereintes Land. Das hinderte ihn übrigens nicht daran, Thatchers Sozialphilosophie («So etwas wie Gesellschaft existiert nicht») als Ausdruck von widerwärtigem Sozialdarwinismus zu geißeln. Nein, fein schweigen konnte der kleine große Mann mit seiner blitzenden Brille nicht mehr. Er warnte und ermunterte, schrieb bezaubernde Karten zu Artikeln und Büchern, die ihm gefallen hatten. Ihm, der friedlich starb, verklärte sich aber auch nichts in seinen letzten Wochen. Das deutsche Willkommen für die Flüchtlinge begrüßte und bewunderte er, die Spaltung Europas ließ ihn Schlimmes ahnen. Aber er zitierte Franklin Delano Roosevelt: Das einzige, was wir fürchten müssen, ist die Furcht.
KOMMUNIST FÜR DREI TAGE
VORTEILE DES ABSTANDS: MARTIN MOSEBACH
30. 07. 2021
Dem Schriftsteller Martin Mosebach, der am 31. Juli seinen 70. Geburtstag feiert, hat es an einsichtsvollem Zuspruch nicht gefehlt. Die Liste seiner Loberinnen und Lober ist dabei so heterogen, dass auch Skeptiker neugierig werden sollten. Robert Gernhardt, Brigitte Kronauer, Eckhard Henscheid, Navid Kermani, Michael Maar: Wer solche Bewunderer hat, braucht vielleicht nicht einmal mehr große Preise, die Mosebach allerdings auch bekam, darunter den Büchnerpreis.
Doch kontrastiert dieser solide Ruhm mit unübersehbaren Reserven bei der professionellen Literaturkritik. Mosebach blieb bis heute nie unumstritten, nicht wegen politisch-weltanschaulicher Provokationen, sondern wegen gewisser äußerer Signale, die sein Verhältnis zur Gegenwart anzeigen. Die Stichworte lauten «Einstecktuch» und «Katholizismus», sie betreffen, in durchaus willkürlicher Zusammenstellung, den Habitus und den Glauben. Dabei ist der Letztere hier keine Frage des Habitus, also gar kein «Feuilletonkatholizismus», sondern wirklich Religion. Beides verweist auf eine Ferne zur Gegenwart, ein Nichtdabeisein, das offenbar provokanter ist als einzelne Meinungsäußerungen. Was dann auch erklärt, warum sein Fall anders liegt als der von Handke, Walser oder Botho Strauß, denen man konkrete Ansichten übelnimmt, während Mosebach bisher auch mit Provokationen ohne langes Debattengewitter durchgekommen ist. Warum auch einen Autor öffentlich maßregeln, der ohnehin nicht mitspielen mag? Denn Mosebach separiert sich ja auch nicht einmal privatreligiös-feintuerisch; er bleibt weltnah unbeeindruckt bei sich.
Wie katholisch ist der Schriftsteller Mosebach? Dass es die Person ist, bleibt unübersehbar, Mosebach ist eine der geistreichsten Stimmen des Katholizismus, beißend kritisch gegen seine heutige Gestalt, ultramontan, dem römischen Mittelpunkt verpflichtet, in einem historischen Sinn. Dazu gibt es Bücher, Essays und Interviews in Menge, am bekanntesten die Verteidigung der tridentinischen Messe in «Die Häresie der Formlosigkeit».
Zugleich aber hat Mosebach Weltanschauungsliteratur, die die Wirklichkeit nach Meinungen filtert, immer abgelehnt, ohne deren vorübergehende Wirksamkeit zu leugnen. Die Lektüre von Émile Zolas Roman «Germinal» habe ihn für ein paar Tage zum Kommunisten gemacht, bekannte er. Die Privatreligiosität des katholischen Dichters Stefan George hat er scharfsinnig als Sackgasse analysiert und im Gegensatz dazu das Katholische bei James Joyce und Marcel Proust, zwei fast areligiösen Portalfiguren des modernen Romans, herausgearbeitet.
In Prousts Teegebäck Madeleine eine Hostie wiederzuerkennen, die beim Eintauchen in eine Tasse Tee Kaskaden von Erinnerungen auslöst so wie Brot und Wein im Abendmahl die Gegenwart des Herrn bezeichnen, mag noch naheliegen; kühner ist der Anspruch von James Joyce, aus unbearbeiteten sprachlichen Fundstücken des Alltags Kunst zu gewinnen. Auch das ist eine sublimierende «Wandlung», die für Mosebach immer noch am Geheimnis des Glaubens teilhat.