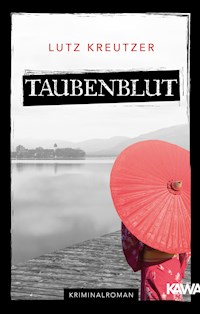Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Hauptkommissar Josef Straubinger
- Sprache: Deutsch
Im Stolberger Stadtteil Gressenich, am Fuß des Kalvarienbergs, wird eine verbrannte Leiche gefunden. Gehörte der als Römer verkleidete Mann der Community des weltweit gefragten Computerspiels »Brass Master One« an? Eines der wertvollsten Messinggefäße aus der Römerzeit, der weltberühmte Gressenicher Eimer, spielt die zentrale Rolle. Doch er birgt einen Fluch, der das ganze Dorf in den Abgrund stürzt. Für Hauptkommissar Straubinger und seine Kollegin Anja Schepp beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Wird es ihnen gelingen, die geheimnisvollen Ereignisse aufzuhalten, bevor alles zu spät ist?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 417
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lutz Kreutzer
Römerfluch
Kriminalroman
Zum Buch
Ein Dorf am Abgrund »Das war eine Art Hinrichtung«, sagte Anja. »Verdammt!«, rief Straubinger. »Kann mir irgendjemand erklären, was das alles mit der Römerzeit zu tun hat?«
In der Grillhütte eines Stolberger Motorradclubs wird ein verbrannter Mann gefunden. Der als Römer verkleidete Tote nährt das Gerücht um die wertvollsten Messinggefäße der Römerzeit, die Gressenicher Eimer. Als dann auch noch unzählige Gamer des beliebten Computerspiels »Brass Master One« aus aller Welt anreisen, um eben diese Eimer zu suchen, gerät alles aus den Fugen. Ein Wissenschaftler und seine dubiose Partnerin stürzen das ganze Dorf in den Abgrund. Bald gibt es weitere Tote. Für Hauptkommissar Straubinger und seine Kollegin Anja Schepp beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Wird es ihnen gelingen, den geheimnisvollen Fluch aufzuhalten, bevor alles zu spät ist?
Lutz Kreutzer, 1959 in Stolberg geboren, schreibt Thriller, Kriminalromane sowie Sachbücher und gibt Kurzgeschichten-Bände heraus. Auf den großen Buchmessen in Frankfurt und Leipzig sowie auf Kongressen coacht er Autoren, ebenso richtet er den Self-Publishing-Day aus. Am Forschungsministerium in Wien hat er ein Büro für Öffentlichkeitsarbeit gegründet. In Hörfunk und TV wurden zahlreiche Beiträge über seine Arbeit gesendet. Seine beruflichen Reisen und alpinen Abenteuer nimmt er zum Anlass, komplexe Sachverhalte in spannende Literatur zu verwandeln. Lutz Kreutzer war lange als Manager in der IT- und Hightech-Industrie tätig. Seine Arbeit wurde mit mehreren Stipendien gefördert. Heute lebt er in München.
Mehr Informationen zum Autor unter: www.lutzkreutzer.de
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2023 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Alexander / stock.adobe.com
ISBN 978-3-8392-7612-9
Zitat
»Was weint ihr um mich? Weint um die Seuche und das Sterbenmüssen aller!«
(Kaiser Mark Aurel um 180 n. Chr. auf dem Sterbebett bei Wien)
Montag, 14. August 2023
Acht Sekunden
Gressenich, am Kalvarienberg, 6 Uhr morgens
Die Beine des Mannes lagen ruhig auf dem Rost. An den Sohlen seiner hochgeschnürten Sandalen klebte feuchter Lehm. Die mit Palmetten bestickte Tunika war bis zur Mitte der Oberschenkel hochgerutscht. Seine rechte Hand hing herab und berührte den Boden. Der goldene Kranz aus Eichenlaub hatte sich in den schwarz gelockten Haaren verheddert, sodass er schief auf seinem Kopf saß und das linke Auge verdeckte. Eine weiße, purpurgesäumte Toga fiel wie ein Brautschleier auf die Pflastersteine und hatte sich dort ausgebreitet. Vom Hinterkopf des Mannes tropfte Blut.
Er brannte.
Kurz riss er die Augen auf. Er wollte schreien, doch der Gürtel, der seine Tunika gehalten hatte, war eng um seinen Hals geschlungen und nahm ihm die Luft. Seine Augen schienen weit nach außen getreten, seine Zunge zitterte, und dann schloss er die Lider. Er hatte sich damit abgefunden.
Heiliger Laurentius! Lichterloh.
Acht Sekunden später war er tot.
3 Monate zuvor: Sonntag, 14. Mai
Brass Master One
Stolberg, in einem Privathaus in der Altstadt
»Was für ’n heißer Scheiß!«, rief Tim mit weit aufgerissenen Augen. »Ich halt’s nicht aus!« Wie durch einen Tremor verursacht hackte er mit zwei Fingern auf die Tastatur ein. Bogengeschosse flogen durch die Luft, machten surrende Geräusche, durchschlugen mit einem dumpfen Klatschen die Körper bärtiger Krieger, Pfeilspitzen durchtrennten Sehnen und Muskeln, trafen durch Augen ins Hirn, Männer stöhnten und starben. Im Hintergrund eine antreibende elektronische Musik. Tim haute auf eine Funktionstaste, die Römische Phalanx bildete die Schildkrötenformation. Unter Tims Zuckungen rückte deren geschlossene Schlachtlinie mit »Ho«-Rufen bei jedem Schritt vor und drang geballt und unaufhaltsam in die feindlichen Linien ein.
Tim hatte es drauf. Durch sein gezieltes Einhacken auf die Tastatur hatte er die Römische Armee voll im Griff, auf seinem Großbildschirm. Jetzt prallten seine Legionäre auf die wilden Reihen der Barbaren und töteten alle, die noch nicht durch die Bogenschützen niedergestreckt worden waren. Nach einigen Minuten riss er die Arme hoch. Seine Römer hatten gewonnen. »Yeahhh!« Er nahm die Arme wieder runter und sah Marie an. »Voll anders als bei Asterix! Die Römer sind einfach supergeil!«
»Maaaann!«, schrie Marie. »Das ist Mist. Zum dritten Mal hab ich nun verloren. Jetzt nimmst du mal die Barbaren!«
»Hey, du hast immerhin ein Bergwerk ausgehoben und ganz schön Punkte gesammelt. Du hast drei Hochöfen gebaut, ein Hammerwerk zur Produktion der Messinggefäße errichtet und sie super verkauft. Du hattest zeitweise viel mehr Punkte als ich.«
»Und warum kommt dann die römische Armee und kämpft gegen meine Leute? Scheißspiel!«
»Weil deine blöden Sunuker zu viel abhaben wollten. Nix Steuern zahlen!«, spottete Tim. »Den Römern als Besatzungsmacht bleibt doch dann kaum mehr etwas übrig. Das können sie nicht zulassen.« Er sprang auf und streckte die Hände in die Höhe. »Kriiiiiieg!«, brüllte er.
»Und dann kriegt man fürs Umbringen auch noch Punkte«, sagte Marie angewidert.
Tim grinste. »Tja, deswegen heißt das ja Krieg, weil man was kriegt! Und es ist eben ein Kriegsspiel.«
»Nein! Ein Strategiespiel. Wer schafft es am besten, ein Dorf zu errichten, ein Bergwerk zu eröffnen und auszubauen, Erz daraus zu bergen, aus dem Messing edle Gefäße zu erschaffen und die Handelsbeziehungen zu fremden Völkern aufzunehmen. Darum geht’s. Um Frieden, nicht um Krieg!«
Tim zischte und schüttelte den Kopf. »Wer schafft es am besten, am Ende die Herrschaft zu erringen, um die Messinggefäße zu verkaufen? Das ist doch das Entscheidende. Und da ist eben Krieg ein Mittel.«
»Ja, ist ja auch irgendwie geil«, gab Marie zu. »Ich wollte ja nur sagen, dass mir die Aufbauphase besser gefällt als die Zerstörung.«
»›Brass Master One‹ ist das beste Computerspiel der letzten Jahre!«, rief Tim. »Das Schlachtengetümmel ist so echt, als wäre man selbst mittendrin. Und das hier bei uns! Mega! Sogar die Amis spielen das. Ist momentan in den Charts auf Platz 10 angelangt! Platz 10 in den USA, das muss man sich mal geben! Und auch Koreaner, Australier, Japaner. Einfach alle, die ganze Welt spielt ›Brass Master One‹. Und die Russen kaufen es auch.«
»Du weißt aber, dass in dem Spiel die größte Gefahr nicht vom Krieg, sondern von der Seuche ausgeht«, sagte Marie. »Die kann auch deine Soldaten erwischen und umbringen.«
»Quatsch! Ich kenne keinen Spieler, den sie im Spiel wirklich erwischt hätte.«
»Weil du es nicht wahrhaben willst. Fünf sind schon ausgeschieden. An der Seuche gestorben, die damals angeblich zwei Kaiser das Leben gekostet hat. Ob es die wirklich gegeben hat?«
»Klar, aber die Pest kriegt im Spiel nur, wer die Götter nicht genug ehrt und wer den Matronen nicht genug spendet«, ergänzte Tim.
»Und, spendest du genug?«, fragte sie.
Tim druckste. »Ja, jeder zehnte Teil, den ich verdiene, wird gespendet. Dann passiert schon nix.«
»Wie sind die bloß auf Gressenich gekommen?«
»Na, weil hier zur Römerzeit eben die beste brass production …«
»Oh Mann! Was heißt ’n das schon wieder?«, wollte Marie wissen.
»Messingproduktion, ›brass‹ heißt Messing«, erklärte Tim mit der überheblichen Mimik des Besserwissenden. »Die berühmteste Messingproduktion im ganzen Römischen Reich war, wie es aussieht …«, Tim machte eine einladende Geste mit den Händen und hob die Brauen, »in deinem Dorf, in Gressenich!«
»Und diese Göttin? Diese miese Schlampe!«
»Nur, weil sie dich in die Pfanne haut!« Tim lachte. »Zickenkrieg, oder wat?«
»Diese Bitch! Hat mich dauernd fertiggemacht!«
»Weil du nix auf die Reihe bringst. Sie will, dass du noch mehr Messing produzierst, dass du heilige Eimer wie am Fließband herstellst. Und dass du ihrem Glauben folgst. Und was machst du? Kümmerst dich ständig um andere Mitspieler. Das sieht sie einfach nicht gern.«
Marie schmollte. »Ja, ich weiß. Ich bin zu gutmenschlich.«
»Mir tut sie nix! Mir tut sie gar nix«, sagte Tim und grinste überheblich. »Weil ich zupacke …«
»… und für sie über Leichen gehst.«
»Ach was, komm, jetzt sei keine Spielverderberin.«
Marie sah nachdenklich aus. »Komisch, bei mir und all meinen Freundinnen macht sie ständig Ärger. Nur euch Kerle lässt sie in Ruhe.«
»Punktabzug, weil ihr eben Mädels seid«, ätzte Tim und lachte schadenfroh. »Wie im alten Rom eben! Noch ’ne Runde?«
»Blödmann, du unterstützt das auch noch! Echt fies!«, beschwerte sich Marie den Tränen nahe. »Diese dämliche Matrone! Ich hasse dich, Sunuxsal!«
Mittwoch, 17. Mai
Der Vortrag
Gressenich, im Pfarrheim
»Es ist also nicht auszuschließen, meine Damen und Herren, dass weitere von diesen unbezahlbaren Prunkgefäßen in irgendeinem eurer, ja, eurer Stollen aus der Römerzeit verschollen sind«, schloss Dr. Herbert Sabzynski.
Aus dem Publikum im Saal des Pfarrheims kam Applaus. Er sah in teils begeisterte, teils skeptische Gesichter.
»Herzlichen Dank«, rief der junge Pfarrer in den Beifall hinein, nachdem er etwas linkisch auf die Bühne gesprungen war, »für Ihr wunderbares Referat in unserer Vortragsreihe ›Kultur pur in Wald und Flur‹.« Gönnerhaft streckte er dem Vortragenden seine Hand entgegen und wollte das Publikum zu mehr Jubel ermuntern, doch der Applaus ebbte ab. »Sie wissen, Herr Dr. Sabzynski, wir haben Sie eingeladen, weil dieses Computerspiel in aller Munde ist. Viele Fremde kommen nach Gressenich und wollen die Messinggefäße und die Bergwerke sehen, in denen man das Erz gehoben hat. Da fühlen wir uns bei Ihnen, einem ehemaligen Gressenicher, in besten Händen.« Der Pfarrer wartete auf Zuspruch aus dem Publikum, doch der blieb weitgehend aus. Nur eine Frau rief etwas Unverständliches.
»Ist lange her«, sagte Sabzynski und blickte verlegen lächelnd zu Boden.
»Äh, ja, also, wir vom Kulturverein haben uns daher gedacht, mal einen echten Fachmann einzuladen. Denn es schadet sicher niemandem von uns, wenn uns ein, äh … sagen wir mal, ein Berufener die historischen Grundlagen erklärt.« Der Pfarrer blickte in teils versteinerte Gesichter. »Äh, … Sie können Dr. Sabzynski nun Fragen stellen«, schob er irritiert hinterher.
»Diese Hemmoorer Eimer, von denen Sie sprechen, warum nennt man die nicht gleich Gressenicher Eimer, wenn sie doch hier bei uns hergestellt worden sind?«, fragte ein Mann aus der vorletzten Reihe und klang dabei fast beleidigt.
Sabzynski holte Luft. »Es ist unumstritten, dass hier in Gressenich in den ersten Jahrhunderten nach Christi Geburt Messing hergestellt wurde. Also …«, Sabzynski machte eine Wirkpause, »… vor fast 2.000 Jahren. Es gab diese römischen Bergwerke im Römerfeld, also zwischen Gressenich, Mausbach und Hastenrath. Alles deutet darauf hin, dass die Bergleute der Römer damals schon Galmei, also Zinkerz, herausgeholt haben, um daraus vor Ort das goldglänzende Messing zu fertigen. Und alles spricht dafür, dass es hier in der Nähe geschah. So viel wissen wir.« Er holte Luft und ging ein paar Schritte zum Rand der Bühne. »Nur, fast möchte ich sagen bedauerlicherweise, gefunden hat man diese Messingeimer zuerst im Hemmoor, also in Norddeutschland bei Cuxhaven. Die ersten Finder nannten sie übrigens ›Eimer‹ wegen der Henkel. Man könnte auch Kübel oder Kessel sagen, ein etwas schöneres Wort. Aber dass man sie so weit im Norden gefunden hat, das ist ein wunderbarer Beweis dafür, wie weit die Handelsbeziehungen gereicht haben müssen. Und es ist nun mal Usus unter Archäologen, Artefakte, also Funde menschlicher Kunstfertigkeit, nach dem Fundort zu benennen. Deshalb heißen diese Messingkübel aus Gressenich nun einmal Hemmoorer Eimer.«
»Zurückholen und umbenennen!«, rief ein Spaßvogel aus der Mitte des Auditoriums und erntete ein paar Lacher. »Die gehören uns!«
»Ich kann euch trösten«, fuhr Sabzynski fort, »viele Archäologen und Historiker sagen bereits hinter vorgehaltener Hand ›Gressenicher Eimer‹, sogar die Fachleute im Britischen Museum in London. Und das, obwohl man hier bei euch in Gressenich noch keinen einzigen gefunden hat«, schloss Sabzynski und lächelte. »Aber das, meine Damen und Herren, genau das will ich ändern.«
Ein Raunen ging durch den Saal.
»Blödsinn, alles Quatsch«, polterte ein bulliger Mann, der in der zweiten Reihe saß. »Alles Humbug! So was gibt es hier nicht. Keine Römer, keine Gallier, keine Griechen, keine Kelten und auch keine Marsmenschen! Gressenich bleibt Gressenich. Wir sind alte Germanen!« Wieder Lacher aus dem Auditorium.
»Die sich in Gressenich übrigens Sunuker nannten«, klärte Sabzynski süffisant auf.
»Wenn wir hier plötzlich so Messingpötte finden, dann haben wir doch nur Probleme«, zeterte ein Mann aus der dritten Reihe. »Dann wird alles geschützt, Naturschutz und so, und wir dürfen nix mehr machen!«
»Wenn schon Schutz«, warf Sabzynski ein, »dann bitte Bodendenkmalschutz, mein Herr.«
»Ja, super, weshalb wir am Bovenheck keine Keller bauen durften, weil da so altes Römerzeug gefunden wurde.«
Die Leiterin der örtlichen Grundschule hob die Hand. Der Pfarrer erteilte ihr das Wort. »Ich darf Sie alle daran erinnern, dass es unerheblich ist, ob wir uns nun als Germanen, Römer oder als Kelten sehen. Tatsache ist nun einmal, dass dieses Dorf wie ganz Deutschland Vorfahren aus aller Herren Länder hat. Wir haben uns alle ineinander verliebt und uns gemischt.« Von hinten ertönte ein Pfiff und noch einer aus einer anderen Ecke. Ein amüsiertes Gackern drang durch den Saal.
Die stellvertretende Vorsitzende des örtlichen Motorradclubs erhob sich und verschränkte die Arme, wodurch sie ihre Tätowierungen selbstbewusst zur Schau stellte. »Die Gressenicher haben schon immer gevögelt, wo gerade Platz war!«, verkündete sie Kaugummi kauend. Der ganze Saal brach in Gelächter aus.
Die Schulleiterin drehte sich zu ihr, warf verächtlich ihre hellblonde Mähne nach hinten und wandte sich dann ans ganze Publikum. »Was gibt es da zu pfeifen und zu johlen? Ja, verliebt und fortgepflanzt. Euren Kindern in der Grundschule haben wir das längst beigebracht. All unsere Gene sind gemischt. Afrikaner, Araber, Europäer. Wir sind Kinder von allen, ob ihr wollt oder nicht!«
»Und ein paar Neandertaler sind auch dabei!«, rief eine üppige Blonde, die noch vor ein paar Jahren eine Gastwirtschaft geführt hatte. »Die hab ich alle kennengelernt.« Wieder johlendes Gelächter.
Ein weiterer Mann erhob sich, groß, schlank, in einem hellen Leinenanzug. »Moment, meine Freundinnen und Freunde, Moment. Stellt euch mal vor, was hier los ist, wenn wir diese Kübel oder Kessel finden! Der Fremdenverkehr! Touristen aus aller Welt!« Kurz drehte er sich zu Sabzynski. »Darf ich mich vorstellen, Herr Dr. Sabzynski, Manfred Wohlfahrt, Freie Wählergemeinschaft, Mitglied des Landtages NRW.« Dann wandte er sich wieder an das Auditorium. »Dazu Wissenschaftler, äh, und Wissenschaftlerinnen, Tagesausflügler und Tagesausflüglerinnen, Römerliebhaber …«
»… und Römerinnenliebhaber!«, feixte ein dicker Mann in der ersten Reihe.
»… ganze Familien mit ihren Kindern strömen zu uns«, fuhr Wohlfahrt unbeirrt fort. »Die Kinder kommen wieder, wenn sie erwachsen sind, bringen wiederum ihre Kinder mit. Was für großartige Aussichten!«
»Ja, und zwischen Gressenich und Mausbach baust du dann mithilfe von Lannert ein neues Phantasialand!«, rief eine Frau und zeigte auf den lokalen Bauunternehmer, der wegen ungewöhnlich hoher Beratungsverträge mit politischen Kräften in Verruf gekommen war.
»Oder ein Römerspaßbad im Forellenparadies, direkt am Omerbach«, schlug eine andere vor.
»Ja, ich weiß, ihr seid skeptisch«, versuchte Wohlfahrt zu besänftigen. »Aber die Dorfentwicklung, die Dorfentwicklung!«, mahnte er. »Wir bauen ein Römerhotel, Cafés, ein Schaubergwerk, neue Kneipen …«
»… ja klar, Manni! Und du kriegst überall Freibier!«, brüllte ein junger Bursche mit dunklen Dreadlocks, dessen Bemerkung ebenfalls allgemeine Heiterkeit auslöste.
»… neue Restaurants«, versuchte es der Abgeordnete noch einmal.
»Nur über meine Leiche«, protestierte der Bierbaron, der das Bistro »Petit Marron« führte. Wieder Gelächter.
»… und einen Gallierpuff!«, tönte es leise aus der letzten Reihe. Gegröle im Saal. Manni Wohlfahrt gab auf und setzte sich.
Der Pfarrer hob entsetzt die Hände. »Einhalt, meine Gressenicher und, äh, -innen. Einhalt, bitte. Ich weiß, tief in euch schlummert ein tapferes Herz! Zeigt euch also bitte von eurer guten Seite. Wir haben einen Gast«, rief er in die Menge, wobei er beruhigend die Hände auf und ab bewegte und aufdringlich lächelnd auf Dr. Sabzynski zeigte. »Einen ehrbaren Gast von der Universität in Lüttich.«
»Darf ich auch was fragen?« Eine leise Stimme, kaum zu hören. Eine erhobene Hand etwa in der Mitte des Saals.
Der Pfarrer reckte seinen Hals, um zu erfassen, wem die Hand gehörte. Einer jungen Frau, der Pfarrer kannte sie noch aus dem Kommunionsunterricht, sie war mittlerweile 17 oder 18 Jahre alt. »Ja, natürlich, Marie, also?«
»Es gibt da dieses Computerspiel, ›Brass Master One‹.Sie kennen es, Herr Dr. Sabzynski?«, richtete sich Marie leise an den Historiker.
Sabzynski nickte. »Wer kennt es nicht?«, fragte er und lächelte wissend. »Das ist ja mittlerweile ein internationaler Renner und wird in aller Welt gespielt, wenn ich recht informiert bin. Ich selbst habe es freilich noch nicht gespielt«, antwortete er, beugte sich leicht vor und legte die Hand auf seine Brust, »aber ich kenne es von meinem Neffen, der dürfte in deinem Alter sein.« Sabzynski drehte sich zur Seite, sah zu Boden und ging ein paar Schritte. »Er hat mir viel davon erzählt, unter anderem, dass es da um die Messingherstellung während der Gressenicher Römerzeit geht.« Er sah Marie nun direkt an und fügte hinzu: »Sie können übrigens etwas lauter sprechen, Marie.«
Marie fasste sich ein Herz und rief mit leicht bebender Stimme: »Jaja, es ist … es ist, hm … ja, alsooo, es ist so, dass da viel Krieg drin ist, in dem Spiel. Und es geht aber eigentlich um die alten Römer und so, und um Germanen, um die, äh …«
»Sunuker hießen die …«, flüsterte Tim ihr zu.
»Also, ja, diese Sunuker, so heißen die nämlich, die hier gewohnt haben.«
»Ja, dieser germanische Stamm hat zwischen Jülich und Aachen bis in die Eifel und Ostbelgien gesiedelt«, dozierte Sabzynski, »und sie haben teilweise die Kultur und das Wissen der Kelten übernommen, die Caesar ja im Westen, also in Gallien, besiegt und vertrieben hatte.«
»Ja, und ich möchte fragen, ob denn das alles stimmt, was da so in dem Spiel drin ist. Ich krieg nämlich … ja und Tim hier auch …«, sagte sie und zerrte an einem Ärmel des Jungen, der neben ihr saß, »Tim hier bekommt auch so viele.«
»Na, was bekommen Sie beide denn in einer solch großen Anzahl?«, fragte Sabzynski.
Das Publikum lachte leise, und Marie lief rot an. »Ach so! Ja, E-Mails bekommen wir. Es ist ja so ein Spiel, wo man sich über das Internet verbinden kann …«
»Nee, muss«, warf Tim ein.
»… ja, also mit anderen Spielern vernetzen muss. Irgendjemand hat bei Facebook nun in die Gruppe geschrieben, dass ich aus Gressenich bin und Tim aus Stolberg kommt. Und irgendjemand hat dann auch unsere E-Mail-Adressen verraten. Und nun werde ich jeden Tag zugeballert mit Zuschriften. Gressenich, und Stolberg, wo ist das, und haben die wirklich hier gekämpft, und haben die wirklich Messingeimer gebaut und ihre Toten darin beerdigt«, rasselte Marie herunter, »und gibt es so Bergwerke noch, und kann man sehen, wie die so Eimer noch herstellen, und was ist mit der Seuche … ach, alles Mögliche«, schloss sie atemlos ab. Ihre Augen aber waren voller Stolz. Erleichterung lag in ihrem Gesicht, das alles gesagt zu haben.
»Danke Marie, das haben Sie sehr schön wiedergegeben«, antwortete Sabzynski.
»Und vor allem: Gibt es ›The Gression Bucket‹, also den Gressenicher Eimer, wirklich?«, ergänzte Tim. »Wir Stolberger sind da ein bisschen neidisch, weil Stolberg ist ja die eigentliche Messingstadt.«
Sabzynski grinste und nickte. »Das alles sind berechtigte Fragen. Nun, dass es Gressenich noch gibt, das steht ja außer Zweifel, wenn ich Sie hier alle so sitzen sehe«, er ließ seine Arme über das Auditorium schweifen und erntete ein paar Lacher im Publikum. »Ob hier Kämpfe stattgefunden haben, das kann ich nicht wirklich sagen. Aber angesichts meiner hier erlebten Zeit kann ich mich doch erinnern, dass ihr ein streitlustiges Völkchen seid.« Sabzynski machte eine Pause, um die allgemeine Heiterkeit abzuernten. »Und da zur Römerzeit sogar alltägliche Streitereien mit Faustschlägen und Messerstechereien ausgetragen wurden, kann man wohl davon ausgehen. Dass hier in Gressenich Messing zur Römerzeit, aber viel später erst in Stolberg hergestellt wurde, ist unter Fachleuten unumstritten, und dass die Sunuker und Römer in den Gressenicher Eimern ihren Leichenbrand bestattet haben, das stimmt auch. Und jetzt zu deiner entscheidenden Frage, junger Mann«, sagte er und wandte sich fast feierlich an Tim. »Ob es diese Eimer tatsächlich gibt, ist nicht die Frage, sondern wie viele es davon gibt.« Er senkte seine Stimme. »Aber bisher … und ich sage deutlich: bisher«, raunte er und hob den Zeigefinger, »bisher haben wir keinen gefunden, der eindeutig auf Gressenich verweist. Wie gesagt, bisher!«
Eine Frau Anfang 50, die bisher im Schatten der Empore an der hinteren Wand gestanden hatte, meldete sich zu Wort. Ihre ergrauten Haare hatte sie locker zu einem Zopf zusammengebunden, der ihr über die linke Schulter hing und fast bis zur Hüfte reichte. »Entschuldigen Sie, Herr Dr. Sabzynski. Sie mögen mir verzeihen, dass ich nicht viel über die Welt Ihrer Wissenschaft weiß. Sie haben uns erzählt, dass Sie eine glaubwürdige Quelle haben, die vermuten lässt, dass es hier in Gressenich solche Gefäße wirklich gegeben hat.«
Sabzynski war für ein paar Sekunden sprachlos, als er sie ansah. Ihre hohen Wangenknochen, ihre großen blauen Augen und ihre eleganten Bewegungen schienen ihn zu beeindrucken. Seine Augen glänzten, als hätte er eine Madonnenbegegnung. Er lächelte sie lange an, bevor er antwortete. »Ja, das ist richtig.«
Ein paar Leute drehten sich nach hinten. Ein Tuscheln ging durch die Reihen. »Ist das nicht … Veronika?«, flüsterte der Mommsen-Bauer seiner Frau hinter vorgehaltener Hand zu.
Seine Frau erschrak, prüfte noch einmal mit kritischem Blick die Frau an der hinteren Wand, sah zurück zu ihrem Mann und nickte. »Ja, das ist sie. Veronika Lorenz, die Schlampe!«
»Was macht die denn hier?«, fragte Mommsen.
»Will den Jungs wohl wieder den Kopf verdrehen!«, zischte seine Frau und wusste, dass auch er einmal hinter ihr her gewesen war. »Sie sieht aus, als würd sie ’ne Cannabisplantage betreiben.«
»Entschuldigen Sie, liebe Dame«, warf der Pfarrer an die Frau an der hinteren Wand gerichtet freundlich ein, »vielleicht stellen Sie sich kurz vor, damit wir wissen, wer Sie sind, bitte.«
»Nicht so wichtig.«
»Kein Vorname, kein Nachname?«, fragte der Pfarrer vorsichtig.
»Blödsinn«, rief ein Mann aus der Runde, »du bist doch …«
»Halt die Klappe, Sauschädel!«, schrie sie ihn mit glühenden Augen an.
Der Mann erschrak und schwieg.
»Sie ist es!«, tuschelte Frau Mommsen ihrem Mann zu. »Hab ich’s doch gewusst! Wie hat sie sich gleich genannt früher? Total abgehoben. Und gekifft hat sie.«
Mommsen hob die Schultern. »Keine Ahnung, wie denn?«
»Irgendwas mit S. Wie so ’ne Göttin«, zischelte sie gehässig.
Die Frau wandte sich wieder an Sabzynski. »Und mehr wollen Sie uns nicht über Ihre Quelle berichten?«, fragte sie laut und deutlich und kam währenddessen einen Schritt vor.
»Tut mir leid, ein paar Geheimnisse muss ich noch für mich behalten«, antwortete Sabzynski, immer noch grinsend.
»Wenn es denn so ist, hätte man nicht längst einen dieser Eimer finden müssen?«, fragte sie mit einem gewinnenden Lächeln.
Sabzynski verneinte. »Viele haben sich damit beschäftigt, aber die hatten ja meine Informanten nicht.«
Frau Mommsen kramte in ihren Erinnerungen. »Hat der Sabzynski nicht auch was mit ihr gehabt?«, flüsterte sie ihrem Mann zu.
»Ja, wer hätte das nicht gerne?«, antwortete Mommsen leise. »Die waren ungefähr ein Jahrgang und gingen nach Stolberg aufs Gymnasium.«
»Es gibt aber keine direkten Beweise für Ihre Behauptung«, schob die Frau hinterher, »sehe ich das richtig?«
»Du bist eine sehr skeptische Frau, Miss … Anonym«, sagte er spitzfindig, und spätestens jetzt musste jeder merken, dass sich die beiden kannten. »Aber … das steht dir absolut zu.« Sabzynski hob den Kopf und antwortete mit triumphierend leuchtenden Augen: »Nun, meine Erfolge diesbezüglich erzählen jedoch eine ganz andere Geschichte.«
Ein unruhiges Hin und Her erfüllte den Saal. Alle im Raum hatten sich umgedreht und beobachteten, wie die Frau reagieren würde.
Veronika Lorenz hatte die Hände in die Hüften gestützt und ließ nicht locker. »Welche Erfolge sind das denn?«
Eine leise Männerstimme war zu hören. »Jetzt halt doch endlich mal die Klappe, du Besen!«
»Ich hab’s gehört«, entgegnete sie mit glühenden Augen und fixierte den Hünen, der sich ertappt fühlte und schnell wegsah.
Sabzynski streckte genüsslich seinen Rücken und atmete noch einmal durch. »Um Messing herzustellen, brauchte man neben dem Galmei auch Kupfer in großen Mengen. Das fand man aber in der näheren Umgebung von Gressenich kaum in ausreichender Form.« Mit nachdenklichem Gesicht sah er kurz zu Boden und schritt quer über die Bühne. Dann blieb er abrupt stehen, legte den Zeigefinger an sein Kinn und sah an die Decke. »Ich habe deswegen in der gesamten Eifel nach Möglichkeiten gesucht.« Plötzlich wandte er sich wieder dem Publikum zu. »Und endlich, endlich bin ich fündig geworden«, verkündete er. »Ein römisches Kupferbergwerk. Und dort …«, er streckte die Hand nach oben und sah den Zuhörern in die Gesichter, »dort habe ich einen Hinweis gefunden. Einen hinreichenden Hinweis dafür, dass es den ›Gressenicher Eimer‹ wirklich gibt.« Seiner Stimme war der Triumph deutlich anzuhören.
Ein weiteres Raunen ging durch den Saal, erstaunte Blicke und gespitzte Münder. »Wenn Sie das beweisen«, rief der Bierbaron, »dann baut Manni Wohlfahrt sogar ein Disneyland. Und ich übernehme dort den Entengrill!«
Applaus und Bravorufe. Auch Sabzynski amüsierte sich nun sichtlich und richtete sich ebenfalls an Manni Wohlfahrt. »Wenn ich das so salopp sagen darf, Herr Wohlfahrt, mit dem Computerspiel haben Sie doch bereits Ihr Disneyland, aber eben virtuell. Machen Sie was draus! Schauen Sie auf die Jugend. Und begreifen Sie es als Chance!«
Als alle anderen Zuhörer den Saal verlassen hatten, ging Veronika Lorenz nach vorn und betrat die Bühne, wo Sabzynski noch mit Wohlfahrt und dem Pfarrer plauderte.
»Veronika, forsch und klar wie früher«, sagte Sabzynski lächelnd.
Sie spürte, dass immer noch etwas zwischen ihnen funkte. »Wie schön, dich zu sehen, Herbert.«
Im Windfang des Eingangs stand ein Mann in einer Kutte, sah starr nach vorn und ließ die beiden nicht aus den Augen. Er wusste, dass sie sich bald an alles erinnern würden.
Donnerstag, 18. Mai
Sunuxsal
Neuf Gression, Hohes Venn, Belgien
Der Wind pfiff scharf und peitschte kalten Regen auf das Dach. Debora erschrak jedes Mal, wenn eine Bö erneut einen Guss an die Holzwand klatschte. Draußen schien die Welt unterzugehen. »Huh!«, rief sie und zuckte zusammen, als ein Blitz den Raum so grell erhellte, dass ihre Augenlider zitterten.
Veronika Lorenz saß grinsend am Küchentisch und war gerade dabei, eine Rede vorzubereiten. »Was ist denn los mit dir? Hast du das Wetter hier oben im Venn immer noch nicht begriffen?«
Debora kam näher und schüttelte sich. »Doch, schon, aber irgendwie hab ich immer noch ein bisschen Angst hier in Neuf Gression.«
»Komm her, setz dich zu mir«, sagte Veronika tröstend. Debora nahm neben ihr Platz und lächelte verlegen, woraufhin Veronika ihr die Hand auf den Kopf legte. »Wie lange bist du jetzt bei mir, meine Liebe?«
Debora dachte nach. »Es wird jetzt fast fünf Jahre her sein, seit ich zu dir kam.«
»Siehst du, und seit du hier bist, geht es dir immer besser.«
Debora rückte ein wenig näher und legte ihre Stirn auf Veronikas Handrücken. »Dea Mater, ich bin dir so dankbar! Niemals kann ich das zurückgeben, was du für mich getan hast. Nur …«
Veronika nahm ihre Hand. »Ich weiß, Debora, meine Liebe, ich weiß. Leider hat es bei dir noch nicht geholfen.«
Debora schluchzte. »An den Männern mangelt es ja nicht, aber es will einfach nicht funktionieren. Bei den anderen …«
»Ja, bei den anderen wirkt es. Ich weiß. Hab Geduld. Nimm deinen Trank einfach weiterhin und glaube daran. Und wähle dir einen kräftigen Mann aus. Du bist ein schönes Mädchen, es wird einer kommen, ein guter Hengst«, brummte sie und lachte, »mit dem es klappen wird, bestimmt. Und dann ziehen wir dein Kind hier auf.« Sie lächelte und schüttelte Deboras Arm, sodass auch sie in ihr Lächeln einfiel und Veronika herzlich umarmte.
»Sunuxsal, wenn ich das alles nur gutmachen könnte, was du mir gibst!«
»Du tust genug, meine Liebe, ich weiß das zu schätzen. Und nun mach weiter, verwöhne uns mit deinen wunderbaren Brioche, die alle so gern mögen.«
Debora sah sie verzückt an, erhob sich und ging zu der großen Arbeitsplatte, während Veronika sich wieder ihrer Rede zuwandte. Sie holte den Teig aus der Maschine, streute Mehl auf die Arbeitsplatte und begann damit, den Teig mit der Hand nachzukneten. Sie beobachtete Veronika aus dem Augenwinkel und druckste herum, bevor sie eine Frage wagte. »Meine Dea Sunuxsal, hast du eigentlich das Dilemma mit diesem Computerspiel mitbekommen?«
Veronika sah auf und tippte mit dem Kugelschreiber gegen ihr Kinn. »Ja, natürlich. Ich war sogar gestern auf einem Vortrag deswegen.«
»Ich weiß nicht, ob das gut für dich ist, dieses Spiel. Und damit … auch für uns.«
Veronika lachte. »Aber Debora, das ist doch nur ein Computerspiel! Und es kann nicht schaden, wenn das Spiel so einen großartigen Erfolg hat und meine Figur darin den Menschen nähergebracht wird.«
»Ich mach mir Sorgen, Sunuxsal.«
»Warum machst du dir Sorgen?«
»Du hättest nicht teilnehmen sollen, Sunuxsal. Es ist nicht gut für dich. Warum hast du dir dort Eintritt verschafft?«
Veronika rückte ihre Sitzposition zurecht. »Debora, es ist nichts anderes als ein Computerspiel. Ich habe angeboten bekommen, die Rolle der großen Matronengöttin in dem Spiel zu übernehmen, und es ist mir doch lieber, dass ich sie ausfülle als jemand anders. Als ich angemailt wurde, war das eine Ehre für mich.« Sie verzog ihr Gesicht zu einem kindischen Grinsen und hob kurz die Schultern. »Außerdem finde ich Computerspiele superklasse. Ich spiel sie einfach gerne!«
»Ja, aber du wirst immer mehr in die Ecke gedrängt, und es heißt, du agierst zunehmend böse in dem Spiel. Das ist nicht gut! Und es besorgt mich.«
»Na ja, die Figur reagiert teilweise automatisch. Ich bin ja nicht immer drin im Spiel. Aber Sunuxsal ist eine zentrale und wichtige Figur.« Veronika Lorenz räusperte sich und fixierte die Tischplatte, wobei sie ihre Augenbrauen nachdenklich kräuselte. »Hm, in der Tat, das ist vielleicht nicht schön. Aber es ist ja auch nur ein Spiel.«
»Ein Spiel, das mittlerweile die ganze Welt umspannt. Das kennt einfach jeder. Bist du sicher, dass das nicht manipuliert wird?«, fragte Debora besorgt. »Zu deinem Nachteil?«
»Ach was«, wiegelte Veronika ab, »das ist doch Blödsinn! Wer sollte mir damit schaden wollen? Der Spielverlauf hat sicher nichts mit mir zu tun. Sicher nicht«, sagte sie bestimmt, schüttelte leicht den Kopf und sah wieder auf die Papierblätter, die vor ihr lagen.
Debora schnitt Butter in kleine Würfel, die sie in den Teig einknetete. »Sei dir nicht so sicher. In dem Spiel richtet Sunuxsal aus irgendeinem Grund über die Frauen. Machst du das aktiv?«
»Nein, das mache ich nicht aktiv.«
»Ja, ist es dir noch nicht aufgefallen?«
»Nein, Debora, ich mache das jedenfalls nicht.« Ihre Stimme wurde robuster.
»Das verheißt nichts Gutes. Dahinter steckt eine Macht, die du nicht kennst. Wende dich an den Spielmaster! Du musst etwas unternehmen, bevor dein Ruf zerstört ist. Die Menschen nehmen das sehr ernst.«
Veronika stand auf, ging umher und sah grübelnd zu Boden.
»Wir müssen endlich einen Gral vorweisen«, forderte Debora, »etwas, an das die Menschen glauben können. Es wird schon getuschelt, dass du nie einen besessen hast.«
»Debora, du gehst deutlich zu weit!«, entgegnete Veronika scharf. »Ich habe nie behauptet, dass ich einen finden werde. Ich habe immer gesagt, ich werde es versuchen. Ich war kurz davor!«, fluchte sie mit zusammengebissenen Zähnen. »Ich hätte ihn fast anfassen können«, verdeutlichte sie mit starrem Blick.
»Wo ist in den Augen deiner Jüngerinnen der Unterschied? Ich bin deine Zeremonienmeisterin und deine Botschafterin, und ich muss es dir sagen. Es reicht den Menschen nicht mehr, sie geben dir ihr Geld, damit du ihnen die Kraft des Grals schenkst. Es sind deine Worte, es ist dein Heiligtum, das du herbringen willst. Vergiss das nicht. Du hast es ihnen …«
»Schweig!«, herrschte sie Debora an, die augenblicklich zusammenzuckte. »Was denkst du dir eigentlich dabei, an mir zu zweifeln? Seit Jahren versuche ich, einen zu bekommen. Seit Jahren!«
Debora senkte den Kopf und blickte stumpf auf ihre teigverklebten Hände. »Ich weiß, meine Dea!«, flüsterte sie.
Veronika zitterte vor Wut. Ihr Atem ließ ihren Brustkorb erbeben. »Was glaubst du, was ich tagtäglich mache? Ich denke nur an euer Seelenheil«, schnalzte sie unwirsch, »ihr, die ihr hierher zu mir gekommen seid, ihr seid meine einzige Sorge! Und seit Jahren beschütze ich gerade dich!«
»Sunuxsal, ich habe es doch nicht so gemeint«, versicherte Debora.
Immer noch aufgeregt stampfte Sunuxsal hin und her. »Der Vortrag gestern, warum bin ich wohl dort gewesen?«, schnaubte sie.
Debora schüttelte übertrieben den Kopf und hob die Schultern.
»Weil ich eine Spur habe. Das Computerspiel, das du so nutzlos findest, es hat dafür gesorgt, dass ich jemanden wiedergetroffen habe, den ich aus meinem ersten Leben kenne. Und er wird mir den Weg zu dem Gral ebnen.« Sie atmete tief durch, ging auf Debora zu und stemmte die Hände in die Hüften. »Verlasst euch drauf. Ihr werdet sehen. Sunuxsal lässt euch nicht im Stich.« Ihr Blick war starr, sie legte den Kopf in den Nacken und warf ihren Zopf nach hinten, wobei sie ihre Lippen zusammenpresste.
»Sunuxsal«, flehte Debora, »bitte sei mir nicht gram. Niemand zweifelt an deiner Sorge um uns. Wir lieben dich, Dea Mater!«
Sie setzte sich an den Tisch zurück. Deboras Worte schienen sie zu beruhigen.
Debora wurde nun ganz leise. »Aber die Leute fragen sich, ob dieses Spiel, dieses ›Brass Master One‹, deiner Reputation nicht ernsthaft schadet. Wer steckt bloß dahinter?«
Veronika stützte den Kopf in die Hände und seufzte.
Samstag, 20. Mai
14 Jahre
Mausbach, Privathaus Sigrid Meckel
»Hallo, jemand zu Hause?«, rief Hauptkommissar Josef Straubinger, als er die Tür hinter sich schloss. Er zog seine Stiefel aus und stieg die Holztreppe hinab in den Keller. Seine grüne Arbeitsjacke, die Schnürstiefel und die verstärkte Arbeitshose hängte er an einen Haken und rief erneut, diesmal ins Treppenhaus hinauf. »Sigrid! Bist du zu Hause?« Keine Antwort, bevor er den kleinen Raum mit der Dusche betrat. Als er sich unter den heißen Wasserstrahl stellte, vernahm er irgendetwas. Eine Stimme von oben, die er aber nicht verstehen konnte.
Er trocknete sich notdürftig ab, wickelte das Badetuch um die Hüften und stellte fest, dass sein Bauch nicht mehr der eines jungen Mannes war. Seine sportlichen Tätigkeiten hatten nachgelassen. Da war die Waldarbeit eine Wohltat. Vor drei Jahren hatte er Harry Heitkamp, den Förster von Zweifall, durch ein eher skurriles Ereignis kennengelernt. Ein Spaziergänger hatte außer sich vor Aufregung im Forsthaus den Fund einer Leiche gemeldet. Die Leiche befinde sich etwas unterhalb der Gemarkung »Kartoffelbaum«, in der Nähe der Quelle der Roten Wehe. Nachdem der Wanderer ihm versichert hatte, dass der Mensch wirklich tot sei – ja, er liege unter Astwerk, aber man könne deutlich einen Körper erkennen –, hatte Heitkamp Straubinger angerufen. Straubinger war schnell gewesen, und so fuhren der Förster, Straubinger und der Wanderer an den Fundort. Dort erspähten sie schon von Weitem einen hellen Körper, der unter einem Haufen Laub hervorlugte. Straubinger bat die beiden stehen zu bleiben, um die Situation allein zu erkunden. Er zog Handschuhe an und schob das Laub zur Seite. Dann gab er ein lautes »Kruzifix« von sich. »Ha! Ja, sauber«, rief er, »da hat jemand sei G’spusi im Wald vergessen!«, und winkte die beiden anderen heran. Er zeigte ihnen die vermeintliche Leiche, die sich im wahrsten Sinne des Wortes als etwas Ungewöhnliches entpuppte: eine Sexpuppe. Aufblasbar, lebensgroß und, aufgrund der wenigen Luft, ziemlich »schiaglad«, wie Straubinger sich ausdrückte, also mit ausgeprägt schielendem Blick.
»Der ist wohl die Puste ausgegangen«, bemerkte Heitkamp, zeigte auf den Einstich in Brusthöhe und warf einen Blick auf den Wanderer, der sich für die ganze Aufregung entschuldigte.
»Scho recht«, sagte Straubinger, »besser einmal zu viel gemeldet, und wenn es auch nur in memoriam Tom Sharpes ein Puppenmord ist.«
Da es ein Freitagabend war, lud der Förster den Kriminalbeamten noch kurz zu sich ins Forsthaus ein, um ein Protokoll anzufertigen. »Die Puppe kommt in meine persönliche Asservatenkammer. Sie glauben gar nicht, Herr Straubinger, was sich im Wald so alles findet.«
»Und, meldet sich manchmal jemand, der etwas wiederhaben will, was er hat liegen lassen?«
»Manchmal schon. In unserem heutigen Fall denk ich mal, dass niemand sich so schnell melden wird. Ansonsten müssen wir doch noch einen Mordfall draus machen«, scherzte er.
Aus dem Protokoll war ein langer Abend geworden, an dem sich herausgestellt hatte, dass der Förster ein Liebhaber bayerischen Bieres war. Und so wurde aus dem langen Abend eine halbe Nacht und der Beginn einer Freundschaft. Sie hatten schnell festgestellt, dass sie eine gemeinsame Leidenschaft teilten, die Straubinger noch aus seiner bayerischen Heimat im Chiemgau mitgebracht hatte. Nämlich mithilfe eines Flaschenzugs und eines Kaltblutgauls gefällte Stämme aus den Steillagen des Waldes zu bergen, je steiler desto besser, und Brennholz daraus zu machen.
Straubinger zog den Knoten an seinem Handtuch fester und stieg die Treppe hinauf. Als er ins Wohnzimmer kam, saß Sigrid auf dem Sofa und las in einer Zeitschrift. Sie waren nun seit 14 Jahren zusammen. Damals, während des Falls mit dem Wolkenmaler hatten sie sich kennen und lieben gelernt. »Nanu, du bist ja doch zu Hause. Hast du mich nicht gehört?«, fragte er irritiert.
Sigrid sah nicht auf. »Doch, ich hab dich gehört.«
Er setzte sich neben sie, nahm ihr vorsichtig die Zeitschrift aus den Händen und fragte: »Alles in Ordnung? Oder stimmt etwas nicht?«
Sigrids Gesicht zeigte eine Mischung aus Ärger und Kummer. »Ach, Josef, du merkst es nicht einmal.«
»Ja, was denn, Liebes, was ist los?«
»Ach nichts«, sagte sie beiläufig, nahm sich die Zeitschrift zurück und tat so, als würde sie weiterlesen.
Straubinger ging ins Schlafzimmer und setzte sich auf die Bettkante. Natürlich hatte er es gemerkt. Seit einiger Zeit war bei ihnen eine Art Sprachlosigkeit entstanden, die auch ihn betrübte. Aber er hatte sich nichts anmerken lassen. Zu sehr schmerzte die Erinnerung an die Trennung von seiner ersten Frau. Angefangen hatte es mit kleinen Beschwerden, Spitzen und Sticheleien, wenn er später vom Dienst nach Hause gekommen war. Dann, irgendwann, hatte sie ihn ausgelacht, wenn er müde ins Bett sank. Und zum Schluss hatte sie jeden Abend mit ihm einen Streit begonnen. Nun befürchtete er, dass es ihm mit Sigrid ebenso ergehen könnte, obwohl sie ein ganz anderer Typ war. Aber der Gedanke bereitete ihm ein derartiges Unbehagen, dass er einer Aussprache lieber aus dem Weg ging.
Er zog bequeme Sachen an, fasste sich ein Herz und ging zu ihr zurück. »Sigrid, was ist los? Du kannst nicht einfach zur Tagesordnung übergehen.«
»Hast du wirklich nichts gemerkt?«
Straubinger lehnte sich zurück. »Gibt es … gibt es einen anderen?«
Sigrid setzte einen Blick auf, als hätte er sie mit einem Eimer Wasser überschüttet. Sie nickte und sah zu Boden.
»Komm, Sigrid, jetzt spiel bitte nicht die bedröppelte Unschuld vom Lande! Wer ist es?«
Sigrid ging hoch. »Wah! Ihr seid doch alle gleich. Das Erste, was euch in den Kopf kommt, ist ›wer‹. Statt ›was‹ oder ›wieso‹!«
»Ich finde diese Frage überaus gerechtfertigt!«, gab Straubinger zurück. »Ich will wissen, mit wem du mich hintergehst.«
»Hintergehst? Hintergehen kann ich nur jemanden, der mir Aufmerksamkeit schenkt. Der mich einweiht in seine Geheimnisse und Leiden. Du merkst es doch gar nicht, erst, wenn ich es dir direkt auf die Nase binde.«
»Was«, sagte er, »ich meine, was fehlt dir?«
»Oh Gott, Josef, was mir fehlt?«, rief sie aufgebracht. »Was haben wir in den letzten Jahren gemeinsam gemacht? Du bist entweder im Dienst, und seit du die Leitung der Dienststelle übernommen hast, kommst du fast gar nicht mehr nach Hause, oder du bist im Wald und fällst Bäume mit einem alten Ackergaul und deinem Försterfreund. Dann kommst du heim, ziehst deine dreckigen Klamotten aus, gehst duschen und bist müde. Und wenn du schläfst, dann schreist du im Schlaf, weil dich angeblich immer wieder derselbe Albtraum quält. Und weißt du was? Du sagst mir einfach nicht, was es ist, was dich so plagt. Du verschweigst mir deine Vergangenheit. Wo bleibe ich, wo bleiben wir?«
Straubinger sah an die Wand, auf das Foto, das Sigrid vor ein paar Jahren auf Madeira gemacht hatte. Ein Blumenmeer in Schwarz-Weiß fotografiert, am Horizont das Wasser. Da waren sie ganz schön verliebt gewesen. In diesem Moment machte es auf ihn eher den Eindruck eines frisch ausgehobenen Grabes, auf dem die Blumen der Trauernden als Erinnerung an eine pompöse Vergangenheit ruhten, und er spürte die in seinem Kopf wabernde Leere jahrelang verpasster Chancen. Er sah sie lange an. »Meine Träume werden nicht der Grund sein, Sigrid. Das schiebst du vor.« Danach wusste er nicht, was er noch sagen sollte. Er legte die Hand auf ihre und wartete ab.
»Ich spüre gar nix, wenn du das denkst«, sagte sie zurückweisend und legte seine Hand zurück. »Lass es, Josef, es ist zu spät. Es kribbelt nix mehr.« Sigrid erhob sich und stellte sich an die Anrichte. »Es ist nicht so, dass uns nichts mehr verbindet. Ganz im Gegenteil. Du bist der beste Freund, den ich jemals hatte.«
»Seinen besten Freund betrügt man nicht, egal mit wem!«, erwiderte Straubinger scharf. »Also, wer ist es?«, beharrte er.
Sigrid sah erneut zu Boden. »Es ist ein alter Schulfreund, jemand, der mich immer noch attraktiv findet. Es ist nichts Ernstes. Aber ich habe dadurch gemerkt, wie weit wir beide voneinander entfernt sind, Josef.«
Straubingers Blick war so traurig, dass auch sie ihre Traurigkeit nicht mehr verbergen konnte. »Ach Josef, es tut mir leid, aber …«
Er sah sie lange an und brachte keinen Ton heraus. Seine Kehle war wie zugeschnürt. Er kannte das Gefühl. Es würde ihn zerreißen. Er konnte es nicht zulassen, nicht schon wieder.
»Vergiss es«, sagte er traurig. »Ich komme nicht wieder.« Er erhob sich, ging auf sie zu und gab ihr einen Kuss auf die Stirn. »Ich hätte es gern anders gehabt. Vielleicht ist es wirklich meine Schuld. Zu Ende. Zu Ende getan, zu Ende gedacht, zu Ende geliebt.« Er ging zur Tür.
»Wo willst du hin?«, fragte sie erschrocken.
»Ich gehe zu einem Freund. Meine Sachen werde ich abholen, am Wochenende.« Er schluckte. »Wenn du nicht hier sein wirst.«
Sigrid sah ihn an, wollte etwas sagen, doch alles, was sie jetzt hätte sagen können, wäre ihr nur wie eine billige Entschuldigung vorgekommen.
»Gute 14 Jahre«, flüsterte er. »Ich werde dich vermissen, Sigrid. Sehr. Du bist eine wunderbare Frau.«
Freitag, 26. Mai
Unter der Kastanie
Gressenich, »Petit Marron«
»Sommer, Sonne, Grillwurst, Gressenich on the Beach«, sang Oliver und pfiff fröhlich weiter, als er im Gastgarten des »Petit Marron« die Tische eindeckte.
»Oliver, hier ist kein Strand!«, knurrte der Bierbaron ihn an. »Hier gibt es nur den Omerbach da vorn.«
»Na, wenn der nochmals über die Ufer geht, Vadder«, flachste Oliver, »dann haben wir wieder den Strand an der Bar.«
»Sehr witzig, so was solltest du nicht mal denken!«, wetterte der Bierbaron. »War genug im vorletzten Jahr!«
»Ist ja gut, hast ja recht«, antwortete Oliver besänftigend und schüttelte eine grüne Decke aus.
»Oli, heute die rot-weiß karierten Decken«, rief die Kellnerin. »Schöner Tag, nicht zu warm, nicht zu kühl.«
»Alles klar, Moni«, antwortete er und öffnete die Kiste mit den Tischdecken, die an der Ligusterhecke stand.
Der Bierbaron legte die schwarze Werbetafel auf den runden Stehtisch und schrieb mit einem weißen Kreidestift:
Kamelen und allen anderen, die eine Woche lang ohne Getränk auskommen, sollte man misstrauen.
Er legte den Kopf schräg, überprüfte das Schriftbild und stellte die Tafel vor die Außenmauer. »Jetzt können die Gäste kommen«, meinte er grinsend.
»Wart mal ab, so wie ich das sehe, kommen demnächst mehr Gäste, viel mehr Gäste!«, rief der Junge seinem Vater zu, während er erstaunt auf sein Smartphone glotzte.
»Warum sollten mehr kommen?«
»Das neue Computerspiel. Das ist echt der Wahnsinn!«
»Und was hat das mit uns zu tun?«
»Du hast doch vor zwei Monaten bei dem Vortrag gehört, dass Gressenich darin eine wichtige Rolle spielt. Also, das Spiel, das ist echt cool. Geht sogar übers Handy.«
Der Bierbaron nahm ihn skeptisch in den Blick. »Gressenich, in einem Spiel? Ach ja, wie heißt noch mal das Spiel?«
»›Brass Master One‹.«
»Also … ›Messing Meister Eins‹.« Der Bierbaron lachte. »So ein Quatsch!«
»So nennt das ja auch niemand, ist international! Und das ist kein Quatsch, Vadder«, gab Oliver zurück und ließ das Tischtuch kurz fallen. »Die kommen wirklich. Es gibt da eine Facebookgruppe, wo so was verbreitet wurde. Hier, total verrückt, was da abgeht!«
»Versteh ich nicht, Oli, das ist mir zu hoch.«
Oliver verdrehte die Augen. »Moni, erklär du es ihm!«, rief er der Kellnerin zu und fummelte mit seinem Smartphone herum.
Moni sah ihn an, als hätte er sie in eine Matheprüfung geschickt, lachte und verschwand im Gastraum.
Oliver ging zu seinem Vater hinüber und stellte sich an den Stehtisch. »Also, hör zu. Du solltest wissen, worum es geht, wenn die Leute kommen. Dieses Spiel …«
»… das in Gressenich spielt …«, warf der Bierbaron gelangweilt ein und hob die Schultern. »Werden wohl nur so ein paar Heinis wie du Interesse dran haben. Was nutzt uns das hier?«
»Also, der Vortrag, den dieser Doc im Pfarrheim gehalten hat … Er ist nicht der Einzige, der glaubt, dass es diese Dinger hier gegeben hat.«
»Und? Glaubst du das etwa auch?«, fragte der Bierbaron mit spöttischem Blick.
»Vadder, Leute aus aller Herren Länder spielen das Spiel!« Oliver nahm seinen Vater beim Arm. »Hör doch mal zu. Das ist eine eigene Welt da drin. Supergeile Grafik und so. Du denkst, du bist in der Römerzeit. Mittlerweile sind das an die 300.000 Leute. Weltweit.«
»300.000?«, schoss es aus dem Bierbaron hervor. Er gab einen Pfiff von sich. »Und zu was in aller Welt kann man sich da zusammenschließen?«
»Zu einer Art Minengesellschaft der Antike. Du bezahlst Einsatz, um ein Bergwerk zu eröffnen, nur ein paar Euro, die heißen natürlich in dem Spiel Sesterzen.«
»Wie die römischen Münzen«, sagte der Bierbaron.
Oliver grinste. »Die klau ich mir abends immer aus der Thekenkasse!«, scherzte er.
Der Bierbaron zupfte kurz an seinem Ohr.
»Hey!« Oliver zog den Kopf zurück. »Also, der Höhepunkt ist das Herstellen der Prunkgefäße, im Spiel heißt so ein Ding ›The Gression Bucket‹.«
Der Bierbaron lachte. »Was ist denn das wieder für ein Blödsinn?«
Oliver verdrehte die Augen. »Jetzt sei doch nicht so altmodisch! So was von von gestern!« Er drehte sich weg und ging ein paar Schritte. »Dann eben nicht!«
Der Bierbaron brummte. »Hey, so war das nicht gemeint. Klar will ich wissen, was es mit diesem Spiel auf sich hat. Komm her!«
»Vergiss es!«, sagte Oliver eingeschnappt und ging weiter.
»Dann sag mir zumindest, was das alles mit dem ›Petit Marron‹ zu tun hat.«
Brummig drehte Oliver sich wieder um. »Also, heute«, erklärte er und hob sein Smartphone hoch, »da hat der Administrator in einer Facebookgruppe zu diesem Spiel verbreitet, dass dieses Gression tatsächlich noch existiert. Nämlich Gressenich. Und mehr noch, dass es diese Prunkeimer auch noch gibt. Und dass sie hier im Dorf irgendwo versteckt sind.«
»Ja und?«
»Vadder, das war erst gestern. Von den Hunderttausenden Spielern weltweit sind allein mehr als 30.000 in der Facebookgruppe engagiert. Und für morgen haben sich schon Leute angesagt. Sie wollen alle den Ort sehen, wo die vielleicht wertvollsten Messinggefäße der Antike hergestellt worden sind. Fotos machen. Selfie-Süchtige. Bilder posten. Dabei sein! Und als Tipp für Essen und Trinken hab ich soeben das ›Petit Marron‹ angepriesen. Mit Foto vom Haus und einem von dir, du weißt schon, das mit dem Leffe in der Hand und dem Teller mit dem Gulasch, wo du so blöd lachst«, schäkerte er und schlug seinem Vater auf die Schulter.
Der Bierbaron schüttelte den Kopf. »Ohne mich zu …«
»Tausende Likes und Daumen hoch! Also, Vadder, klopf die Schnitzel platt und kühl das Bier ein. So viel du kannst!«
Der Bierbaron fasste sich ans Kinn und nickte. »Da muss ich mir wohl doch was einfallen lassen«, sinnierte er. »Ich hoffe, du hast recht damit, sonst …«
»Sonst was?«, fragte Oliver fordernd.
»Schon gut, Oliver, ich glaub dir mal.« Er wandte sich um und rief in den Gastraum: »Moni! Wie viele Schnitzel haben wir eigentlich vorrätig?«
»Vielleicht 30.«
»Hmm, für heute dürfte das noch genügen. Aber morgen, wenn da tatsächlich viele Leute kommen …«, sagte er zu Oliver.
»Was können wir machen? Was ist sonst noch da?«, rief er Moni erneut zu.
»Wart mal«, antwortete Moni, »ich hab ’ne Idee. Damit kriegst du ’ne ganze Kohorte von Römern satt! Ruf mal die Feuerwehr an!«
Samstag, 27. Mai
Anjas Spiel
Polizeiwache in Vicht
Oberkommissarin Anja Schepp kochte sich einen Kaffee. Sie war befördert worden und hatte den Dienst in Vicht angetreten. Sie fühlte sich wohl hier in der Wache, die offiziell Bezirksdienst Süd, Anlaufstelle Vicht hieß. Noch vor zwei Jahren war die Wache komplett abgesoffen, bei der Hochwasserkatastrophe, als Autos und ganze Hauseinrichtungen wie Spielzeug weggeschwemmt worden waren. Sie hatte Anfang des Jahres den Dienst von Hanno Drechsler übernommen, der es lange ausgehalten hatte, bevor er sich hatte pensionieren lassen. Sie war frei, ihr Dienstbezirk war eher ruhig, und die Menschen in den Dörfern südlich und östlich von Stolberg waren weitgehend brave Bürger. Ein paar Kiffer, ein paar Diebe, ein paar Raser, ein paar Steuerhinterzieher und ab und zu ein alkoholisierter Autofahrer, wenn sie denn einen erwischte. Junge Burschen, die selbst gebastelte Bomben im Wald zündeten, Mädchen, die sich in sozialen Medien ein paar Klamotten zu viel auszogen, und Väter, die in der Folge zu hart zupackten. Oft musste sie schlichten, und dann war alles wieder gut. Schwerwiegende Fälle gab es selten. Viele der jungen Leute hockten lieber hinter ihrem Computer, als draußen etwas anzustellen. Und wenn sie welche von ihnen dabei erwischte, wie sie irgendeinen Unsinn im Kopf hatten oder online mit Drogen dealten, dann reichte es meistens, eine Verwarnung auszusprechen.
Festnahmen konnte sie an zwei Händen abzählen. Und wenn es mal schwierig wurde, dann war Drechsler zur Stelle. Er konnte ihr zumeist ein paar Tipps zu den Menschen hier geben, denn er kannte sie alle persönlich.
Das Einzige, was sie störte, war ihr unglaublich langweiliger Kollege, Kommissar Tomke Schluff, dem man jede Information, wirklich jede, aus der Nase ziehen musste. Er stammte aus Westerholt in Norddeutschland, ein paar Kilometer von der Küste entfernt. Ein Ort, von dem er behauptete, die spannendste Eventlocation dort sei das Gartencenter, weil man in den Plastikbiotopen den Goldfischen beim Sichvermehren zusehen könne. Das fand er lustig. Seine sonstigen Bemerkungen waren auch nicht viel klüger. Tomke trank jede Menge Tee und ging gefühlt alle paar Minuten eine rauchen. Und so roch er auch. Immer dann, wenn Anja die Nase rümpfte wegen der teuflischen Mischung aus ausgelutschtem Tee und kalter Zigarettenasche, sagte Tomke: »Teesatz un Tabak, ’n echter Ostfriesenjong!«, wobei er unverbesserlich grinste. Auf der anderen Seite war Tomke pflegeleicht, tat alles, worum Anja ihn bat, und hatte keine Probleme damit, unter einer weiblichen Vorgesetzten zu arbeiten.