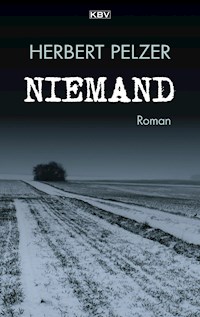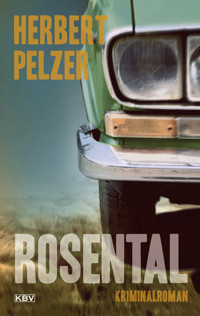
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: KBV Verlags- & Medien GmbH
- Kategorie: Krimi
- Serie: KBV-Krimi
- Sprache: Deutsch
1973 – Ein Sommer der bunten Farben und der finsteren Schatten Es ist heiß und trocken. Im beschaulichen Dorf Nörvenich wird eine männliche Leiche gefunden. Erschossen aus nächster Nähe, hingerichtet vor der eigenen Haustür. Das Entsetzen über die grausame Tat ist groß, denn keiner der Dorfbewohner kann sich an einen ähnlich kaltblütigen Mordfall erinnern. Während der Rest der Welt lebensfroh in den grellbunten Farben der Zeit erstrahlt, nimmt Kriminalhauptkommissar Emil Glasmacher von der Kripo Düren die Ermittlungen auf. Die wenigen erfolgversprechenden Spuren führen an die Mosel sowie in die nahe Kreisstadt Euskirchen. Schließlich gerät ein Elendsquartier am Euskirchener Stadtrand in den Fokus der Ermittlungen: das Rosental. Verbirgt sich hier, im Schatten der Zuckerfabrik, zwischen den Baracken und Schrottautos, ein Motiv für den Mord? Befindet sich unter den letzten Bewohnern dieser nach und nach verlassenen Siedlung der Täter? Und kann es gelingen, einen weiteren Mord noch rechtzeitig zu verhindern?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 282
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Herbert Pelzer
Rosental
Vom Autor bisher bei KBV erschienen:
Es wird jemand sterbenNiemand
Herbert Pelzer, geb. 1956, lebt und schreibt auf dem platten Land vor den Toren Kölns. Zuletzt hat er bis zum Frühjahr 2020 in der Film- und Fernsehausstattung gearbeitet, daneben widmet er sich seit einigen Jahren dem Schreiben.
Seit 2008 verfasst er Beiträge zur Regionalgeschichte, 2017 erschien mit Durch die Jahre sein Debütroman. 2021 veröffentlichte er bei KBV Es wird jemand sterben, die erste Kriminalerzählung, die – wie viele seiner Texte – in die Nachkriegszeit seiner Heimat, der Voreifel, führt. 2022 folgte Niemand.
HERBERT PELZER
ROSENTAL
KRIMINALROMAN
Originalausgabe
© 2023 KBV Verlags- und Mediengesellschaft mbH, Hillesheim
www.kbv-verlag.de
E-Mail: [email protected]
Telefon: 0 65 93 - 998 96-0
Umschlaggestaltung: Ralf Krampunter Verwendung von © Martin Debus - stock.adobe.com
Lektorat: Volker Maria Neumann, Köln
Druck: CPI books, Ebner & Spiegel GmbH, Ulm
Printed in Germany
Print-ISBN 978-3-95441-661-5
E-Book-ISBN 978-3-95441-669-1
Für Helmut
Die Welt mag untergehen,wenn ich mich nur rächen kann.
Cyrano de Bergerac
INHALT
1. KAPITEL
2. KAPITEL
3. KAPITEL
4. KAPITEL
5. KAPITEL
6. KAPITEL
7. KAPITEL
8. KAPITEL
9. KAPITEL
10. KAPITEL
11. KAPITEL
12. KAPITEL
13. KAPITEL
14. KAPITEL
15. KAPITEL
16. KAPITEL
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
1. KAPITEL
Alles begann damit, dass das Mädchen in Gerti Aborowskis Auto gekotzt hat.
Blass und spindeldürr hatte sie mit hocherhobenem Daumen am Straßenrand gestanden, und weil Gerti nicht wollte, dass sie zu einem dieser Arschlöcher ins Auto stieg, hatte sie angehalten.
»Wo soll’s denn hingehen?«, hatte sie gefragt, und das Mädchen hatte die Straße hinunter gezeigt und geantwortet: »In diese Richtung.«
Komische Antwort, aber Gerti war es eigentlich völlig egal, wohin dieses etwas verhuscht wirkende Wesen wollte, darum hatte sie nur gelacht und gesagt: »Na, dann komm, steig ein.«
Und das Mädchen war leicht wie eine Feder auf den Beifahrersitz gerutscht.
»Sag mal, wo kommst du eigentlich jetzt her? Hier draußen ist doch nichts.«
»Von da drüben«, die dünne Stimme des Mädchens passte zu ihrer fragilen Erscheinung. Der Zeigefinger ihrer schneeweißen Hand hatte zu den Feldern hinübergedeutet, aus denen sich, ein Stück von der Landstraße entfernt, der dichte Bewuchs rund um das Brasselsmaar erhob. Es war ein heißer Freitag im Juni, die Farbe der Ähren des Getreides wechselte gerade vom hellen Grün des Frühjahrs ins kräftige Goldgelb des Sommers. Gerti hatte das Radio leiser gestellt, weil sie dachte, dass sie vielleicht ein bisschen quatschen würden, doch das Mädchen hatte nur stocksteif dagesessen. Ihr Blick war stumm auf die Landstraße vor ihr gerichtet, und plötzlich hatte sie zu würgen angefangen. Blitzschnell hatte sie sich aufgerichtet, ihre Knie auseinandergedrückt, und einen Strahl übel riechender Kotze vor ihre Füße erbrochen.
»Was soll das denn?« Die Reifen hatten gequietscht, so hart war Gerti auf die Bremse gestiegen. »Bist du bescheuert? Kotzt mir hier ins Auto rein! Sag doch was, dann wär ich rechts rangefahren.«
Das Mädchen war noch blasser als vorher geworden, mit dunkel umrandeten Augen hatte es Gerti traurig angesehen, »Tschuldigung« geflüstert und sich mit ihrem dünnen Unterarm den Mund abgewischt.
»Also so was!« Gerti war vollkommen bedient gewesen. Doch was sollte sie machen? Sie war ausgestiegen, ums Auto herumgefegt, hatte die Beifahrertüre aufgerissen und die ganze Schweinerei auf der Fußmatte aus ihrem Auto herausbalanciert. Als sie weiterfuhren, war das Gras am Straßenrand mit Kotze verschmiert und die Fußmatte im Kofferraum auf dem Reservereifen gelandet.
Das Auto wieder sauber zu bekommen, war eine Heidenarbeit. Eigentlich hätte diese dumme Göre das machen sollen, doch die war verschwunden. Als sie den Kreuzberg hinunter ins Dorf gefahren waren, gleich nachdem sie die Brücke über den Neffelbach passiert hatten, da hatte das blasse Mädchen ihre Umhängetasche gegriffen und gebeten, dass Gerti anhalten solle. »Danke schön«, hatte sie noch gehaucht, dann war sie eilig ausgestiegen und auf dem Weg hinüber zum Burgpark davongeeilt.
Fast hatte Gerti die Begegnung schon vergessen, als sie sich am folgenden Tag daranmachte, den Wagen zu waschen. Doch beim Öffnen der Fahrertür ihres Renault 16 schlug ihr der scharfe Geruch von vergorener Kotze entgegen, und sofort hatte sie wieder das Bild des blassen Mädchens auf dem Beifahrersitz vor Augen. Ihr R 16 war giftgrün, die Farbe erinnerte an einen Laubfrosch. Die albernen Witze ihrer Kollegen über diese zugegebenermaßen etwas gewagte Farbe ignorierte Gerti mittlerweile. Sie liebte dieses Fahrzeug, es war ihr erster eigener Wagen – und er war bezahlt. Aus diesem Grund stieg auch jetzt wieder der Ärger in ihr hoch. Warum hatte diese Göre nichts gesagt? Es wäre so einfach gewesen, kurz anzuhalten, damit sie sich aus dem Wagen lehnen konnte.
Mit einem entschlossenen Seufzer holte sie ihr Putzzeug aus dem Spind, ihre schärfsten Reinigungsmittel kamen zum Einsatz, und bald schon war der komplette Innenraum ihres giftgrünen R 16 mit einer dicken Schicht aus Seifenschaum überzogen.
Das Auto parkte am Straßenrand vor ihrem Haus, ein Stück die Grünstraße hinauf stand ein weiterer, und ganz oben stand der Wagen von Otto Rinkens. An fast allen waren Türen und Hauben geöffnet. Es war Samstagnachmittag, mit Putzeimern und Gartenschläuchen bewaffnet waren ihre Besitzer damit beschäftigt, dem Schmutz der vergangenen Woche auf ihren Autos den Garaus zu machen. Gewöhnlich schallten zu dieser Zeit die lauten Stimmen von aufgeregten Sportreportern aus den Autoradios. In den Fußballstadien der Nation kommentierten sie, unterlegt vom Lärm der Zuschauer, die Spiele der Bundesliga. Nur hin und wieder unterbrach ein Hit aus den aktuellen Musikcharts die Reportagen. Doch heute, am Nachmittag, sollte das DFB-Pokal-Endspiel in Düsseldorf ausgetragen werden, da wollten alle Männer natürlich vor dem Fernsehgerät sitzen, weshalb sie an diesem 23. Juni 1973 ihre ausgebreiteten Fensterleder sehr viel weniger liebevoll als sonst über den glänzenden Lack ihrer Lieblinge zogen.
Das allwöchentliche Ritual des Wagenwaschens, öffentlich vollzogen auf den Straßen des Dorfes Nörvenich, bedeutete so manchem nichts weniger als die verdiente Belohnung für das anstrengende Leben in einer Welt, die ganz und gar verrückt geworden zu sein schien. Da waren zum Beispiel die ständigen Reibereien zwischen den Politikern in Ost- und Westdeutschland. Sollte der Honecker doch hinter seiner Scheißmauer hocken und sich für den Größten halten. Daneben gab es die Gefahr für Leib und Leben unbescholtener Bürger durch diese durchgeknallten Mörder, die sich in der sogenannten RAF zusammengefunden hatten. Dann die jungen Leute, die lange Haare und hässliche Parkas trugen, Haschisch rauchten und sich in Köln auf dem Neumarkt versammelten, um »Ho Ho Ho Chi Minh« zu skandieren. Und in Bonn regierten die Roten! All das Ungute, das sich in die Welt geschlichen hatte, ließ sich am Samstagnachmittag für eine kurze Weile von den lauten, aufgeregten Stimmen im Autoradio verdrängen. Hoffentlich gewannen wenigsten die Kölner heute Nachmittag das Finale, dachten die einen, während die anderen mit gleicher Inbrunst für ihre Gladbacher den Sieg erhofften. Damit man wenigstens ein bisschen Freude erleben durfte in dieser verrückten Zeit. Bevor man sich am Montagmorgen schon wieder viel zu früh im frisch geputzten Wagen auf den Weg zu einer eintönigen Maloche nach Düren oder sonst wohin machen musste.
Der Kirchgang am Vormittag, der Schweinebraten mit Kartoffeln und Soße um zwölf Uhr, Mittagsschlaf, Kaffeetrinken mit Buttercremetorte und danach ein Spaziergang mit der Familie; der Sonntag verging so, wie fast alle Sonntage vergingen. In schläfriger Eintönigkeit. Als am Abend draußen vorm Dorf die letzten Ausflügler in ihren frisch geputzten Autos auf ihrem Weg von der Eifel zurück nach Hause über den Heerweg brausten, da saßen die meisten Dorfbewohner vor ihren Fernsehgeräten und schauten Karl-Heinz Köpke dabei zu, wie er die neuesten Nachrichten über den Besuch des großen KPdSU-Generalsekretärs Breschnew in den USA vom Blatt ablas.
In der Nacht zog ein heftiges Gewitter über Nörvenich hinweg. Vom Donnergrollen geweckt, stand Gerti Aborowski auf und ging hinüber zum Fenster, um es zu schließen. Keine Sekunde zu früh, denn kaum, dass sie wieder in ihrem Bett lag, prasselte lang anhaltender Starkregen gegen die Fensterscheiben. Am nächsten Morgen war die Luft kühl und rein, die bleierne Trägheit des Sonntags schien vom Regen in die Tiefen der Kanalisation gespült worden zu sein. Eigentlich gute Bedingungen für den Start in eine neue Arbeitswoche. Schon früh waren etliche Dorfbewohner auf den Beinen, um sich auf den Weg zu ihren Arbeitsplätzen zu machen, und alle, die ihn sahen, wunderten sich über den Polizeiwagen, der mit hohem Tempo und eingeschaltetem Martinshorn ins Dorf hineinfuhr.
Menschen erschienen in geöffneten Fenstern und Türen, Köpfe wurden gehoben, Hälse gereckt, und das Blaulicht war noch eingeschaltet, als zwei Polizisten durch ein schmiedeeisernes Tor das Grundstück der Rinkens in der Grünstraße betraten.
Vor den Treppenstufen hinauf zur Eingangstür, verdeckt von einem halbhohen Rhododendronbusch, lag ein Mann von etwa sechzig Jahren rücklings auf dem Boden. In seiner Stirn klaffte ein dunkles Loch, unter seinem Hinterkopf glänzte eine wässrige Blutlache in der Morgensonne. Der Mann war tot, das erkannten die Polizisten sofort. Auf der oberen Treppenstufe stand eine Frau, sie war untersetzt, ihr geblümter Morgenmantel stand offen und gab den Blick auf ein blau gestreiftes Nachthemd frei. Starr vor Entsetzen sah sie die Polizisten an, dann gaben ihre Beine nach. Gerade eben noch gelang es ihnen, die Frau aufzufangen, bevor sie auf die Treppenstufen schlug.
* * *
Hinter Kriminalhauptkommissar Emil Glasmacher röchelte die Kaffeemaschine, das Brot war nicht mehr frisch, darum bestrich er die Scheibe mit einer dicken Schicht Erdbeermarmelade. Früher lief um diese Zeit schon das Transistorradio. Seitdem Rita ihn verlassen hatte, blieb es still an seinem Frühstückstisch. Nur der gedämpfte Lärm der erwachenden Stadt drang von der Holzstraße herauf in seine Wohnung im zweiten Stock.
Der Kaffee war bitter, die Marmelade zuckersüß. Er überflog die Schlagzeilen in der Tageszeitung: Breschnew in den USA. Günter Netzer schießt im Düsseldorfer Rheinstadion das Siegtor im Pokal-Finale. Kurz blieb er an der Wettervorhersage hängen, dann klatschte ihm ein Tropfen roter Marmelade auf das Zeitungspapier. Verdammt! Genervt faltete er die Zeitung zusammen, trank den letzten Schluck Kaffee und begann lustlos, den Frühstückstisch abzuräumen. Er musste los, ein Blick auf seine Armbanduhr zeigte ihm an, dass er spät dran war.
Gerade hatte er im Flur seine Jacke vom Haken genommen, als das Telefon klingelte. Der Apparat war grün, er hatte viel lieber das schlichte Postgrau haben wollen, aber Rita war nicht von dem grünen Endgerät abzubringen gewesen. Sie hätte das hässliche Ding einfach mitnehmen sollen. Beim dritten Klingeln nahm er den Hörer ab: »Glasmacher.«
Die Stimme am anderen Ende der Leitung klang aufgeregt.
»Sind Sie sicher?«, hakte er nach. Und dann: »Jaja, schon gut. Wo ist das, sagen Sie?« Er versuchte seinen linken Arm in den Jackenärmel zu schieben.
»In Nörvenich. Okay, bin unterwegs.«
Die Luft war klar an diesem Morgen. In der Nacht hatte es geregnet, nasse Blätter von jungen Akazienbäumen klebten auf seinem Wagen. Es herrschte bereits reger Verkehr auf den Straßen, trotzdem kam er gut voran, viel weniger Autos fuhren aus der Stadt heraus, als in sie hineinströmten. Vor zwei Monaten hatte Kriminalhauptkommissar Emil Glasmacher seinen 58. Geburtstag gefeiert. Die Feier hatte aus einem Besuch im Dalmatiner bestanden, wo er sich alleine an einen Tisch im hinteren Bereich gesetzt und einen Grillteller bestellt hatte. Trotz seines Alters und obwohl er deftiges Essen mochte, war er immer noch schlank, am Morgen seines Geburtstags hatte er seine schwarzen Haare vorm Spiegel auf graue Stellen untersucht und zu seiner Freude nur einige wenige an den Schläfen gefunden. Dazu ließ ihn seine schlanke Figur jünger erscheinen, als er war. Niemand konnte behaupten, dass Glasmacher einen unzufriedenen Eindruck mache. Die Kollegen wussten, dass er seinen Beruf liebte, die jüngeren bewunderten ihn dafür, wie er es immer wieder schaffte, den ganzen Dreck, mit dem sie sich tagein, tagaus beschäftigen mussten, einfach nicht an sich heranzulassen. Als trüge er so etwas wie einen unsichtbaren Leidzerbröseler mit sich herum, der alles, was tagtäglich auf ihn einströmte, in Sekundenschnelle in mikroskopisch kleine Fitzelchen pulverisierte. Darüber hinaus schien er die Arbeit und sein Privatleben messerscharf voneinander trennen zu können. »Das wird mir wohl nie gelingen«, hatte Mike Matzerath gestöhnt. Matzerath war Glasmacher als Assistent zugeteilt worden, eigentlich war sein Vorname Michael, doch alle, außer Glasmacher, nannten ihn Mike.
Jetzt verließ er über die Kölner Landstraße die Stadt Düren, in der er nun schon seit mehr als dreißig Jahren Verbrecher jagte. Die ganze Palette der Widerwärtigkeiten, zu denen die Menschen fähig sind, war ihm schon untergekommen. Schlimme Fälle, verdammt schlimme Fälle, die verbunden waren mit furchtbarem Leid für die Opfer, waren darunter gewesen. Er hatte sie alle routiniert und, in den Augen der Kollegen, mit einer bewundernswerten Distanz bearbeitet. Dabei war die Quote seiner gelösten Fälle beachtlich, sie war sogar unverschämt hoch, was ihm jede Menge Anerkennung im Kollegenkreis einbrachte.
Und jetzt fuhr er hinaus zur nächsten Widerwärtigkeit. Im Dorf Nörvenich war eine Leiche gefunden worden, und Glasmacher hätte nicht sagen können, um das wievielte Opfer es sich dabei in seiner Laufbahn handelte.
Die Grünstraße sah aus wie all die anderen Straßen in der Region, die etwa zwanzig Jahre zuvor bebaut worden waren. Einfamilienhäuser mit quadratischem Grundriss, die Giebelwand zur Straßenseite hin ausgerichtet, und Vorgärten, in denen Rosen und Margeriten in sauber geharkten Beeten blühten.
Das eingeschaltete Blaulicht am geparkten Wagen der Kollegen zeigte Glasmacher den Einsatzort an. Rechts und links der Straße waren zahlreiche Autos abgestellt worden, vermutlich Schaulustige, denn eine ziemlich große Menschenmenge hatte sich drüben beim Blaulicht versammelt. Ein gutes Stück vom Haus entfernt hielt er hinter zwei abgestellten Fahrrädern, die ihm die Weiterfahrt versperrten. Er sah seinen Assistenten Matzerath, der bereits hinter der Polizeiabsperrung stand und sich mit einem uniformierten Kollegen unterhielt. Als er sich ihnen näherte, erkannten sie ihn. Der Uniformierte hob das Absperrband an, Matzerath trat eine Zigarette aus und wendete sich seinem Chef zu. Wie fast alle Menschen um ihn herum, so überragte Michael Matzerath auch den Uniformierten um eine Kopflänge. Das blonde Haar reichte ihm fast bis auf die Schultern, der üppige Schnurrbart endete erst unterhalb der Mundwinkel. Diese modischen Langhaarfrisuren, wie sie derzeit viele Männer trugen, behagten Emil Glasmacher nicht. Er fand sie unpraktisch, und den meisten Männern standen diese Mähnen auch nicht. Sie sahen damit aus wie die pubertierenden Halbstarken, die hässliche Parkas trugen und auf dem Kölner Neumarkt »Ho Ho Ho Chi Minh« brüllten. Doch Matzerath war ein guter Kriminalist, darum hatte Glasmacher beschlossen, sich mehr damit zu beschäftigen, was in Matzeraths klugem Kopf vor sich ging, als damit, was darauf wuchs.
»Morgen, Chef«, grüßte Matzerath knapp, dabei wies er schon auf die männliche Leiche, die am Ende des Plattenwegs vor der Treppe lag. »Otto Rinkens«, fuhr er fort, »57 Jahre alt, lebte mit seiner Frau alleine hier im Haus. Sieht verdammt nach Kopfschuss aus, aufgesetzt.«
Glasmacher nickte Matzerath und dem Uniformierten zu, der beiseitetrat, um den schmalen Weg freizugeben. Rinkens Leiche zeigte keinerlei Spuren von Gegenwehr. Fast sah es so aus, als ob der Mann schliefe, nur sein rechter Arm war abgewinkelt, als hätte er noch in letzter Sekunde nach etwas greifen wollen.
Glasmacher beugte sich ein wenig zu dem Toten hinab, nein, hier hatte tatsächlich kein Kampf stattgefunden, der Mann war dem Anschein nach überrascht worden.
»Wer hat ihn gefunden?«, wollte Glasmacher wissen.
»Seine Frau«, erklang die Stimme des Uniformierten in seinem Rücken. »Elfriede Rinkens, sie ist drinnen, sitzt im Wohnzimmer auf der Couch. Der Rettungswagen ist unterwegs.«
Mit einem unterdrückten Ächzen richtete sich Glasmacher wieder auf, die Kollegen von der Spurensicherung waren eingetroffen, auch sie begrüßte er nur mit einem freundlichen Kopfnicken, dann drückte er sich am Rhododendronbusch vorbei und stieg die Treppe hinauf zum Hauseingang. Im Wohnzimmer saßen zwei Frauen eng beieinander auf dem Sofa. Über ihnen hing die gestickte Darstellung einer alpinen Landschaft in einem üppig profilierten Goldrahmen an der Wand. Die etwas kleinere der beiden Frauen musste Elfriede Rinkens sein, dachte Glasmacher. Mit einem blütenweißen Taschentuch betupfte sie sich das Gesicht. Die Frau neben ihr sah sie traurig an, während sie Elfriede die Hand auf die Schulter legte.
»Würden Sie uns bitte einen Moment alleine lassen?«, sprach Glasmacher sie an, die Frau schaute ein wenig beleidigt zu ihm auf, verließ dann aber, ohne zu zögern, den Raum. Glasmacher stellte sich vor, fragte, ob sie sich setzen dürften, er und der Kollege Matzerath, und obwohl Frau Rinkens keine Reaktion zeigte, nahmen sie auf den Sesseln gegenüber der Couch Platz. Die Frage, ob sie ihr ein paar Fragen stellen dürften, beantwortete die Frau mit einem kaum wahrnehmbaren Kopfnicken. Sie stand eindeutig unter Schock, stellten die Polizisten fest, darum hielten sie die Befragung kurz. Gerade konnte Frau Rinkens noch die Frage, ob sich ihr Mann in den letzten Tagen anders als sonst verhalten habe, mit einem knappen »Nein« beantworten, als zwei Sanitäter mit schweren Notfallkoffern in den Händen den Raum betraten. Sofort baten sie die Polizisten, die Befragung zu beenden, worauf Matzerath sein Notizbuch zuklappte und seinem Chef hinaus in den Flur zum Ausgang folgte. Glasmacher stand in der offenen Haustür und beobachtete die Kollegen der Spurensicherung. Dieser Fall schien ein dickes Ding zu sein. Ein Mann war vor seinem eigenen Haus erschossen worden, anscheinend ohne sich zur Wehr gesetzt zu haben.
Die Menge der Schaulustigen hinter dem schmiedeeisernen Gartentor war noch größer geworden, Kollegen hatten bereits damit begonnen, die Nachbarn zu befragen, als einer der Sanitäter hinter ihm das Haus verließ, um eine Trage für Frau Rinkens aus dem Rettungswagen zu holen. Kriminalhauptkommissar Glasmacher stieg die Treppe hinab, er musste mit dem Leiter der Spurensicherung sprechen.
Am Nachmittag fuhren sie gemeinsam in Glasmachers Wagen zurück zur Polizeistation nach Düren. Matzerath hatte sein Notizbuch aufgeklappt und tippte mit seinem Kugelschreiber auf seinen Aufzeichnungen herum. »Da ist ja nicht viel zusammengekommen«, sagte er. »Die Nachbarn waren ein Totalausfall, niemand hat etwas gehört oder gesehen.« Er begann, in dem abgegriffen Büchlein zu blättern, blieb an einer Seite hängen und fuhr fort: »Die Rinkens lebten dem ersten Eindruck nach so unscheinbar wie zwei Grashüpfer auf einer abgelegenen Wiese. Da kommt noch ein Batzen Arbeit auf uns zu.«
Glasmacher fand den Vergleich komisch, er schaute seinen Kollegen an, wollte etwas sagen, doch dann fiel sein Blick an dem üppigen Schnurrbart vorbei nach draußen auf die Gymnicher Burg, die sie gerade passierten. Davor war ein Park angelegt worden, bequeme Sitzbänke unter ausladenden Bäumen, asphaltierte Spazierwege zwischen gepflegten Rasenflächen, und an den Eingängen standen große Schilder, auf denen aufgelistet war, welche Verbote bei der Nutzung des Parks zu beachten waren. Die Burg dahinter machte einen etwas heruntergekommenen Eindruck, irgendwie passten Burg und Park nicht zueinander.
Während Matzerath weiterredete, gingen Glasmachers Gedanken zurück in die Vergangenheit. Vor vielen Jahren war er schon einmal hierhin gerufen worden, damals ging es um den Fall Hubert Hüsch, der tot im Rosenbeet vor der Gymnicher Burg gelegen hatte. Der alte Harff war sein Vorgesetzter gewesen, und obwohl Harff von Anfang an erhebliche Zweifel an Glasmachers Theorie vom kleinen Ganoven Kaspar Niemand als Täter hatte, war er durch nichts davon abzubringen gewesen. Wie vernagelt hatte sich sein Hirn allen anderen Optionen verschlossen. Doch Harff hatte recht behalten, Niemand war nicht der Täter, und Glasmacher hatte reichlich belämmert dagestanden.
Es war einer der ersten Fälle in seiner Laufbahn, und es war ein mieser Einstieg als Ermittler gewesen, dachte Glasmacher, als das Ortsschild von Nörvenich vor ihnen auftauchte. Viele Jahre lang war die Erinnerung an den Fall Hüsch tief vergraben gewesen unter dem riesigen Berg von Erinnerungen an zig heikle Fälle. Nach seiner Meinung hätte sie dort auch für alle Ewigkeit bleiben können, doch jetzt holte sie ihn in aller Klarheit wieder ein. Das schmerzte, und Emil Glasmacher schwor sich, hier kein weiteres Waterloo zu erleben.
»… das sollten wir zuallererst überprüfen«, hörte er Matzerath wie aus der Ferne sagen.
»Unbedingt«, antwortete Glasmacher, »so machen wir es.«
* * *
Hinter ihr röchelte die Kaffeemaschine. Sie saß an dem alten, verkratzten Tisch in ihrer Küche, wie sie oft über Stunden dasaß, wenn der Monat sich wieder einmal grässlich langsam seinem Ende näherte. Auf dem Tisch stand nichts für ein Frühstück bereit, nur eine Schachtel Zigaretten lag dort neben einem Stapel alter Boulevardzeitungen und zerfledderter Illustrierten, in denen bereits jedes Kreuzworträtsel gelöst war. Die Schachtel war schon zur Hälfte leer, sie würde bald schon wieder zu Skopins hinübergehen müssen, um einige von den starken Filterlosen zu schnorren, die der Alte immer begleitet von schmierigen Anzüglichkeiten herausrückte.
Kaffee und Tabak, das war ihr täglich Brot, ohne sie würde sie keine Woche überleben. Und Bier natürlich, neben dem Stapel alter Zeitungen drängelten sich einige leere Flaschen auf dem kleinen Tisch, eine fette Fliege setzte sich auf einen Flaschenhals und krabbelte unruhig darauf herum.
Das Haus, in dem sie wohnte, gehörte ihr nicht, es war eines von einer ganzen Reihe eingeschossiger Häuser, die vor Jahren von der Stadt im Rosental errichtet worden waren. Hier waren Leute, die keinerlei Ansprüche zu stellen hatten, in sogenannten Einfachstwohnungen untergebracht worden. Keine Badewanne, keine Dusche, ein Herd in der Küche, der mit Kohle oder Holz befeuert werden musste, dazu die lärmende Bundesstraße und die stinkende Zuckerfabrik nur einen Steinwurf entfernt. Die Alfred-Nobel-Straße war keine gute Adresse, Leute ohne Arbeit, Sozialhilfeempfänger und Geringverdiener lebten hier dicht gedrängt neben Kleinganoven und Autoschiebern. Hier wohnten die Mädchen, die die knappsten Hotpants, und die Jungs, die die Hosen mit dem weitesten Schlag trugen. Über Leonid Iljitsch Breschnew und die KPdSU wusste hier kaum jemand etwas, schon gar nicht, warum dieser komische Kauz gerade in den USA weilte.
Mit den Jahren war das Viertel zum Schandfleck der Stadt Euskirchen geworden. Alles hier war heruntergekommen, renovierungsbedürftig. Doch hier renovierte schon lange niemand mehr.
Arko von schräg gegenüber schlug an. Wütend zerrte der Hund an seiner Kette und verbellte den dicken Baggerfahrer, der gerade hinüber zu seinem Caterpillar schlurfte. Ein neuer Arbeitstag begann, heute würde er dem Haus von Jablonskis den Rest geben. Die Familie war ausgezogen, sie wohnte jetzt im fünften Stock einer Mietskaserne am anderen Ende der Stadt. Das Haus wurde abgerissen, so wie alle Häuser abgerissen wurden, deren Bewohner bereits umgesetzt worden waren, wie das im feinsten Behördendeutsch genannt wurde.
Gisela Langhoff goss sich den ersten Pott Kaffee ein an diesem Tag. Die würden sie hier niemals rauskriegen, dachte sie bei sich. Niemals, dafür war es jetzt zu spät. Draußen vor ihrem Fenster stieg Staub auf, der Greifarm des Baggers riss die Wände von Jablonskis Haus um, als wären sie aus Pappe gefertigt. Sie wendete den Blick ab und schlürfte vom heißen Kaffee, er schmeckte bitter wie Galle. So saß sie, wie sie so oft dasaß, an ihrem alten, verkratzten Küchentisch. Über Stunden, freudlos und ohne jeden Antrieb. Sie starrte auf das schwarze Rund in ihrer schmutzigen Tasse, und wie beinahe an jedem Tag, so gingen auch jetzt ihre Gedanken wieder zurück zu jenem Tag im September 1955. Sie verspürte den Reiz, die volle Tasse mit Wucht an die Wand zu knallen.
2. KAPITEL
Otto Rinkens war mit einem Kopfschuss getötet worden. Die Waffe war aufgesetzt und sehr wahrscheinlich mit einem Schalldämpfer bestückt worden. Deutlich erkennbare Schmauchspuren auf seiner Stirn ließen keinen anderen Schluss zu.
Seine Ehe mit Elfriede war kinderlos geblieben, es war kaum acht Wochen her, dass sie ihren fünfundvierzigsten Hochzeitstag gefeiert hatten. Rinkens betrieben ein Busunternehmen, sie waren erfolgreich, fünf Busse standen auf dem Betriebsgelände am Dorfrand. Touren in den Schwarzwald und an die Nordsee gehörten zu ihrem Angebot. Auf jedem ihrer Busse prangte der Werbeslogan in gefälliger Schönschreibschrift: Mit Rinkens Reisen sorglos reisen!
Die zugezogenen Vorhänge an den Fenstern ihres Büros tauchten den Raum in ein grelles Gelborange. Kriminalhauptkommissar Emil Glasmacher und sein Assistent Michael Matzerath saßen sich an ihren Schreibtischen gegenüber und fassten zusammen, was sie über das Mordopfer wussten.
»Ein absolut unauffälliges Leben haben diese Leute geführt«, sagte Matzerath. »Kaum vorstellbar, dass sie Feinde hatten.«
Trotz der zugezogenen Vorhänge war es schon am Morgen warm in ihrem Büro, die Sonne stand bereits hoch am Himmel, das Polizeipräsidium war ihr schutzlos ausgeliefert.
»Einen Raubüberfall würde ich ebenfalls ausschließen«, fuhr Matzerath fort, »warum sollte jemand sein Opfer mitten in der Nacht vor das Haus locken und es dort erschießen, ohne sich danach irgendeine Beute anzueignen?«
Die Überlegungen seines Assistenten waren wie immer präzise. Glasmacher nickte zustimmend mit dem Kopf. Guter Mann, dachte er.
»Also: Die Rinkens verbringen den Abend gemeinsam vor dem Fernsehgerät«, Matzerath zählt die Punkte seiner weiteren Ausführung an den Fingern ab, »sie geht als Erste zu Bett, das war gegen 22:30 Uhr. Sie bekommt noch mit, wie er ihr folgt, sie schaut auf den Wecker, es ist exakt 22:49 Uhr. Dann schläft sie ein. Ihr Schlaf ist bewundernswert tief, dafür ist sie dankbar. Nur einmal, nämlich um 4:12 Uhr, wird sie wach und bemerkt, dass das Bett neben ihr leer ist. Mehrmals steht Otto in der Nacht auf, um aufs Klo zu gehen. Seine Blase, eine Altmännerblase, man kennt das ja. Am Morgen wird sie wach, es ist 6:57 Uhr, Otto liegt nicht in seinem Bett. Das ist ungewöhnlich, fast immer schläft er länger als sie, darum richtet sie sich auf und ruft nach ihm. Sie vermutet ihn schon im Bad, doch da ist er nicht. Das Licht im Treppenhaus ist eingeschaltet, auch das ist ungewöhnlich. Sie geht hinunter, ruft mehrmals nach ihm, doch sie bekommt keine Antwort. Unruhe steigt in ihr auf. Sie zieht die Rollläden an der Terrassentür hoch und schaut in den Garten. Nichts, Otto ist nicht zu sehen. Dann geht sie zurück in den Flur, durch die Buntglasscheiben in der Haustür erkennt sie schemenhaft etwas Ungewöhnliches, vorsichtig öffnet sie und sieht Otto rücklings auf dem Boden vor der Treppe liegen.« Matzerath ist zum dritten Mal bei seinem rechten Daumen angekommen. »Irgendjemand oder irgendetwas muss ihn in der Nacht, noch vor 4:12 Uhr, aus dem Haus gelockt haben, wo er auf seinen Mörder gestoßen ist«, beendet Matzerath seine Zusammenfassung.
Na prima, dachte Glasmacher, so weit, so gut, aber aus all dem ergab sich für ihn nichts, rein gar nichts, woran sie ansetzen konnten. »Dass Frau Rinkens ihren Mann im Haus erschossen und danach nach draußen geschleppt hat, können wir, glaube ich, ausschließen. Dafür gibt es keinerlei Anhaltspunkte.«
»Sehe ich genauso«, stimmte Matzerath zu, »so eine ist die nicht, auch wäre sie zu schwach, eine Leiche durchs Haus zu schleppen. Darüber hinaus haben wir nicht den kleinsten Hinweis dafür gefunden.«
Gut, die Frau war raus, dachte Glasmacher, das schien immerhin sicher zu sein, doch blöderweise hatte der Regen in der Nacht draußen, beim Fundort der Leiche, alle Spuren verwischt. Sie mussten anders an den Fall herangehen. Morgen würde die Zeitung darüber berichten, einschließlich der Bitte an die Bevölkerung, verdächtige Beobachtungen der Polizei zu melden. Vielleicht hatten sie ja Glück, und es kam etwas Brauchbares rein. Aber wie oft war ihm schon das Glück bei der Lösung eines Falls zu Hilfe gekommen? Er konnte sich nicht an ein konkretes Beispiel erinnern. Gedankenverloren schaute Glasmacher zu Matzerath hinüber, dessen Gesicht in das leuchtende Gelborange der sonnenbeschienenen Vorhänge getaucht war, während er konzentriert in seinem Notizbuch blätterte.
Sie würden nach Nörvenich fahren müssen, Familienangehörige, Mitarbeiter, wenn es sein musste, jeden Dorfbewohner mussten sie befragen. Das würde wieder eine Ochsentour werden. Viel Gequassel für vielleicht nichts. Doch es ging nicht anders.
»Wen, hatten Sie gesagt, sollten wir zuerst überprüfen? Die Mitarbeiter?« Matzerath schaute von seinem Notizbuch auf. »Nein, zuerst noch einmal die Nachbarschaft, dann die Familienangehörigen und dann natürlich auch dringend die …«
»Schon gut«, unterbrach Glasmacher seinen Assistenten, »legen wir los, aber die Mitarbeiter sollten wir uns auch vorknöpfen.«
»…Mitarbeiter«, beendete Matzerath seinen Satz begleitet von einem angedeuteten Kopfschütteln. Irgendwie angespannt war der Chef in den letzten Stunden. Das war man gar nicht gewohnt von ihm.
Die Polizeihauptwache in Düren befand sich in einem schlichten Zweckbau. Gleich neben der schönen alten Villa, in der Emil Glasmacher seine Karriere bei der Kripo begonnen hatte, war sie vor Jahren in kürzester Zeit hochgezogen worden. Ein rechteckiger Kasten mit Flachdach und ohne jeden Charme, wie Glasmacher fand. Überhaupt war die Stadt gerade in einem Höllentempo dabei, ihr eben erst erworbenes Flair einer schnieken Fünfzigerjahrestadt wieder zu verlieren. Nackter Beton, kalte Glasfronten und viel zu viele Quadratmeter Waschbetonplatten verunstalteten jetzt sein schönes Düren. Er fragte sich, was sich die Herren und Damen Architekten wohl dabei dachten, wenn sie in einem Gebäude wie der Polizeihauptwache 75 Fenster einbauen ließen. In einer Front! Die nach Südosten ausgerichtet war! Er konnte sich lebhaft vorstellen, wie ein junger Architekt seinen Planungsentwurf dem Dürener Stadtrat vorstellte. Frisch von der Uni, in brauner Cordhose und grünem Rollkragenpullover, würde er sich nervös wie ein Teenager vor seinem ersten Rendezvous erheben und verkünden: »Die Südostseite ist mit der maximal verglasten Fläche optimal für die bestmögliche Lichtausbeute ausgestattet. Außerdem gilt es längst als erwiesen, dass eine erhöhte Sonneneinstrahlung ursächlich ist für die vermehrte Ausschüttung des körpereigenen Glückshormons Serotonin. Was wiederum bedeutet, dass die Beamten zukünftig mit deutlich gesteigerter Motivation ihrer für uns alle so wichtigen Arbeit nachgehen werden.«
Im Stadtrat werden sie schwer beeindruckt von diesem Redeschwall mit den Köpfen genickt haben. Die modernen Zeiten ließen sich eben nicht mehr aufhalten, verbeulte Dienstwagen und verbeulte Schreibtische in den Büros waren passé. Nun sollte alles heller, bunter und irgendwie poppiger werden. Da konnte man leicht auf die schön geschwungenen Neonreklamen über den Geschäften in der Innenstadt und das heimelige Blausteinpflaster der öffentlichen Plätze verzichten. Und schließlich hing ja vor jedem Fenster auf der Wache ein Vorhang aus gelborangefarbenem Synthetikmaterial, der zwar pflegeleicht war und eine enorm positive Grundstimmung verbreitete, aber weder Licht noch Wärme von den Büros fernhielt. In Nörvenich gab es sogar noch Fachwerk. Das Bürgermeisteramt oder das schöne alte Haus gegenüber der Burg waren so recht nach Glasmachers Geschmack.
In der Grünstraße hatten sie Glück, auf dem Nachbargrundstück der Rinkens stand eine Frau im Vorgarten und unterhielt sich mit einer weiteren Frau. Es ging um den Vorfall in der Nacht von Sonntag auf Montag, das erkannte Glasmacher sofort. Keine zwei Tage waren seitdem vergangen, die Suppe kochte noch, und das war ihm ganz recht. »Na, dann los«, sagte er zu Matzerath, »hoffen wir mal, dass bei dem Gequassel etwas Substanzielles dabei ist.«
War es aber nicht. Nein, die Frauen hatten nichts gehört, außer dass es stark geregnet hatte in dieser Nacht. Da waren sie sich einig. Das so etwas heutzutage überhaupt möglich war! Erschossen vor dem eigenen Haus! Mitten in der Nacht und das sogar hier bei ihnen auf dem Dorf. »Wie in Schikajo«, sagte die Nachbarin.
Glasmacher wollte gerade das Gespräch beenden, als er einen Mann hinter seinem Rücken wahrnahm. Ausgestattet mit heftigen O-Beinen und einem Paar abgelaufener Schuhe an den Füßen, war er nahe bei ihnen stehen geblieben. Die blanke Neugier stand ihm ins verschwitzte Gesicht geschrieben. Über die Schulter trug er eine schwere lederne Tasche, der Mann war offensichtlich der Postbote hier.
»Ja bitte«, sprach Glasmacher ihn an, »kann ich Ihnen helfen?«
»Mir? Äh, nee. Ich meine, ja, doch. Ich wollt fragen, ob Sie schon wissen, wer das getan hat.« Mit einem Kopfnicken deutete er hinüber zu Rinkens Haus.
»Die Ermittlungen dauern noch an«, antwortete Glasmacher knapp. Schon wollte er sich wieder abwenden, als er dann doch fortfuhr: »Sie sind hier der Postbote, nehme ich an?«
»Ja, genau. Rey, Willibert mein Name, ich bin jeden Tag hier. Die Rinkens kriegen ja jeden Tag Post, und nicht nur einen einzigen Brief. Das ist oft ein ganzer Packen, Rechnungen, amtliche Sachen, auch viel Privates. Die kriegen Post aus der ganzen Welt, also aus ganz Deutschland. Erst letzte Woche war ein Brief dabei, der …«
»Jaja, schon gut«, unterbrach Glasmacher ihn. Aber sagen Sie, Herr …«
»Rey, Willibert.«
»Sagen Sie mal, Herr Rey, ist Ihnen vielleicht etwas Besonderes aufgefallen in der letzten Zeit?«
»Mir? Nee, was soll mir denn aufgefallen sein?«
»Das fragen wir Sie, ist doch nicht schwer zu verstehen, oder?« Mike Matzerath hielt sein offenes Notizbuch in der Hand. Hier sollte doch verdammt noch mal wenigstens ein winzig kleiner Hinweis rauszuholen sein.
»Ja, also mir«, wiederholte Rey und sah dabei Rinkens Nachbarin an, »also mir ist echt nichts Auffälliges aufgefallen, oder, Roswitha, uns ist hier doch nichts aufgefallen, was für die Herren wichtig sein könnte?«
Du lieber Gott, dachte Glasmacher, was für ein Typ. Das konnte ja heiter werden. Für den Fall, dass Herrn Rey doch noch etwas einfallen sollte, forderten sie ihn auf, umgehend in der Polizeiwache in Düren anzurufen. Dann verabschiedeten sie sich und gingen hinüber zum Haus der Rinkens.
Elfriede Rinkens öffnete selbst. Sie war alleine im Haus, anscheinend hatte sie sich schon wieder etwas gefangen. Im Krankenhaus hatte man sie untersucht, jedoch nichts gefunden, was eine Einweisung zur stationären Behandlung gerechtfertigt hätte. Darum war sie mit dem Taxi schon am Nachmittag wieder zurück nach Nörvenich gefahren worden. Eine Nachbarin schaute jetzt zweimal täglich nach ihr. Eine gewisse Frau Körfer von gegenüber kümmerte sich nun um sie.
Zu dem, was sie bereits ausgesagt hatte, konnte Frau Rinkens heute nichts hinzufügen. Darum nur ein paar letzte Fragen noch, dann würde man sie auch schon wieder in Ruhe lassen. Doch, ja, ihre Ehe würde sie als eine glückliche bezeichnen. Otto sei ja ein viel beschäftigter Mann gewesen, da sei er halt nicht so oft zu Hause gewesen. Am Anfang habe sie darunter gelitten. »Aber man gewöhnt sich mit der Zeit an so Vieles«, sagte sie. Und nein, wirtschaftlich hätten sie keine Probleme. Das Geschäft sei gesund, sie hätten keine Verbindlichkeiten. Einmal im Jahr machten sie eine große Urlaubsreise. Otto fahre leidenschaftlich gerne weg, er sei immer unternehmungslustig gewesen. Das sei ja aber auch wichtig fürs Geschäft, auf ihren Reisen testet er gerne das ein oder andere mögliche Ziel für ihre beliebten Fahrten. Mit Rinkens Reisen sorglos reisen, das war nicht nur so ein Werbespruch, da war Otto ganz gewissenhaft, da wollte er immer ganz genau wissen, was er den Kunden anzubieten hatte.
Ganz früher, in den Anfangsjahren ihres Geschäfts, da sei er auch hin und wieder mal alleine losgefahren. Aber das sei schnell wieder vorbei gewesen, sagte Elfriede, er habe sie dann immer dabeihaben wollen, weil Frauen mit ganz anderen Augen zum Beispiel auf die Sauberkeit in einem Hotel achteten.
Glasmacher und Matzerath sahen sich an. Der eine klappte sein Notizbuch zu, der andere unterdrückte einen leisen Seufzer.