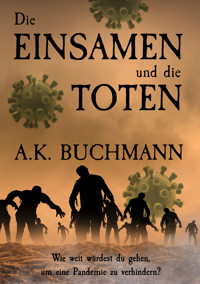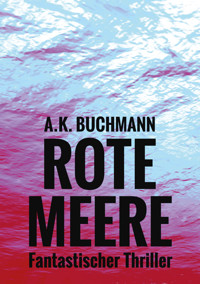
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Shadodex - Verlag der Schatten
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein Luxusliner. Unterdrückte Vampire. Und ein unfassbarer Plan. Nach einem traumatischen Jugenderlebnis hat Holly Salem ihr Leben in den Dienst von THIRTEEN STRIPES gestellt, der Geheimorganisation zur Kontrolle des Vampirbestands für Nordamerika. Doch ein tödliches Experiment, das sie an einem Elitesoldaten durchführen muss, beginnt ihr Weltbild zu zersetzen. Schließlich ist sie sich ihrer Überzeugungen nicht mehr sicher. Einzig ihrer besten Freundin könnte sie sich nun anvertrauen. Aber die befindet sich für verdeckte Ermittlungen auf einem Luxusliner und ahnt nicht, dass ein abtrünniger Vampirsoldat im Begriff ist, den Nordatlantik in ein Meer aus Blut zu verwandeln. Ein packender Genremix auf See, der sich vom klassischen Vampirbild löst. Grusel meets Spannung und psychische Untiefen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 451
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ROTE MEERE
vonA.K. BUCHMANN
Alle Rechte, insbesondere auf digitale Vervielfältigung,
vorbehalten.
Das Buchcover darf zur Darstellung des Buches unter Hinweis auf den Verlag jederzeit frei verwendet werden.
Eine anderweitige Vervielfältigung des Coverbilds ist nur mit Zustimmung des Verlags möglich.
Die Handlungen sind frei erfunden.
Evtl. Handlungsähnlichkeiten sind zufällig.
www.verlag-der-schatten.de
Erste Auflage 2024
© A. K. Buchmann
© Coverbilder: Depositphotos kerenby
Covergestaltung: Verlag der Schatten
© Bilder: Depositphotos ElemenTxDD (Wolfsaugen)
knivesandtools (Dolch)
A.K. Buchmann (Luxusliner, U-Boot, Zerstörer, Wellen, Ratte, Schwertfisch, Versinkender, Autorenfoto)
Lektorat: Shadodex – Verlag der Schatten
© Shadodex – Verlag der Schatten, Bettina Ickelsheimer-Förster,
Ruhefeld 16/1, 74594 Kreßberg-Mariäkappel
ISBN: 978-3-98528-043-8
ROTE MEERE
Fantastischer Thriller
von
A.K. BUCHMANN
Dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte.
Aus diesem Grund findet sich am Ende eine Triggerwarnung.
Achtung!
Die Triggerwarnung enthält Spoiler für das gesamte Buch!
Wie weit würdest du für deine Überzeugungen gehen?
Er kämpft für die Menschen.
Sie verweigern ihm die Anerkennung.
Jetzt wendet er sich gegen sie.
Obwohl Captain Jeremiah Winters seit dem Jahr 1775 für Amerika in den Krieg zieht, werden ihm auch noch an der Schwelle zum 21.
Jahrhundert seine Grundrechte verwehrt, weil er ein Vampir ist. Selbst sein Leben gehört nicht ihm. Es liegt in den Händen der Geheimorganisation THIRTEEN STRIPES, die in ihm und jedem anderen
seiner Art eine potenzielle Bedrohung für die öffentliche Sicherheit ausmacht. Ein missglückter Fallschirmsprung öffnet Winters die
Augen. Er ist nicht länger bereit, die ihm zugewiesene Rolle in der Welt zu spielen. Zusammen mit seinem Team aus Elitesoldaten plant er seinen eigenen Unabhängigkeitskrieg, um dem Schattendasein zu entkommen, und beschwört mitten auf dem Atlantik ein Meer
aus Blut herauf.
Inhalt
Prolog
ERSTER TEIL: SCHARADE
Befehle
Wolfspfade
Ufer
Dinnerjackets
Ratten
Unmaskiert
Fischen
ZWEITER TEIL: VEITSTANZ
Ursprünge
Kursänderungen
Verwandlungen
Entscheidungen
Hilflosigkeit
DRITTER TEIL: KREUZSEEN
Sichtungen
Zerstörer
Sackgassen
Lageänderungen
Kräfte
Epilog
Personenliste
Danksagung
Triggerwarnung
Buchhinweise
Über die Autorin
The only easy day was yesterday.
(Motto der Navy SEALs)
Prolog
Nordatlantik, 1991
östlich von Norfolk
Winters war im freien Fall. Über ihm donnerten die Turbinen und schluckten das ewige Schweigen der Nacht. Langsam zählte er im Kopf von drei rückwärts und zog die Reißleine. Während er darauf wartete, dass sein Körper von über einhundertzwanzig Meilen pro Stunde auf fast null abgebremst wurde, spannte er die Muskeln an.
Der übliche Riss des Bremsmanövers, der ihn von der Bauchlage in die Senkrechte katapultierte, blieb aus.
Sein Fallschirm hatte sich nicht geöffnet.
Er rechnete.
Sie waren aus fünfunddreißigtausend Fuß abgesprungen. Das verschaffte ihm von jetzt an drei Minuten und …
… sieben Sekunden …
… sechs Sekunden …
… fünf Sekunden …
… bis er mit der Wasseroberfläche kollidierte. Der Einschlag würde ihn im Vergleich zu einem Menschen vermutlich nicht töten, aber ihm jeden Knochen brechen und ihm das Bewusstsein rauben. Seine Kampfausrüstung, die unter anderem aus einer Glock, einer MP-5 von Heckler & Koch, Munition, Ersatzmunition, Nachtsichtgerät sowie der Körperpanzerung bestand, war bei diesem Übungssprung um panzerbrechende Raketen ergänzt worden. Sie waren an Brust und Hüfte befestigt und würden ihn in die Tiefe des Atlantiks ziehen. Im Notfall müsste er sie abschneiden. Zunächst aber galt es, seine Optionen zu sondieren.
Eine Frage schob sich plötzlich in seinen Gedankenkreis. Konnte er eigentlich ertrinken? Der Sauerstoffmangel schnitt ihn definitiv von seinem Bewusstsein ab, aber wie lange musste er unter Wasser bleiben, um die Schwelle zum Tod zu überschreiten?
Er wusste es nicht.
Eins nach dem anderen.
Winters sah nach oben. Drei Gleitschirme verschwanden gerade in einem Wolkenband, das sich vor dem nächtlichen Himmel dunkelgrau abzeichnete. Bei seinen Männern, Blondell, Lavender und Blackburn, lief also alles glatt. Sie hatten die Formation gebildet, in der sie bis in die Landezone schweben würden.
Er war als Letzter gesprungen, aber er würde als Erster unten ankommen, wenn sich der Schirm nicht öffnete.
Sicherlich waren seine Männer bereits jetzt alarmiert. Er hatte sich ihnen auf der Formationshöhe von dreiunddreißigtausend Fuß nicht angeschlossen. Gerade gingen sie mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass er die Sache unter Kontrolle bringen würde. Nur Blondell traute er zu, sich ernsthafte Sorgen um ihn zu machen. Obwohl Winters die beiden Lieutenants, Flea Lavender und Ed Blackburn, länger kannte, stand ihm Sergeant Major Scott Blondell am nächsten. Er war denkfähig und souverän. Flea hingegen neigte zur Impulsivität, Blackburns Festhalten an der Religion erschien ihm befremdlich.
Keiner der Männer hatte ihn jemals enttäuscht.
Bis zur Landezone, einem Baseballfeld in Virginia Beach, waren es knapp fünfundzwanzig Meilen. Wenn er nicht mit gebrochenen Knochen auf dem Meeresgrund liegen wollte, auf die vage Möglichkeit vertrauend, dass die anderen ihn fanden, musste er den Fallschirm aus dem Rucksack holen, um wenigstens den Strand zu erreichen.
Captain Jeremiah Winters zog die Beine an die Brust und kam in der Luft in eine sitzende Position, um seinen freien Fall mithilfe des erhöhten Luftwiderstands größtmöglich abzubremsen. Zudem ermöglichte ihm nur eine senkrechte Haltung, nach dem Fallschirm auf seinem Rücken zu tasten, ohne ins Trudeln zu geraten.
Er sah wieder nach oben. Gerade drehte die Boeing ab. In einigen Minuten würde sie auf dem Norfolk International landen, von dem aus sie gestartet war. Das Dröhnen ihrer Turbinen wurde leiser, schluckte aber noch immer das Rauschen des Fallwinds.
Normalerweise flog die Maschine für eine große amerikanische Fluggesellschaft, in dieser Nacht war sie inkognito für die US Navy unterwegs. Solange Schurkenstaaten im Krisenfall ihren Luftraum für militärische Flüge sperrten, den Linienverkehr aber weiterhin gestatteten, trainierten Spezialeinheiten wie die Navy SEALs den gefährlichen Absprung aus den Passagiermaschinen.
Der kleine Pilotfallschirm hatte gezündet. Er flatterte zweieinhalb Meter über Winters’ Kopf und trug wenigstens ein wenig zur Stabilisierung seiner Körperhaltung bei, wenngleich er seine Fallgeschwindigkeit nicht reduzierte. Der Hauptschirm steckte noch immer im Rucksack fest. Er zog ruckartig an den Tragegurten an seinen Schultern, um ihn zu lösen. Der Schirm entfaltete sich nicht. Er versuchte es erneut mit noch mehr Kraft und blieb auch dieses Mal erfolglos. Die Notprozedur für seine Situation sah die Trennung der Hauptkappe, in welcher sich der widerspenstige Fallschirm befand, und die anschließende Öffnung des Reserveschirms vor.
Winters fiel in ein tiefer liegendes Wolkenband. Von oben sahen Wolken stets aus, als könne man sich auf sie legen, von innen betrachtet waren sie aber nichts weiter als Nebel. Feuchter Dunst legte sich auf die wenigen freien Stellen an den Rändern seines Gesichts, das von der Sauerstoffmaske bedeckt wurde. Er musste den Höhenmesser nahe an seine Augen halten, um ihn ablesen zu können.
Einundzwanzigtausend Fuß.
Damit ihn der Reserveschirm noch rechtzeitig abbremste, bevor er mit dem Atlantik kollidierte und das Bewusstsein verlor, durfte er nicht unter vierhundert Fuß gelangen. Er hatte also noch Zeit. Es gab keinen Grund, in Panik zu geraten. Ein derartiger Affekt lag ihm ohnehin fern, aber seit einiger Zeit litt er an einer merkwürdigen inneren Unruhe, die von der Unfähigkeit begleitet wurde, ausschließlich nach vorne sehen zu können. Erinnerungen an vergangene Kriegseinsätze bedrängten ihn. Brennende Ölfelder, brennender Dschungel, Häuserskelette. Dazwischen mischte sich der Händedruck des Präsidenten anlässlich der nicht lange zurückliegenden Verleihung der Medal of Honor. Eine warme, glatte Hand. Es war die erste Auszeichnung, die ihm verliehen worden war, gleichzeitig die höchste. Obwohl es sogar ein Foto gab, auf dem ihm der Präsident im Oval Office die Hand schüttelte, war die Sache unter Verschluss. Niemand sollte wissen, wer er war, geschweige denn was. Die Fotografie lag zusammen mit dem Orden in seinem Kellerregal.
Winters stellte fest, dass es in seinen Ohren nicht mehr dröhnte, sondern rauschte. Die Maschine war außer Sicht- und Hörweite. Er fiel aus der Wolkenschicht heraus. Für einen Augenblick zeigte sich das Gesicht des Nachthimmels mit seinen gleichmäßig leuchtenden Sternen. Er griff an seine rechte Schulter, um die Hauptkappe des Fallschirms mithilfe des Twinkies zu lösen, aber auch das Reservekabel fügte sich nicht. Er brauchte mehrere Anläufe. Erneut umhüllten ihn Wolken.
Blondells flehender Gesichtsausdruck vor der grünen Hölle. Helfen Sie mir Captain! Bitte! Für die Rettung seines Lebens damals in Vietnam hatte man ihm keinen Orden verliehen, ganz im Gegenteil. Er hatte sich erst vor einem Ausschuss rechtfertigen müssen, war anschließend degradiert worden.
Blondell lebte. Das war das Einzige gewesen, was für ihn zählte, auch wenn der Mann danach anders war. Er war einer von ihnen geworden. Und er füllte mit seiner Präsenz zumindest einen Teil der Leerstelle, die Winters seit zwei Jahrhunderten schmerzte. Mit den beiden anderen Männern seines Teams, Flea und Blackburn, führte er eine Zweckgemeinschaft, aber die Beziehung zu Scott Blondell war von intimerer Natur.
Der Reserveschirm zündete und bremste Winters’ freien Fall abrupt. Er streckte die Beine, während er aus der Wolkendecke hinausglitt. Der kräftige Wind trieb ihn auf die amerikanische Küste zu. Fünfzehntausend Fuß, wieder neblige Wolken. Dieses Mal waren sie lichter.
Der Präsident im Oval Office, der ihn für seine Verdienste während Desert Storm lobte. Schnarrender Südstaatenakzent. Seine Laudatio drehte sich in erster Linie um das Öl, das Winters’ tapferer und persönlicher Einsatz gesichert hatte, kaum aber um die dank ihm noch lebenden Kameraden. Dann Ruinen, panikhelle Gesichter, die leblosen Männer, die er nicht hatte schützen können, im blutdurchtränkten Wüstentarn vor Bagdad.
Er ließ die letzten Wolkenfetzen über sich und schwebte zwischen Himmel und Erde, unter ihm das Meer als dunkle Fläche. Nur vereinzelt glitzerte stecknadelfein die Gischt.
Zu seinem Bedauern wurde das Firmament über dem Ozean von den Wolken verschleiert und über Land von den Lichtern der Zivilisation getrübt. An der Scheide zwischen Atlantik und Festland machte er die beiden Cape Henry Leuchttürme aus, die sie im Bauch der Boeing passiert hatten. Deutlich erinnerte er sich an sie und an den schattenhaften Umriss der gerade erst auf Kiel gelegten USS NEW ORLEANS im Militärhafen von Norfolk. Das waren die einzigen Momente, in denen er aus dem runden Flugzeugfenster gesehen hatte. Wie so häufig war keine Zeit gewesen, der Combat Controller hatte ihn und sein Team zur Vorbereitung des Absprungs schnell wieder auf die Füße gejagt. Winters’ Leben glich einer atemlosen Aneinanderreihung von Fallschirmsprüngen, Tauchgängen, Schießtrainings und Kriegseinsätzen.
Nun glitt er dahin, der Nylonschirm trug ihn. Seine Gedanken spannten sich erst über die Militärroutinen und schließlich über die Zeiten hinweg. Nur einmal in seinem Leben war er einem Mann begegnet, der gewesen war wie er selbst, wahrscheinlich der Erste seiner Art. Kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs hatten sie einander gegenübergestanden. Die Tiefe der Augen des anderen holte ihn seitdem immer wieder ein. Er hatte ihm in den Seelengrund geblickt und sich selbst in ihm erkannt.
Er war ein Schöpfer.
Ein Ausgestoßener.
Ein Getriebener.
Winters hatte ihn für die Eleganz seiner Bewegungen und die Souveränität seiner Entscheidungen bewundert. Der andere hatte das Exil gewählt, er selbst den Dienst. So mussten sie sich sofort wieder trennen. Der Graben zwischen ihnen war damals zu tief gewesen. Schenkte ihm seine zweite Natur ein ebenso langes Leben wie es Winters vergönnt war? Eine Zeit lang hatte er den anderen für weich gehalten, obwohl er schlicht schlauer gewesen war als er selbst. Er hatte sich entschieden, das ihm gegebene Leben nicht mit der fortwährenden Aussicht auf den Tod zu verschwenden.
Westlich seiner Position zuckte eine Wetterleuchte über den Himmel. Der Virginia Beach zeichnete sich als schmaler, heller Streifen vor den Leuchttürmen ab. Er sah auf den Höhenmesser und schätzte die Entfernung. Unmöglich, es noch bis in die Landezone zu schaffen, aber mit ein wenig Glück und dem Ostwind im Rücken musste er wohl nicht allzu weit schwimmen.
Winters machte sich für die Landung bereit. Wieder maserte eine Wetterleuchte den Nachthimmel. Beinahe zeitgleich fasste er einen Entschluss. Fantasiebilder eines waghalsigen Plans schoben sich in seinen Geist. Er schüttelte den Kopf, aber sie ließen sich nicht vertreiben. Also sah er ihnen zu, hielt sich selbst im ersten Moment für verrückt, im zweiten für mutig, im dritten klatschte er ins Wasser und saß bis zur Brust in der sanften Brandung vor dem Virginia Beach. Der Fallschirm sank in den Ozean. Er stand auf, riss sich die Maske vom Gesicht und lief los, der Schirm blähte sich hinter ihm im Wasser und hielt ihn zurück. Er geriet aus dem Gleichgewicht, stürzte rücklings, wurde von einer Welle überrollt. Einen Augenblick lang ließ er sich in der atemlosen Dunkelheit des Seewassers treiben und lauschte der Brandung und seinem eigenen rasenden Herzschlag. Schließlich löste er geübt die Gurte des Fallschirms von seinem Körper, kam auf die Beine und stapfte an Land. Bei jedem Schritt stieß ihm seine Ausrüstung unsanft gegen die Oberschenkel.
Noch heute Nacht würde er seine Männer in seinen vagen Plan einweihen. Sie würden einige Jahre Vorbereitungszeit für diese gewaltige Mission benötigen, mit der er entweder seinen eigenen Untergang besiegelte oder den Beginn eines neuen Zeitalters einläutete.
ERSTER TEIL: SCHARADE
Befehle
Norfolk, 1998
Der Präsident hatte ihn nach dem Frühstück in den Tod geschickt. Er sprach langsam und kontrolliert, aber seine Stimme vibrierte wie eine Wasseroberfläche, die ein kaum merklicher Hauch streicht. Im ersten Moment glaubte First Lieutenant Frank Lee Lavender, den seine Kameraden Flea nannten, an ein statisches Rauschen in der Telefonleitung, aber der Präsident wiederholte den entscheidenden Satz zweimal. »Sie werden diesen Befehl befolgen, Herr Lavender! Sie werden ihn befolgen!« Flea sah ihn förmlich vor sich, leicht nach vorne gebeugt, mit einer Hand den Telefonhörer haltend, die andere mit mahnend aufgestelltem Zeigefinger.
Selbstverständlich hatte ihm der Präsident den genauen Wortlaut des Befehls verschwiegen. Er war Politiker. Lange Zeit seines Lebens hatte Flea sich über zurückgehaltene Informationen, unnötig lange Sätze und ausufernde Argumentationen der Anzugträger in Washington D.C. geärgert. Schließlich verstand er, dass sie sich, genau wie er selbst in seinen Einsätzen, tarnen mussten, um strategisch im Vorteil zu bleiben. Mit dieser Einsicht ließ sich das Telefonat im Rückblick auf zwei nennenswerte Aspekte reduzieren. Erstens war es mehr als ungewöhnlich, vom Präsidenten selbst angerufen zu werden. Die Navy SEALsunterstanden ihm zwar direkt, aber Flea hatte noch nie erlebt oder auch nur im Entferntesten gehört, dass der Oberbefehlshaber sich persönlich an einen seiner Elitesoldaten wendete. Zweitens war die Rückversicherung der Loyalität unnötig. Flea hatte sich stets als amerikanischer Patriot bewiesen. Er wäre so weit gegangen, das für jeden SEAL zu behaupten. Somit blieb eine einfache Schlussfolgerung. Der Präsident forderte sein Leben. Im Hintergrund war ein ganz großes Ding am Laufen.
»Ziehen Sie Ihr Shirt aus, Herr Lavender!«
Flea grinste dümmlich. »Das ist jetzt nicht gerade der Befehl, den ich erwartet hatte, Ma’am.«
»Die Stiefel und Socken auch!«
Sie sah zu ihm auf, ohne den Kopf zu heben. Ihre dunklen Augen hielten seinem herausfordernden Blick stand.
»Vielleicht könnten Sie das heute Abend in einem intimeren Rahmen noch mal wiederholen? Am Strand vielleicht? Pünktlich zum Sonnenuntergang am Virginia Beach unterhalb der beiden Cape Henry Leuchttürme? Ist Militärgelände, aber Sie haben keine Probleme da reinzukommen, nicht wahr?« Flea setzte sein bezauberndes Boy-Group-Lächeln auf.
»Führ dich nicht auf wie ein Preisgockel, bloß weil der Präsident deinen Namen kennt! Du hast die Lady doch gehört!« First Lieutenant Edward Blackburn stemmte die Hände in die Hüften. Der hohe Raum verstärkte das Grollen in seiner Stimme.
Flea verkniff sich zu fragen, ob er neidisch auf den Anruf des Präsidenten sei. Stattdessen zuckte er mit den Schultern. »Hooya!«
Er zog sich das T-Shirt über den Kopf.
»Sind Sie nicht ein bisschen schmal für einen Soldaten dieses Formats? Herrje, Sie sehen aus wie ein Fünfzehnjähriger!«, kommentierte der Mann, der zusammen mit der Frau gekommen war, um ihm den Befehl zu übermitteln. Die beiden hatten sich nicht vorgestellt und auch nicht die Institution genannt, für die sie arbeiteten. Der Präsident hatte ihr Erscheinen angekündigt. Das musste wohl genügen. Zwar trugen sie beigefarbene Navy-Uniformen, die aber schlecht saßen und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nur der Tarnung dienten. Die Tasche der Frau gehörte nicht zum Militär-Standard.
»Ich sehe aus wie ein Achtzehnjähriger und wir Froschmänner beurteilen andere nach der Kraft ihrer Herzen«, bemerkte Flea schlicht und schnürte die Stiefel auf. Er nahm grundsätzlich keine Männer ernst, die zu fett waren, um ihr eigenes Körpergewicht an einer Reckstange nach oben zu ziehen. Der General, der ihm gewöhnlich die Befehle erteilte, war Mitte fünfzig und damit im selben Alter wie dieser Kerl, aber unter seinen Bauch konnte man keinen Bleistift klemmen.
»Haben Sie vielleicht einen Zettel und einen Stift?«, fragte der Mann und klopfte mit beiden Händen seine Taschen ab. »Ich will mir Ihre ergreifende Antwort aufschreiben! Vielleicht kann ich damit Ihre Urgroßmutter beeindrucken!«
Flea überging den Kommentar. Er hoffte, dass der entscheidende Befehl von der Frau kommen würde. Sie war niedlich. Mit ihren kurzen, dunklen Haaren, den großen Augen und der zierlichen Figur erinnerte sie ihn an Audrey Hepburn.
Er wurde enttäuscht.
»Sie werden jetzt in das Becken springen und so lange tauchen, bis Sie bewusstlos werden.« Der Mann grinste, zog dabei aber nur einen Mundwinkel nach oben.
Flea sah Blackburn fragend an. Deshalb waren sie also zum Ausbildungsbecken und nicht in einen Besprechungsraum gegangen. Aber was sollte daran besonders sein? Der Absauf-Drill war Teil seiner Ausbildung gewesen. Auch er schulte SEALs auf diese Art und Weise. Das Wasser war ihr Element. SEAL: Sea, Air, Land. Zugegeben, ertrinken war nicht gerade angenehm, und wenn er genau darüber nachdachte, konnte er dem Wasser nicht viel abgewinnen. Aber das half nichts. Ein SEAL musste schwimmen und tauchen wie ein Fisch. Wenn Flea einen Bus voller neuer Jungs zum ersten Mal zum Becken fahren ließ, rissen sie die Mäuler noch auf. Nachdem sie ein oder zwei Wochen lang jeden Morgen schwammen, bis ihnen die Luft ausging, und ihre Körper erschlafften, wurden sie erst leiser und verstummten schließlich. Es gab keine Gewöhnung an die Todesangst, aber sie lernten, bis zum letzten Atemzug zu schwimmen.
Ed Blackburn erwiderte Fleas Blick. Seine dunkle Nasenspitze zuckte kaum merklich nach oben. Kapierst du ’s nicht?, schien er ihn zu fragen.
Flea stand auf dem Schlauch. Er leistete dem Befehl Folge, auch wenn ihm die ganze Situation gleichzeitig absurd und irgendwie gewöhnlich erschien. Er stopfte seine Socken in die Stiefel, ging auf den Beckenrand zu, während er einige Male stoßartig durchatmete, und sprang kopfüber in das Fünfzig-Meter-Becken.
Sein verschwommener Blick glitt über die Bodenkacheln, während er darüber nachdachte, wie sehr er das Wasser verabscheute. Am liebsten übernahm er Aufgaben, die im Bereich des Heeres lagen. Nächtliche Streifzüge, bei denen er zusammen mit seinem Team auf die Jagd ging, waren sein Ding. An die Einsätze als Black Devils während des Zweiten Weltkriegs erinnerte er sich mit den dahingleitenden Jahren in fast schon sentimentaler Weise.
Flea erreichte die andere Seite des Beckens, schwamm eine Rollwende, stieß sich ab und tauchte wieder zurück. Black Devils … SEALs … Seit den 1940er-Jahren jedenfalls immer Spezialeinheit. Stets mittendrin, aber ohne wirklich dazuzugehören.
Das waren noch Zeiten gewesen! Der Captain, Blackburn und er waren durch die Dunkelheit geschlichen wie die heilige Dreieinigkeit aus der Hölle und hatten die Deutschen das Fürchten gelehrt. Captain Winters lief voran, Ed und er folgten ihm. Ihre geschwärzten Gesichter, die dunklen Wollmützen und die Uniformen ließen sie mit der Nacht verschmelzen. Ihrer Ausrüstung war nichts beigefügt, was Geräusche verursachen konnte. Nur wenn es sich nicht vermeiden ließ, töteten sie mit dem Gewehr. Ihre bevorzugte Waffe war das Messer.
Erneut hatte er die fünfzig Meter zurückgelegt und kehrte um.
Schwamm er hin oder zurück? Er wusste es nicht. Es erschien ihm auch nicht weiter wichtig. Der Befehl war eindeutig.
Wo war das damals gewesen? Vermutlich in der Provence, irgendwann kurz nach dem D-Day im Juni 1944. Er erinnerte sich noch genau an die nächtliche Sommerwärme, die Zikaden und den sandigen Boden unter seinen Stiefeln. Als sie die Umrisse eines Kübelwagens vor dem Lager der Deutschen erkannten, gebot ihnen Winters mit einem gehobenen Arm innezuhalten. Sie hockten sich in einer Bodenwelle nebeneinander, spähten nach den Wachen, die im Vergleich zu ihnen taub und blind waren. Die deutschen Soldaten zogen ihre Kreise um das Lager herum und die drei Black Devils warteten geduldig, bis sich eine Lücke auftat, durch die sie ins Innere huschten.
Flea stieß an, wendete und schwamm.
Butcher ’n’ bolt, abschlachten und abhauen, hatten sie diese Art von Missionen genannt.
An den genauen Weg in die Holzbaracke der Offiziere konnte er sich im Nachhinein nicht mehr erinnern und nahm daher an, dass er ohne Komplikationen verlaufen war. Aber er entsann sich noch genau des Kampfmessers in seiner Faust. Noch heute besaß er es. Das extra für die Black Devils angefertigte V-42 war ein Meisterstück! Der lederne Griff verjüngte sich hinten zu einem spitz zulaufenden Schlagstück. An das Ricasso oberhalb des Schafts schloss sich die doppelseitig geschliffene Klinge an.
Anstoßen, wenden, weitertauchen.
Die deutschen Offiziere lagen entlang der Barackenwände in ihren Feldbetten und schliefen. Anders als Menschen benötigten die drei Black Devils kaum Licht, um sich in der Dunkelheit zu orientieren. Trotzdem ließen sie die Tür einen Spaltbreit offen, um sich nicht von den Geschehnissen innerhalb des Lagers abzuschneiden. Falls jemand käme, wollten sie rechtzeitig gewarnt sein. Die sternenklare Nacht warf einen spärlichen Lichtschein herein. Flea folgte seinen Ohren und seiner Nase. Vier im ruhigen Rhythmus der Ruhe schlagende Herzen. Vier nach Schweiß stinkende Uniformen und Stiefelpaare, Pomade und Waffenöl. Winters’ großer, schlanker Schatten baute sich vor dem ersten Feldbett auf, an dessen Fußende ein weiteres stand, das Flea übernahm. Blackburn bezog vor dem Offizier, der an der Rückwand der Baracke schlief, Stellung. Sie benötigten kein Zeichen, um zu wissen, wann die anderen bereit waren. Flea presste seine Hand auf den Mund und die Nase des Deutschen, durchschnitt ihm im selben Moment die Kehle so tief, bis die Klinge des Dolchs auf den Widerstand der Halswirbelsäule stieß. Er hörte das Herz des Mannes losjagen und das leise Plätschern des Bluts. Aber schnell wurde der Puls träger und verstummte schließlich.
Anstoßen, weitertauchen.
Der verbliebene Offizier war aufgewacht. Flea hörte, wie er sich aufsetzte. Mit einem Satz war er bei ihm. Winters war einen Schritt schneller, erstickte den aufkeimenden Laut mit einer Hand, durchstieß gleichzeitig mit dem spitzen Messer die Brust an zwei Stellen und brachte so die Lunge zum Kollabieren. Die Luft entwich leise zischend durch die Stichwunden. Er setzte einen Kehlschnitt. Der Deutsche fiel zurück auf sein Feldbett.
Der Beckenrand.
Winters schlich zur Tür, spähte durch den Spalt hinaus, lächelte und sah Flea an. »Die Aufkleber«, raunte er und leckte das Blut von der Messerklinge.
Flea kramte in seiner Hosentasche und holte ein paar der viereckigen Sticker hervor. »Das dicke Ende kommt noch!«, stand in deutscher Sprache darauf. Er klebte je einen auf jeden der Toten. Diese Aktion würde am kommenden Morgen das Lager in einen wild gewordenen Hühnerhaufen verwandeln. Sollten die Deutschen sich nur vor Angst in die Hosen pissen! Flea grinste und sah durch den Türspalt in die Nacht hinaus. Seine Hochstimmung wurde vom Konzert der Zikaden begleitet.
Langsam wurden Fleas Gedanken träger. Die Provence entglitt ihm. Er beobachtete die Bodenkacheln je nach Tiefe des Beckens mal näher mal weiter entfernt unter ihm vorbeistreichen. Schon immer war er Soldat gewesen. Obwohl … ganz zu Anfang hatte er schlicht Geld gebraucht, aber schon bald hatte er sich damit arrangiert. Bis zur Gründung der Black Devils im Verlauf des Zweiten Weltkriegs war er einfacher Infanterist geblieben. Danach hatte er zusammen mit Winters und Blackburn immer wieder die Spezialeinheiten gewechselt. Army Rangers, Green Berets, Navy SEALs, Delta Forces, wieder SEALs. Alles für ihr Land. Winters ging stets voraus. Sie folgten ihm. Sie befolgten die Anordnungen des Präsidenten. Bis sie in Vietnam Blondell dazubekamen, waren sie unter sich. THIRTEEN STRIPES wollte sie nie zu lange an einem Ort wissen, weihte Dritte nur ein, wenn es sich nicht verhindern ließ, so wie beim General, der ihnen auf die Schliche gekommen war. Scheiße, ging ihm diese ganze Geheimniskrämerei auf die Nerven!
Schon wieder der Beckenrand.
Es war an der Zeit, den eigenen Geist zurückzuziehen, bevor die Panik kam. Flea kratzte seine Gedanken zusammen wie Eis von einer Windschutzscheibe. Einer hielt sich hartnäckig und forderte seine Aufmerksamkeit: Was in aller Welt tue ich in diesem Becken?
Blackburn hatte die Puzzleteile offenbar zusammensetzen können.
Abstoßen, schwimmen.
Tief in seinem hageren Oberkörper, irgendwo zwischen atemlos zuckendem Zwerchfell und den Lungenspitzen, spürte er die Panik wachsen, diesen evolutionären Reflex, der auch seinem Gehirn nicht abzugewöhnen war. Seine Gedanken wichen davor zurück, nur einen nahm er mit in die Dunkelheit.
Warum? …
Und dann ein letzter Gedankenblitz.
… Winters! Sie wollen an mir überprüfen, ob er noch am Leben ist!
Fleas Selbst hüllte sich in einen Kokon, drosselte von dort aus seinen Herzschlag. Die wasserblauen Kacheln verschwanden hinter einem schwarzen Vorhang. Seine Hand stieß gegen den Beckenrand. Aber davon merkte er nichts mehr. Er schwamm auf Autopilot. Sein Körper wendete selbstständig.
Irgendwann erschlafften seine Muskeln mitten in der Bewegung. Flea sank den Bodenkacheln entgegen. Das Becken war an dieser Stelle zehn Meter tief.
Holly Salem beobachtete jede Bewegung Lavenders vom Beckenrand aus. Es roch nach Chlor und Testosteron und sie sah einem Mann beim Ertrinken zu.
Ihr müsst alle Register ziehen! Irgendetwas Großes geht da vor sich!, beschwor ihre deutsche Kollegin sie in ihrer Erinnerung. Sie hatte ihr geglaubt und Sam alarmiert, aber mit jedem Schwimmzug des SEALs bröckelte ihre Überzeugung ein klein wenig mehr.
»Bin gespannt, ob Typen wie ihr ersaufen können«, sagte ihr Kollege Sam Hatfield gerade unnötigerweise.
Ihre Hände umschlossen die Henkel der Tasche fester. Sein dämliches Gequatsche würde sie irgendwann in den Wahnsinn treiben. Sie sehnte den Tag herbei, an dem sie ihn endlich loswerden konnte. Aber der lag noch weit in der Zukunft. Es dauerte viele Jahre, um sich als Senior zu bewähren, und solange Altersgrenzen höher gehandelt wurden als Befähigungen, hatte sie keine Aussicht auf einen anderen Partner.
»Darf ich fragen, wie ich Typen wie ihr verstehen darf, Sir?«, fragte Lieutenant Blackburn.
Sam sah ihn verwundert an. »Na, Typen wie ihr eben.«
»SEALs?«
»Auch Robben können nur sehr lange die Luft anhalten. Ein normaler SEAL kann also ertrinken«, sagte Sam, der offensichtlich stolz auf sein naheliegendes Wortspiel war.
»Dann meinen Sie vielleicht Schwarze?« Blackburn verschränkte die Arme vor der Brust.
»Nein, nein!« Sam lachte etwas zu laut. »Dass die ersaufen können, ist klar. Außerdem ist ihr Kumpel im Wasser ja gar nicht schwarz, oder sind Sie farbenblind?«
Blackburn schwieg eisig.
Holly musste für zwei Sekunden die Augen schließen und tief durchatmen. Sie trat einen Schritt näher an den Beckenrand neben einen der Startblöcke, damit die beiden nichts davon mitbekamen.
Am Anfang ihrer Zusammenarbeit hatte sie Sam nach seinen peinlichen Auftritten beiseitegenommen und ihm erklärt, dass man weder Schwarze mit dem N-Wort ansprach noch sie oder irgendeine andere Frau mit Schätzchen. Stets hatte er sie verwundert angesehen und gefragt: »Ach, ist das so?« Lange, wirklich sehr lange, glaubte sie, er wisse es nicht besser, sondern sei einfach ein wenig unterbelichtet. Schließlich war ihr die Absicht hinter seinem Verhalten mit einem Schlag bewusst geworden. Sie hatte ihn unterschätzt. Er war weit von Dummheit entfernt, aber auch von einem Weltbild, das zwischen Schwarz und Weiß Farben zuließ.
Holly richtete ihre Aufmerksamkeit wieder auf Lieutenant Lavender. Seine Ausdauer war bemerkenswert, aber sie hatte auch nichts anderes erwartet. Die physische Leistungsfähigkeit dieser Kreaturen war außergewöhnlich. Zum wievielten Mal wendete er jetzt? Sie hatte vergessen mitzuzählen.
Er stieß sich gerade nahe ihrer Position bei den Startblöcken ab und schwamm von ihr weg. Verloren seine Bewegungen langsam an Dynamik? Sie eilte um die Startblöcke herum und folgte dem tauchenden Mann entlang der Längsseite des Beckens. Ihre Tasche, die sie in einer Hand hielt, geriet ihr zwischen die Beine. Um ein Haar wäre sie gestolpert.
»Ist es langsam so weit?«, rief Sam ihr nach.
»Ich glaube schon!«
»Wird auch Zeit!«
Sie fasste Lavender erneut ins Auge, sezierte seine Bewegungen. Als sie mit ihm zusammen im letzten Drittel des Beckens ankam, war sie sicher. »Er wird langsamer«, rief sie Sam zu.
Trotzdem führte der Mann die Schwimmbewegungen weiter sauber aus. Sie musste sich daran erinnern, dass er gerade im Begriff war zu ertrinken.
Mit siebzehn hatte sie erlebt, wie Thomas, der mit ihr zusammen im Literaturunterricht von Herrn Lammer gesessen hatte, eine Ratte ersäufte. Das Tier fanden sie keuchend und blutend am Straßenrand. Holly hatte zu diesem Zeitpunkt keinen Gedanken daran verschwendet, was ihm geschehen war. Aber sie versuchte Thomas davon abzuhalten, es kopfüber in den Bach zu stecken. Er war ein riesiger Kerl gewesen, der mühelos mit ihr fertigwurde. Nicht aber mit dieser Ratte. Obwohl sie verletzt gewesen war, hatte sie sich in seiner Hand gewunden und gezappelt und ihm schließlich mehrfach in den Finger gebissen. Das war Thomas ganz recht geschehen. Die Ratte überlebte trotz ihrer Wehrhaftigkeit nicht. Er tauchte sie nur noch tiefer in das schlammige Uferwasser, ohne zu ahnen, dass ihr Biss wohl bereits seinen eigenen Untergang besiegelt hatte. Seitdem hatte Holly sich oft gefragt, ob das, was ihm später an diesem Tag zugestoßen war, zu verhindern gewesen wäre, wenn er nicht geblutet hätte.
Lavender schlug wieder an und wendete. Noch immer wirkte er kontrolliert, obwohl er der Bewusstlosigkeit nahe sein musste. Zug um Zug schwamm er weiter, bis seine Bewegungen unvermittelt zerflossen. Arme und Beine gerieten in einen Schwebezustand, sein Körper begann zu versinken.
Holly sah zur Uhr, die hinter den Startblöcken angebracht war. 11:50 Uhr. »Es ist so weit!«
Sam kam mit Blackburn im Schlepptau um das Becken gewatschelt. Er sah aus wie ein Puter. Sein Kopf war zu klein für den Körper, seine Hose schlackerte ihm um die Beine und obwohl er sie unter dem Bauch trug, spannte sie um die Hüften. Seiner Rückseite hatte sie heute noch keine Aufmerksamkeit gezollt und sie hoffte, dass ihr dieser Anblick erspart bleiben würde. Zu oft schon war ihr sein weißer Arsch förmlich ins Gesicht gesprungen, wenn er sich nach irgendetwas bückte oder auch nur weit genug nach vorne lehnte.
Lieutenant Blackburn entledigte sich seines marineblauen Shirts, der Stiefel und Socken.
»Was haben Sie vor?«, fragte Sam.
Blackburn deutete auf das Becken. »Ihn da rausholen, Sir.«
Holly sah erneut auf die große Uhr. 11:52 Uhr.
»Das werden Sie schön bleiben lassen!«, säuselte Sam.
»Wollen Sie das übernehmen, Sir?« Blackburn stellte die Stiefel ordentlich nebeneinander und richtete sich auf. Er war sicherlich sieben Fuß hoch und muskelbepackt wie ein Profiboxer.
Sam lachte herzlich. »Natürlich nicht!« Er sah zu Blackburn auf, sein Lächeln zerfiel. »Aber Sie werden das auch nicht tun, klar?«
Blackburn schaute auf die Uhr. Langsam wie ein Raubtier glitt sein Blick von dort zu Sam zurück. Sein Brustkorb hob und senkte sich unter tiefen Atemzügen. Sam grinste wie ein Dompteur, der sich den Wildkatzen überlegen fühlt.
11:55 Uhr.
»Sir, wenn mir die Frage gestattet ist …«
»Nein! Sie ist Ihnen nicht gestattet!« Sam lächelte weiterhin, aber sein Ton war messerscharf.
Holly Salem mischte sich vorsichtshalber ein. »Wir werden Ihre Hilfe gleich benötigen, um Lieutenant Lavender aus dem Wasser zu bergen. Haben Sie bitte noch einen Moment Geduld, Sir.«
Während sie sprach, bemerkte sie aus dem Augenwinkel, dass Sam vor Blackburn zurückwich. Vermutlich öffnete er gerade mit dem rechten Daumen das an seinem Gürtel befestigte Holster. Er war schlau wie eine Krähe. Würde Blackburn auf ihn losgehen, hätte er auf kurze Distanz keine Chance. Das änderte sich aber, sobald er ein paar Meter Abstand zwischen sich und den Soldaten brachte, denn der beleibte Alte zog viel schneller, als man ihm zutraute. Mit etwas Abstand würde selbst Blackburn keine Chance haben.
12:01 Uhr.
Lavenders Körper lag reglos seit über zehn Minuten auf dem Boden des Schwimmbeckens.
»Und wann genau werden Sie meine Hilfe in Anspruch nehmen, Ma’am?«
Sie wollte gerade zu einer Antwort ansetzen, aber Sam kam ihr zuvor. »Ruhig Blut, Junge. … Wann haben Sie Ihre letzte Injektion erhalten?«
»Gestern, Sir!«
»Und er?« Sam deutete auf das Becken.
»Er auch, Sir.«
Holly trat noch näher an den Beckenrand heran, bis sie auf dem Überlaufgitter stand. Hinter ihr war die Schussbahn frei. Ihre Hände umklammerten den Henkel der Kühltasche. Sie hoffte inständig, dass ihnen allen ein High-Noon-Showdown erspart blieb. Sie versuchte sich mit dem Gedanken an die makellosen Akten der beiden Soldaten zu beruhigen. Bis zum heutigen Tag hatten sie stets erfüllt, was von ihnen gefordert wurde. Eine Eskalation zwischen Sam und dem Lieutenant war damit unwahrscheinlich. Die Stimmung zerrte trotzdem an ihren Nerven. Und Lavender ins Becken zu jagen, war ihr schon dramatisch genug gewesen. Zwar hatte sie mit ihren Vermutungen den Stein ins Rollen gebracht, dieser Befehl war aber nicht ihre Idee gewesen. Sie hätten auch anders an die nötigen Informationen gelangen können, doch Sam hatte die Führungsetage davon überzeugt, dass eine schnelle Lösung benötigt wurde, und schließlich sogar den Präsidenten ins Boot geholt. Das Verschwinden der NEW ORLEANS begann bereits Kreise zu ziehen, bald würde die Presse Wellen daraus machen.
12:06 Uhr.
Die Wasseroberfläche hatte sich beruhigt und lag beinahe makellos glatt vor ihr. Holly stand an einem Grab. Das Gefühl drang ihr in den entlegensten Seelengrund und stieß dort federleicht gegen … Mitleid? Ausgeschlossen! Für welche wie den durfte sie so etwas nicht empfinden, das hatten sie ihr eingebläut, außerdem hatte sie diese Kreaturen kennengelernt. Sie ließ sich von seiner äußeren Erscheinung blenden.
Er sieht nur aus wie ein Mensch!In Wirklichkeit ist er ein Monster!
Wie ein Mantra wiederholte sie die Sätze in ihren Gedanken. Allein der Glaube daran fiel ihr plötzlich schwer.
Auf der gegenüberliegenden Seite des hohen Raums schwang die Glastür auf. Ein großer, schlanker Mann trat ein, verschränkte die Hände auf dem Rücken und kam mit langen Schritten auf sie zu. Während der Reise nach Norfolk hatte Holly auch einen standardisierten Blick in die Akten der ortsansässigen Offiziere geworfen. Sie kniff die Augen zusammen, um auf die Distanz seinen Rang erkennen zu können. Vier Sterne auf den Litzen, ein General. Sie erinnerte sich an das Foto von ihm. Der Mann war als Einziger in die wahre Natur der beiden Lieutenants eingeweiht. Wie lautete sein Name noch?
Presley? Nein! Priesly!
12:10 Uhr.
Im Gehen warf der General einen ausführlichen Blick in das Becken. Holly sah über die Schulter zu Sam, der seinerseits Blackburn nicht aus den Augen ließ. Blackburn stand stramm wie ein Zinnsoldat und hatte die Hand zum Salut gehoben.
»Bequem stehen!«, rief der General ihm zu.
Blackburn stand nun mit gespreizten Beinen zwischen ihr und Sam. Seine Arme baumelten locker an den Seiten herunter. Der General hielt neben ihm an, sah von Holly zu Sam und befahl schließlich seinem Mann: »Holen Sie ihn aus dem Wasser, Lieutenant!«
»Ja, Sir!«
Noch bevor Blackburn sich in Bewegung setzen konnte, fuhr Sam dazwischen. »Der Mann bleibt, wo er ist!« Er hob entschuldigend die Hände. »Befehl von oben!«
»Was soll das?« Einige Zornesfalten auf der Nasenwurzel des Generals traten deutlich hervor. »Ich bin oben!«
»Geht noch weiter rauf, General Priesly«, sagte Sam achselzuckend. »Anweisung vom Präsidenten.«
»Dass er neuerdings Telefondates mit meinen Jungs durchführt, ist mir nicht entgangen! … Wer sind Sie beide und was wollen Sie hier?«
»Tut mir leid, aber Ihre Sicherheitsfreigabe ist nicht hoch genug für diese Informationen.«
General Priesly schnappte nach Luft. »Wie bitte?«
»Sie haben mich verstanden.«
Der General verengte die Augen zu schmalen Schlitzen. Er war einer dieser Männer, die eine Aura natürlicher Autorität umgab. Auf die Zurschaustellung seiner militärischen Errungenschaften an der Uniform verzichtete er. Er trug einzig seine Sterne, die seinen Rang auswiesen, und die goldene Insignie bestehend aus Adler und Dreizack auf der Brust, die ihn als SEAL kennzeichnete. Holly Salem vermutete, dass er nicht allzu oft auf Gegenwind stieß.
Ohne den Blick von Sam abzuwenden, sprach er mit Blackburn. »Wie lange ist er schon da unten, Lieutenant?«
»Zweiundzwanzig Minuten, Sir.«
Obwohl sie die ganze Zeit über dabei gewesen war, traf Holly die Zahl wie ein Faustschlag.
Zweiundzwanzig Minuten.
Mit nahezu hundertprozentiger Sicherheit hätte bei jedem Menschen nach Zusammenbruch des Herz-Kreislauf-Systems inzwischen unwiderruflich der Hirntod eingesetzt. Im allerbesten Fall wäre mit schweren und irreparablen Hirnschädigungen zu rechnen.
»Holen Sie ihn da raus! Ich halte den Kopf dafür hin!«
»Das könnte Sie in der Tat den Kopf kosten!« Sam ging auf den General zu, Blackburn auf den Beckenrand. »Wollen Sie wirklich Ihre vier Sterne für das Ding da unten riskieren?«
»Sie sagen mir, was hier vor sich geht, oder ich lasse es darauf ankommen«, sagte General Priesly gedehnt, aber Holly sah, wie sich seine Augen weiteten. In seinem Kopf ratterte es. Das war sicher auch Sam nicht entgangen.
Blackburn machte sich zum Sprung bereit.
»Also gut!«, sagte Sam.
Sie kannte ihn lange genug, um zu wissen, dass er sich nicht erpressen ließ. Er lenkte nur zum Schein ein. Der General sollte sein Gesicht zukünftig vor seinen Männern wahren können. Sam war davon überzeugt, dass er auf seiner und ihrer Seite stand.
Offenbar ging seine Rechnung auf.
»Warten Sie, Blackburn!«, sagte General Priesly.
Lieutenant Blackburn hielt inne. Ausdruckslos starrte er ins Wasser. Holly erschauderte unwillkürlich.
»Wo ist Captain Winters?«, fragte Sam.
»Was …? Beantworten Sie endlich meine Frage! Was zum Teufel geht hier vor?«
»Das mache ich gerade, aber Sie verstehen die Antwort offensichtlich nicht. Ich wiederhole die Frage, General. Wo ist Captain Jeremiah Winters?«
»Auf derUSS NEW ORLEANS, aber ich verstehe nicht …«
Sam hob beide Augenbrauen.
»Wollen Sie damit sagen, dass die NEW ORLEANS …?«, fragte der General.
»Zu meinem Bedauern, Sir. Die Sache ist noch unter Verschluss, aber lange kann sie da nicht mehr gehalten werden, und dann wird sich die Presse darauf stürzen.«
»Oh! … Und jetzt wollen Sie überprüfen, ob Winters …«
Sam nickte.
»Der Mann ist mit der Medal of Honor ausgezeichnet worden. Der führt doch nichts im Schilde, das unserem Land schaden könnte! Ich kenne … kannte ihn«, sagte der General im Brustton der Überzeugung.
Sam schwieg.
Der General war wirklich auf Zack, das musste Holly ihm lassen. Er hatte die Puzzleteile mithilfe der wenigen Informationen erstaunlich schnell zusammengesetzt.
»Kann ich Lavender jetzt rausholen?«, fragte Blackburn, ohne sich umzudrehen.
»Einen Moment noch!« General Priesly sah Sam fest an und dämpfte die Stimme. »Hätten Sie das nicht irgendwie anders überprüfen können?«
»Zu kleines Zeitfenster.«
»Verstehe. Wie lange lassen Sie ihn noch im Becken?«
»Zwanzig Minuten sollten reichen.«
»In exakt zwanzig Minuten holen Sie ihn raus, Blackburn!«, sagte der General laut und deutlich.
»Ja, Sir!«
Nur langsam kroch der Minutenzeiger voran. Das angespannte Schweigen ließ den hohen Raum zusammenschrumpfen. Zwei- oder dreimal setzte der General an, etwas zu sagen, aber Sam schüttelte den Kopf oder legte einen Zeigefinger auf den Mund und deutete auf Blackburn, der nach wie vor unbewegt am Rand stand und in die Tiefe starrte.
Hollys Blick glitt immer wieder zu Lavenders Körper auf dem Beckengrund. War das wirklich nötig? Konnte die Öffentlichkeit nicht einfach ein paar Tage lang hingehalten werden, bis eine Klärung auf einem anderen Weg stattgefunden hätte? Sie dachte erneut an die Ratte in Thomas’ Hand und fragte sich, worin der Unterschied zwischen dem grausamen Handeln des Jugendlichen und ihrem eigenen bestand. Sie atmete tief durch.
Endlich gab Sam grünes Licht und Blackburn hechtete ins Becken. Kaum war sein Kopf unter Wasser, fragte Sam: »Kann er uns noch hören, Holly?«
»Schwer zu sagen.«
»Riskieren wir es einfach. … General, der Soldat Blondell im Team um Winters, warum ist er gegangen? Die Kurzversion bitte! Aktenlage ist uns geläufig.«
»Kriegsmüde.«
»Nur das?«
»Denke schon. Macht sogar demnächst eine Kreuzfahrt auf dem Atlantik.«
»Ihre persönliche Meinung?«
»Kriegsmüde, wie gesagt. Hören Sie, verstößt das hier nicht gegen irgendwelche Rechte?« Der nervöse Unterton des Generals zog feine Risse in seine autoritäre Fassade.
»Die haben aus guten Gründen nur eingeschränkte Grundrechte, General! Und Sie wissen genau wie ich, dass die beiden auch diese mit Eintritt in Ihren Verein abgegeben haben. Sie sind Eigentum der Vereinigten Staaten von Amerika.«
»Das mag alles sein, aber es ist trotzdem … irgendwie unanständig, finden Sie nicht?«
»Da müssen Sie einen Moralphilosophen befragen. Ich bin kein Experte für richtiges oder falsches Handeln, sondern für die öffentliche Sicherheit.«
Blackburn durchbrach die Wasseroberfläche und die beiden Männer am Beckenrand verstummten. Er drehte sich und den leblosen Körper in Rückenlage. Der Kopf seines Kameraden ruhte auf seinem Bauch.
Als er ihn aus den Becken hievte und auf den weißen Fliesen ablegte, sah Holly in die totenstarren Augen unter den halb geöffneten Lidern. Sie hockte sich neben Lavender, prüfte mit einem Finger den Widerstand seiner Lider. Sie waren weich. Er simulierte nicht. Holly musste ein Kichern unterdrücken und hielt sich selbst eine Sekunde lang für paranoid. Natürlich täuschte er keine Bewusstlosigkeit vor, er war mehr als vierzig Minuten lang unter Wasser gewesen! Er musste tot sein. Sofort rief sie sich zur Ordnung.
Ich ziehe voreilige Schlüsse!
Ihre gesamte Inszenierung hatte die Beantwortung dieser einen Frage zum Ziel. Konnten sie ertrinken? Genau das würde sie nun unvoreingenommen überprüfen. Verdammt, warum gab es ausgerechnet zu Hypoxie keine Studien? Sonst war doch auch jedes nur erdenkliche Experiment an ihnen durchgeführt worden.
Sie öffnete die Kühltasche und zog ein Stethoskop hervor.
Blackburn zog die Nase hoch. Er kniete ihr gegenüber.
»Alles in Ordnung?«, fragte sie, ohne ihn anzusehen.
»Hängt davon ab, ob er wieder wach wird, Ma’am.«
Sie nickte und begann Lavenders Brust abzuhorchen.
Kein Herzton.
»Drehen Sie ihn bitte auf den Bauch, Lieutenant Blackburn.«
Blackburn drehte Lavender um. Sie setzte das Stethoskop auch an verschiedene Stellen des Rückens an. Sie ließ sich Zeit.
»Kriegen Sie ihn wieder hin?«, fragte Blackburn.
»Sie können ihn wieder auf den Rücken legen, Lieutenant.«
Erneut wendete Blackburn seinen Kameraden.
Wenn ein Mensch starb, reagierte die Umwelt mit würdevollem Respekt, aber Lavender war bereits zu Lebzeiten zu einem Gegenstand degradiert worden. Holly fühlte sich als Unmensch entlarvt.
»Bekommen Sie das wieder hin?«, fragte Blackburn erneut. In seiner Stimme vibrierte Hoffnung.
Sam schaltete sich ein. »Nun? Ist er tot?«
»Sein Herz-Kreislauf-System ist wie erwartet zusammengebrochen«, sagte Holly schlicht.
»Sein Herz schlägt nicht mehr, also ist er tot, richtig?«
»Genau genommen müsste ich weitere Tests …«
Sam unterbrach sie. »Kann er aus eigener Kraft wieder aufwachen?«
Sie zögerte.
»Wir waren uns einig, dass wir nach vierzig Minuten Bescheid wissen. Mädchen, das war doch das entscheidende Argument. Sonst hätte der Präsident uns doch nicht eins seiner teuren Kriegsspielzeuge überlassen.«
General Priesly sah Sam entrüstet von der Seite an.
»Sie wissen doch, wie ich das meine, General!«
Priesly stemmte die Hände in die Hüften. »Was ist jetzt?«
Holly atmete tief durch. »Ich glaube nicht, dass er aus eigener Kraft wieder aufwacht.«
»Aber Sie können dafür sorgen, nicht wahr?«, fragte der General.
»Ich denke schon«, sagte sie zögerlich und verschwieg ihre Unkenntnis bezüglich der möglichen Folgeschäden.
»Denken Sie nicht, holen Sie ihn zurück!«
Holly sah Sam an, der kaum merklich nickte. »Ich weise darauf hin, dass dieses Vorgehen dann lediglich einen Näherungswert darstellt. Da können auch schon vermeintliche Kleinigkeiten wie die abweichende Wassertemperatur den Unterschied machen. Um absolut sicherzugehen, müsste ich weitere Tests durchführen.«
»Ja, ja! … Später kannst du noch ein paar Feldstudien an einem anderen Exemplar machen. Fürs Erste wissen wir genug. Wir wollen ihn ja auch nicht unnötig quälen, nicht wahr, General?«, sagte Sam.
General Priesly nickte erleichtert und auch Blackburns Gesicht klarte auf.
Holly Salem hängte sich das Stethoskop um den Hals und griff nach einem Venenkatheder.
Der General verlagerte das Gewicht von einem Bein auf das andere. »Müssten Sie nicht mit einer Herzdruckmassage beginnen?«
Sie lächelte ihn an. »Das wird nicht nötig sein, Sir. Sein Herz wird von alleine wieder anspringen, wenn das hier Wirkung zeigt.« Sie griff abermals in die Kühltasche und zog einen unbeschrifteten Infusionsbeutel mit einer gelblichen Flüssigkeit darin heraus. »Sie müssen im Hinterkopf behalten, dass er kein Mensch wie wir ist.«
Der General nickte.
»Sie dürfen sie niemals unterschätzen, General! Bekommen die beiden auch regelmäßig ihre Injektionen?«, fragte Sam.
»Selbstverständlich!«
»Sind Sie mal einem Exemplar begegnet, das keine Injektion erhalten hat?«
Der General schüttelte den Kopf.
»Ich sage es Ihnen: Unterschätzen Sie sie nicht!«
Holly rollte mit den Augen. Ein Moralphilosoph war Sam vielleicht nicht, aber ein verdammter Moralapostel … und ein Weltuntergangsapologet. Sie wendete sich wieder Lavenders Körper zu und strich über seinen Arm. Unter der fahlen Haut erkannte sie kein geeignetes Blutgefäß für den Venenkatheder.
»Darf ich, Ma’am?« Blackburn hielt ihr die geöffnete Handfläche hin. »Da bin ich gut drin, auch wenn ich die Zugänge meistens dahin lege.« Er deutete auf seinen Hals. »Das machen wir im Feld so. Größere Trefferfläche.«
»Lass ihn machen, wenn er will«, sagte Sam.
Sie reichte Blackburn die Packung mit dem Venenzugang. Er öffnete sie. Der Katheder sah in seiner Pranke aus wie ein Spielzeug. Beeindruckend behände legte er den Zugang in die Halsvene seines Kameraden. Holly schloss die Infusion an und hielt den Beutel hoch.
Zunächst geschah gar nichts. Doch nachdem die Flüssigkeit die Vene erreicht hatte, konnten sie buchstäblich zusehen, wie das Leben zurück in Lavender tropfte. Seine Haut verlor die fahle Blässe.
Blackburn nahm ihr den Infusionsbeutel ab. Sie griff eilig nach dem Stethoskop um ihren Hals und setzte dem Lieutenant den runden Kopf auf die Brust. Nach einigen Sekunden hörte sie einen leisen Herzschlag, kurz darauf folgte ein weiterer, der bereits ein wenig kräftiger klang. Der Atemreflex setzte ein, aber Lavenders Lungenflügel waren voll mit Wasser. Er gurgelte.
»Richten Sie ihn auf!«, wies Holly Blackburn an und nahm den Infusionsbeutel wieder entgegen.
Der große Mann packte die Oberarme seines Kameraden und zog ihn in eine sitzende Position. Lavender begann zu husten, aus seinem Mund schoss ein Schwall Wasser. Er riss die Augen auf. Der Strom wollte nicht enden. Sie legte die freie Hand auf seinen kühlen Rücken. Lavender hustete und würgte abwechselnd. Eine Welle aus Mitleid überspülte Holly. Sie hoffte, dass sein Gehirn keinen Schaden genommen hatte. Mein Gott, er wirkte so zerbrechlich. Die zarten Gesichtszüge, die weiße Haut. Am liebsten hätte sie ihn in ihre Arme gezogen. Hatten diese Männer nicht schon genug für ihr Land getan?
Sie drehte das kleine Rädchen, mit dessen Hilfe die Infusion reguliert wurde, ganz auf, damit er nun möglichst schnell wieder auf die Beine kam. Es war das Mindeste, was sie tun konnte, wenn sie ihn schon als Versuchskaninchen missbrauchten.
Es dauerte einige Sekunden, bis Flea wieder in der Gegenwart angelangt war. Das Erste, was er sah, waren seine eigenen Beine. Der Hustenreiz wollte nicht aufhören und er gab ihm willfährig nach. Das Wasser musste aus seinen Lungen. Es war nicht zu ertragen. Auch so ein Reflex wie die verdammte Panik. Er hatte Durst. Flea drehte den Kopf und sah Blackburn an.
»Wird gleich besser, du hast eine Infusion dran.«
Wut brannte ihm im Magen, sie war aber nicht so schlimm wie der Durst. Er fühlte sich schwindelig und seltsam desorientiert, obwohl er genau wusste, wo er war und was geschehen war.
Blackburn umschloss mit den Händen seinen Kopf, presste ihm dabei von unten gegen den Kiefer, sodass er den Mund schließen musste. »Es wird gleich besser, hörst du?«
Flea nickte und Blackburn gab ihn frei. »Wie lange …?«, fragte er.
»Zweiundvierzig Minuten, aber die Lady hat dir was Hübsches verpasst. Bald geht’s wieder.« Blackburn hob die Augenbrauen und nickte, als wolle er ihn auf etwas aufmerksam machen.
Flea drehte den Kopf, nahm dabei den Zugang an seinem Hals zur Kenntnis. »Ach, hallo Lady! Und? Haben Sie es sich überlegt?«, fragte er unumwunden. Mit jeder verstreichenden Sekunde ging es ihm besser. Sein Körper saugte geradezu den Infusionsbeutel aus.
»Wie? … Was soll ich mir überlegt haben?«
Sie war wirklich bezaubernd. Hinter der Überraschung in ihrem Gesicht bemerkte er ein weiteres Gefühl. Mitleid, das musste es sein. Er tat ihr leid. Das war seine Chance. »Na, unseren kleinen Strandspaziergang heute Abend bei Sonnenuntergang am Virginia Beach.«
»Würde sagen, der hat keinen Schaden davongetragen.«
Flea sah über die Schulter. Hinter ihm stand dümmlich grinsend der Mann in der schlecht sitzenden Navy-Uniform, daneben General Priesly. Er hob die Hand zum Salut. »General!«
Priesly nickte ihm zu.
»Den Schaden hatte ich vorher schon, Sir!«
Ohne eine Reaktion des Mannes abzuwarten, sah er wieder zu der Frau. »Aber kleine Makel wirken ja bekanntlich anziehend, finden Sie nicht auch?«
»Er ist in der Tat wie immer!«, stellte der General zufrieden fest und atmete tief durch. »Euren Fischerurlaub auf der Neufundlandbank habt ihr euch dieses Jahr mehr als verdient, Jungs!«
Flea und Blackburn nickten gehorsam.
»Ich gebe Ihnen hiermit Ihr Eigentum zurück, General«, sagte der Mann. »Komm, lass uns gehen, Schätzchen!«
Unwillkürlich drückte sie Blackburn den Infusionsbeutel in die Hand, hielt dann aber inne. »Ich würde Lieutenant Lavender gerne noch einige Stunden lang im Auge behalten.«
»Der kommt schon klar. Los jetzt! Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit! Zeit ist Geld!« Ohne sich nochmals umzuwenden, ging der Mann am Becken vorbei und verließ die Schwimmhalle. Holly blieb unschlüssig zwischen ihm und den Soldaten hin- und hersehend zurück.
»Arschloch!«, sagte General Priesly halblaut. »Verzeihung, Ma’am!«
»Kein Problem.« Sie strich Lavender über den Rücken. »Die Infusion ist durch. Können Sie aufstehen, Lieutenant?«
Flea erhob sich umständlich und machte zwei Kniebeugen. Blackburn hielt den Beutel. »Alles okay, Ma’am.«
»Haben Sie auf dem Gelände eine Unterkunft?«
»Klar!«
»Gehen Sie dorthin und ruhen Sie sich aus. Begleiten Sie ihn, Lieutenant Blackburn?«, fragte sie und stand ebenfalls auf.
»Selbstverständlich.«
Flea präsentierte seinen Hals, um sich den Zugang entfernen zu lassen. Als sie die Nadel herauszog, vibrierten ihre Hände kaum merklich.
»Kommen Sie, Ma’am! Ihr Kollege wartet.« General Priesly wandte sich ebenfalls zum Gehen um. Er nickte den beiden Lieutenants zu. »Macht für den Rest des Tages frei.«
»Vielen Dank, Sir!«, sagten beide wie aus einem Munde.
Die Frau stopfte das medizinische Equipment in ihre Tasche und ging an seiner Seite um das Becken herum.
Flea sah ihnen nach, bis sie außer Hörweite waren, und warf Blackburn einen fragenden Blick zu.
»Sie haben es geschluckt«, flüsterte der.
Flea nickte.
»Um ein Haar hätte Sie deinen Herzschlag gehört, Mann! Ich habe ihn genau gehört.«
»Hab ihn schon auf einen Schlag in zwei Minuten runterreguliert.«
»Ja, habe ich mitbekommen.« Blackburn kratzte sich am Kopf. »Wir haben ja damit gerechnet, dass jemand kommt und nach Winters fragt. Aber das?«
»Für wen arbeiten die?«, fragte Flea. »CIA?«
»Glaube ich nicht. Dafür wussten sie zu viel. Die waren von THIRTEEN STRIPES.«
»Seit wann weiß der Präsident über THIRTEEN STRIPES Bescheid? Lincoln hat doch damals entschieden, dass er nur im Ausnahmefall ins Boot geholt wird.«
Blackburn zuckte mit den Achseln. »Jeder Mitwisser in einem hohen politischen Amt bringt normalerweise die Gefahr der Entdeckung mit sich.« Er sah Flea mit gehobenen Augenbrauen an, aber der war gedanklich bereits abgedriftet.
»Glaubst du, dass sie kommt? Heute Abend zum Leuchtturm, meine ich«, fragte Flea.
Blackburn sah ihn verwundert an. »Wer? Die Frau?« Er räusperte sich und sah zur Decke. »Flea, hör endlich auf, mit deinem Schwanz zu denken! Das hat uns schon immer nur Ärger eingebrockt. Sie hat das für einen dummen Spruch gehalten, klar?«
»Alter, hast du sie gesehen?« Er stieß Blackburn mit dem Ellbogen in die Rippen. »Sie ist süß! Außerdem tue ich ihr leid. Perfekte Bedingungen, um an ein paar Informationen zu gelangen.«
»Die gibt dir keine Informationen. Auch nicht bei einem romantischen Strandspaziergang, weil sie gar nicht erst erscheinen wird!«
»Wer weiß? Mitleid öffnet so manche Tür.« Flea zwinkerte ihm zu. »Außerdem wirkt die Injektion nicht mehr so gut.«
»Was?«, rief Blackburn und sah sich hektisch um. Er dämpfte die Stimme wieder. »Woher …?«
Flea sah an sich herunter. »Mein Schwanz ist so erfolgreich wie seit zehn Jahren nicht. Pass auf, was ich dir sage, mein Freund: Sie wird auftauchen!«
Blackburn überlegte. »Das Nachlassen der Injektionen würde auch erklären, dass sie dann doch so schnell wieder von dir abgelassen haben. Ich hätte dich noch ein oder zwei Stündchen tot am Beckenrand liegen lassen, um sicherzugehen, dass du die Augen wirklich nicht wieder aufmachst.«
Wolfspfade
Nordatlantik, 1998
NORTHERN STAR
Sie fuhren in den Sonnenuntergang. Tagesmüde trug der Atlantik die NORTHERN STAR sanft auf seinem Rücken. Patricia Wickwire erwartete durch die Brückenfenster gebannt den Kuss zwischen der roten Sonne und dem Meer. Sie fühlte sich frei. Auf der Brücke gut und gerne fünfundzwanzig Meter über der Wasserlinie zu stehen, hatte etwas von fliegen. Die Vergnügungsdecks mit dem Außenpool, dem Tennisplatz und den Liegestühlen waren im abgestuften Heck des Oceanliners untergebracht. Vor ihr lagen nur der Bug mit den Kränen sowie der Ankeranlage und der blaugrüne Ozean.
Für einen kurzen Augenblick sah sie sich selbst, zehnjährig und noch mädchendürr, am Pier des Dockviertels von Liverpool stehen und sehnsüchtig durch die langen Reihen der Handelsschiffe hindurch nach Westen starren. Irgendwann, hatte sie sich damals geschworen, würde ihr Blick auf den Ozean grenzenlos sein. Nichts würde ihn einschränken, kein Schiff und erst recht kein Erwachsener, der ihr sagte, sie solle nicht mit den Händen in den Taschen herumstehen und von der für ein Mädchen unerreichbaren Seefahrerei träumen. Sie allein würde Befehle auf einer Brücke erteilen.
»Wunderschön, nicht wahr?« Kapitän Robert Shepard war unbemerkt an sie herangetreten.
»Unbeschreiblich!«, stimmte Wickwire ihm zu. Sie hatte es bis zur Ersten Offizierin gebracht. Es war alles andere als leicht gewesen.
»Aber Poseidon kann auch anders!« Der alte Mann zwinkerte ihr zu.
Sie nickte wissend. Die über tausend Crewmitglieder des Oceanliners NORTHERN STAR lernten früher oder später alle die Gesichter des Meeres kennen. Der Nordatlantik war ein launenhaftes Kind. Mal wogte er turmhoch auf, überspülte das Vorschiff und schleuderte die Gischt bis an die Brückenfenster. Nur Stunden später schaukelte er träge vor sich hin, als sei nichts gewesen.
»Die Nordatlantikroute nach New York fahre ich am liebsten«, sagte sie. »Manchmal wünsche ich mir, dass wir von Liverpool aus starten würden.«
Der Kapitän kannte ihre Herkunft. Wenn sie unter vier Augen miteinander sprachen, nannte er sie manchmal ein starkes Mädchen aus dem Hafenviertel. Im Gegensatz zu vielen anderen Männern, die ihr im Laufe ihrer Karriere begegnet waren, sagte er das frei von Ironie oder Überheblichkeit. Vielmehr schwang in seinen Worten stets Aufrichtigkeit mit. Von Anfang an hatte er sie mit offenen Armen willkommen geheißen, obwohl eine Frau auf der Brücke sich wohl auch schwer mit seinem englischen Upper-Class-Weltbild vereinbaren ließ.
Shepard strich sich über den grauen Bart. »Eine Route mit Geschichte.« Er seufzte.
Sie sah den alten Mann an. Lange war es nicht mehr hin bis zu seiner Pensionierung. Alle fürchteten die Zukunft, seit Universe-Line, für die sie an Bord der STAR fuhren, an diesen Amerikaner verkauft worden war, aber Wickwire spürte, dass es ihren Kapitän besonders hart traf.
»Ich möchte den Platz heute am Captain’s Table nicht mit Ihnen tauschen, Sir.«
»Warum? Wer sitzt denn dort? Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich mir die Liste noch gar nicht angesehen habe.«