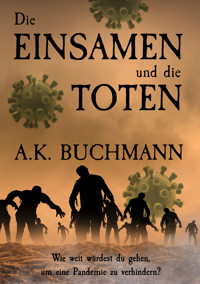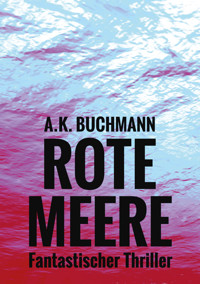Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Shadodex - Verlag der Schatten
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Zwei Weltkriege. Zwei verlorene Generationen. Ein gemeinsames Schicksal. Und eine Frage: Wer ist die Bestie? In den Gräben des Ersten Weltkriegs kämpfen die Brüder Reinhard und Eberhard am Ende der Hoffnung gegen Gas und Hunger. Als sie versprengt werden, scheint ihr Tod unausweichlich. Doch eine seltsame Begegnung und ein unerwarteter Fund retten ihr Leben. Der Preis dafür besteht im Verlust ihrer Menschlichkeit. Umgehend durchlebt Reinhard eine Metamorphose, die das Tier in ihm weckt. Eberhards Verwandlung in eine Bestie vollendet sich dagegen erst viel später während des Zweiten Weltkriegs und vertieft den Graben, der sich bereits 1916 zwischen den Brüdern aufgetan hat. Seit Jahrhunderten werden wir Menschen in unseren Albträumen von Kreaturen heimgesucht. Aber vielleicht sind wir schlimmer als sie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 467
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tiefe
Gräben
vonA. K. Buchmann
Alle Rechtevorbehalten.
Das Buchcover darf zur Darstellung des Buches unter Hinweis auf den Verlag jederzeit frei verwendet werden.
Eine anderweitige Vervielfältigung des Coverbilds ist nur mit Zustimmung des Verlags möglich.
Die Handlungen sind frei erfunden.
Evtl. Handlungsähnlichkeiten sind zufällig.
www.verlag-der-schatten.de
Erste Auflage 2023
© A. K. Buchmann
© Coverbilder: Depositphotos justinasv775, TsuneoMP
Covergestaltung: Verlag der Schatten
© Bilder: Depositphotos urbanbuzz (Stacheldraht), ElemenTxDD (Wolfsaugen), justinasv775 (Coverhintergrund), TsuneoMP (Wolf)
A. K. Buchmann (Zeichnung Wolf, Autorenfoto)
Lektorat: Shadodex – Verlag der Schatten
© Shadodex – Verlag der Schatten, Bettina Ickelsheimer-Förster, Ruhefeld 16/1, 74594 Kreßberg-Mariäkappel
ISBN: 978-3-98528-023-0
Content Warnung:
Dieser Roman enthält realistische Beschreibungen seelischer und körperlicher Gewalt gegen Kinder und Jugendliche, u.a. durch Autoritäten, insbesondere in Form der Darstellung des Kriegsdienstes an der Front sowie der Gräueltaten im Rahmen der »Euthanasie«-Programme gegen behinderte Menschen zur Zeit des deutschen Faschismus. Zum Mord an kranken und behinderten Kindern und Jugendlichen innerhalb des NS-Regimes nimmt die Autorin im Nachwort Stellung.
Alle handelnden Figuren sowie handlungstragenden Orte sind frei erfunden.
Zwei Weltkriege.
Zwei verlorene Generationen.
Ein gemeinsames Schicksal.
Und eine Frage: Wer ist die Bestie?
In den Gräben des Ersten Weltkriegs kämpfen die Brüder Reinhard und Eberhard am Ende der Hoffnung gegen Gas und Hunger. Als sie versprengt werden, scheint ihr Tod unausweichlich. Doch eine seltsame Begegnung und ein unerwarteter Fund retten ihr Leben. Der Preis dafür besteht im Verlust ihrer Menschlichkeit. Umgehend durchlebt Reinhard eine Metamorphose, die das Tier in ihm weckt. Eberhards Verwandlung in eine Bestie vollendet sich dagegen erst viel später während des Zweiten Weltkriegs und vertieft den Graben, der sich bereits 1916 zwischen den Brüdern aufgetan hat.
Seit Jahrhunderten werden wir Menschen in unseren Albträumen von Kreaturen heimgesucht. Aber vielleicht sind wir schlimmer als sie.
Inhalt
Prolog
ERSTER TEIL: KRIEGSKINDER
Versprengt
Ruinen
Begraben
Verbote
Masken
Funde
Blutrausch
Perspektiven
Kreuzwege
Blutsbande
Frontlinien
Gefangennahmen
ZWEITER TEIL: EXILANTEN
Familienbande
Metamorphosen
Verluste
Hierarchien
Bestien
Richter
Zwischenwelt
Widerstand
DRITTER TEIL: KÄMPFER
Wiedersehen
Erkenntnisse
Befreier
Abschiede
Begegnungen
Epilog
Nachwort
Danksagung
Über die Autorin
Für meinen Ringbuddy
»In combat the first thing to die is often the plan.«
Devil’s Brigade1
Prolog
Ostdeutschland, 1988
»Kann ich mal deinen Hund streicheln?«
Der Alte hielt verwundert auf dem schmalen Weg inne, der vom Gemüsegarten zu seinem Haus führte. Das Kind stand an dem von Hainbuchen gesäumten Türchen und sah ihn erwartungsvoll an. Es war vielleicht neun Jahre alt.
»Was willst du?«, fragte er barsch. Er fühlte sich seltsam ertappt.
»Ob ich mal deinen Hund streicheln kann?«, rief das blonde Mädchen und hielt dabei die Hände trichterförmig an den Mund.
Der Alte blinzelte. Er kannte die Kleine nicht. Dass sie sich nicht von seinem mürrischen Gesichtsausdruck schrecken ließ, gefiel ihm. Langsam schlurfte er auf das Türchen zu. Die Hüfte tat ihm weh. Sein Arzt hatte ihm vorgeschlagen, ihn zur Kur zu schicken, wohl in erster Linie, um ihn unter Leute zu bringen, aber er war da eigen. Er hatte dem Arzt verschwiegen, dass die Träume in letzter Zeit zurückgekehrt waren. Das ging den jungen Mann nichts an. Was wusste der schon? Er war in einer anderen Zeit aufgewachsen.
»Willst du nicht lieber die Hasen füttern?«, fragte der Alte und hielt das kurz zuvor geerntete Bund Möhren am Grün hoch. Seine Hand war von Narben überzogen. Die Zeit hatte sie zu hellen Strichen verblassen lassen.
»Nein, ich mag Hunde lieber.«
»So, so!« Er legte die Möhren auf einen der mit weißen Waschbetonplatten ummantelten Pfosten ab, in die das Türchen zu seinem verwilderten Grundstück eingelassen war.
»Woher weißt du denn überhaupt, dass ich einen Hund habe, kleines Fräulein?«
»Hab ihn gestern Nacht gesehen!«, sagte das Mädchen und grinste breit. Anstelle des rechten oberen Eckzahns klaffte eine Lücke. Aus dem Zahnfleisch lugte der nachkommende Zahn hervor. Ein Haargummi bändigte einen Teil ihrer Locken. Sie trug ein schwarzes T-Shirt mit einem Wolf darauf, der den Mond anheulte, und kurze Hosen.
»Lassen dich deine Eltern nachts draußen rumlaufen?«, fragte er kopfschüttelnd.
Sie sollten wirklich besser auf das Mädchen aufpassen. Kinder können einem so leicht verloren gehen, dachte er.
»Nein, nein! Wir wohnen jetzt da!« Das Mädchen deutete auf das Nachbarhaus. »Ich konnte nicht schlafen und habe aus dem Fenster geschaut. Da saß dein Hund auf der Terrasse und hat den Mond angesehen. Gestern Nacht war er ganz groß und rund. Dein Hund hat hochgeblickt, als würde er ihn gleich anheulen wollen. Wie der da!« Sie deutete auf ihr T-Shirt. »Siehst du?«
Er überging die Frage. Stattdessen zeigte er auf das Nachbarhaus. »Wohnen die Reinemanns nicht mehr da?«
»Die sind doch in den Westen rüber!«, erwiderte das Mädchen. »Weißt du das denn nicht?«
»Nein.«
»Redest du nicht mit deinen Nachbarn?«
»Ich rede doch mit dir!«
Das Mädchen verengte die Augen zu Schlitzen. »Du hast nicht mitbekommen, dass die getürmt sind? Da reden doch alle Erwachsenen ständig drüber. Und wenn ich dann nachfrage, tun sie so, als sei nichts passiert oder verbieten mir den Mund.«
Der Alte musterte über ihren Kopf hinweg die Reihe der Einfamilienhäuser. »Nein«, sagte er und verzog das Gesicht. »Ich rede nicht so viel mit den Leuten. Die sagen sowieso nicht, was sie denken.«
»Hm«, machte das Mädchen und plapperte weiter. »Ich bin Nina. Ich rede auch nicht so gern mit Leuten. Lieber mit Tieren, aber ich darf kein eigenes haben.«
»Ihr habt doch jetzt ein großes Haus mit Garten, vielleicht darfst du da ein Tier haben. Ich kann dir zwei oder drei von den Hasen mitgeben. Die haben gerade Junge bekommen.«
Nina überlegte. »Die Hasen wären natürlich ein Anfang, aber ich hätte lieber einen Hund, am liebsten einen Wolf!« Sie legte die Stirn in Falten. »Eigentlich wäre ich selbst gern ein Wolf! Dann könnte ich tun und lassen, was ich will! Du weißt schon, frei umherstreifen.« Sie formte die Hände zu Klauen und rannte einmal im Kreis.
Der Alte lachte. Er konnte sich nicht entsinnen, wann er das letzte Mal gelacht hatte. Die Sorglosigkeit des Kindes rührte ihn an, umspielte alte Erinnerungen voller dunkler Schatten, die nun versuchten, ans Licht zu gelangen.
»Ein Wolf ist kein Haustier«, tadelte er. »Und du halbe Portion überlebst bestimmt nicht in der Wildnis.« Der Alte musterte die Kleine von oben nach unten. »Andererseits … Wenn ich mir deine Knie so ansehe, hast du’s wohl faustdick hinter den Ohren, was?«
Nina sah an sich hinunter. Beide Knie waren verschorft, an den Schienbeinen reihten sich blaue Flecken aneinander.
»Die Mutti sagt immer, dass ich wohl besser ein Junge geworden wäre«, entgegnete sie schulterzuckend und fügte ernst hinzu: »Natürlich ist ein Wolf kein Haustier! Der würde dann auch die Hasen fressen!« Sie zwinkerte dem Alten spitzbübisch zu.
Er grinste wieder, was die Ringe um seine Augen noch faltiger wirken ließ.
»Die Mutti hat gesagt, dass es hier in den Wäldern früher Wölfe gab!«
»Die gab es!«
»Hast du mal einen gesehen?«
»Das habe ich! Einen großen mit dunklem Fell! Er war ganz nah und hatte bernsteinfarbene Augen.«
»Wirklich?«
»Wirklich! Er stand direkt vor mir und hat mich angesehen und dann hat er nach mir geschnappt.« Der Alte klatschte in die vernarbten Hände.
Das Mädchen stand unbewegt vor dem Gartentürchen und rollte mit den Augen. »Na klar!«, sagte es gedehnt. »Was ist mit den Wölfen passiert? – Jetzt will ich aber die Wahrheit hören!«
Dem Alten wurde schwindelig. Er stützte sich am Gartentürchen ab. Mit einem gewaltigen Schlag sprengten sich die Erinnerungen den Weg in seinen Geist frei. In ihrer Mitte ragte die Schuld auf wie ein Mahnmal.
ERSTER TEIL: KRIEGSKINDER
Versprengt
Frankreich, 1916
Noch zwei Männer standen vor ihm. Der erste kletterte bereits auf die schmale Holzleiter, ein Junge, kaum älter als er selbst. Reinhard Sperber kannte ihn nicht. Er war erst vor Kurzem ihrem Zug zugeteilt worden und hatte die Feuertaufe noch nicht hinter sich gebracht.
Der Junge erreichte den oberen Rand des mit Sandsäcken und Brettern befestigten Schützengrabens. Gleich würde er loslaufen, das erste Tageslicht im Rücken, und Reinhard würde ihn aus dem Blick verlieren. Vielleicht liefe er ihm später im Feld noch einmal über den Weg oder er säße am Abend neben ihm in einem anderen Graben, um auf den nächsten Angriff zu warten, oder aber er würde sich zum Rapport bei Petrus melden. Niemand konnte das vorhersagen. Ohnehin war es besser, wenn man sich um seinen eigenen Kram scherte.
Er war der Übernächste. Reinhard atmete tief ein und aus, um seinen jagenden Herzschlag unter Kontrolle zu bringen, und fixierte die abgegriffenen und schmutzigen Holme der Leiter, nach denen Flüger, der Mann vor ihm, nun griff. Maschinengewehre ratterten, dazwischen einzelne Schüsse.
Die erste Welle ist also schon vorn!, schlussfolgerte er.
Unweit explodierte eine Artilleriegranate. Erde und Staub stoben auf. Reinhard duckte sich intuitiv. Jemand griff von hinten nach seinem Koppel.
Eberhard!
»Los, los, los!«, hörte er Vizefeldwebel Schneider brüllen, der schräg neben ihm stand.
Er richtete sich wieder auf, sein Blick streifte das Portepee des Unteroffiziers. Er verzichtete darauf, ihm ins Gesicht zu sehen, das beim Brüllen unter fleckiger Röte immer dieselbe Mimik zeigte: gefletschte Zähne. Seit für ihn der Krieg begonnen hatte, wurde er Schneider, der ihn in unheilvoller Weise an seinen alten Lehrer erinnerte, nicht los.
»Vorwärts!«, bellte der Unteroffizier, und Reinhard bemerkte, dass es nicht weiterging.
Der namenlose Junge hockte noch auf der letzten Leitersprosse und starrte in Richtung Süden über das Schlachtfeld hinweg.
Tu das nicht!, dachte Reinhard, aber der Junge fügte sich nicht seinen Gedanken, sondern ließ sich zurück in den Graben rutschen.
Flüger versuchte einzugreifen. Mit der flachen Seite des Bajonetts schlug er ihm gegen den Hosenboden. »Los mach schon! Du musst nach vorn!«
»Vorwärts, du Feigling!«, brüllte Vizefeldwebel Schneider, dessen Stimme sich vor Wut überschlug.
Eine weitere Artilleriegranate detonierte. Sie war näher als die letzte. Wieder duckte Reinhard sich. Erde und Steine prasselten auf ihn nieder. Eine Kakofonie aus Schreien und Schüssen folgte.
Eine ihrer eigenen Kanonen antwortete donnernd aus Süden, dem Zentrum des Sturmlaufs. Sie befanden sich am Nordflügel.
Als er wieder aufsah, stand der Junge am Boden des Grabens nur einen Meter neben ihm. Flüger kletterte die Leiter empor und verschwand. Im Blick des Jungen schwamm die Frage, die sie sich alle schon gestellt hatten: Was mache ich hier?
Reinhard hatte schnell gelernt, dass es sinnlos war, sich darüber Gedanken zu machen, trotzdem erwischte er sich von Zeit zu Zeit bei einem absurden Gedanken. Er stellte sich vor, dass ihr Vater käme, um ihn und Eberhard abzuholen.
Schneider war außer sich. Im Wechsel bellte er dem Jungen Beleidigungen und Befehle ins Gesicht. Der aber sah ihn nicht einmal an. Der Unteroffizier hatte gut reden. Bis zum Schluss stand er hinten im Graben und überwachte den reibungslosen Ablauf des Angriffs.
Reinhard ahnte, was als Nächstes geschehen würde. Er drehte sich um, griff nach Eberhards Handgelenk und zog seinen Bruder vor sich. »Du gehst zuerst!«
Eberhard sah ihn verwundert an, nickte aber und griff nach der Leiter. Er war groß und dünn, seine Bewegungen wirkten hölzern.
Neben ihnen fiel ein Schuss. Aus dem Augenwinkel bemerkte Reinhard einen Körper zusammensacken. Er sah nicht hin, Eberhard dagegen schon.
»Was …?«
»Los weiter!«, drängte Reinhard.
»Willst du auch so enden?«, schrie Schneider an Eberhard gewandt und hob mahnend die Pistole.
»Nun mach schon!« Reinhards Tonfall ließ keinen Widerspruch zu.
Zu seiner Erleichterung wandte sein jüngerer Bruder sich ab und kletterte die Leiter weiter empor.
Es gab so viele Möglichkeiten, in diesem Krieg zu sterben. Wegen Feigheit vor dem Feind vom eigenen Unteroffizier erschossen zu werden, war es in diesem Moment jedenfalls nicht. Deshalb hatte er Eberhard vor sich selbst in die Reihe gestellt. Wenn er bereits draußen wäre und sein Bruder auf dumme Gedanken käme, könnte er ihm nicht helfen.
Reinhard griff nach der Leiter und kletterte aus dem Graben. Vielleicht würde ihnen das Glück heute hold sein und sie blieben am Leben.
Er nahm den Karabiner mit dem aufgepflanzten Bajonett in den Anschlag und rannte los. Eberhard, der nur wenige Schritte gelaufen war, folgte ihm.
Die Einöde zwischen den Fronten lag unter einer staubigen Dunstglocke, die von der Morgensonne nur spärlich durchbrochen wurde. Unter den Stiefeln knirschten Granatsplitter. Reinhard spurtete an Einschlagstrichtern vorbei, sprang über Ausrüstungsgegenstände und umlief Ballen aus Stacheldraht und dem heimtückischen Bandstacheldraht, der sich wie eine Schlange in Kleidung und Haut verbiss. Auch um die grau-grünen Leichen machte er einen Bogen.
Eine Artilleriegranate schlug irgendwo hinter ihm ein. Dieses Mal legte er nur kurz die freie Hand über den Helm.
An die ersten Meter des Niemandslands zwischen den Fronten konnte Reinhard sich für gewöhnlich später erinnern, aber sobald sie auf die anderen stießen, löste sich die Kausalität der Erinnerungen auf und zurück blieben zusammenhangslose Bilder.
Die Welle der Franzosen tauchte vor ihnen auf. Es war dem ersten Sturm also nicht gelungen, sie in ihren eigenen Gräben zu überrennen.
Er änderte die Richtung und lief nach Norden, um am äußersten Rand der Nordflanke eine geeignete Stellung zu suchen. Hinter einer aufgedunsenen Pferdeleiche warf er sich auf den Bauch. Es stank erbärmlich auf dem Schlachtfeld. Eberhard kauerte sich neben ihn und würgte. Reinhard schluckte seinen Ekel hinunter und legte den Karabiner an. Ein Schuss, ein Mann fiel. Repetieren. Ein weiterer Schuss. Repetieren. Er musste nicht bewusst mitzählen. Das machte sein Kopf automatisch. Fünf Schuss bildeten den Puls seines Überlebens. Als er das Magazin geleert hatte, übergab er seinem Bruder die Waffe, der nachlud. Derweil schoss Reinhard mit Eberhards Karabiner weiter.
Reinhard warf einen kurzen Blick zurück zu dem Graben, aus dem sie gekommen waren. Die französische Artillerie feuerte nun beinahe pausenlos, ließ Erde und Gliedmaßen aufspritzen und durchtränkte den Dreck mit Blut. Aus dem Dunst wurde ein Nebel, der über die Brüder hinwegkroch. Schlachtfeld und Soldaten verschwammen zu Silhouetten. Von ihrer Position hinter dem toten Klepper aus waren Freund und Feind bald schon nicht länger zu unterscheiden.
»Wir müssen nach Süden und uns den anderen anschließen«, stellte Reinhard fest, als das Artilleriefeuer verstummt war. Er stand auf. Eberhard folgte ihm. Langsam bewegten sie sich durch den Nebel. Der Pferdekadaver geriet außer Sichtweite und Reinhard orientierte sich an den Schlachtgeräuschen.
Die Schüsse der Karabiner wurden lauter, wie auch die Schreie. In einem Granattrichter bemerkte Reinhard einen deutschen Soldaten, der auf dem Bauch lag und die Hände über den Kopf gelegt hatte. Er ließ sich hineinrutschen. »Alles in Ordnung?«
Der Deutsche drehte sich herum. »Bin von den anderen getrennt worden.« Es war Vizefeldwebel Schneider. Seine Stimme zitterte.
Reinhard verkniff sich ein Augenrollen. »Wir müssen weiter, Herr Vizefeldwebel.«
Eberhard hüstelte.
Jetzt habe ich zwei, auf die ich aufpassen muss!, dachte Reinhard, dem augenblicklich klar war, für wen der beiden er sich entscheiden würde, wenn es hart auf hart käme. Blut war eindeutig dicker als Hierarchien.
»Sie haben recht, Sperber!« Schneider kam auf die Füße, überließ aber Reinhard mit breiter Geste den Vortritt.
Er kroch aus dem Trichter. Seine Augen tränten vom Staub, den die Granaten aufgewirbelt hatten. Erneut umlief er Stacheldraht, Metallsplitter und stieg über Leichen. Sie waren frisch. Er ging geduckt voran, den Karabiner im Anschlag, und ignorierte die beginnende Erschöpfung, so gut es ging. Das Gewehr wog beinahe vier Kilogramm, lief er gebückt, schien es an Gewicht dazuzugewinnen. Er hatte das Zeitgefühl verloren und der Sonnenstand ließ sich durch den Nebel kaum ausmachen.
Die Kampfgeräusche beschränkten sich auf vereinzelte Schüsse, auf Rufe und Schreie. Hin und wieder kläffte ein Maschinengewehr. Reinhard vermutete, dass die Infanteristen in der Mitte des Schlachtfeldes aufeinandergestoßen waren und nun hauptsächlich mit den Bajonetten aufeinander einstachen. Aus derlei Schlachten gingen, seiner Erfahrung nach, keine Sieger hervor. Am Ende blieb die Frontlinie, wo sie zuvor gewesen war. Die menschlichen Überreste beider Seiten krochen in den Graben zurück, aus dem sie gekommen waren. Das Kaiserreich und Frankreich hatten eine Menge Munition verschossen und weniger Mäuler zu stopfen. Manchmal fragte Reinhard sich, ob dieser ganze Krieg darauf ausgerichtet war, zwei letzte Überlebende ausfindig zu machen, die dann im pockennarbigen Niemandsland gegeneinander antreten mussten.
Er schob den Gedanken beiseite. Jetzt ging es darum, am Leben zu bleiben.
Ein Soldat kam aus dem Nebel gerannt. Als er der drei gewahr wurde, hockte er sich hin und zielte. Reinhard zog Eberhard hinter einen Ballen Bandstacheldraht. Schneider reagierte zu spät. Der Schuss traf ihn in die Brust. Er ging zu Boden und schnappte nach Luft. Nun feuerte der Mann auf Reinhard und Eberhard, die ihre Köpfe gegen den Boden drückten.
Der Mann musste nachladen.
»Warum nutzt du das nicht aus, Reinhard? Schieß doch!«
»Ich schieße auf niemanden, der Schneider auf dem Gewissen hat!« Reinhard grinste wölfisch.
»Aber, er ist unser Unteroffizier!«
»Eben drum! Wir gehen weiter!«
Das kurze Gespräch hatte wertvolle Zeit gekostet. Reinhard hastete los, aber der andere war schneller. Er richtete den Lauf auf die Brüder. Reinhard hob die Hände. Eberhard kauerte sich hinter ihn.
Der Mann kam näher. Ein Franzose, der ihr Vater hätte sein können. Reinhards Sprachkenntnisse waren begrenzt, also entschied er sich für eine universelle Sprache. Mit einem Nicken deutete er auf Schneider, der im Begriff war, sein Leben auszuröcheln, dann lächelte er. Der Franzose folgte seinem Blick und schürzte die Lippen. Schon oft hatte Reinhard an den älteren Männern eine Art mitleidigen Reflex wahrgenommen. Manchmal taten sie sich schwer, auf Jungen wie ihn oder Eberhard zu schießen. Sie zögerten.
»Komm!«, flüsterte Reinhard. »Er wird uns schon nichts tun.«
Sie liefen weiter. Der Franzose war über die Schulter hinweg nur noch als Umriss zu erkennen. Bevor der Nebel ihn schluckte, sah Reinhard, wie er Schneider das Bajonett in die Brust stieß.
Reinhard hatte das Gefühl, dem Kampfgeschehen einfach nicht näher zu kommen. Immer wieder blieb er stehen, lauschte und sah sich um. Schemenhaft erkannte er einen Zaunpfahl. Sie konnten also nicht weit entfernt von einem Graben sein. Die Frage war nur, wer sich darin aufhielt?
»Wo sind wir?«, fragte Eberhard.
»Leise!«
Eine Maschinengewehrsalve zischte an ihnen vorbei.
»Lauf!«, rief Reinhard, packte seinen Bruder am Arm und rannte los.
Die Sonne begann hinter den endlosen Gräben zu versinken und in Reinhards Stimme schwang Hoffnung mit. »In der Dunkelheit können wir es wagen, Eberhard!«
Der Angesprochene lag auf dem Rücken im Dreck und betrachtete ausdruckslos das letzte Licht des Tages am diesigen Himmel.
»Wir können es dann wagen, was meinst du?«
Es war eine rhetorische Frage, so viel war Eberhard klar. Sein Bruder hatte die Entscheidung längst gefällt.
Reinhard kroch auf allen vieren durch den Granattrichter, ein kreisrundes Loch, das ein Artilleriegeschütz in den französischen Boden gerissen hatte, mit einem Durchmesser von rund fünf Metern und einer Tiefe von etwa zwei Metern. Die Seiten aus verbrannter Erde ragten steil auf. In diesem Explosionskrater suchten die beiden Brüder seit dem Vormittag vor dem Maschinengewehr Schutz.
In der Hoffnung, dass der Schütze nicht bemerkt hatte, wohin sie entwischt waren, wagte Reinhard es zum ersten Mal, über den Kraterrand zu spähen. Dabei schob er seinen Körper, der stets gedrungen wirkte, obwohl er schlecht ernährt war, vorsichtig nach oben.
»Weit und breit nichts zu sehen. Weder Freund noch Feind.« Er blickte Eberhard über die Schulter hinweg an, der sich das öde Niemandsland zwischen den beiden nahezu unbeweglichen Frontlinien vorstellte, über das der Herbstwind in Erwartung eines erbarmungslosen Winters tobte und die letzten Dunstschwaden des vergangenen Gefechts vor sich hertrieb.
»Ich kann immer noch nicht weit sehen. Der letzte Orientierungspunkt, den ich hatte, war dieser Zaunpfahl.« Er rutschte zurück in den Trichter. »Wenn es dunkel ist, gehen wir zurück!« Reinhard stieß ihn barsch in die Seite.
»Wir wissen doch nicht mal, in welche Richtung wir müssen. Wir haben die Orientierung verloren«, insistierte Eberhard und schloss die Augen.
Reinhard beugte sich nahe an sein Gesicht heran. Sein Atem strich über Eberhards Wange. »Doch! Natürlich wissen wir das! Die Sonne geht im Westen unter. Wir müssen also in die entgegengesetzte Richtung, dann finden wir zu unseren Leuten zurück.«
»Woher willst du das wissen? Vielleicht liegen wir hinter unseren eigenen Leuten?«, bemerkte Eberhard.
»Kannst ja hingehen und nachsehen!«
»Blutende Finsternis.«
»Hör auf, so was zu sagen! Du klingst, als seist du nicht bei Sinnen. Wir gehen zurück und holen uns unsere Ration Suppe ab.«
Eberhard öffnete die Augen.
Suppe!
Er dachte weniger an den Geschmack von Steckrüben oder gar Fleisch als vielmehr an die Wärme, die sie in seinem Inneren erzeugen könne. Er würde langsam schlürfen und jeden Schluck genießen. Er würde andächtig den Nebel beobachten, der von ihr aufstieg.
Der Nebel …
»Was ist, wenn das Gas kommt?«, fragte er beunruhigt.
»Dann können wir immer noch sterben!«, entgegnete Reinhard und kroch wieder durch die schwere, klumpige Erde des Trichters. »Das kann uns überall erwischen, weißt du doch!« Auf der gegenüberliegenden Seite scharrte er mit den Händen in der Erde der Steigung. Seine Finger waren überzogen von einem Geflecht weißer Narben.
Eberhard hob den Kopf und beobachtete ihn. »Was machst du da?«, fragte er.
»Hier müssen wir raus und dann immer in die Richtung laufen.« Reinhard deutete mit einer von Dreck und Ruß dunkel gefärbten Hand nach Osten, die letzten Strahlen der Sonne im Rücken. An die Wand des Trichters hatte er eine Markierung gezogen, die aussah wie ein Dreieck ohne Grundlinie.
»Fändest du ein Kreuz nicht passender?«, fragte Eberhard.
Sein Bruder kommentierte die Bemerkung mit Schweigen.
Eberhard fuhr fort: »Wir haben keine Masken. Und wenn das Gas kommt …«
»Ich weiß«, seufzte Reinhard. »Wenn das Gas kommt. Heute Morgen ist kein Gas gekommen.« Er ließ sich an der Ostseite des Trichters auf den fleckigen Hosenboden sinken und lehnte sich an den steil aufragenden Erdwall. Den Karabiner legte er sich über den Bauch. »Wir müssen hier weg«, flüsterte er. »Es ist nur eine Frage der Zeit.«
»Er starb für uns, unsere Liebe sein Lohn«, zitierte Eberhard.
»Ich sage, hör auf damit!«
»Das ist Fontane. Weißt du das nicht mehr?«
»Das hat doch keinen Sinn, dieser ganze Scheiß, den sie uns eingetrichtert haben. Ehrenvoll zu sterben. Hast du hier schon mal einen ehrenvoll sterben sehen? Hier verrecken sogar die Offiziere.«
Eberhard schwieg und sah wieder hoch zum Himmel, der in Purpur brannte, ohne dabei zu wärmen.
Reinhard lag richtig. Der Krieg hatte sie betrogen. Als sich die Brüder Sperber vor mehr als zwei Jahren mit siebzehn und achtzehn Jahren freiwillig gemeldet hatten, glaubten sie fest daran, einen Ehrendienst am deutschen Volk zu vollbringen. Obwohl – eigentlich war es Reinhard gewesen, der seinen Bruder überzeugt hatte, mit ihm zusammen zum Militär zu gehen. Er war schon als Kind mutiger gewesen und hatte an Ehre und Tapferkeit geglaubt. Sein Bruder würde sicherlich einen guten Offizier abgeben, überlegte Eberhard, einen, der noch einen Funken Anstand besaß, den man nicht erschießen wollte, sobald er einem den Rücken zuwandte.
Während Eberhard bereits nach der ersten Schlacht alle Ideale zugunsten seines nackten Überlebens aufgegeben hatte, schien Reinhard sich auch nach zwei Jahren Krieg nicht schrecken zu lassen. Den Kopf hielt er stets aufrecht auf den Schultern, den Blick nach vorn gerichtet. Eberhard war froh, dass er so war. Anders hätte er das alles nicht ausgehalten. Die erste Schlacht, die sie erlebt hatten, war in Flandern gewesen. Unebenes Gelände hatte den Vormarsch erschwert. Sie wateten durch Bachläufe und schlugen sich durch dorniges Gestrüpp. Niemand wusste genau, wo es langging, aber sie liefen unermüdlich vorwärts, bis die Stille zerfetzt wurde und der Junge rechts von Eberhard fiel. Eberhard verstand nicht, was geschah. Für einige Sekunden sah er zu, wie der andere versuchte aufzustehen, dabei immer wieder ungelenk zu Boden sank, als stimme etwas nicht mit ihm. Mit aufgerissenen Augen sah er Eberhard an, der ihm die Hand reichte, um ihm aufzuhelfen, da packte ihn Reinhard und zog ihn zu einem nahen Bachlauf. Die Hand des anderen entglitt Eberhard. Er wollte Reinhard zurechtweisen, erst da bemerkte er, dass der Bruder ihn anbrüllte. Er solle mitkommen und Deckung suchen. Mit dem Bauch im Wasser und Reinhards Hand auf seiner Wange, die seinen Kopf fest nach unten in den Schlick des Ufers drückte, sickerte ihm langsam die Erkenntnis in den Verstand, der nur langsam arbeitete. Auf sie war geschossen worden und das Leben seines Kameraden ging gerade zu Ende, ohne dass einer von ihnen den Feind überhaupt zu Gesicht bekommen hatte. Später fragte sich Eberhard, ob der andere im Gegensatz zu ihm verstanden hatte, was geschah, ob er in dem Moment wusste, dass er starb. Eberhard musste lange an diesen ersten Sterbenden zurückdenken, der auch er hätte sein können. Er säte in ihm die Überzeugung, dass der Krieg ein Würfelspiel war, bei dem manche Glück und manche Pech hatten. Er sehnte sich nach einem Spiel, das mit Verstand und Durchhaltevermögen zu gewinnen war. Allein bei diesem ersten Angriff sah Eberhard Dutzende Sterbende, aber keiner war ihm jemals wieder so nahe gegangen wie der erste. An wie vielen Toten er im Laufe des Krieges vorbeigegangen war, wusste er nicht. Er hatte aufgehört, sie zu zählen. Die Artillerie und die Maschinengewehre hatten es ihm ohnehin schwer gemacht, den Überblick zu behalten. Dann aber war das Gas gekommen. Es überschwemmte die Gräben mit Leichen, und Eberhard hörte bald auf, ihnen Nummern zu geben. Nicht nur, weil das ein unmögliches Unterfangen war, sondern auch, weil das Gas alle Aufmerksamkeit forderte. Lautlos kroch es umher und wählte seine Opfer, die, sobald sie es rochen, bereits so gut wie verloren waren. Hätte Eberhard seinen Bruder nicht, der ein untrügliches Gespür für den furchtbaren gelben Nebel hatte, wäre er längst tot. Davon war er fest überzeugt. Reinhard hatte Glück im Spiel. Aus diesem Grund gab es auch keinen anderen Weg, als Reinhards Plan zu folgen und mit Einbruch der Dunkelheit aus dem Trichter zu fliehen. Alles, wirklich alles, war besser, als unter konvulsivischen Zuckungen sein Leben auf den verdammten französischen Boden zu kotzen.
»Va!«
Eberhard hob den Kopf. »Was war das?«
Reinhard spähte über den Rand des Granattrichters in die Richtung, aus welcher der Ruf gekommen war. »Was soll das denn?«
Eberhard sah, wie sich die Stirn seines Bruders unter dem Helm in Falten legte. »Was?« Er drehte sich auf den Bauch und schob sich vorsichtig nach oben, bis auch er über das Niemandsland zwischen den Fronten blicken konnte. Der Dunst des Gefechts hatte sich inzwischen aufgelöst. Bandstacheldraht und Stacheldraht wanden sich keine zwanzig Meter entfernt entlang eilig eingehauener Holzpfosten zu einem behelfsmäßigen Zaun. »Gott steh uns bei!«, hauchte er. »Wir wären dem Franzmann um ein Haar in den Graben gefallen!«
»Va!«
»Da drüben!«, bemerkte Reinhard neben seinem Bruder.
»Was tut er da?«, fragte Eberhard.
»Hat wahrscheinlich den Verstand verloren, der arme Teufel«, vermutete Reinhard. »Auch eine Möglichkeit, zu entkommen.«
Eberhard war sich nicht sicher, ob das besser wäre, als zu sterben, während er den nackten Mann beobachtete, der mit erhobenen Armen durch die Einöde stolperte. Seine Unterschenkel bluteten. Er musste zuvor in einem der Zäune hängen geblieben sein. Unter der von Dreck fleckig dunklen Haut zeichneten sich die Knochen der Rippenbögen deutlich ab. Die Franzosen hatten wohl auch nicht genug zu essen.
»Va!«, rief er erneut und sah mit noch immer erhobenen Händen zum Himmel auf. »Ce qui est enterré ne doit pas être trouvé!«
»Was sagt er?«, fragte Reinhard.
»Wir sollen gehen und irgendetwas, das begraben ist, will nicht gefunden werden, oder so ähnlich.«
»Als würde sich einer die Mühe machen, hier was zu vergraben«, schnaubte Reinhard. »Die Reste erledigen hier doch die Ratten.«
Unwillkürlich dachte Eberhard an die widerwärtigen Schädlinge. Sie kamen mit der Dunkelheit. Frech trippelten sie über einen hinweg, wenn man versuchte, mit dem Rücken an die Grabenwand gelehnt, zu schlafen. Ihre nackten Schwänze hinterließen ein schleifendes Geräusch.
Der Mann drehte den Kopf und sah in Richtung des Granattrichters, in dem die Brüder versteckt lagen. »Va!« Seine Augen nahmen einen wilden Ausdruck an.
»Er hat uns gesehen!«, flüsterte Reinhard entsetzt und ließ sich ein Stück tiefer rutschen, verlor den Franzosen dabei aber nicht aus den Augen.
Auch Eberhard zuckte zurück in den Schutz der Deckung und hielt die Hände über den Kopf.
»Der irre Franzmann kommt direkt auf uns zugelaufen!«, sagte Reinhard und griff fester nach dem Bajonett. »Er wird uns verraten!« Sein Atem begann stoßweise zu gehen, aber mit ein paar tiefen Zügen brachte er ihn unter seine Kontrolle.
Eberhard, der keinen nackten, wahnsinnigen Mann ausgerechnet mit einem Messer töten wollte, bewunderte einmal mehr den Mut seines Bruders, der mit der Ruhe eines Raubtiers sein Gewehr umfasst hielt und tun würde, was getan werden musste, sobald der Franzose ihnen zu nahe kam.
Eberhard hatte seines Wissens nach bisher keinen Mann getötet. Das übernahm Reinhard für ihn. Manchmal hatte er mit dem Bajonett zugestochen. Angeekelt hatte er die Klinge dabei beobachtet, wie sie durch die Uniformen der Belgier oder Franzosen gefahren war. Doch alle waren weitergelaufen. Alle.
Ein einzelner Schuss fiel, im selben Moment hob der Wind an, eine klägliche Melodie zu heulen.
Jemand rief: »Idiot!«
Eberhard erschauderte.
Reinhard ließ sich auf den Boden des Trichters rutschen. »Das war knapp! Noch ein paar Meter und er wäre wirklich hier rein gefallen.«
»Was ist passiert?«, fragte Eberhard.
»Die Franzosen haben ihn erschossen.«
»Bist du sicher?«
Reinhard seufzte. »Wer soll es denn sonst getan haben? Ich war es jedenfalls nicht. Der Schuss kam aus Westen.«
»Die Franzosen schießen auf ihre eigenen Leute?«
»Wundert dich hier noch irgendwas? Unsere Offiziere schießen auf uns. Hast du doch auch erlebt, oder nicht?«, fragte Reinhard und sah zum Himmel auf. »Na endlich! Die Sonne ist so gut wie weg.«
Eberhard schluckte schwer. Sein Bruder gab sich gleichgültig, aber er wusste, dass ihn das Erlebte nicht kaltließ. Einen armen Irren zu erschießen, war kein Krieg, das war Mord. Eberhard versuchte, nicht weiter darüber nachzudenken, und nahm stattdessen das Gespräch wieder auf. »Du hast recht. Wir müssen gehen, bevor sie ihren Toten holen.«
Reinhard lachte humorlos. »Warum sollten sie das tun? Wir müssen vielmehr aufpassen, dass sie uns nicht holen! Wir warten noch ab, bis es stockdunkel ist, bevor wir uns durchschlagen.«
Die Brüder verstummten. Es verging eine Stunde. Vielleicht waren es auch zwei, vermutete Eberhard, der zunehmend in Gedanken versank, die zunächst kaum über die Gräben hinausreichten. Er dachte an den nackten Franzosen. Vielleicht war es ja ein Segen, den eigenen Verstand vor dem Krieg zu verschließen. Oder war man dann mit dem Krieg zusammen eingesperrt, ohne die Möglichkeit, ihm zu entkommen? Er versuchte den Gedanken abzuschütteln, indem er sich sagte, dass jeder im Tod zu Gott fand. Das hatte der Herr Pfarrer ihnen beigebracht. Wie aber konnte Gott all das zulassen?
Plötzlich gab es nur eine Lösung für ihn: Gott existierte nicht. Alles, was ihm blieb, war dieses eine Leben auf Erden, das er und sein Bruder in diesem verdammten Krieg verschwendeten. Eberhard schwor sich, sollte er wie durch ein Wunder mit heiler Haut diesem Krieg entkommen, in seinem ganzen Leben nie wieder an eine Front zurückzukehren. Er würde sich eine angenehme Arbeit suchen. Eine Schreibstube schien ihm geeignet. Vater lebte es ihm vor. Er ging jeden Morgen fein gebürstet aus dem Haus und kam am Abend ebenso nach Hause. Dazwischen hielt er einen Griffel, dokumentierte Lagerbestände und schrieb Briefe. In einer Schreibstube würde er ruhig und konzentriert bis an das Ende seiner Tage vor sich hin arbeiten. Er würde die Hand sein, nicht der Spielstein.
Reinhard sinnierte dagegen nicht. Er wartete ab, bis es dunkel genug war, um sich aus dem Trichter zu wagen, dem Bild des tot zusammenbrechenden nackten Irren verwehrte er den Zutritt zu seinen Gedanken, aber es schlich sich immer wieder an, leise und grausam, wie das Gas.
Ruinen
Deutschland, 1945
»Ich glaube nicht, dass Vater es gut findet, wenn wir draußen bei der Munitionsfabrik spielen«, sagte Wilhelm in die morgendliche Stille hinein.
»Stell dich doch nicht so an, Wilhelmine! Er hat es nicht verboten, also ist es ihm egal«, seufzte der fünfzehnjährige Oscar und schloss wieder zu Hans auf, der unbeirrt weitergegangen war. »Außerdem«, fügte er ohne sich umzuwenden hinzu, »spielen wir nicht, sondern stellen Wehrmachtseigentum sicher, bevor es die Amis in die Finger bekommen.«
»Aber früher war es auch verboten, dass wir dorthin gehen.«
»Früher wurde dort auch noch gearbeitet.«
Hilfe suchend sah Wilhelm sich um, aber Chris zuckte lediglich mit den Schultern und sagte: »Weißt doch, wie er ist.«
Wilhelm wusste nicht, ob Chris ihren gemeinsamen Bruder Oscar oder den Vater, der das Verbot ausgesprochen hatte, meinte. Obwohl der Krieg vorüber war und Vater wieder zu Hause anzutreffen, wirkte er stets abwesend, die Kinder schienen ihm tatsächlich egal zu sein. Oscar war brüsk wie eh und je. Chris konnte es also um beide gehen.
Die Ruine der Munitionsfabrik erschien hinter der Wegbiegung. Wilhelm seufzte laut, woraufhin sein Bruder Oscar und dessen Freund Hans zu tuscheln begannen. Er glaubte »Feiges Huhn« zu verstehen. Hans linste über die Schulter zu ihm zurück. Wilhelm wollte widersprechen. Sehr wohl kann ich mutig sein, wollte er sagen, aber er fürchtete, dass die beiden älteren Jungen einen Beweis seiner Tapferkeit fordern würden. Dabei konnte er sich bereits vorstellen, wie dieser aussähe. In dem Fall würde ihm auch Chris nicht mehr helfen können. Dann würde er klettern müssen oder zündeln. Auf beides war er nicht gerade scharf.
Hans und Oscar rannten los, Chris schloss sich ihnen lachend an. Nur Wilhelm folgte dem Sandweg weiter im Schritttempo, während er die Munitionsfabrik beäugte. Die Mauerreste und der fast ausgebrannte Dachstuhl wirkten fehl am Platz zwischen den Feldern, Wiesen und weitläufigen Wäldern, die das Tal umschlossen. Mehrmals hatte er sich versucht vorzustellen, dass dort statt der Fabrik eine Burg gestanden hatte. Er selbst war wahlweise Hagen oder Sigfried gewesen, der gegen Ritter oder Drachen kämpfte. Aber er wurde der Vorstellung bald müde. Sie war ihm zu deprimierend. Am Ende waren doch alle tot. Der Krieg in der thüringischen Provinz hatte ihm gereicht. Mit dem Kriegsende waren die Amerikaner gekommen. Sie waren in jedes Haus eingedrungen und hatten mit vorgehaltenen Waffen alle Erwachsenen zusammengetrieben und mitgenommen. Wilhelm hatte den gesamten Tag über unaussprechliche Ängste um seine Eltern ausgestanden. Am Abend waren sie zwar wieder da gewesen, schwiegen aber über das Erlebte. Die meisten Erwachsenen hatten nach diesem Tag Brauben verlassen. Dafür kamen die Flüchtlinge in langen Trails, das Schreckensgespenst der Roten Armee im Nacken. Aber auch von ihnen blieb niemand in der Stadt, als ob in ihr Geister lebten.
Und nun mussten sie ausgerechnet wieder zu der verdammten Munitionsfabrik gehen, die ihn stets an die Mündungen der amerikanischen Gewehrläufe erinnerte.
Wilhelm hatte ein ungutes Gefühl. Er sah durch ein großes Loch in der Mauer, wie Hans und Chris im Inneren mit den Füßen suchend über den Boden streiften. Oscar dagegen schwang sich über die Mauerreste immer weiter nach oben. Über die niedrigen Backsteinmauern traute sich Wilhelm noch zu klettern, aber wie sein Bruder hoch hinaus bis unter die rußschwarzen Dachbalken zu kraxeln, hielt er für ein lebensmüdes Unterfangen.
Als er bemerkte, dass Hans und Chris nebeneinander hockten und etwas auf dem Boden verstreuten, wurde er noch langsamer und tat, als habe er ein Tier im Gebüsch entdeckt, um ihnen nicht in den Gebäuderest folgen zu müssen. Er wandte sich ab. Hinter ihm zischte es und die anderen lachten. Wilhelm hielt stets Abstand, wenn Hans, Oscar und Chris das Schwarzpulver aus den Projektilen, die sie im Schutt suchten, zu Linien auf den Boden rieseln und verpuffen ließen. Auf die Gefahren hinzuweisen, hatte er dagegen aufgegeben. Das schürte nur die unschönen Spitznamen, die sie ihm gaben. Feigling. Wilhelmine. Pimpf. Dabei war er gerade mal drei Jahre jünger als Hans, der allerdings als einziger sechzehnjährig an der Front gewesen war und nicht müde wurde, das zu betonen. Nur aus diesem Grund war er ihr unhinterfragter Anführer. Aber Wilhelm glaubte fest, dass er hinter seiner Großmäuligkeit etwas zu verbergen versuchte.
»Seht euch das an!«, rief Hans und hielt ein keulenförmiges Ding in die Höhe. Damit alle es bewundern konnten, drehte er sich mit erhobenen Armen um die eigene Achse.
Wilhelm spähte wieder durch das Loch in der Mauer. Im Gebälk der Ruine pfiff Oscar anerkennend durch die Zähne. Dann verstummte er plötzlich.
Chris reagierte zuerst. »Mensch Hans! Sei vorsichtig! Das ist …«
»Ich weiß, was das ist! Ich war an der Front, schon vergessen?« Er ließ die Arme bis auf Höhe der Brust sinken und sah spöttisch auf das Ding in seiner Hand, um zu bedeuten, dass er die Situation unter Kontrolle hatte.
Wilhelm sah die Explosion nicht. Er hörte sie und fast gleichzeitig wurde er von den Beinen gerissen. Eine Staubwolke breitete sich vom Inneren der Munitionsfabrik aus, spülte durch das Mauerloch und begrub ihn. Der sandige Dunst drang ihm in Mund und Nase. Er rollte sich auf den Bauch, drückte den Kopf auf den Boden und hielt sich die Ohren zu, wie er es in der Nacht getan hatte, als die Flieger über dem Städtchen gekreist waren und ihre Bomben auf die Fabrik geworfen hatten. Unwillkürlich erinnerte er sich an den Schein des Brandes am Nachthimmel. Erst als eine Hand nach seinem linken Unterarm griff und daran zerrte, wälzte er sich auf den Rücken und öffnete die Augen. Er musste ein paarmal zwinkern, bis er wieder klar sehen konnte.
Chris stand über ihm. Ihr blonder, langer Zopf war von rotem Staub bedeckt. Auf der rechten Wange blutete sie aus kleinen Wunden. Auch an ihrem rechten Arm vermischten sich Blut und Dreck. Sie musste sich im Moment der Detonation abgewendet haben.
»Christiane?«, fragte Wilhelm. »Ist alles in Ordnung?«
»Das wollte ich dich auch gerade fragen«, sagte sie und strich ihrem jüngeren Bruder über den Kopf, ehe sie sich zu der Ruine umwandte, die im staubigen Nebel lag. »Oscar?«, rief sie laut. Ihre Stimme vibrierte.
»Hier oben!«
Wilhelm und Chris sahen ihn hinter dem Dachbalken winken.
»Wo ist Hans?«, brüllte Oscar.
Chris antwortete nicht. Sie sah Wilhelm über die Schulter hinweg an. In ihren Augen schwammen Wut, Hass und Schmerz.
Wie er vom Dachstuhl auf den Sandweg gekommen war, daran konnte sich Oscar nicht erinnern. Insgesamt war ihm, als hätte die Explosion seine Wahrnehmung ausgelöscht. Obwohl seine Lungen und seine Beine von der Anstrengung brennen mussten, spürte er sie kaum. Fast die Hälfte der gut und gern fünf Kilometer bis zum Elternhaus der drei Geschwister hatte er bereits im Spurt hinter sich gebracht. Neben dem Verlust des Körpergefühls waren seine Gedanken in einen Kreislauf geraten. Die wenigen Erinnerungen, die für Oscar noch existent waren, drehten sich um Hans. Hans, der mit dem Einzugsbescheid in der zitternden Hand in seinem Zimmer stand. Hans, der mit ihm am Tag vor seinem Abmarsch am Waldrand saß, über das Tal blickte und sagte, dass er Angst habe. Hans, der mit verdreckter, stinkender Uniform aus dem Zug sprang und ihn viel zu lange umarmte. Hans, der im roten Staub in der Fabrik lag und sich nicht bewegte.
Oscar sah sein Elternhaus hinter den Wiesen und Feldern auftauchen. Wenn man sich Brauben von Norden her näherte, war es das erste Gebäude am Ortsrand, ein schönes großes Haus, in dessen Vorgarten die Sonnenblumen begannen zu blühen. An der Rückseite schloss sich ein weitläufiger Bauerngarten an.
Oscar rannte, als wäre der Leibhaftige hinter ihm her. Die Bilder in seinem Kopf hielten Schritt, drehten sich gar noch schneller. Kaum wähnte er sich in Rufreichweite, begann er zu brüllen: »Mama! Hilfe!« Er spurtete einige Sekunden weiter, bis er genug Atem für einen erneuten Schrei aufbringen konnte. »Mama!«
Seine Mutter erschien hinter der Hausecke, die kleine Lotte auf dem rechten, einen Korb Wäsche unter dem linken Arm. Hektisch winkte er ihr zu, kam ins Straucheln und stürzte zu Boden. Er rappelte sich auf, die Knie blattgrün und braun, rannte winkend und rufend weiter. Die Mutter war alarmiert. Sie ließ den Wäschekorb fallen, setzte das Mädchen ins Gras und kam ihm mit hochgerafftem Rock entgegengerannt.
»Der Hans!«, rief Oscar.
»Ist mit dem Wilhelm und der Christiane alles in Ordnung?«
»Der Hans!«, wiederholte er.
»Was ist mit dem Hans?«, fragte die Mutter außer Atem, blieb stehen und stützte sich vornübergebeugt auf den Knien ab.
»Es hat ihn erwischt.«
»Was soll das heißen, Oscar?« Die Mutter sah fragend auf. »Was hat ihn erwischt?«
Oscar rang nach Atem und nach Worten. »Es ist explodiert.«
Die Mutter schüttelte den Kopf, um ihm zu verstehen zu geben, dass sie noch immer nicht folgen konnte.
Oscar stiegen die Tränen in die Augen, hinter dem Schleier erkannte er seinen Vater, der mit Lotte an der Hand über die Wiese auf ihn zukam. Seine Unterlippe begann zu beben, er wusste nicht, wie er das Geschehene erklären sollte.
»Was ist denn passiert?«, fragte sein Vater laut.
»Irgendwas ist mit dem Hans«, antwortete die Mutter. »Aber er sagt nicht genau, was los ist.«
Der Vater schloss zu ihnen auf. Er seufzte. »Gib Antwort, Junge: Was ist passiert?«
Oscar straffte die Schultern, so gut es ging. »Ich …«, begann er stammelnd. Noch immer weigerten sich die Geschehnisse, sich in Worte fassen zu lassen.
Sein Vater wurde ungeduldig. »Mein Gott, Junge! Wirst du dich wohl fassen! Wo ist der Hans?«
Darauf wusste Oscar zu antworten. »Munitionsfabrik.«
Jetzt endlich verstand die Mutter. »Wart ihr etwa draußen bei der Fabrik und habt da noch irgendwas gefunden, das explodiert ist? Du hast doch eben gesagt, da sei was explodiert.«
Oscar nickte. Mutter und Vater tauschten vielsagende Blicke aus. Lotte stand still daneben und sah von einem zum anderen.
»Was ist denn explodiert?«, fragte der Vater.
»Hand…granate«, stammelte Oscar.
»Hat er sie festgehalten, als sie hochgegangen ist?«
Oscar nickte erneut.
»Zeig mal. Wie hat er sie gehalten?«
Oscar entsann sich des letzten unversehrten Bildes, das er von Hans hatte. Die Handgranate vor der Brust, der überlegene Blick. Zitternd ahmte er die Körperhaltung seines Freundes nach.
»Was machen wir denn jetzt?«, fragte die Mutter und sah ihren Mann an. »Kannst du nicht zu den Amerikanern gehen? Vielleicht können die schnell einen Arzt schicken. Er ist doch noch fast ein Kind.«
Der Vater winkte ab. »Braucht’s nicht. Der ist hin.« Er wendete die Hand seiner jüngsten Tochter in der seinen. Oscars Blick fiel wie so oft auf die Narben auf dem Handrücken seines Vaters, von denen er nicht wusste, wie sie dorthin gekommen waren.
»Was ist mit Wilhelm und Christiane? Geht’s denen gut?«
»Ja«, brachte Oscar hervor. Tränen liefen ihm über die Wangen.
Der Vater übergab das jüngste Kind seiner Frau. »Ich geh rüber zu seinen Eltern.« Er wandte sich ab und stapfte über die Wiese, während er ärgerlich vor sich hin murmelte. »Man möchte meinen, dass sie alt genug sind, um sie allein zu lassen. Wenigstens hat’s nur den erwischt, um den ist es nicht schade.«
Ein Faustschlag hätte Oscar nicht härter treffen können.
Begraben
Frankreich, 1916
»Folg mir, Eberhard!«
Reinhard robbte bäuchlings über den Rand des Granattrichters, in dem die Brüder seit über zwölf Stunden ausgeharrt und auf die Dunkelheit gewartet hatten. Eberhard benötigte einige Sekunden, um sich von seinen Gedanken zu lösen und in die Gegenwart zurückzufinden. Schwerfällig zog er sich dem Beispiel seines Bruders folgend am Ostrand des Trichters hinauf. Die Dunkelheit des dahinterliegenden Niemandslandes verschluckte ihn beinahe. Der blasse Vollmond hatte sich hinter einem Wolkenfetzen versteckt. Eberhards Hände waren so kalt, dass er kaum die schwarze Erde fühlte. Vor ihm kroch sein Bruder fast lautlos und mit einer Sicherheit, als verfüge er über Karte und Kompass. Eberhard selbst musste sich bemühen, nicht vor Kälte und Anstrengung zu schnaufen. Bereits nach wenigen Metern schmerzten ihm die Schultern und die Knie bis hinauf in die Oberschenkel, als Steine und gefrorener Dreck an ihnen scheuerten. Am schlimmsten aber war der Gedankenkreis, der sich unablässig in seinem Kopf drehte. Konnten sie von den Franzosen unbemerkt auf die andere Seite der Front gelangen? Überraschte sie das Gas? Würden am Ende gar ihre eigenen Leute auf sie schießen, weil sie für einen Spähtrupp gehalten wurden? Trotz der Dunkelheit bewegten sie sich auf dem Präsentierteller. Die Wolken konnten den Mond jederzeit wieder freigeben oder irgendjemand hatte schlicht gute Augen. Ihr Leben war Glück und Zufall ausgeliefert.
Zu spät bemerkte Eberhard, dass sein Bruder einen kleinen Bogen gekrochen war. Seine rechte Hand griff beim nächsten Zug vorwärts in etwas Metallenes. Hastig zog er sie zurück, aber da wanden sich bereits kühle Spitzen um seine Finger, den Handrücken und das Gelenk und begannen an der Haut zu kratzen. Mit der freien Hand versuchte er sie zu entfernen, doch sie zogen sich weiter zu und schnitten ihm in das kalte Fleisch. Er japste erschrocken. Eigentlich wusste Eberhard, dass er nicht daran ziehen durfte, aber das Wissen fiel seiner aufsteigenden Panik anheim. Mit einem Ruck versuchte er seine Hand zu befreien, das spitze Metall biss fester zu. Er fühlte, wie Blut aus den Wunden zu quellen begann. Unüberlegt sprang er keuchend und zerrend auf. Der Wind frischte auf und vertrieb die Wolken, hinter denen der Mond erschien. In seinem fahlen Licht erkannte Eberhard, dass er sich ausgerechnet in einem losen Stück Bandstacheldraht verfangen hatte, dessen Widerhaken ihm unerbittlich die Haut zerschnitten. Er versuchte das verworrene Knäuel abzuschütteln, während er einen Schrei unterdrückte.
Reinhard war unbemerkt an ihn herangetreten und griff mit beiden Händen nach seinem freien Oberarm, bis Eberhard seine Aufmerksamkeit auf ihn richtete. Er schnappte nach Luft. Reinhard sah ihn ruhig an und legte den Zeigefinger auf die Lippen. Langsam wiegte er den Kopf vor und zurück, das Kinn erst auf die Brust, dann den Hinterkopf in den Nacken legend, dabei öffnete er den Mund weit, um ihn dann wieder zu schließen. Eberhard verstand. Er sollte langsam und tief durchatmen.
Die ersten Atemzüge gerieten ihm nur zitternd, doch bald wurde er ruhiger. Er wurde sich des Brennens seiner Hand gewahr, aber der Schmerz war erträglich. Die Brüder standen mitten in der Nacht im Ödland zwischen den Fronten unter dem Vollmond. Als der Wind innehielt, schien für einen winzigen Augenblick auch die Zeit stillzustehen, dann holten Eberhard wieder seine Gedanken ein. Er fragte sich, was sie nun tun sollten. Mit dem Ding, das seine Hand knebelte, konnte er unmöglich weiterkriechen. Einfach geduckt zu laufen, war dagegen zu gefährlich. Ihre Silhouetten waren als Schatten gegen die Nacht sichtbar. Es war nur eine Frage der Zeit, bis eine Wache, auf welcher Seite auch immer, auf sie aufmerksam wurde und das Feuer eröffnete. Erneut begann Panik in Eberhard aufzusteigen und nach seiner Kehle zu greifen. Seine Beine gerieten in Bewegung. Unruhig tänzelte er von einem auf das andere, doch bevor er wie ein waidwundes Tier davonsprengen konnte, mischten sich die Franzosen ein. Der erste Schuss verfehlte die Brüder um einige Meter. Eberhard erkannte es an dem pfeifenden Geräusch des Projektils. Den zweiten Schuss nahm er als durchdringendes Zischen wahr. Er musste nahe an ihnen vorbeigeschrammt sein.
Obwohl er gerade noch den Drang verspürt hatte, davonzurennen, blieb Eberhard nun einfach stehen. Es war Reinhard, in den Bewegung kam. Den Bruder hinter sich herziehend rannte er los. Seine Stiefel knirschten auf der Erde, kleinen Steinen und Metallsplittern.
Als der nächste Schuss zischte, schlug Reinhard einen Haken, dann noch einen und schließlich sprang er zurück in den Granattrichter, dem sie erst vor Kurzem entkommen waren. Eberhard folgte seinem Bruder stolpernd, verlor das Gleichgewicht und stürzte kopfüber in den Trichter. Unbedacht streckte er im Fallen die Hände aus, um sich abzustützen. Der Aufprall trieb ihm die Spitzen des Bandstacheldrahts noch tiefer in die Hand. Dieses Mal konnte er einen Schmerzensschrei nicht unterdrücken.
Die Franzosen hörten auf zu schießen, aber die Brüder saßen in der Falle, und als Eberhard das realisierte, schrie er noch einmal auf. Dann kehrte die Stille der Nacht zurück, die selbst der Wind nicht mehr unterbrach.
Reinhard machte seinem Bruder keine Vorwürfe. Er hatte gehandelt, wie er gehandelt hatte. Die Brüder saßen einander auf den Knien gegenüber. Eberhard biss die Zähne aufeinander und atmete in schnellen Stößen. Bedächtig entfernte Reinhard im spärlichen Licht des Mondes den Draht von den Händen seines Bruders, indem er den geschwungenen Verlauf des Metalls erst mit den Augen nachvollzog und ihn dann vorsichtig, Widerhaken für Widerhaken, aus der Haut löste. Es erinnerte ihn an das Entwirren eines durcheinandergeratenen Wollknäuels. Die Mutter hatte es gehasst, die Schlingen und Knoten zu lösen, und sich stets mit einer süßen Mehlspeise erkenntlich gezeigt, wenn die Jungen diese Aufgabe freiwillig übernommen hatten. Dabei war es Eberhard immer am besten gelungen, die langen Fäden ordentlich aufzurollen. Er erledigte es mit derselben geflissentlichen Akribie, mit der er seine Aufsätze für die Schule schrieb. Zugegeben hätte er es sicherlich nicht, aber Reinhard vermutete, dass seinem Bruder der Gefallen für die Mutter Spaß machte. Für ihn, Reinhard, war es hingegen wirklich ein Gefallen. Er sagte sich, es schule seine Konzentration, und hinterher gäbe es Dampfklöße mit Zucker. Nun war er froh, dass er an Wolle hatte üben können, schließlich ging es um die rechte Hand seines Bruders.
Als er die letzte Schlinge des Drahts endlich löste, atmete er erleichtert auf. Mit dem spärlichen Rest Wasser aus seiner Feldflasche reinigte er die Wunden an den Fingern, dem Handrücken und dem Handgelenk und ließ Eberhard trinken. Das Muster der Einschnitte erinnerte Reinhard kurz an ein Spinnennetz.
»Leg dich hin und ruh dich etwas aus«, flüsterte er. Er selbst lehnte den Rücken gegen die Ostseite des Trichters und griff nach dem Karabiner, um Eberhard zu bedeuten, dass er die Wache übernehmen werde.
Eberhard seufzte einige Male und wälzte sich von einer Seite auf die andere, bis ihn schließlich die Erschöpfung überwältigte und er einschlief. Hin und wieder zuckten seine langen, dünnen Beine oder er murmelte etwas im Schlaf, das ängstlich oder verzweifelt klang. Reinhard wusste, dass sein Bruder jede Nacht von Albträumen gequält wurde. Meistens schienen sie allerdings schlimmer zu sein als der, den er gerade erlebte. Eberhard schrie dann entweder im Schlaf oder fuhr auf, als jagte ihn der Teufel persönlich. Reinhard fragte sich, ob er auch diese Art Träume durchmachte und sich bloß nicht daran erinnern konnte. Einmal hatte er seinen Bruder darauf angesprochen, der ihm aber sagte, er schlafe so fest wie ein Baby. Ganz konnte er das nicht glauben, denn obwohl sein Körper offenbar ruhig war, brachte der Schlaf kaum Erholung, sodass Reinhard sich bereits beim Erwachen erschöpft fühlte. Trotzdem sehnte er sich jetzt nach Schlaf. Die Strapazen des Tages begannen sich schwer auf seine Glieder zu legen, er war hungrig und durstig, und obwohl er sich verbot einzuschlafen, geriet er doch in einen Schwebezustand, in dem ihm sein Geist merkwürdige Bilder zeigte.
Er sah den nackten Franzosen. Er schaute diesmal nicht zum Himmel auf, sondern wühlte unter einem Mond aus Alabaster in dem Granattrichter wie ein Tier auf Knien an der Stelle in der Erde, die Reinhard mit dem dreieckigen Zeichen markiert hatte, als suche er etwas. Bei alledem war es Reinhard, als schwebe er über der Szene. Plötzlich hielt der Mann inne und streckte die geschlossene Hand nach oben. Reinhard wusste mit der Sicherheit eines jeden Träumenden, dass er etwas Wichtiges in ihr verborgen hielt. Er starrte auf die Faust, bis er bemerkte, dass der andere ihn ansah. Der Blick erschütterte ihn bis ins Mark. Er erkannte seine eigenen hellbraunen Augen, durchzogen von dunkelorangenen Sprenkeln, in denen des Mannes wieder, deren Blickrichtung sich abermals änderte, zurück zu der Faust glitten, die langsam im Begriff war, sich zu öffnen. Doch ehe Reinhard das darin Verborgene sehen konnte, stand er in einem Wald. Direkt vor ihm pirschte ein Wolf mit dunklem, fast schwarzem Fell, meliert von einigen grauen Haaren, durch das Unterholz. Er jagte. Doch er war nicht auf der Spur von Hasen oder Rotwild. Er jagte andere Wölfe, auch das wusste Reinhard sicher.
Eberhard stöhnte im Schlaf laut auf. Reinhard fuhr zusammen. Er umfasste den Karabiner, den er auf seinem Bauch abgelegt hatte, und sah sich um. Der Mond war noch nicht untergegangen. Es war vielleicht zwischen zwei und drei Uhr nachts. Vorsichtig spähte er über den Rand des Granattrichters. Sowohl im Westen als auch im Osten schlief die Front. An einigen Stellen schwappte der fahle Schein der Lampen über die Grabenränder. Kurz betrachtete Reinhard die dunkle Silhouette des toten Franzosen unweit ihres Verstecks. Der Mann lag auf dem Bauch, die Hände mussten im Fall unter den Körper geraten sein, das Gesicht lag auf der Erde.
Arme Kreatur! Erschossen wie ein Tier!, dachte er, rutschte zurück auf seinen Platz, an dem er die vergangenen Stunden verbracht hatte, und schloss die Augen.
Die Visionen kehrten nicht zurück. Stattdessen umklammerte eine Frage hartnäckig seinen Geist. Was hatte der Franzose in seiner Hand gehalten? Es musste etwas Kleines gewesen sein.
Reinhard schob sich leise auf die Knie, drehte sich um und betrachtete nachdenklich die Stelle, an der er soeben noch gelehnt hatte. Das bodenlose Dreieck war kaum noch zu erkennen. Beim Kriechen aus dem Trichter hatte sich die Erde gelöst und die beiden Linien fast vollständig verwischt. Reinhard legte erst eine, dann zwei Fingerspitzen auf die verbliebene Markierung und begann, vorsichtig daran zu kratzen. Nach einigen Momenten hielt er inne.
Nein, das ist absurd, es war nur Einbildung.
Schon wollte er sich wieder auf den Hosenboden setzen, doch seine Neugierde war stärker. Eigentlich fühlte es sich nicht recht an wie Neugierde. Dem Gefühl war etwas wie ein Drang beigemischt, ganz so, als habe er keine andere Wahl.
Er sah sich um, sein Bruder schlief noch immer tief und fest, nur seine Augen rollten unter den geschlossenen Lidern. Reinhard zuckte mit den Schultern, wandte sich der Stelle in der Trichterwand zu und begann, mit einer Hand zu graben. Die ersten Zentimeter des Sediments ließen sich leicht lösen, sodass ihm Erde und kleine Steine über die Hand rieselten. Dann musste er mehr Kraft aufwenden, um tiefer zu gelangen. Er nahm das Bajonett zu Hilfe. Als seine Hand bequem in dem Loch Platz fand, tastete er mit den Fingerspitzen die Wände der entstandenen Höhle ab, aber er fand nichts.
So drängend das Gefühl vor wenigen Minuten noch gewesen war, so plötzlich verschwand es nun und Reinhard seufzte leise, während er immer wieder mit den Händen in das Häufchen abgetragener Erde griff und sie sich durch die Finger gleiten ließ. Als etwas zwischen Zeigefinger und Mittelfinger hängen blieb, sah er hin. Es handelte sich um einen Stein. Reinhard hob die Brauen über sein eigenes Verhalten und ließ den Stein achtlos zu Boden fallen. Wütend griff er nochmals in das verbliebene Häufchen und presste die Erde in der Faust. Etwas Spitzes stach ihn in den kleinen Finger. Er öffnete die Hand und glaubte an ein Stück Stacheldraht, fand aber einen Zahn. Tatsächlich hatte sich die scharfe Kante eines Zahns – das musste es sein, Reinhard erkannte es an der Form – in seine Haut gebohrt, aus der ein kleiner Tropfen Blut quoll und mit dem Dreck verschmolz. Er wischte mit dem Ärmel über das Ding, bis er im Mondlicht das Weiß erkennen konnte.
Ein Zahn,dachte er spöttisch, den sollte ich aufheben, falls mir einer von meinen abhandenkommt.
Wobei … handelte es sich überhaupt um einen menschlichen Zahn? Größe und Form ließen auf einen Backenzahn schließen, aber für den eines Menschen erschien er ihm zu scharfkantig. Nachdenklich betrachtete er ihn noch ein paar Augenblicke.
Als sich eine Wolke vor den Mond schob, steckte er ihn in die Hosentasche und nahm sich vor, Eberhard danach zu fragen. Sein Bruder, der gern las und in der Schule aufgepasst hatte, wusste vielleicht eine Antwort. Damit war die Sache für Reinhard erledigt.
Erneut setzte er sich so, dass er den Rücken anlehnen konnte, und überlegte, was als Nächstes zu tun sei. Sollten sie noch einmal einen Fluchtversuch wagen? Vielleicht eignete sich die Zeit vor dem Sonnenaufgang, wenn der Mond untergegangen und die Nacht am dunkelsten war. Gut möglich, dass die Franzosen sie unter ihren eigenen Albträumen bis dahin vergessen hatten oder sie die beiden Brüder entkommen ließen. Manchmal stimmte die Nacht einen gnädig, weil sie die Frage nach dem Sinn stellte, jedenfalls bis die Pflicht wieder unerbittlich auf einen herableuchtete. Sie würden es wagen müssen, denn beim letzten Angriff hatte keine der beiden Seiten das Gas eingesetzt. Obwohl es niemanden in Stücke riss oder erschoss, war es die furchtbarste aller Kriegsplagen. Erst war es aus den Fässern gekrochen wie aus der Büchse der Pandora, später fiel es mit den Schrapnells vom Himmel, und Reinhard fühlte, wie es sich langsam anschlich. Es würde bald kommen und sein Bruder und er saßen in dem Trichter ohne den einzig wirksamen Schutz, ohne Gasmaske.
Als der Mond unterging, weckte Reinhard seinen Bruder aus dessen unruhigen Träumen. Er flüsterte seinen Namen, bis Eberhard flatternd die Lider hob und sich ungelenk aufrichtete.
»Wir müssen es noch mal versuchen«, wisperte Reinhard. »Die Zeit drängt. Ich glaube, dass das Gas bald kommt.«