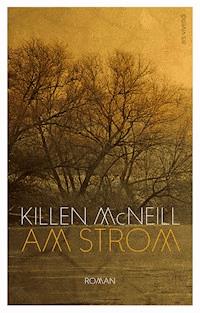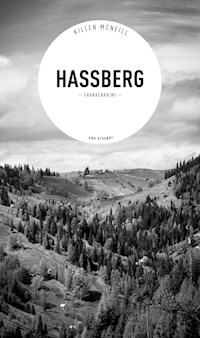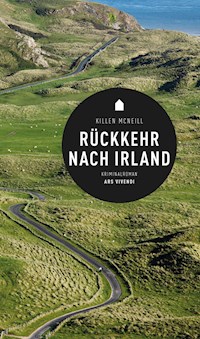
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ars vivendi Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Eine Gruppe Burgsteinacher geht auf eine Irland-Rundfahrt mit dem erfahrenen irischstämmigen Reiseleiter Michael, der seit über vierzig Jahren in Franken lebt. Vor den grandiosen Kulissen der grünen Insel machen sich aber bald erste Risse im kleinbürgerlichen fränkischen Mikrokosmos und Ungereimtheiten in der Biografie des Reiseleiters bemerkbar. Warum will Michael nicht seinen Heimatort in Nordirland aufsuchen? Und warum ist er damals überhaupt ausgewandert? Die Reise wird mehr und mehr von mysteriösen Vorfällen überschattet, die schließlich in einem Todesfall gipfeln. Als die Gruppe bei einem Sturm auf einer entlegenen Insel strandet, spitzen sich die Ereignisse endgültig zu ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 325
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Eine Gruppe Burgsteinacher tritt eine Irland-Rundfahrt mit dem erfahrenen irischstämmigen Reiseleiter Michael an, der seit Langem in Franken lebt. Vor den grandiosen Kulissen der grünen Insel machen sich bald erste zwischenmenschliche Probleme und Ungereimtheiten in der Biografie Michaels bemerkbar. Warum will er seinen Heimatort nicht besuchen? Die Reise wird mehr und mehr von mysteriösen Vorfällen überschattet, die schließlich in einem Todesfall gipfeln. Dann strandet die Gruppe bei einem Sturm auf einer entlegenen Insel …
Killen McNeill stammt aus Nordirland. Er studierte Germanistik, war in den Jahren 1973/74Austauschstudent in Erlangen und zog dann nach Franken. Er war zweiundvierzig Jahre lang Fachlehrer für Englisch an der Haupt- bzw. Mittelschule Scheinfeld. 2001 erschien sein erster, auf Englisch geschriebener Roman Trains & Boats & Planes. Sein Kurzkrimi »Pfarrers Kinder, Müllers Vieh« wurde 2012 als Siegergeschichte der Jury im Wettbewerb um den Fränkischen Krimipreis ausgezeichnet. 2013 erschien bei ars vivendi sein Roman Am Schattenufer, 2015 folgte Am Strom, 2019 sein erster Kriminalroman, Hassberg.
Der Abdruck des Gedichts Das geraubte Kind* in der Übersetzung von Mirko Bonné erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Luchterhand Verlags. Die Rechte an der deutschen Übersetzung liegen beim Luchterhand Literaturverlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH.
Vollständige eBook-Ausgabe der im ars vivendi verlag erschienenen Originalausgabe (Erste Auflage Oktober 2021)
© 2021 by ars vivendi verlag GmbH & Co. KG, Bauhof 1, 90556 Cadolzburg
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (druch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhlate von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
www.arsvivendi.com
Satz: ars vivendi
Lektorat: Dr.Felicitas Igel
Umschlaggestaltung: FYFF, Nürnberg
Motivauswahl: ars vivendi
Umschlagfoto: © Westend61/Martin Siepmann
Datenkonvertierung eBook: CPI buchbücher.de GmbH, Birkach
eISBN 978-3-7472-0301-9
Rückkehr nach Irland
Für Bri
Prolog
Mary Doherty, 16.Mai 1959
Das Böse ist fort, als Mary aufwacht, und eine unheimliche, ermattete Stille herrscht im Haus. Aber irgendwo wird es sich versteckt haben und auf sie lauern. Gestern Nacht tobte es zwischen ihren Eltern wieder lange, zog von der Küche ins Wohnzimmer und nach draußen in den Garten. Es drang in Marys Schlafzimmer ein, bis sie aufstand und das Fenster schloss. Und immer noch hörte sie es mit seinen hässlichen Worten in der Nachtluft flattern, wie Raubvögel, die mit ihren Flügeln gegen die Fensterscheiben schlugen. »Wo warst du?« »Ich halte das nicht mehr aus!« »Du warst schon wieder mit ihm auf der Insel.« »Du spionierst mir nach!« »Du lügst.«
Jetzt wird es wenigstens bis Mittag ruhig sein, weil Marys Mutter auch heute so lange schlafen wird. Ihr geliebter Daddy wird, wie immer in letzter Zeit, die Nacht auf dem Sofa im Wohnzimmer verbracht haben. Nur die zusammengeknüllte Decke wird davon zeugen. Aber seltsam, dass Mary das Muhen der Kühe auf dem Weg von der Wiese in den Stall zum Melken noch nicht gehört hat.
Mary steht auf. Sie zieht ihre Latzhose und die Gummistiefel an und geht nach unten. Sie ist fünf Jahre alt. Im Wohnzimmer zeigt die Standuhr neben dem Bild von dem Mann, der in den Fluss schaut, acht Minuten vor sechs, und die Decke liegt zu Füßen des Sofas. Ihr Vater ist schon fort. Mary meint gehört zu haben, wie er vor ungefähr einer Stunde aufgestanden ist. Ein Rumoren unter ihr, das in ihren Halbschlaf drang. Aber warum hört sie jetzt nicht die Kühe oder das Zischen der Melkanlage? Sie zieht den Hocker aus der Küche, seine Beine scheppern über die Fliesen im Flur. »Shhh!«, flüstert sie ihnen zu. Sie will ihre Mutter nicht wecken. Sie stellt den Hocker vor die Hintertür, steigt darauf, hebt den Riegel an, zieht die Tür etwas nach innen auf. Dann steigt sie wieder vom Hocker, schiebt ihn zur Seite und macht die Tür auf.
Kühle, feuchte Luft zieht von draußen ins Haus. Der Mond hängt über Mulroy Bay und spiegelt sich darin. Der Bergrücken von Loughsalt schwebt zwischen dem silbernen See und dem grauen Himmel wie eine schwarze Wolkenschicht. Jetzt hört sie das Stöhnen der Kühe auf der Wiese. Warum hat ihr Vater sie nicht geholt? Noch ein Geräusch vernimmt sie, ein mechanisches, aber nicht die Melkanlage, sondern einen Motor. Es ist der Ford Prefect, der ganze Stolz ihres Vaters. Doch er klingt gedämpft, wie wenn er in der Scheune wäre. Aber wenn er in der Scheune ist, warum läuft er dann?
In dem Moment kommt der Motor ins Stolpern, stottert und setzt aus. Mary läuft über den betonierten Weg zwischen Haus und Scheune. Schon vorher riecht sie die Dämpfe, die der Motor ausstößt, und sieht die Schwaden, die zwischen den Scheunentoren nach außen drängen.
Jetzt weiß Mary: Da drin in der Scheune wartet das Böse auf sie.
»Bleib stehen, Mary.«
Es ist ihr zehn Jahre älterer Bruder John-Joe. Er hat einen Bademantel über seinen Schlafanzug geworfen, und seine nackten Füße klatschen auf dem Weg. Er geht an ihr vorbei zum Scheunentor und macht es auf. Ein Riesenschwall weißen Gases entweicht aus dem Inneren, wie eine Nebelbank, die über der Bucht von Mulroy Bay schwebt. John-Joe keucht und hustet und geht zur Seite. Mary stellt sich neben ihn. Die Dämpfe verflüchtigen sich, aus dem grauen Schleier taucht das schwarze Heck des Fords Prefect auf, dann zwei Körper, die Rücken an Rücken vorne sitzen. Die Köpfe hängen nach unten. Die Vordertüren sind offen; die Beine ihres Vaters baumeln aus dem Auto. Er trägt noch seine gestreifte Schlafanzughose.
»Daddy!«, ruft Mary.
»Beweg dich nicht weg von hier«, sagt John-Joe. Er läuft vor zur offenen Fahrertür, hustend und mit den Armen wedelnd. Dann kommt er wieder.
»Ist Mammy auch im Auto?«, fragt Mary.
»Das ist nicht Mammy«, sagt John-Joe. »Das ist eine andere Frau.«
Schon ist ihre Mutter da, ebenfalls im Bademantel. Sie dünstet den Branntwein von gestern Abend aus, man riecht es selbst im Freien. »Oh Gott«, sagt sie. »Er hat’s getan. Er hat’s wirklich getan.«
Niemand kümmert sich um Mary. Sie steht alleine vor der Scheune. Ihre Mutter ist zur Telefonzelle am Ende der Auffahrt gelaufen, und John-Joe ist verschwunden. Niemand hat Mary gesagt, dass ihr Vater tot ist.
»Daddy?«, ruft sie. »Daddy?«
Sie tritt näher. Ein Schlauch führt vom Unterboden des Autos ins Innere. Er ist in das hintere Fenster eingeklemmt.
»Daddy?«
Ihr Vater sitzt seitlich auf dem Fahrersitz, Rücken an Rücken mit dem Körper einer Frau, von der Mary nur die gewellten braunen Haare sieht. Über seinem Schlafanzug trägt er einen blauen Bademantel. Mary bückt sich, um ihm ins Gesicht zu sehen. Vielleicht schläft er nur.
»Weg da!«, ruft eine raue Stimme hinter ihr, und eine Hand fasst sie an der Schulter und zieht sie weg.
Jetzt erst fängt sie zu weinen an, aber auch der Mann, der sie weggezogen hat, kümmert sich nicht um sie. »Geh ins Haus«, sagt er, und sie geht ein Stück vom Auto weg, bleibt aber vor der Scheune stehen.
Sie schaut zu, wie der Mann in der blauen Uniform erst den Oberkörper ihres Vaters packt, ihn halb aus dem Auto holt, ihn umdreht, seine Beine ins Auto legt und die Fahrertür schließt. Dann macht er das Gleiche mit der Frau und wischt die Türgriffe mit einem Taschentuch ab. Anschließend wischt er sich die Hände ab, dreht sie nach innen und wieder nach außen. Er hat ein Feuermal an der Innenseite seiner linken Hand.
SUIZIDPAKT IN MILFORD steht riesengroß auf der ersten Seite des Donegal Reporter, als ginge es um den neuesten Hollywoodstreifen. Mary lernt gerade Lesen, aber das versteht sie nicht, und keiner will es ihr erklären, nicht ihre Mutter, nicht John-Joe, nicht Miss Rafferty in der Primary School. In ihrem Kopf schiebt Mary es zu den vielen Dingen, auf die sie sich keinen Reim machen kann oder über die sie sich keine Gedanken machen will: dass ihre Mutter immer öfter im Bett liegen bleibt und dass das ganze Zimmer nach Branntwein riecht; dass John-Joe jetzt die ganze Arbeit auf der Farm machen muss, dass ihre Mutter John-Joe jedes Mal zum Schweigen bringt, wenn er über ihren Vater reden will; dass das Bild von dem Mann, der in den Fluss schaut, auf einmal verschwunden ist; dass immer weniger Essen da ist.
Und eines Tages ist auch John-Joe verschwunden aus ihrem Leben. Er ist in einem Heim, hat ihre Mutter erzählt, da ist er besser aufgehoben. Und dann müssen auch Mary und ihre Mutter von der Farm wegziehen, in ein Council House in Milford. Und ihre Mutter trinkt immer mehr und lebt von der Sozialhilfe, und Mary schämt sich für sie und für sich selbst. Mary versucht aufzuräumen und die Flaschen zu verstecken, wenn jemand vom Sozialamt kommt. Zum Glück ist sie gut in der Schule, das ist ihre Zuflucht, darüber bestimmt sie. Ihre Welt ist der Küchentisch zu Hause, wenn sie dort alleine sitzt und ihre Hausaufgaben macht, hat sie alles im Griff. Mathe, Englisch, Gälisch, alles beherrscht sie, Bücher werden ihr Zuhause, andere Hobbys hat sie nicht.
Einmal, als sie neun ist, besucht sie mit ihrer Mutter John-Joe in seinem Heim in Sligo, und das, was sie verdrängt hat, kommt wieder hoch.
SUIZIDPAKT IN MILFORD. Ihr Vater soll Selbstmord begangen haben, zusammen mit einer anderen Frau. John-Joe weiß etwas, das er nicht sagen darf. Marys eigene Erinnerungen an den Tag werden immer verschwommener, aber sie hat noch vor Augen, wie der Polizist die Lage der Leichen geändert hat. Warum? Wer war die andere Frau? Dann kommt die Nachricht, dass John-Joe sich umgebracht hat. Wie der Vater, wird getuschelt. Liegt in der Familie. Mary kann mit niemandem darüber reden. John-Joe ist tot, und ihre Mutter schweigt.
Wenn sie groß ist, wird sie die Wahrheit herausfinden. Das Erwachsenwerden wird sie retten. Bis dahin muss sie den Kopf unten halten und ihre Kindheit hinter sich bringen. Die Schule ist der Schlüssel dazu. Sie ist die beste Schülerin in ihrer Klasse, bekommt ein Stipendium und kann mit zwölf auf die Mädchenschule in Letterkenny gehen.
Am Wochenende und in den Ferien verdient Mary Geld. Sie arbeitet im Haushalt einer reichen Familie. Aber das Geld muss sie vor ihrer Mutter verstecken, so wie diese ihre Schnapsflaschen vor ihr verstecken muss. Mary muss am Ersten jedes Monats auch immer schauen, dass sie das Geld aus ihrem Stipendium von der Bank abhebt und verbirgt, sonst versäuft es ihre Mutter. Die Dohertys, einst angesehene Bauern, sind jetzt slags, Gesocks, das Gespött ihrer Siedlung, in ganz Milford bekannt. Ihre Mutter ist eine Witzfigur. Wenn sie wieder irgendwo betrunken und vollgepinkelt herumliegt, muss Mary sie auflesen, stützen und nach Hause schaffen. Zu zweit sehen sie aus wie ein laufender Heubock. Wenn die Mutter hinfällt, zieht Mary sie mit, und für alle Welt sieht es so aus, als ob auch Mary besoffen ist. In der Pubertät wird sie ein hübsches Mädchen, im gleichen Maße, in dem ihre Mutter immer mehr vor die Hunde geht; es ist, als würde Mary ihre ganze Schönheit aufsaugen. Und ihre Mutter hasst sie dafür. Oder für etwas anderes, das Mary nicht versteht. Aber mehr noch hasst ihre Mutter, wie es scheint, sich selbst.
Einmal hält ein Auto an, als Mary ihre Mutter wieder einmal heimschleppt. Es ist ihre Französisch- und Deutschlehrerin, Miss Twomey. »Alles in Ordnung?«, fragt sie und erschrickt, als sie Mary erkennt. »Ja, ja, meiner Mutter geht es nicht gut«, sagt Mary. Miss Twomey steigt aus und hilft Mary, ihre Mutter hinten ins Auto zu hieven, dann fährt sie sie schweigend nach Hause. »Du kannst jederzeit zu mir kommen, Mary«, sagt sie, bevor sie wegfährt.
Mary muss kochen, waschen, aufräumen. Sie muss schauen, dass sie in der Schule halbwegs saubere Blusen, Röcke und Strümpfe trägt. Diese Mary Doherty ist eine Person, die sie nicht sein will.
Sie ist immer noch die beste Schülerin in ihrer Klasse. Aber Freundinnen hat sie kaum. Für die anderen Mädchen ist sie eine Streberin; Mary kann es ihrerseits nicht verstehen, warum sie für die Schule nichts tun soll. Dann würde sie dem Elend ja niemals entkommen. Miss Twomey spricht vom University College in Dublin, davon, dass Mary dort studiert und selbst Lehrerin wird. Sie würde bestimmt ein Stipendium bekommen. Dublin! Da war Mary noch nie. Sie war sowieso noch nie im Urlaub.
Mary spart und sammelt das Geld, das sie am Wochenende verdient, immer ein Pfund. Sie versteckt die Pfundscheine dort, wo ihre Mutter nie suchen würde, in ihren Schulbüchern Thinking through mathematics und Graiméar Gaeilge. Bis Mai 1971 hat sie fünfundfünfzig Pfund gespart. In diesem Jahr macht Mary ihren Schulabschluss. Sie ist erst siebzehn. Sie will Veterinärmedizin studieren und Tierärztin werden. Der Weg ins Erwachsensein ist eine breite, sichere Straße. Miss Twomey plant für die Klasse eine Abschlussfahrt nach Paris. Mary wird sich die Fahrt von ihrem ersparten Geld leisten können. Paris, dann Dublin. Das Leben wartet auf sie.
Dass sie die beste Prüfung geschrieben hat, die je eine Schülerin am Loreto Convent geschafft hat – alle sieben Fächer mit Auszeichnung –, das wird sie nie erfahren. Denn am Montag der letzten Schulwoche findet sie ihre Schulbücher im Wohnzimmer am Boden. Sie liegen aufgeschlagen da. Das Geld ist weg. Und ihre Mutter auch. Sie ist auch am Abend nicht zurück. Am Dienstag geht Mary zur Polizei. Ihre Mutter ist dort bekannt, die Polizisten wimmeln Mary ab, ihre Mutter wird schon wieder auftauchen, wenn sie nüchtern ist. Am Mittwoch steht ein Polizist an der Haustür. Ein Bauer hat die Leiche ihrer Mutter am Ufer von Mulroy Bay in der Nähe von Rough Island gefunden.
Der Weg aus dem Elend ist von einer breiten, sicheren Straße zu einem Drahtseil geschrumpft. Aber es führt noch ein Weg darüber.
Am Donnerstag, dem letzten Schultag, an dem Miss Twomey sich von der Klasse verabschieden wollte, tut Mary etwas, wofür sie sich ein Leben lang schämen wird. Sie zieht ihre Schuluniform an und packt ihre Schultasche, nicht mit Büchern, sondern mit Kleidung. Sie nimmt den frühen Bus nach Letterkenny und kommt vor 8Uhr in die Schule. Der Hausmeister hat gerade aufgeschlossen, sonst ist noch niemand da. Mary geht ins Klassenzimmer. Sie weiß, wo das Geld für die Klassenfahrt ist. In dem unteren Schrank ihres Klassenzimmers gleich rechts, wenn man in den Raum kommt, in einer Jacobs’ Biscuit Dose. Der Schrank ist nicht abgesperrt, undenkbar, dass eine Schülerin etwas stehlen würde. Aber Mary macht den Schrank auf und holt die Dose heraus. Es sind über vierhundert Pfund darin; Mary nimmt siebzig davon. Auf dem Rückweg zum Busbahnhof wirft sie ihre violette Schuljacke in eine Mülltonne. Ihr Pullover ist der einzige graue Fleck, der sich in entgegengesetzter Richtung durch ein violettes Heer schiebt. Die anderen Mitschülerinnen kommen gerade an.
Mary steigt in den Bus nach Derry und kehrt nie mehr nach Milford zurück.
Heimatliche Gefühle
Sonntag, 9.Juni 2019
1. Tag: Herzlich willkommen in Irland!
Flug von Frankfurt am Main nach Dublin. Nach der Ankunft erleben Sie die quirlige irische Hauptstadt Dublin bei einer Stadtrundfahrt. Anschließend Weiterfahrt zum Hotel nach Sligo. Sammeln Sie heute erste Eindrücke von der grünen Insel!
9:50Uhr
Unten auf der Irischen See jagen sich die Flecken von Licht und Schatten wie Kinder auf dem Spielplatz. Ihr Tanz ist aber nur ein Spiegel der Sonnenstrahlen und der zerfetzten Wolkenschichten, durch die der Flieger sinkt.
Aus einem Kabinenfenster links schaut Conni Melchior hinaus. Sie ist 34, zierlich, hat eine rote Pixie-Frisur und große Augen in einem kleinen Gesicht. Ihr Blick richtet sich weder auf das Meer noch auf den Himmel, sondern auf den linken Flügel.
Sie dreht sich nach rechts, wo ihr Freund sitzt. »Merkst du was?«, fragt sie.
»Was? Nee. Wir landen halt gleich«, sagt Tarik Kasal, 36, Deutschtürke bei der Kripo in Ansbach, ebenfalls klein, aber dunkelhaarig und breitschultrig.
Sie tippt auf das Fenster. »Die Klappen müssten doch schon längst unten sein«, sagt sie. »Wir sinken doch. Ich spür’s in den Ohren.«
»Das sagst du jedes Mal. Schau halt nicht hin«, sagt Tarik.
»So ein Schmarrn. Meinst du, die Dinge ändern sich, wenn man nicht hinschaut? Und hast du gehört, dass die Räder ausgefahren sind?«
»Jetzt, wo du es sagst: nein. So ein Pilot kann auch mal was vergessen.«
»Haha. Und wenn er es wirklich vergessen hat? Und keiner sagt was, aus Angst, sich zu blamieren? Und wenn wir alle sterben, bloß weil niemand sich blöd vorkommen wollte? Ich geh jetzt mal vor und sag Bescheid.«
»Mein Gott, Conni, bleib sitzen, warum musst du immer am Fenster sitzen, wenn du so einen Terror veranstaltest? Ich mach jetzt die Blende zu.«
Er streckt seine Hand zum Fenster, aber Conni schiebt sie zurück. »Das tust du nicht. Ich muss doch wissen, ob die alles richtig machen.«
Tariks rechte Nachbarin, eine nette Dame Mitte sechzig, schlank, elegant, weiße Haare mit blonden Strähnchen in einer frischen Bob-Frisur, lehnt sich etwas nach vorne und sagt lächelnd zu ihr hinüber: »Machen Sie sich keine Sorgen, Frau Melchior. Wissen Sie, die da vorne, die wollen schließlich auch nach Hause.« Sie heißt Ellen Rabenstein, hat grüne, wache Augen, und ihr Hochdeutsch ist von einem rheinischen Singsang unterwandert.
»Das wollten die auf der Brücke der Titanic damals sicher auch«, erwidert Conni. »Bloß geholfen hat’s nix.« Conni ist Deutsch- und Englischlehrerin am Gymnasium in Burgsteinach, Mittelfranken, und seit letztem Jahr Leiterin der Volkshochschule dort.
Vom Gang gegenüber mischen sich zwei Damen ins Gespräch ein. Sie sind gut zehn Jahre älter als Frau Rabenstein, einmal schwarz, einmal brünett, jeweils übertriebene Versionen ihrer früheren Haarfarben, die Dauerwellen mit viel Haarspray fixiert. »Runter kommen sie immer, Frau Melchior«, sagt die Schwarzhaarige, Grete Eberlein, die früher den Rewe-Markt in Burgsteinach geführt hat. Ihre brünette Nachbarin ist Hilde Ermel, ehemalige Sekretärin der Volkshochschule Burgsteinach. Sie sind Schwestern und beide seit einigen Jahren verwitwet.
»Das meint sie nicht so, Frau Melchior«, sagt Hilde. Sie ist einundachtzig, zwei Jahre älter als Grete, hat aber nie das Gefühl aus ihrer Kindheit ablegen können, auf Grete aufzupassen und dafür sorgen zu müssen, dass die Welt sie mit dem richtigen Blick betrachtet. »Flugzeuge sind das sicherste Transportmittel. Wird schon gut gehen.«
»Und das haben die Passagiere auf der Titanic damals bestimmt auch gedacht«, sagt Conni.
»Am liebsten würde Conni das Flugzeug selber fliegen«, erklärt Tarik der wachsenden Zuhörerschaft.
»Stimmt doch gar nicht, du Blödmann«, flüstert Conni. »Die sollen’s bloß gescheit machen.«
»Mensch, kannst du nicht einfach meine Hand nehmen, wenn du Angst hast? Wie andere Frauen auch?«, flüstert Tarik zurück.
Zwischen den Kopfstützen vor ihnen erscheinen zwei freundlich blinzelnde, mit schwarzem Kajal geschminkte Augen in einem Kopf mit stoppelig rasiertem Schädel links und einer gelben Tolle, die kunstvoll über die rechte Seite drapiert ist. »Der Pilot macht einen Low-Power-Approach, keinen Standard-Approach. Alles ganz normal, Frau Melchior«, sagt eine angenehm sonore Stimme. Sie gehört Thorsten Weck vom Weckruf, dem Telefonladen in der Hauptstraße von Burgsteinach.
Die Tolle macht einem kurz geschorenen Schädel Platz, dessen ebenfalls freundlicher Besitzer Adrian Loy sagt: »Wir sind Hobbyflieger, wissen Sie. Der Low-Power-Approach spart Sprit und ist umweltfreundlich.« Er ist fünfzehn Jahre älter als Thorsten, Vermögensberater bei der Castell-Bank, hat Lachfalten um die warmen braunen Augen und trägt eine Nickelbrille.
»Siehst du, Conni«, sagt Tarik. »Umweltfreundlich.«
Conni hat aber eine Aversion gegen Totschlagargumente, Zurechtweisungen und Belehrungen von Männern, egal, wie freundlich oder wohlmeinend sie vorgebracht werden, außerdem ist sie immer noch sauer auf Tarik. »Was heißt schon Umwelt?«, sagt sie, laut genug, dass alle um sie herum es hören. »Für mich, für meinen Verstand, für meine Seele, ist erst einmal mein Körper die Umwelt. Wir sind erst einmal alle unsere Umwelt. Wir Menschen sind uns die wichtigste Umwelt überhaupt. Sollen die 200Menschen hier drinnen wegen der anderen Umwelt da draußen draufgehen?«
»Gut gesprochen«, ertönt es energisch vom Fensterplatz auf der gegenüberliegenden Seite. Dort sitzt ein dünner älterer Herr mit Gesichtszügen wie ein Raubvogel, die Wangen silbrig schimmernd, weil schlecht rasiert. Dass er jemals den zu groß geratenen Lodenmantel ausgefüllt hat, in den er gewickelt ist, scheint unvorstellbar. Er ist Dr. Wollmuth, ehemaliger Chef von Conni am Gymnasium, seit fünf Jahren in Pension. »Dominium terrae!«, fügt er hinzu und hebt einen Zeigefinger.
»Und überhaupt«, flüstert Conni, »was meinst du mit ›wie andere Frauen auch‹? Welche Frauen nehmen denn deine Hand?«
»Mensch, Conni«, flüstert Tarik zurück. »Das habe ich doch bloß so gesagt.«
»Die blöde Michelle hat bestimmt deine Hand genommen und mit ihren Tussi-Glupschaugen geflattert.«
»Oh Gott, geht das wieder los.«
Eine Stewardess kommt von vorne und sammelt die Trinkbecher ein.
»Sagen Sie bitte dem Piloten, es wird Zeit, dass er die Flügelklappen und das Fahrwerk ausfährt«, sagt Conni.
»Mache ich«, sagt die Stewardess, nickt, und geht unbeirrt weiter nach hinten.
Alle sind sie Teilnehmer einer Volkshochschul-Reisegruppe aus Burgsteinach, insgesamt 19Leute, die im hinteren Teil des Airbus A320 willkürlich verstreut sitzen. Fast alle sind aus Burgsteinach und Umgebung. Sie gehören zu verschiedenen Kreisen, mathematisch gesehen zu verschiedenen Mengen – Kirche, TSV, Gesangsverein, Schwimmverein, Schule, Samstagvormittagseinkaufsbegegnungen – und kennen sich aus ihren Schnittmengen.
»Meine Damen und Herren, wir befinden uns nun im Sinkflug, bitte setzen Sie sich auf Ihren Sitz, legen Sie den Sicherheitsgurt an und schalten Sie alle elektronischen Geräte aus, bis die endgültige Parkposition erreicht ist.«
Es rumpelt, und die Klappen an den Flügeln gehen nach unten.
»Na endlich«, sagt Conni.
»Dich wenn sie nicht hätten«, sagt Tarik.
»Wenn man nicht alles selber macht«, sagt Frau Rabenstein. »Stimmt’s, Frau Melchior?«
Um Conni herum kommen aus verschiedenen Ecken leise Lacher; sie selbst lacht etwas zeitversetzt mit.
»Macht euch nur lustig«, sagt sie. »Jetzt stellt euch vor, die machen das alles nicht korrekt, und wir stürzen ab, da ärgert man sich dann, dass man nichts gesagt hat.«
In Puerto Rico ist es 5Uhr früh. Seit Beginn der Wetteraufzeichnungen hat es hier noch nie so viel geregnet wie in den letzten vierundzwanzig Stunden. Über 500mm an einem Tag markiert die Wetterstation auf dem Gelände des Caribbean Paradise Hotels in Patillas. Dahin ist Roselyn Boscana mit ihrem Nissan Micra unterwegs, um die Morgenschicht in der Küche anzufangen. Sie beugt sich vorne über das Lenkrad, um besser sehen zu können. Auf ihrer linken Seite ist der Rio Marin auf sieben Meter angestiegen, ein noch nicht gesättigtes, vom Regen gefüttertes Riesentier, das über seinen Käfig hinausgewachsen ist und schon Pfützen auf die Straße wirft. Es ist noch dunkel, und die Scheibenwischer ihres Autos schaffen es kaum, die Frontscheibe vom Regen freizumachen. Das ist gerade genauso nützlich, wie in der Dusche eine Brille mit Scheibenwischern zu tragen, denkt sie. Es ist ihr letzter Gedanke, weil sich auf einmal eine Linkskurve auftut, die noch nie auf der Strecke war. Bis Roselyn klar wird, dass es ein ganzer Hang ist, der sich verselbstständigt hat und als Schlammlawine auf sie zurast, ist es zu spät. Ihr Auto und sie werden in den Fluss gerissen.
Ursache ist der tropische Sturm Kyle, der sich vor zehn Tagen an der Westküste Afrikas gebildet hat. Bis er weiter nach Norden zieht, werden noch fünf Menschen in Schlammlawinen umkommen. Solche tropischen Stürme hinterlassen eine Schneise der Verwüstung auf dem amerikanischen Festland, bis ihnen die Kraft ausgeht und sie sich auflösen. Das wird Kyle nicht tun. Er wird bei New Jersey auf ein Tiefdruckgebiet aus der Arktis treffen, und mit vereinten Kräften werden sie in einem wilden Derwisch-Wirbel über den Atlantik nach Irland ziehen. Aber das kann zu diesem Zeitpunkt noch kein Mensch voraussagen.
Eine Reihe vor Thorsten Weck und Adrian Loy sieht Michael Lynas, 66, durch sein Bordfenster die irische Küste herangleiten. Er ist der Reiseleiter der Gruppe aus Burgsteinach, in Nordirland geboren und aufgewachsen, lebt aber seit fünfundvierzig Jahren in Franken. Er ist groß und hat ein kantiges Gesicht wie ein unbehauener Brocken, dessen Botschaft ein Steinmetz erst herausmeißeln müsste. Im Ruhezustand scheint es aus dem Gleichgewicht geraten, wegen der zur Mitte hin aufsteigenden Augenbrauen, die Michael einen Ausdruck des Dauerstaunens über die Welt und ihre Eigenarten verleiht. Erst wenn er lacht, wenn sein Mund den Bogen seiner Augenbrauen widerspiegelt, wirkt sein Gesicht vollendet, seiner wahren Bestimmung zugeführt. Aber das kann manchmal dauern. Er hat noch volle dunkle Haare, altmodisch geschnitten und nach vorne gekämmt; seine Frau Andrea wollte ihm immer eine andere Frisur verpassen, nach hinten gekämmt oder lang oder dauergewellt, aber die Frisuren saßen alle auf ihm wie ein Tier, das sich nicht wohlfühlt, und bei der ersten Gelegenheit Reißaus nehmen wird.
Es ist die elfte Studienreise nach Irland, die er vorbereitet und als Reiseleiter geführt hat, und er war auch oft privat im Urlaub hier, unzählige Male hat er die Szenerie im Landeanflug nun schon vor sich gesehen: den langen, glitzernden Strand von Portmarnock, den Hügel von Howth und die Bucht dazwischen. Das Flugzeug dreht sich, und das Festland kippt nach rechts oben weg, das blaue Meer und der kleine grüne Fleck von der Insel Ireland’s Eye schieben sich erneut in Michaels Blickwinkel. Dann schiebt sich die Landschaft wieder ins Lot, dem Flieger entgegen.
Unten eilt der Schatten des Airbus der Maschine voraus; wie ein Pfeil zieht er über das Meer, das jetzt, aus der Nähe betrachtet und vom Wind geriffelt, wie die Haut eines alten Mannes aussieht, zieht über den Sandstreifen und weiter zu den grünen Feldern dahinter. Dann ist der Flieger auch schon über dem Land.
Die Landschaft unter ihnen erscheint, wie vorher das Meer, wie ein Patchwork von Schatten und Licht, ein Palimpsest, dem hauptsächlich die letzten Jahrhunderte ihr Gepräge verliehen haben. Die ältesten Spuren sind verwischt oder ganz ausradiert. Reißbrettentworfene Siedlungen und Blasen von Autoparkplätzen und Friedhöfen schieben sich in die Willkür von heckenumzäunten Äckern; hingegossene Autobahnen und modellierte Verkehrsinseln umklammern verstreute Farmhäuser.
»Na?«, fragt sein Sitznachbar und nickt ihm aufmunternd zu. »Heimatliche Gefühle?« Es ist Christian Paulus, Bürgermeister von Burgsteinach, ehemaliger Chefverkäufer bei VW-Schumann im Ort. Er ist bei der SPD, einmal geschieden und mit seiner jetzigen Partnerin nicht verheiratet, drei Umstände, die vor fünfundvierzig Jahren, als Michael das erste Mal nach Burgsteinach kam, unvorstellbar gewesen wären. Er hat kurze graue Haare, einen Dreitagebart, ebenfalls grau, ist groß und sportlich, sieht in den Jacken und Krawatten, die er als Bürgermeister tragen muss, immer leicht deplatziert aus. Seine Partnerin, Melanie Huprich, Physiotherapeutin mit blondem Zopf, ist nicht minder sportlich. Bei einem Autoverkaufsgespräch haben sie sich kennengelernt und sich daraufhin von ihren damaligen Partnern getrennt. Diese waren sich ebenfalls sympathisch und kamen kurz darauf zusammen; sie sind auch bei der Reise dabei und sitzen weiter vorne.
Für Dublin hat Michael keine heimatlichen Gefühle, er mag die Stadt gerne und kennt sie gut, aber einmal, das erste Mal, als er dort war, fühlte er sich in ihr so fremd wie sonst selten auf der Welt, und das hat er nicht vergessen. Heimatliche Gefühle hat Michael auch sonst auf seinen Irlandreisen nicht gehabt, weil er, seitdem er aus seiner nordirischen Heimat geflüchtet ist, nie mehr dort war. Alle Studienreisen führten bislang in den Süden oder Westen, und wenn Michael mit seiner Frau Andrea in Irland Urlaub gemacht hat, dann auch nur dort. Die nördlichste Region, die er mit Andrea besuchte, war Slieve League im Süden Donegals, weit weg von der Gegend, in der er als Kind und Jugendlicher die Sommerferien verbracht hatte.
»Nicht wirklich«, antwortet er.
»Kommt noch«, sagt der Bürgermeister.
»Klar«, sagt Michael.
Dies ist die erste Studienreise nach Nordirland, die er begleitet. Heimatliche Gefühle, wird er sie haben? Ein vage erinnerter Zitatfetzen aus seinem Germanistikstudium flattert in seinen Kopf wie früher auf dem Gehsteig in seinem Heimatort Kilmartin eine leere Fish-and-Chips-Tüte um den Fuß. Heimat, darin war noch keiner. Darüber hat er damals einen Aufsatz schreiben müssen. Dass niemand je in seiner Heimat war, diesen Gedanken hatte er im Frühjahr 1974 noch weit von sich gewiesen. Er wusste genau, wo seine Heimat war. In Kilmartin. Es war der letzte Aufsatz, den er an der Uni schrieb. Und zwei Wochen später wusste er tatsächlich nicht mehr, wo seine Heimat war.
Unter ihnen erscheint die graue Rollbahn, und der Flieger setzt auf, erst links, dann rechts, dann vorne.
Spätestens jetzt hätte Andrea nach meiner Hand gegriffen, denkt Michael.
10:20Uhr
Die Reisegruppe aus Burgsteinach hat sich wieder zusammengefunden und ist auf dem Weg durch den Dubliner Flughafen zur Gepäckausgabe, Michael läuft voraus. Seltsam, denkt er, wie unterschiedlich einem so ein Flughafen vorkommen kann, je nachdem, ob man ankommt oder abfliegt, obwohl es die gleichen Gänge, Rolltreppen, Rollwege und Räume sind; alles kommt einem neu vor. Es ist wie ein Vorgeschmack auf die Demenz.
»Michael!«, hallt es von hinten. »Warte mal! Du mit deinen langen Beinen, du bist schon wieder zu schnell.«
Es ist Betty Scheuerlein, Besitzerin von Bettys Beauty Salon in der Hauptstraße von Burgsteinach, einem Friseurladen, und zusammen mit ihrem Mann Stammmitreisende bei Michaels Reisen.
Michael bleibt stehen.
»Du musst fei daran denken bei den Wanderungen, dass du nicht so davonsaust«, sagt Betty, als sie ihn einholt. »Da sind viele Ältere dabei.«
»Alles klar, Betty«, sagt Michael, »Dafür habe ich ja dich.«
Betty strahlt und läuft weiter neben ihm her.
Er kann Betty gut leiden. Strahlen ist ihr natürlicher Gesichtsausdruck, zu ihrem breiten Kiefer gehört ein breites Lächeln, und wenn sie nicht strahlt, muss sie ihre Züge bändigen, die Winkel ihres Mundes zurückpfeifen wie ein Schäfer seine Schafe. Sie ist seine Friseurin; sie hat alle Versuche seiner Frau, seine Haare anders zu gestalten, mitgetragen, und sie auch alle wieder rückgängig gemacht.
»Na, heimatliche Gefühle?«, fragt sie.
»Noch nicht so.«
»Kommt noch«, sagt sie.
»Ja, bestimmt. Wenn wir erst einmal draußen sind.«
Sie steuern auf ein Gepäckkarussell im Bauch des Flughafens zu, das überall auf der Welt sein könnte. Das erstarrte Förderband windet sich um die metallene Anlage wie eine eingeschlafene Schlange, seine Lamellen wie Schuppen. Michael stellt sich in die Mitte, direkt vor den Schacht, der das Gepäck von unten auf das Band befördert. Die anderen Reisenden gesellen sich traubenförmig dazu.
»Wie rum läuft denn das Band?«, fragt Heinz Scheuerlein, Bettys Mann, Fahrlehrer, ein Quadrat von einem Mann mit Mecki-Frisur, dem man seine ehemalige Flinkheit als Stürmer bei Burgsteinachs Fußballverein nicht mehr ansieht. Er und seine Frau Betty sind so etwas wie ein Stimmungsbarometer für Burgsteinach; wenn man wissen will, wie Burgsteinach über etwas denkt, muss man nur sie fragen. »Ich meine, soll man sich links oder rechts von der Ausgabe hinstellen?«, schiebt Heinz nach.
»Die Förderbänder bewegen sich immer im Uhrzeigersinn«, sagt Dr.Wollmuth, hochgewachsen, aber dünn und gebückt; von der Seite wie ein laufendes Fragezeichen. Er war Latein- und Religionslehrer, katholisch, und somit nach Ansicht des bayerischen Kultusministeriums offenbar bestens gerüstet, um seine Schule in die Zukunft zu führen. »Das ist auf der ganzen Welt so. Dextrorsum«, schiebt er nach und macht eine ausladende, kreisende Handbewegung, sodass seine Frau einen Schritt nach hinten gehen muss. Sie ist kleiner, mit zwei großen Wölbungen an der Hüfte und am Busen, satzzeichenmäßig gesehen ein Doppelpunkt zu seinem Fragezeichen.
Michael vernimmt ein leises Stöhnen von der rechten Seite. Es kommt von Conni Melchior. »Wenn das so weitergeht, halte ich es nicht aus«, flüstert sie ihm zu. »Versprich mir, dass wir beim Abendessen nicht neben dem sitzen müssen.«
»Hatten die Römer schon Uhren?«, fragt Tarik in die Runde. »Wäre mir neu. Sonnenuhren höchstens.« Er wippt auf seinen Fußspitzen auf und ab, vielleicht, um an Höhe zu gewinnen.
»Freilich hatten die welche«, sagt Heinz. »Schau her. Solche.« Er zeigt Tarik seine Armbanduhr mit römischen Ziffern.
»Ach jaaa«, sagt Tarik. »Klar. Mit V und X und so. Wie spät ist es denn? Ah, genau, zwei Minuten nach X.«
Alle lachen, selbst Dr.Wollmuth, wenn auch etwas gequält.
»Aber Förderbänder haben die Römer bestimmt nicht gehabt«, sagt Tarik.
»Natürlich nicht«, sagt Heinz. »Da haben Sklaven das Gepäck vom Flugzeug geholt.«
»Türken wahrscheinlich«, sagt Tarik.
»In Dubai läuft das Band gegen den Uhrzeigersinn«, sagt Günther Imrich. Er hat früher als Vertreter für Siemens gearbeitet, verfügt über das entsprechend eingeübte Lächeln und den verbindlichen Gesichtsausdruck, trägt nach hinten gekämmte weiße Haare und sieht aus wie ein in die Jahre gekommener Schlagerstar aus den 50ern. Er ist trotzdem nett. Seine Frau Petra ist ebenfalls nett, oft knapp am guten Geschmack vorbei gekleidet, so wie heute mit einer Leopardenlegging und einem rot-grün gestreiften Minirock darüber. Beide Imrichs sind braun gebrannt, mehr, als sie es vom Skiurlaub her sein dürften. Sie waren früher die Ehepartner von Christian und Melanie. Das Ganze schlug vor fünfzehn Jahren Wellen in Burgsteinach, die aber inzwischen verebbt sind. »So eine Gepäckanlage habt ihr noch nicht gesehen«, fährt Günther fort. »Wie eine riesige Eisenbahnanlage. Ich habe mich links vor die Ausgabe hingestellt und musste ewig warten, bis das Gepäck ganz herum gekommen ist.«
Ratlosigkeit macht sich breit. Die Gruppe verteilt sich in ungefähr gleich großen Teilen links und rechts von der Ausgabe. Das Band steht weiter still.
»Vielleicht ist es wie mit dem Wasser im Abfluss«, sagt Horst Haslbeck, Elektriker, ehemaliger Fußballer in Burgsteinachs legendärer, einst erfolgreicher erster Mannschaft, Günter-Netzer-Frisur, offenes fränkisches Gesicht, in dem man wie in einem Buch lesen kann, Lachfalten um die Augen. Seinerzeit schaffte die Mannschaft den Aufstieg in die Bezirksliga. Heinz Scheuerlein war damals im Sturm dabei, er links und Horst rechts. Sie hatten eine intuitive Beziehung, haben genau gewusst, wo der andere auf dem Spielfeld ist, ohne hinschauen zu müssen, konnten die Pässe dorthin spielen, wo sie wussten, dass der andere sein würde. Auch heute noch sind sie ein eingespieltes Team. »Dass die Förderbänder auf der Nordhalbkugel gegen den Uhrzeigersinn laufen und in der Südhalbkugel im Uhrzeigersinn«, sagt er. »Oder halt andersrum.«
Alle betrachten das regungslose Band noch eine Weile, dann sagt Tarik: »Ich glaub, das Ding ist kaputt. Du wirst nachschauen müssen, Horst.« Er deutet auf das Loch. »Steig rein, ich halte dir die Füße.«
Die Gruppe lacht. Sie kennen Horst in seiner Funktion als Allesreparierer. Er hat das letzte Elektrogeschäft in der Gegend, das nicht zu einem Großunternehmen gehört. Der Beruf, den er bei seinem Vater gelernt hat, hat sich im Laufe seiner Lebenszeit virusartig verästelt. Noch bringt er alles unter einen Hut; seine drahtige Silhouette kann man auf Burgsteinachs Dachfirsten bei allen Wetterlagen balancieren sehen, wenn er Satellitenschüsseln einrichtet. Die Burgsteinacher sehen ihn auch in ihren Gassen, wenn er eine Waschmaschine auf einer Sackkarre liefert oder zum Reparieren abholt, oder in ihren Arbeitszimmern, wie er vor einem defekten PC sitzt und Gott um Beistand bittet.
Es rumpelt in der Tiefe der Gepäckanlage.
»Es geht los«, sagt Dr.Wollmuth. »Incipit.«
»Gott«, stöhnt Conni leise. »Er glaubt tatsächlich, erst, wenn er etwas kommentiert hat, darf es auch wirklich passieren. Tarik, wenn ich so werde, musst du mir es gleich sagen.«
»Okay«, sagt Tarik. »Du wirst so.«
»Depp.«
Das Förderband setzt sich mit einem Ruck in Bewegung, als hätte es sich plötzlich seinen Zweck vergegenwärtigt. Gegen den Uhrzeigersinn. Die Leute, die sich links aufgestellt hatten, versuchen jetzt, rechts einen Platz zu finden. Dr.Wollmuth bleibt stur stehen.
»Ti-hi«, sagt Conni.
Es ist immer wieder erstaunlich, wie leicht es ist, Menschen eine Freude zu machen. Man muss ihnen nur am Gepäckförderband ihre Koffer wiedergeben. Die Anspannung, die vorher spürbar war, löst sich auf, und es herrscht eitel Sonnenschein.
Ein knallpinker Koffer rumpelt aus dem Schacht, mit einer baumelnden Gummifigur am Griff. Die Figur trägt einen roten Parka und hat blonde Wuschelhaare. Ist in der Gruppe ein Donald-Trump-Anhänger? Nein, jetzt sieht man auch die Gitarre und eine riesige Sonnenbrille an dem Männchen. Heino, klar.
Conni holt den Koffer herunter, Applaus brandet auf.
»Ist ironisch gemeint«, sagt Tarik. »Der Koffer. Glaub ich wenigstens.«
»Hab ich von meiner Klasse geschenkt bekommen«, sagt Conni verlegen. »Wir haben ein Projekt über den deutschen Schlager gemacht. Und so finde ich meinen Koffer wenigstens immer wieder.«
»Das sagen sie alle«, sagt Horst.
»He, Tarik, weißt du, wie die türkische Fluglinie heißt?«, fragt Heinz. »Döner Hebab. Verstehst? Döner heb-ab.«
»Der ist gut«, sagt Horst.
»Stimmt gar nicht«, sagt Tarik. »Sie heißt Air Doan.«
Heinz schaut verständnislos.
»Air-Doan«, wiederholt Tarik betont langsam.
»So heißt doch der Präsident«, sagt Heinz.
»Man muss es geschrieben sehen«, sagt Conni. »Air, wie in Air Berlin.«
»Ach so«, sagt Heinz, nickt ernsthaft, und lacht dann plötzlich.
Dann kommt ein Koffer mit einer orangefarbenen Schleife. Michael holt ihn vom Band und stellt ihn ab, dabei schießen ihm unvermittelt Tränen in die Augen. Er wischt sie mit einem Taschentuch ab.
»Alles okay?«, fragt Tarik leise.
»Geht schon wieder«, sagt Michael. »Es war nur die Schleife. Andrea hat sie festgebunden. Immer waren es zwei Koffer, seit vierzig Jahren, und jetzt ist es nur noch einer.«
»Ist doch normal«, sagt Conni. »Wie lange ist es jetzt her?«
»Nächste Woche werden es zwei Jahre.«
»Und du bist seitdem nicht mehr mit einem Koffer verreist?«
»Nein. Ich hab mir gedacht, jetzt muss es gehen. Und es geht auch. Ich war nur überrumpelt.«
»Deiner Frau verdanke ich viel«, sagt Tarik. »Sie war meine Lehrerin, damals in der vierten Klasse. Wenn sie nicht mit meinen Eltern geredet hätte, wäre ich nicht auf die Realschule gegangen und hätte nicht Polizist werden können. Na ja, zuerst war ich auf dem Gymnasium. Ist nicht gut gegangen. Wegen eines bestimmten Lehrers.«
Durch die Ankunftshalle zieht eine Flotte Burgsteinacher Trolleys und Rollkoffer hinaus auf den Zebrastreifen, eine Windböe kommt von rechts, so heftig, dass alle kurz nach links abdriften wie Segelschiffe im Sturm. Dann noch ein Regenschauer, unberechenbar die Richtung wechselnd wie aus einem losgerissenen Wasserschlauch.
»Ist das hier immer so?«, fragt Tarik.
»Nicht immer«, sagt Michael. »Nur meistens.«
Der Zebrastreifen führt die Gruppe in das Parkhaus gegenüber von Terminal 1.
»Hört ihr’s?«, fragt Horst. »Das hat es vor dreißig Jahren nicht gegeben. Das Geräusch von Rollkoffern.«
Es hallt laut, verstärkt von Betonwänden und -decken.
»Stimmt«, sagt Tarik. »Am schlimmsten ist es in Venedig. Du sitzt im November, wo es noch warm ist und die meisten Touristen weg sind, abends bei einem Aperol Spritz in einer Seitengasse am Kanal, und da kommt es um die Ecke, rrrrrrrrrrr.«
»Wisst ihr, wer den Rollkoffer erfunden hat?«, fragt Dr. Wollmuth.
»Klar«, sagt Tarik. »Die Römer. Die Türken auf jeden Fall nicht.«
»Aber den Dachkoffer habt ihr erfunden«, sagt Heinz.
»Die Römer waren’s nicht«, sagt Horst. »Sonst hätte der Hannibal doch keine Elefanten gebraucht.«
»Der Hannibal war gar kein Römer«, sagt Tarik. »Der war Karthager.«
»Genau«, sagt Dr.Wollmuth. »Ceterum censeo Carthaginem esse delendam.«
»In Latein war ich nie gut«, sagt Tarik. »Wissen Sie’s noch, Dr.Wollmuth?«
»Also, wer war’s?«, fragt Heinz. »Ein Ami?«
»Eben nicht«, sagt Dr.Wollmuth. »Mit fast hundertprozentiger Sicherheit ein Deutscher. Im neunzehnten Jahrhundert. Wie auch der erste bemannte Flug von einem Deutschen unternommen wurde. Aber die Amis haben schon immer alles verschleiert und an sich gerissen.«
»Genau«, sagt Tarik. »Uns haben sie doch immer beschissen.«