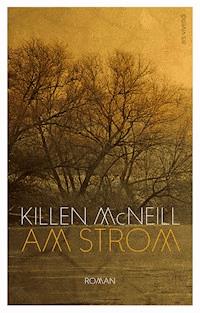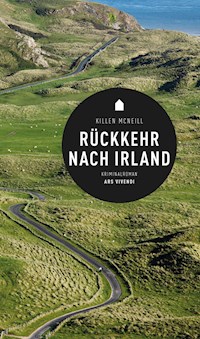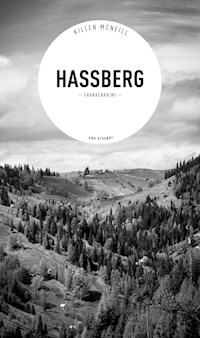Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ars vivendi Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Killen McNeills Epos um eine junge Frau in den Wirren der letzten Tage des Zweiten Weltkriegs in der fränkischen Provinz - Fränkische Geschichte, hautnah erzählt Die junge Lore, in der Bombennacht vom 2. Januar 1945 Vollwaise geworden, flieht aus Nürnberg in das idyllische Dorf Seilar. Dort trifft sie den Hitlerjungen Anton wieder, in den sie sich im letzten Sommer als Erntehelferin verliebt hat. Mit ihm erlebt sie die letzten, schrecklichen Tage des Krieges. Anton soll im Volkssturm Seilar verteidigen, will aber den Einsatz vereiteln, damit das Dorf vor dem Angriff der Amerikaner verschont bleibt. Doch in der Burg, die über Seilar thront, hält sich ein SS-Verband auf, der gnadenlos Vergeltung für Verräter ausübt. 75 Jahre später, bei einer Gedenkfeier für die Kriegsopfer, kommen Lore Zweifel, ob der Untergang des Dorfes tatsächlich so abgelaufen ist, wie es in den Reden geschildert wird. Es beginnt ein Wettlauf mit den eigenen letzten Tagen, um herauszufinden, ob ihr Leben auf eine Lüge gebaut war ..
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 303
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Killen McNeill
Lore und die letzten Tage
Vollständige eBook-Ausgabeder im ars vivendi verlag erschienenen
Originalausgabe (1. Auflage November 2023)
© 2023 by ars vivendi verlag
GmbH & Co. KG, Bauhof 1,
90556 Cadolzburg
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
www.arsvivendi.com
eISBN 978-3-7472-0525-9
In dieser Zeit größter historischer Beschleunigung im Übergang vom Krieg zum Frieden erfuhr auch das Erleben der Menschen eine Verdichtung wie selten zuvor und selten danach.
Klaus-Dietmar Henke
NNMH
Inhalt
Prolog
Erster Teil
Seilar
Bei den Waigandts
Anton
Sophie
Erste Liebe
Letzte Tage in Seilar
Die Einladung
Lores Elend
Zweiter Teil
Rückkehr nach Seilar
Wiedersehen mit Anton
Schlechte Tage und die schönste Zeit
Besuch im Schloss
Kolberg
Nicht tragfähig
Kitzingen geht unter
Die schönste Nacht
Der Frühling
Das Komplott
12. April 1945
Danach
Samstag, 10. September 2022
11. September 2022
Mein Dank geht an
Quellen
Anmerkungen des Autors
Ein Geheimnis aus den letzten Tagen des Krieges in der fränkischen Provinz
Prolog
2022
»Ach, Mama, du kannst doch gar nicht mitreden«, sagt Evi. »Du hast die Liebe doch nie erlebt.« Sie huscht durch die Küche, unruhig wie eine Amsel auf Futtersuche, hebt Dinge hoch, betrachtet sie neugierig von allen Seiten und legt sie wieder beiseite: das Rindenbild vom Königssee, die Chianti-Korbflasche vom Wochenmarkt in Meran, den Zinnteller vom Plönlein in Rothenburg.
Dabei kennt sie alles hier aus ihrer Kindheit. In diesem Haus, das Franz Jungkunz, ihr Vater, in den Fünfzigerjahren in der ersten Nachkriegssiedlung in Neustadt gebaut hat, ist sie mit ihren zwei älteren Brüdern Heinz und Klaus aufgewachsen, und seitdem hat sich fast nichts verändert: Linoleumfußboden aus schwarz-weißen Quadraten, Küchenbüfett mit geriffelten Vorhängen, Tisch mit Resopaloberfläche.
In ihrem Sessel am Küchentisch neben dem Herd sitzt ihre Mutter Lore. Sie ist zu besorgt wegen Evis Streifzug, darüber, was alles in die Brüche gehen könnte, um über ihre Behauptungen nachdenken zu können. Das hebt sie sich für später auf. Gerade hält Evi ein Modell vom alten Pyramidenkogel am Wörthersee in der Hand, das ihr Vater nach dem ersten Kärntenurlaub 1963 aus Streichhölzern gebastelt hat. Lore zieht zischend die Luft ein und hält sie an. Evi hat das Modell schon heruntergeschmissen, als sie fünf Jahre alt war, und Lore musste es notdürftig zusammenleimen, um den Zorn des Vaters auf seine Tochter abzufangen. Evi setzt das Modell wieder ab, wenn auch rechts auf dem Büfett statt links, und Lore atmet auf. Evi geht weiter zum Fenster, das zum Garten hinausschaut. Dort nimmt sie das gerahmte Hochzeitsfoto ihrer Eltern aus dem Jahre 1951 vom Fenstersims.
Lore seufzt. Wenn Evi weg ist, wird sie alles wieder auf den richtigen Platz stellen müssen. Evi war schon als Kind voller Unrast. Bei ihren Besuchen macht sie normalerweise gerne Vorschläge, wie das alte Haus auf Vordermann zu bringen sei. Aber es ist alles noch völlig in Ordnung und von Lore immer sauber gehalten worden. Warum das Alte wegwerfen, wenn es noch gut ist? Und jetzt rentiert es sich auch nicht mehr. Lore wird in diesem Jahr zweiundneunzig, und Franz ist vierundneunzig.
Heute aber treibt Evi etwas anderes um. Gerade hat sie ihrer Mutter erklärt, dass sie ihren Mann Theo verlassen will, nach fast vierzig Jahren Ehe. Und jetzt mustert Evi das Hochzeitsbild von Lore und Franz mit verengten Augen, nickt bestätigend und klopft mit dem Zeigefinger darauf. »Das da«, sagt sie, »das war keine Liebe.«
Wenn Evi so ist, weiß Lore nicht, wie sie mit ihr umgehen soll, was sie ihr antworten soll, ist ihr hilflos ausgeliefert. Evi hat sie schon immer überfordert, sie war ein Nachzügler, acht Jahre jünger als Klaus. Wo hat Evi sie nur her, diese Unruhe, diese Hast, dieses Alles-infrage-Stellen? Nicht von Lore, und auch nicht von Franz. Wenn sie es nicht genau wüsste, könnte Lore denken, Evi wäre gar nicht ihr Kind. Später, wenn Evi fort ist, werden Lore beim Aufräumen die Antworten kommen, die sie jetzt braucht.
»Wieso?«, fragt Lore nur, und, weil ihr nichts Besseres einfällt: »Es hat doch immer alles gepasst.«
Evi stellt das Foto weg, auf den Küchenschrank statt auf das Fensterbrett, und setzt sich Lore gegenüber an den Küchentisch. Sie verschränkt die Arme auf der Tischplatte, dann stützt sie ihr Kinn in beide Hände und schaut ihre Mutter an. »Alles gepasst, alles gepasst«, sagt sie. »Und was sollen die Leute denken, und das gehört sich nicht. Das sind deine Themen. Aber das ist doch nicht alles. Immer an andere denken statt an sich selbst, das habe ich von dir gelernt. Aber unsere Kinder sind schon längst aus dem Haus und haben selber Familie. Und ich bin sechzig. Jetzt denke ich endlich an mich. Vielleicht hättest du das auch viel früher machen sollen.«
Lore betrachtet ihre Tochter und sieht sich selbst vor dreißig Jahren; das trapezförmige Gesicht, die ausgeprägten Wangenknochen, und die nach oben gewölbten Augen, die den entschlossenen Eindruck der Kieferpartie abmildern. Jetzt, wenn Lore sich im Spiegel anschaut, ist die Knochenstruktur noch zu erkennen, aber die Haut ist von tiefen Furchen durchzogen. Wie der ungeteerte Marktplatz von Seilar früher, nach Regen, wenn mehrere Ochsengespanne aus verschiedenen Richtungen Brennholz gebracht haben, denkt sie beim Betrachten ihres Spiegelbildes. Oder als die Amipanzer durchgefahren sind, damals, in der Zeit nach der Katastrophe.
Woran hatten ihn damals ihre Augen erinnert? An Mandarinenscheiben. Das war Weihnachten 44 gewesen. Sonst hat man ja keine Mandarinen gesehen. Er hat es in einem Brief geschrieben, in der Zwischenzeit, als sie getrennt waren.
»Warum lachst du, Mama?«, sagt Evi. »Hörst du mir überhaupt zu?«
»Ja, ja, Kind. Mir ist nur etwas eingefallen.«
»Bitte, Mama, nenn mich nicht Kind! Wie oft soll ich es noch sagen.« Evi schüttelt den Kopf, als hätte ihre Mutter sie aus dem Konzept gebracht. »Was wollte ich noch sagen? Ach ja. Alles gepasst. Ihr habt gedacht, der Theo passt, und der Stefan passt nicht. Ihr habt mich zur Ehe mit Theo überredet, obwohl ich damals schon in Stefan verliebt war. Aber Theo war angehender Zahnarzt und Stefan bloß ein Schreiner. Und jetzt ist Stefans Frau vor zwei Jahren gestorben, und wir haben uns getroffen, und er hat gesagt, dass er nie aufgehört hat, mich zu lieben, und bei mir ist es auch so, und die Chance lasse ich mir nicht noch einmal nehmen. Ich will nicht so enden wie du.«
Eine Frage drängt sich Lore auf, und sie stellt sie, bevor sie nachdenken kann, bevor Evis Worte wirken. »Schneidet Stefan auch bei uns die Hecke?«
Evi hält den Kopf ganz still und schaut Lore mit geweiteten Augen an. »Ist das wieder deine berühmte Ironie?«
»Was? Nein.« Mit Ironie hatte Lore niemals etwas am Hut, sie erkennt sie meistens nicht einmal, aber sie ist oft in ihre durchaus ernst gemeinten Aussagen und Fragen von Gesprächspartnern und Familie hineininterpretiert worden.
»Als ob das jetzt wichtig wäre.« Evi spricht betont ebenmäßig.
»Du machst es wieder«, sagt Lore.
»Was mache ich wieder?«, fragt Evi.
»Du rollst mit den Augen.«
»Ich rolle überhaupt nicht mit den Augen!«, antwortet Evi entrüstet. »Extra nicht!«
»Du rollst innerlich mit den Augen.«
In der Pubertät hatte Evi begonnen, Aussagen ihrer Mutter, die sie für unsinnig hielt, mit Augenrollen und Kopfwackeln zu begegnen. Lore hatte sich das verbeten. Seitdem hat sich Evi diese Kopfhaltung, diesen Blick und diesen Ton angewöhnt.
»Immer wenn du denkst, dass ich dumme Sachen sage, rollst du innerlich mit den Augen«, sagt Lore. »Das merke ich genau.«
»Also gut, ich rolle innerlich mit den Augen. Ich erzähle dir, dass ich mich von meinem Mann nach fast vierzig Jahren trenne, und du fragst, ob mein neuer Mann auch eure Hecke schneidet.«
»Franz schafft es ja nimmer.«
»Gut, ich kann Stefan mal fragen«, sagt Evi. »So.« Sie spricht zu ihren Händen hinunter, die inzwischen auf ihren Knien liegen. Sie heben sich, wie in Zustimmung, und klatschen wieder auf ihre Oberschenkel. »Das wollte ich dir sagen.« Jetzt schaut sie Lore wieder in die Augen, aber ihr Blick ist warm. »Es tut mir leid, Mama. Es ist nicht gegen dich. Ich hab dich doch lieb. Du hast immer dein Bestes für uns gegeben, das weiß ich. Und an der Ehe mit Theo war ich auch selber schuld. Ich hätte halt nicht auf euch hören sollen.« Sie steht wieder auf.
Lore deutet nach oben, zum Schlafzimmer über ihnen. »Willst du nicht den Papa begrüßen, bevor du gehst? Ich glaube, heute hat er einen guten Tag.«
Evi schüttelt den Kopf. »Nächstes Mal, versprochen, ja? Ich muss noch schnell nach Hause, was abholen, bevor Theo zur Mittagspause heimkommt. Nicht, dass er Ärger macht, aber dann geht wieder eine Riesendiskussion los, und heute hab ich keine Zeit.«
»Du bist wohl schon ausgezogen?«
»Ich wohne beim Klaus. Vorübergehend. Bis ich was finde.«
Klaus ist ihr älterer Bruder, der mittlere.
»Mir sagt hier ja keiner was«, meint Lore.
»Ich sag’s dir doch gerade, Mama. Und was Papa betrifft, bin ich mir gar nicht sicher, ob er mich das letzte Mal überhaupt erkannt hat. Ich nehme an, die Diskussion über das Pflegeheim können wir uns sparen?«
Und wieder hat Lore das Gefühl, auf dem falschen Fuß erwischt worden zu sein.
Bevor sie antworten kann, redet Evi weiter. »Das besprechen wir ein anderes Mal, ja? Ruf mich an, wenn du etwas brauchst. Das Handy hast du doch noch, das wir dir Weihnachten geschenkt haben, oder?«
Lore tätschelt die Handytasche, die an ihrem Bauch baumelt. »Ja.«
»Und du nimmst deine Medikamente?«
»Ja.« Lore hatte vor einigen Jahren einen leichten Schlaganfall.
»Gut. Ach, da war ein Brief im Briefkasten.« Evi legt ihn auf den Küchentisch, und dann ist sie fort.
Lore sitzt noch ein Weilchen da und sammelt sich für das bevorstehende Aufrichten.
Nicht so enden wie du. Ja, wie ende ich denn?
Sie stützt sich mit der rechten Faust auf den Küchentisch und erhebt sich mit einem Ruck. Ha! Geschafft! Man muss die Knochen und die Muskeln einen Augenblick, bevor sie die Anstrengung erwarten, übertölpeln, das ist der ganze Trick. Mehr Gewicht auf das linke Bein, das rechte ist seit damals nie mehr so richtig geworden. Ja, so ist es gut. Sie schiebt sich vom Küchentisch weg, schlurft zum Küchenbüfett und nimmt das Hochzeitsbild in die Hand.
Zwei Überlebende aus der dunklen Zeit sind da zu sehen, sie klein und zierlich, er groß und breitschultrig, und trotzdem beugt er sich über sie und lehnt sich an sie wie ein Schiffbrüchiger an ein schwimmendes Wrackteil. Er strahlt; in ihrem Gesicht lauert ein Lächeln, ein scheues Tier, das in einer Ecke im Dunklen hockt und sich noch nicht ans wärmende Feuer wagt.
Sie dreht das Bild um, legt den Rahmen auf das Büfett und macht den Rücken auf. Sie holt das Foto heraus, das seit über siebzig Jahren unter dem Hochzeitsbild liegt. Das macht sie sonst nur einmal im Jahr, am 20. März. Das letzte Mal vor fast einem halben Jahr. Das Foto flattert aus ihrer Hand und landet auf der Arbeitsfläche des Küchenbüfetts. Es ragt ein Stück über den Rand hinaus. »Oh«, sagt Lore. Wenn es auf den Boden fällt, wird sie es nicht aufheben können. Mit zitternder Hand nimmt sie es wieder an sich.
Es ist sechs Jahre älter als das vordere Foto, aus dem Jahr 1945, und zeigt ebenfalls sie und Franz. Er trägt seine Hitlerjungenuniform, und Lore ihre Bund-Deutscher-Mädel-Kluft. Sie sitzen auf einer Bank, Franz auf der linken Seite, aber er lehnt sich nicht an sie, und sein Lächeln wirkt wie aufgeklebt. Doch Lore hat keine Augen für Franz, nur für den Jungen auf ihrer anderen Seite, mit dem sie auf dem Foto eng umschlungen sitzt. Sie schmiegt sich an ihn, wie sie es nie mit Franz getan hat. Sie strahlt über die gesamte Breite ihres Kiefers, und im offenen Gesicht des Jungen hat sich ein kleines Lächeln eingenistet. Es ist der 10. April 1945, zwei Tage vor der Katastrophe.
Du hast die Liebe doch nie erlebt.
Sie dreht das Foto um. Auf der Rückseite hat sie vor vierundsiebzig Jahren einen Brief mit Klebestreifen fixiert, der jetzt nur noch an drei braunen Stellen festhängt.
Lore liest.
Weißt Du noch, einmal habe ich mich vor einer Kinovorführung im RAD-Saal von hinten über Dich gebeugt, um Dich zu überraschen, und Dein Gesicht war verkehrt rum. Für mich. Und das hat mich daran erinnert. Die Mandarinenscheiben. Deine Augen hatten den geraden Strich oben und die Rundungen unten. Du hast so schöne Augen. Und ich wollte sagen, daß ich Dich liebe, und Dir alles Liebe und Gute zu Weihnachten wünschen. Ich kann an nichts anderes als an Dich denken. Ich kann das leicht schreiben, es flutscht wie nichts, aber ich weiß nicht, ob ich es sagen könnte.
Jetzt fällt ihr ein, was sie Evi hätte antworten können, ihr aber niemals eröffnen würde. »Ich habe die Liebe erlebt«, flüstert sie ihrer Tochter nach, »aber nicht mit deinem Vater.«
Erster Teil
Seilar
Montag, 3. Juli 1944, 9:37 Uhr
Der Himmel ist knollig, von dunklen, regengeschwängerten Wolken durchzogen wie ein mit Schmutzwasser vollgesogener Putzlumpen. Lore Mangold, vierzehn, läuft nach Osten auf die letzten Ausläufer des Steigerwalds zu, der sich links am Schwanberg wie eine anbrausende grüne Welle über das tiefer liegende unterfränkische Flachland erhebt. Sie ist gerade mit dem Zug aus Nürnberg in Iphofen angekommen und macht sich auf den Weg. Drei Kilometer muss sie auf der Reichsstraße 8 zu dem Dorf Seilar laufen, das gegenüber dem Schwanberg auf einer kleineren Anhöhe liegt.
Vorgestern hat sie Bescheid bekommen, dass sie als Ernte- und Haushaltshelferin bei der Familie Waigandt in Seilar aushelfen soll, und diese Aufgabe erfüllt sie mit Stolz und Zuversicht. Jetzt kann auch sie in schwierigen Zeiten dem Vaterland und dem Führer dienen. Vor einem Monat ist der Feind in Frankreich gelandet, und die Wehrmacht kämpft heldenhaft gegen eine vom internationalen Judentum bezahlte Übermacht. Es ist die Stunde der Wahrheit; der überlegene Wille muss siegen, und es muss und wird der deutsche sein. Sie soll sich in der RAD-Baracke in Seilar melden, dort wird man ihr den Weg zum Waigandthof zeigen.
Lore trägt einen kleinen grünen Koffer in der Hand und ihre BDM-Uniform am Körper. »Mit der BDM-Uniform ist man für jeden Anlass richtig angezogen«, hatte die Gauführerin während ihrer Rede bei der Aufnahmefeier auf der Nürnberger Burg gesagt. Das war im März, kurz nach Lores vierzehntem Geburtstag, als sie vom Jungmädelbund, von den sogenannten Küken, in den Bund Deutscher Mädel aufstieg. Endlich. Und die Gauführerin hatte recht. Lore fühlt sich in der Uniform ganz anders als sonst. Feierlicher, selbstsicherer. Zielstrebiger. Fast, als ob die Uniform sie trägt und nicht umgekehrt. Die Uniform lässt sie den Kopf hochhalten, den Rücken durchdrücken, Arme und Hüfte schwingen. Im Überschwang des Augenblicks strahlt sie plötzlich, und ein vorbeiratternder holzgetriebener Laster, ein grauer Lieferwagen, bremst schlotternd ab. Die Milchkannen, die er auf der Ladefläche hinten transportiert, scheppern metallen aneinander. Der Fahrer kurbelt das Fenster herunter. Er winkt ihr zu, lächelt sie von unter seiner Patschkappe an, und die zwei Flügel seines schwarzen Schnauzers breiten sich aus wie die Schwingen eines Raben im Schwebeflug. »Heil Hitler und grüß di Gott, schönes Fräulein!«, ruft er laut aus dem Fenster, um den knatternden Motor zu übertönen. »Wo geht’s denn hin?«
»Zum Waigandthof«, antwortet Lore.
»Soso, zum Waigandthof. Da komm ich grad her. Hab da grad die Milch abgeholt. So was wie dich hat er doch gar net verdient, der alte Gänskrong.« Er lacht auf und zeigt zwei ineinander verkeilte Vorderzähne. Dann schiebt er blitzschnell seine Zunge von unten darüber, sodass sein Lacher plötzlich gedämpft wirkt.
»Wie bitte?«, fragt Lore.
»Ach nix. So hübsch, wie du bist, nehm ich dich auf dem Rückweg mit, wennst immer noch auf der Straß bist.«
»Danke. Ich komme schon zu Fuß hin. Heil Hitler«, antwortet Lore und läuft schnurstracks weiter. Hinter ihr holpert der Laster wieder los. Lore schaut zu ihrer Nase hinunter. Glüht sie rot vor Verlegenheit, wie sie es jetzt öfter tut, wenn Männer ihr Komplimente machen? Sie merkt nichts. Lore sieht gut aus, das weiß sie. Es sind ja nicht nur die Arierinnen, wie man sie immer auf den BDM-Plakaten sieht, die den Männern gefallen, das hat sie in letzter Zeit gemerkt. Schließlich sind auch die ganzen UFA-Stars wie Zarah Leander, Ilse Werner oder Brigitte Horney, um die die Männer so ein Aufhebens machen, nicht blond, und Lore ist außerdem eher klein, aber sie weiß um die Wirkung ihres Lachens in ihrem schönen breiten Unterkiefer. Und einen Busen kriegt sie auch schon. Nur die Frisur; da kommen ihr langsam Zweifel. Wenn Zöpfe, wie Lore und alle anderen BDM-Mädels sie haben, so schön und begehrenswert sind, warum haben dann die UFA-Stars keine? Sobald Lore sechzehn ist, will sie auch eine Bubikopf-Frisur mit Dauerwelle. Zwei Jahre noch. Aber wird sie ihre Mutter davon überzeugen können?
Das Dorfzentrum von Seilar bildet ein grünes Oval aus Rasen zwischen zwei Zeilen mit Fachwerkhäusern. In der Mitte der Grünfläche liegt ein Weiher, auf dem Enten herumpaddeln, mit einer kleinen Insel mittendrin. Auf der rechten Seite, die etwas tiefer liegt, befindet sich ein Wirtshaus, Gasthof Friedrich Ammon steht darauf. Die Tür ist offen, und ein dickbäuchiger Mann mit einer roten Kartoffelnase ist darin zu sehen. Daran schließt sich eine Schmiede an, aus der dengelnde Geräusche kommen. Am anderen Ende des Ovals, wo die zwei Straßen wieder aufeinandertreffen, steht eine Kirche. Lore nimmt den linken Weg, der etwas höher verläuft und von drei Linden gesäumt ist. Aus einem Garten schiebt sich gerade rückwärts eine Frau mit Kopftuch und Huckelkorb auf dem Buckel. In dem Korb sind lauter Eier. »Komm, Schoggi«, zischt sie in den Garten hinein, »da gibt’s nichts mehr zu holen.« Bevor sie die Gartentür quietschend schließt, wischt ein kleiner schwarzweißer Hund auf die Straße hinaus, bleibt vor Lore stehen und kläfft sie an.
»Heil Hitler«, grüßt Lore zu dem Rücken der Frau. »Können Sie mir sagen, wo die RAD-Baracke ist?«
»Er meint’s net so«, sagt die Frau anstelle einer Antwort. Als sie sich umdreht, merkt Lore, dass sie selbst etwas von dem Aussehen eines Huhns hat: die Hakennase, die Knopfaugen und die spitze, nach unten hängende Noppe in der Mitte ihrer Oberlippe. Sogar ihre Stimme krächzt. »Er ist gerade so aufgeregt, weil er einen ganzen Haufen Eier unter dem Bett gefunden hat. Eins hat er schon gefressen. Gell, Schoggi, des hat geschmeckt.« Sie redet weiter zum Hund hinunter. »Gell, Schoggi, die Leut’ meinen immer, sie können ihre Eier vor uns verstecken, netamol ihre Eier wollen s’ dem Führer schenken, aber wir finden sie immer, gell, Schoggi. Wir riechen sie.«
Schoggi kläfft wie zur Bestätigung und schleckt sich das Maul. Er hat tatsächlich etwas Eigelb um die Nase.
»Aber bis der Führer in Berlin die Eier bekommt, sind sie doch faul«, sagt Lore.
Die Frau mahlt mit dem Kiefer und betrachtet sie argwöhnisch. »Die Eier sind doch net direkt für den Führer. Da hätte er ja was zu tun.« Wippt ihr Kopf leicht zur Seite wie bei einem Huhn, oder bildet sich Lore das ein? »Die Bauern müssen sie alle abgeben, und sie werden verteilt.«
»Ach so.«
»Bist du die Neue für die Waigandts?«
»Ja. Und ich soll mich in der RAD-Baracke anmelden.«
Die Frau zeigt Lore den Weg. Lore muss ein Stückchen zurück und dann nach rechts. Die RAD-Baracke ist am Ortsausgang in Richtung Altmannshausen links. Dort riecht es nach Holz, Staub, Schweiß, Kraut und feuchter Wäsche. »Kannst net verfehlen«, sagt eine Köchin. »Da oben am Hang, wo es blau ist, da wohnen die Waigandts. Neben der Burg. Die Waigandts sen die Einzigen hier, die wo Flachs anbauen.«
Das ist tatsächlich leicht zu finden. Lore muss wieder zurück zum Dorfgrün und dann an der Kirche vorbei zum anderen Ortsausgang. Am grünen Hang links hinter Seilar hängt das Flachsfeld um den weiß gekalkten Waigandthof wie ein blaues Lätzchen um einen blassen Kinderkopf. Hundert Meter rechts davon steht eine alte Burg, von deren Turm eine Hakenkreuzfahne weht.
Eine halbe Stunde später klopft Lore an die Tür des Bauernhofs, und eine kleine, rundliche, rotköpfige Bäuerin macht auf. Sie trägt einen Säugling mit einem verweinten, verschmierten Gesicht auf der Hüfte. Im Inneren des Hauses schreit ein zweites Kind, und aus der Scheune klingt ein stetes dumpfes Klopfen, das Spalten von Holzscheiten.
»Heil Hitler«, sagt Lore.
»Heil Hitler«, antwortet die Frau, und nachdem Lore nichts mehr sagt: »Was willst du?«
»Ich bin die Neue.«
»Die neue was?«
»Die neue Magd.«
»Wir wollten einen Russen«, sagt die Frau.
»Ich komme aus Nürnberg«, sagt Lore.
Die Frau wiegt ihr Kind ein paarmal hin und her und schaut Lore abwägend an. »Soll das lustig sein?«
»Nein.«
»Bist du evangelisch?«
»Ja.«
»Willi!«, ruft die Frau. »Willi! Mir kriegen doch kan Russn. Mir kriegen a Madla aus Nürnberg. A Evangelische!«
Ein Mann tritt aus der Scheune nebenan, groß und schlaksig, noch keine vierzig, aber gebeugt und mit einem länglichen, sorgenzerfurchten Gesicht. Seine fliehende Stirn, seine skischanzenähnliche Nase und sein vorstehendes Kinn verleihen seinem Gesicht das Aussehen wie bei einer der Statuen auf der Osterinsel, die Lore in der Münchner Illustrierten Presse gesehen hat. Er legt ein Beil auf einen abgesägten Holzstamm, wischt sich die Hände an seinem Blaumann ab und stapft über den Hof auf Lore zu. Ein paar aufgescheuchte Hühner flattern ihm aus dem Weg.
»Kann sie sensen?«, ruft er.
»Kannst du sensen?«, gibt die Frau die Frage weiter.
»Wie bitte?«, fragt Lore.
»Mit der Sense mähen«, erklärt die Frau.
»Nein«, sagt Lore.
»Kann sie nicht«, ruft die Frau.
»Einen Schweinestall ausmisten?«, fragt der Bauer.
»Hab ich noch nie gemacht«, antwortet Lore.
»Auch nicht«, ruft die Frau.
»Eine Sau abstechen? Oder wenigstens ein Kaninchen schlachten?«
»Um Gottes willen«, sagt Lore.
»Nein«, sagt die Frau.
Jetzt steht er schon vor ihr, und seine Frau geht wieder ins Haus. Er überragt Lore um zwei Köpfe, spricht sie aber immer noch nicht direkt an, sondern fixiert einen Punkt zwischen seinen großen Stiefeln.
»Melken?«, fragt er.
»Meinen Sie Kühe oder so was?«, fragt Lore zurück.
Jetzt richtet er seinen Blick doch auf sie. Lore Mangold, vierzehn, aus Nürnbergs Nordstadt, in ihrer strahlend weißen Bluse mit dem exakt gebundenen schwarzen Halstuch im schwarzen Lederknoten und ihrem blauen Rock, Lore Mangold, die bis dahin Kühe, Schweine, Gänse, Kaninchen und Hühner nur gegessen hat, wenn auch schon lange nicht mehr wegen des Krieges. Und sie nimmt ihn ebenfalls wahr, den großen, drahtigen Mann mit der langen krummen Nase, den Bauern Waigandt, der von Nutztieren umgeben lebt, sie auch isst, ihnen aber vorher Namen gibt, sie füttert, manchmal streichelt und zum Schluss doch schlachtet. Zwei Welten prallen aufeinander, genauso weit voneinander getrennt, wie sie es durch verschiedene Sprachen wären.
»Wie ›oder so was‹?«, fragt er. »Soll das ein Witz sein?«
»Nein. Ich mache eigentlich keine Witze. Das denken die Leute manchmal, aber es stimmt nicht.«
Seine Augen weiten sich, dann wird sein Blick milder. »Gut. Wir haben nur Kühe. Zum Melken, meine ich.«
Lore schüttelt ihren rot gewordenen Kopf. »Nein. Leider. Aber ich kann’s vielleicht lernen.«
Er nickt und schweigt eine Zeit lang. »Unsere Russin ist nämlich weg«, sagt er dann, als würde das alles erklären.
»Wo ist sie hin?«, fragt Lore. »Nach Russland?«
Er schaut sie lange an. »Du machst wirklich keine Witze?«
»Nein.«
»Gut. Unsere Russin haben die da drüben erschossen.« Er sticht mit einem rückwärtsgewandten Daumen über seine rechte Schulter zur Burg hinüber. »Die SSler. Aus Spaß an der Freud. Haben s’ beim Eierklauen erwischt. Jetzt hab ich niemand mehr, der mir hilft. Der Nachbar drüben«, nun deutet er mit dem Zeigefinger über Lores Kopf hinweg in die andere Richtung, »der hat a paar Hitlerjungen gekriegt, aber die kaspern mir zu viel rum. Ich wollt wieder a Russin, oder besser noch an Russn, aber es sind scheint’s keine mehr da. Na ja. Was kannst denn?«
»Kochen, Stricken, Nähen.«
»Mmm. Kann meine Frau alles schon.«
»Im Volkstanz bin ich gut. Und Singen. Und eine Telefonistinnenausbildung habe ich auch. Und eine Flakhelferinnenausbildung. Aber am besten kann ich Englisch, das lerne ich in der Schule, und der Lehrer sagt, ich bin seine beste Schülerin.«
»Aha.« Er nickt langsam. »Und das ist auch kein Witz.«
»Nein. Wirklich nicht. Ehrlich.«
»Tja. Kannst nix dafür. Ja.« Er klatscht in die Hände. »Da müssen wir durch, alle miteinander. Wo fangen wir an?« Er reibt sich am unrasierten Kinn, schaut ratlos um sich, dann rastet sein Blick auf den pickenden und scharrenden Hühnern ein. »Ach ja. Mit einem Giegerla. Hol mir ein Giegerla.«
»Ein was?«, fragt Lore.
Er zeigt auf die Hühner, die im Hof picken und scharren. »Das sind Giegerli. Ruf mich, wennst eins hast.« Er kehrt um und läuft zurück zur Scheune.
Lore jagt eine Viertelstunde lang vergeblich nach einem Huhn, zuerst zaghaft, dann immer hastiger und panischer, bis sie zum ersten Mal stolpert und auf ihren Knien im Dreck landet. Die Hühner scheinen einen untrüglichen Instinkt zu haben, wie sie ihr in letzter Sekunde auswischen können. Nach zehn Minuten ändert Lore ihre Taktik, versucht es mit Überraschung, schleicht sich an eines heran, um die anderen einzulullen, im letzten Moment wendet sie sich ab und hechtet nach dem übernächsten. Alles vergeblich. Diesmal fällt sie vornüber auf das Gesicht. Innerhalb kürzester Zeit sind ihre makellos saubere BDM-Uniform, die sie heute früh so stolz angezogen hat, und ihr Gesicht, ihre Hände und Knie dreckverkrustet, und Lores Zuversicht, dem Vaterland und dem Führer hier auf diesem Bauernhof zu helfen, fällt steil ab wie ein Sturzkampfbomber. Bauer Waigandt erscheint ein paarmal aus der Scheune, schaut kurz zu und verschwindet kopfschüttelnd wieder.
Unter das aufgeregte Hühnergegacker mischen sich nach kurzer Zeit menschliche Geräusche: Gelächter und Gejohle. Vorne am Brunnen, wo der Eingang zum Hof vom Weg abzweigt, stehen inzwischen zwei Jungs, etwas älter als Lore, in karierten Hemden und Lederhosen. Das sind bestimmt die Hitlerjungen vom Nachbarn. Einer von ihnen krümmt sich vor Lachen, sein Gesicht ist vor Schadenfreude verzerrt, der andere steht aufrecht, hat die Hände in den Hosentaschen und schaut mit schräg geneigtem Kopf zu. Er hat seine Lippen geschürzt und pfeift irgendwas.
»Guckt nicht so blöd, helft mir halt!«, ruft Lore.
»Ich komme ja schon«, sagt der aufrecht Stehende und läuft herbei.
Der andere verstummt, und Lore widmet sich wieder der Hühnerjagd. Jetzt ist es ihr peinlich, dass sie um Hilfe gebeten hat, und sie will unbedingt ein Huhn fangen, bevor der Junge sich einmischt. Sie scheucht ein braun-weißes Exemplar in eine Ecke zwischen der Scheune und einem Stall, immer weiter in den Neunzig-Grad-Winkel hinein. Ha! Kein Ausweg. Gleich wird sie es haben. Sie geht in die Knie, und es fliegt über ihren Kopf hinweg in die Freiheit.
»So wird das nichts«, sagt der Junge. Er steht jetzt direkt hinter ihr, als sie sich umdreht. »Schau her.« Er hat ein Stück Metall in der Hand, mit einem langen Stiel und einem gebogenen Ende. »So macht man das«, sagt er, schwenkt den Stab und fängt flink mit dem Haken den Fuß eines der Hühner ein, packt es von hinten, die Flügel an die Brust gedrückt, und hebt es hoch, wo es mit entrüstetem Blick den Kopf hin- und herbewegt, aber ansonsten ruhig bleibt. »Und jetzt du«, sagt er und lässt das Huhn wieder los.
»Und wenn ich ihm wehtue?«
»Du tust ihm nicht weh«, sagt der Junge und nimmt ihr den Stab aus der Hand. »Und wenn schon, es ist sowieso gleich egal, weil das hier geht eh nicht gut aus für den Kerl. Schau.«
Wieder diese grazile Bewegung aus dem Ellbogen, und das Huhn hängt mit indigniertem Blick am Haken und wird wieder freigelassen. »So.« Da war nichts Überflüssiges, auch nicht bei seinem Gang, seine Bewegungen haben überhaupt etwas Sparsames, Stilles an sich. Ebenso sein Körper: nicht sehr groß, nicht muskulös, eher kompakt. Seine Haare sind dunkel und nur leicht gewellt, seine Augen braun, seine Augenbrauen spitz zulaufend und klar definiert. Seine Wimpern sind lang, und um seinen Mund hängt ein kleines Lächeln. Es ist alles halb so schlimm, scheint es zu sagen.
Und Lore wird ruhiger. Sie nimmt den Stab, erwischt den Fuß des Huhns und hebt das Tier auf, wie er es ihr gezeigt hat.
»Gut gemacht. Na, siehst du«, sagt er.
»Wie heißt du?«, fragt Lore, das Huhn wie einen Schutz vor sich haltend.
»Anton. Und du?«
»Lore.«
»Bist du neu hier?«
»Ja.«
»Vielleicht sehen wir uns beim Film.«
»Bei welchem Film?«
»Beim RAD unten zeigen sie jeden Samstag einen Film. Letzte Woche war’s Münchhausen, das war vielleicht ein Jux.« Er dreht sich um und läuft pfeifend vom Hof. Jetzt erkennt Lore die Melodie. Sie ist aus dem Film, den Lore letztes Jahr mit ihrer Mutter und Oma im Orpheum-Kino gesehen hat.
»Dein Stab!«, ruft Lore.
»Schenk ich dir.«
»Na endlich.« Bauer Waigandt ist wieder aus der Scheune erschienen. »Gib mir das Vieh.« Er nimmt das Huhn, streichelt es kurz, dann hebt er mit der einen Hand das Beil vom Baumstamm und legt mit der anderen das Huhn mit dem Kopf voran darauf. Er hält Lore das Beil vor die Nase. »Siehst du das? Schau gut hin. Das ist der Unterschied zwischen deiner und meiner Welt.« Er holt kurz aus und hackt dem Huhn den Kopf ab. Der Rumpf zuckt, die Flügel flattern ein paarmal. Mit einem Stück Schnur aus seiner Tasche bindet er die Füße des Huhns schnell zusammen und hängt es an einen Nagel an der Scheunenwand.
»Das ist es, was ich hier brauche, nicht Tanzen oder Telefonieren.«
Lore übergibt sich an der Scheunenwand.
Bei den Waigandts
Es war ein harter Einstieg für Lore. Aber in den nächsten Wochen lernt sie fast alles, was sie auf dem Bauernhof braucht, denn wie kann sie sich zieren, den Schweinstall auszumisten oder das herausschießende Blut des geschlachteten Schweins in der Pfanne aufzufangen oder eben ein Huhn zu köpfen, wenn täglich an allen Fronten die tapferen Soldaten ihr Leben für Deutschland opfern? Ihre BDM-Uniform zieht sie nie mehr zur Hofarbeit an, sondern eine von den zwei Blusen, die sie im Koffer mitgebracht hat, und eine Drillichhose, die ihr Frau Waigandt leiht.
Bauer Waigandt grunzt vor sich hin wie eins seiner Schweine, wenn er um neun Uhr bei der Vesper am Küchentisch mit dem rechten Zeigefinger die Nachrichten im Neustädter Anzeigeblatt verfolgt. »Zurückgeworfen, erneut abgewehrt, behaupten überall die Stellung, groß angelegter Gegenstoß, aha«, liest er dann vor. »Und wieso kommen die Kerle dann immer näher?« Und Lores Fragen – »Aber an den Endsieg glauben Sie doch, oder? An die Wunderwaffen?« – lässt er in der Luft hängen.
Der älteste Sohn der Waigandts, Harald, achtzehn, kämpft an der Ostfront. Seine Briefe in ihren rosaroten Umschlägen kommen in unregelmäßigen Abständen, manchmal zwei an einem Tag, manchmal tagelang nichts. Aber er ist ungefähr so mitteilsam wie sein Vater, was den Inhalt betrifft. Meistens geht es ums Essen, dessen Unzulänglichkeit oder Ausbleiben. Dann huscht Frau Waigandt in die Räucherkammer, holt eine Rauchwurst vom Haken herunter, verpackt sie und bringt sie zur Post.
Lore schläft auf dem Dachboden in einem Bett direkt unter den blanken Ziegeln. Ihr gefällt, dass sie in der Früh gleich weiß, wie das Wetter ist, bei Regen glänzen die Ziegel fettig, bei Wind pfeift es durch, bei Hitze riecht sie den aufgewärmten Ton. Aber sie ist froh, dass sie im Winter nicht da sein wird, sondern wieder in der Wohnung in Nürnberg. Die ersten Tage war sie zum Lesen zu müde, doch inzwischen liest sie abends bei Kerzenlicht immer ein paar Seiten von Das Erbe von Björndal. Die Romane von Trygve Gulbranssen sind die ersten Erwachsenenbücher für Lore. Vor einem Jahr las sie noch die Pucki-Bändchen, aber je älter Pucki wurde, umso weniger glaubwürdig erschien Lore ihr Leben; es tat sich ein Loch auf, ein weißer Fleck, wie auf einer alten Weltkarte, der immer größer wurde. Pucki als Kind war Lore vertraut, die ältere Pucki war allerdings wie keine Frau, der Lore jemals begegnet war. Irgendwann zwischen Puckis neue Streiche und Pucki wird eine glückliche Braut hat sie zum Beispiel einen Busen bekommen, wenigstens dem Titelbild nach, genauso wie Lore ihn in diesem letzten Jahr bekommen hat, aber in den Büchern ist keine Rede davon. Lore ist ganz stolz, dass sie den ersten Björndal-Band Und ewig singen die Wälder geschafft hat, und hofft, Genaueres über das, was in den Pucki-Büchern fehlt, bei Gulbranssen zu finden. Über den Paarungsakt ist sie schon beim BDM grob aufgeklärt worden, das war schlimm genug, aber die technischen Einzelheiten fehlen ihr noch, und zu Hause kann sie nicht danach fragen. Es hat mit den rumpelnden Geräuschen aus dem Schlafzimmer der Waigandts unter ihr zu tun, die sie kurz vor dem Einschlafen vernimmt, da ist Lore sich ganz sicher.
Was auf dem Bauernhof alles anfällt, bringt ihr Bauer Waigandt bei. Wie man den Schweinestall mit der flachen Schaufel ausmistet. Wenn die Schweine frisches Stroh kriegen und darauf herumhüpfen und mit den Hinterfüßen ausschlagen, muss sie vor lauter Mitfreude lachen. Wie man eine Kuh melkt. Dieses Ziehen, abwechselnd mit beiden Händen wie beim Kirchenglockenläuten, wie man dabei den Druck durch die geballte Faust nach unten weitergibt, und trotzdem oben an der Wurzel mit Daumen und Zeigefinger fest zugreift, damit die Milch nicht wieder zurückfließt. Wie man die vollen Milchkannen auf einer Sackkarre zur Weggabelung bringt und sie die Rampe hinaufschiebt, von der sie der Milchfahrer mit dem Schnauzer und dem schlechten Gebiss abholt. Er nimmt alle mit, die nach Iphofen oder Kitzingen wollen; sie müssen nur um zehn Uhr früh am Dorfgrün in Seilar warten. Meistens sind immer ein paar Menschen auf der Ladefläche hinten, zwischen den ganzen Milchkannen. Wer mittags auf der Mainbrücke in Kitzingen wartet, den bringt er dann auch wieder heim.
Wie man dem alten bösen Gänserich, der immer vor dem Haus lauert und einen angreifen will, auskommt, indem man sich ihm von seiner blinden Seite nähert, wo der Hahn ihm das linke Auge ausgepickt hat, ihn am Hals packt und wegschleudert, kurz bevor man sich ins Haus rettet. Wie man Eier in einem Eimer Wasser unter Heu vor der Eierfrau, die tatsächlich Frau Dotterweich heißt, versteckt, sodass der Schoggi sie nicht findet. Wie man Gänse vom Tümpel auf der kleinen Terrasse mitten am Hang unterhalb vom Flachsfeld am Abend vor sich her scheucht und sie wieder in den Stall bringt. Lores Lieblingsaufgabe ist es, auf die Gänseküken aufzupassen. Die Gans hat überraschend ein zweites Mal gebrütet; zwölf Küken sind geschlüpft. Lore muss sie mit gehackten Brennnesseln füttern, sie auf die Wiese bringen, damit sie Gras fressen können, und auf sie aufpassen, damit kein Fuchs oder Habicht sie holt. Dabei kann sie sich ins Gras legen und zwischendurch in den Himmel schauen.
Zwischen dem Bauernhaus und dem Grashang hinauf zum Wald steht eine Reihe Bäume: Buchen, Eichen, ein Haselnussstrauch. In der Buche hat ein Eichhörnchen seinen Kobel gebaut, und bei seinen beherzten, von der Schwerkraft losgelösten, schier unmöglichen Sprüngen geht Lores Herz mit.
Es ist das erste Mal, dass Lore von zu Hause weg ist, und schon nach wenigen Tagen kommt ihr das Leben mit ihrer Mutter und Großmutter in der Mansardenwohnung am Dötschmannsplatz in der Nürnberger Altstadt wie eine ferne Welt vor. An ihren Vater kann sie sich nicht erinnern, er ist vor zwölf Jahren an Lungenkrebs gestorben. Ihre Mutter arbeitet im Kaufhaus Schocken, das jetzt Merkur heißt, und ihre Oma gibt Klavierstunden im Wohnzimmer, und manchmal, wenn der Klavierstimmer da ist oder wenn es Lore bei den unbegabteren Schülern bei all dem Zögern, Stolpern, Wiederholen und Danebenspielen durch Mark und Bein geht, treibt es sie aus der Wohnung hinaus. Dann geht sie ein Stockwerk höher, wo zwei Schwestern wohnen. Sie sind Engländerinnen, Lore weiß nicht, welches Schicksal sie nach Nürnberg gebracht hat, sie vermutet irgendetwas mit einer vergangenen Liebe. So etwas hängt in der Luft wie das Parfüm eines längst abgereisten Besuchs. Eine der Schwestern singt in der Oper im Chor, die andere ist Kostümbildnerin und näht ihr immer die Kostüme. Mit ihnen redet Lore Englisch, so gut sie kann. Sie lernt es am Melanchthon-Gymnasium in der Sulzbacher Straße, und ihr Lehrer, der alte Dr. Bothe, oder »Bottom«, wie ihn die Schüler nennen, weil er im Unterricht alle Rollen aus dem Shakespeare-Stück A Midsummernight’s Dream