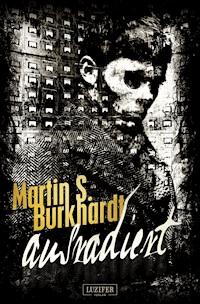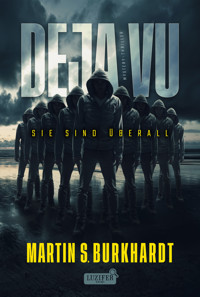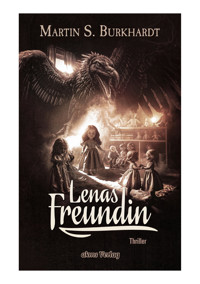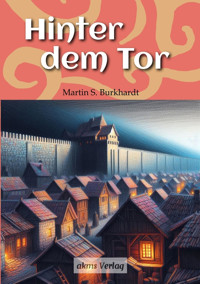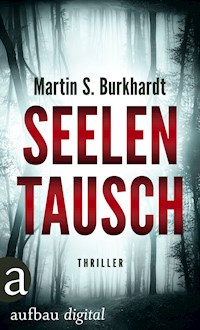3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein gemütliches Wochenendfrühstück mit seiner Familie wird zum Beginn eines Albtraums. Lenny Eggert kommt ein unheilvoller Verdacht, als das Wasser einfach nicht kochen will. Ist eine Substanz absichtlich ins Leitungswasser gegeben worden, um den bevorstehenden G8-Gipfel zu sabotieren? Hinter Lennys Wohnsiedlung liegt das Schlosshotel, in dem das Treffen stattfindet. Es kommt weitaus schlimmer. Nachdem Versuchstiere zunächst nur apathisch in ihren Käfigen lagen, haben sie sich tags darauf gegenseitig zerfleischt. Wie viele Menschen haben bereits das Wasser getrunken? Eine Katastrophe steht bevor. Lenny hat nur noch einen Gedanken: Er muss seine Familie schützen und die Menschen warnen – doch er gerät in ein Netz aus Vertuschung und Desinteresse – und plötzlich befindet er sich auf der Flucht vor Auftragskillern ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 423
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
akms Verlag
akms Verlag
akms Verlag, Hochkamp 35, 22113 Oststeinbek, www.akms.info
Cover & Umschlaggestaltung: Mark Freier, www.freierstein.de
Lektorat: Sabine Fuhlenhagen
Druck und Distribution:
tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg
ISBN: 978-3-384-05189-9
Copyright Gesamtausgabe © 2024 akms Verlag
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Prolog
Sie setzte sich auf einen bequemen Stuhl, nahm einen großen Schluck Tee und seufzte. Wie sie die Felder vermisste. Der Ausblick von ihrer kleinen Terrasse war einmal so idyllisch gewesen. Kühe weideten auf den Wiesen und Vögel spielten zwischen den Ästen der wild gewachsenen Büsche. Vor zwei Jahren war es plötzlich vorbei gewesen mit dieser Herrlichkeit. Als die Bagger aufgetaucht waren, waren auch all die Tiere geflüchtet, die sie so gern mit dem Fernglas beobachtet hatte. Die ersten neuen Gebäude waren innerhalb von sechs Monaten erbaut und versperrten ihr zu allem Überfluss auch noch die freie Sicht zum entfernten Wald. Hinter ihr knarrte die Tür und Annemarie warf einen flüchtigen Blick zurück. Thorsten, ihr älterer Sohn, war endlich aufgetaucht. Er stand da, als hätte er gestern wieder einmal zu viel Bier getrunken.
»Wo hast du denn den ganzen Vormittag gesteckt?«, fragte sie neugierig. Anstatt zu antworten, grunzte Thorsten nur lang gezogen. In seiner Hand blitzte ein länglicher Gegenstand auf, den er aber sofort hinter seinem Rücken versteckte, als sie genauer hinsehen wollte. Thorsten war schwierig geworden in jüngster Zeit. Ob es ihn störte, dass er arbeitslos war und mit Mitte zwanzig noch immer bei seiner Mutter wohnte? Annemarie drehte sich seufzend um und richtete den Blick wieder auf das neu entstandene Wohnviertel. Wie verärgert sie damals gewesen war, als all die Einzel- und Reihenhäuser vor ihrer Nase allmählich Formen angenommen hatten und schließlich die ersten Leute eingezogen waren. Ihr Klempner hatte sie in diesen schweren Wochen zu trösten versucht, indem er ihr von den Vorteilen erzählt hatte, die das Neubaugebiet mit sich bringen würde: eine größere, schön ausgebaute Straße, nette Geschäfte, Straßenbeleuchtung und eine komplett neue Kanalisation, auch für ihr Haus. »Sie sind praktisch das erste Haus, welches an die neue Leitung angeschlossen wird«, hatte er berichtet. »Das frische Wasser beispielsweise kommt zuerst zu Ihnen und geht dann erst hinüber ins Neubaugebiet.« Wie albern sie diese Argumentation damals gefunden hatte. Was hatte man davon, dass sein Haus das vorderste war, und als Allererstes mit Frischwasser beliefert wurde?
Ein Schatten fiel ihr ins Gesicht und holte sie aus ihren Überlegungen. Thorsten stand direkt neben ihr, seine Augen waren geschlossen und es sah aus, als wäre er eingeschlafen. Aber im Stehen? Doch er bewegte sich. Wie in Zeitlupe drehte Thorsten sich zu ihr hin und hob den Arm. Die Sonnenstrahlen spiegelten sich auf dem blanken Gegenstand in seiner Hand, und endlich sah Annemarie, um was es sich handelte. Thorsten hielt ihr spitzes Tranchiermesser fest umgriffen.
»Was willst du denn damit?«, fragte Annemarie scharf. Sie hasste es, wenn Thorsten ans Besteck ging. Statt zu antworten, tippelte ihr Sohn ein Stück vor, sodass sich die Klinge des Messers direkt vor ihrem Gesicht befand. Annemarie las kurz den Herstellernamen an der Seite der Klinge, obwohl sie ihn sicherlich schon hundertmal gelesen hatte, und wollte etwas sagen, als ein brennender Schmerz ihren Körper durchzuckte. Im ersten Moment war sie sich sicher, einen Herzinfarkt erlitten zu haben. Woher sonst sollten diese ungeheuren Schmerzen plötzlich kommen? Annemarie schrie den Namen ihres Sohnes und versuchte, aufzustehen. Es ging nicht. Ihr linkes Bein schien auf eine unheimliche Weise mit dem Gartenstuhl aus Holz verwachsen zu sein. Sie konnte es überhaupt nicht anheben. Ihr Blick fiel auf den Holzgriff, der über ihrem Oberschenkel leicht hin- und herschwang. Ihr Gehirn brauchte eine Weile, um die Verbindung herzustellen. Die Klinge steckte komplett in ihrem Oberschenkel! Sie war sogar auf der anderen Seite wieder herausgetreten und tief in das Holz des Gartenstuhls eingedrungen. Annemarie begann zu schreien. Hatte Thorsten das gemacht? Vielleicht war der Tollpatsch ausgerutscht und hatte das Messer zu spät losgelassen. Ihr Kopf drehte sich, aber sie konnte ihren Sohn nirgends entdecken. Die Terrassentür stand offen. War er wieder ins Haus gegangen? Womöglich hatte der arme Kerl einen Schock erlitten. Annemarie wollte nach ihm rufen, doch eine neuerliche Schmerzattacke raubte ihr fast die Besinnung. Inzwischen hatte sich der helle Stoff ihrer Sommerhose auf der gesamten Länge ihres Beines dunkelrot verfärbt. Ihr wurde schwarz vor Augen. Der Blutverlust. Wo steckte Thorsten nur? Endlich erschien ihr Sohn an der Türschwelle. Und der gute Junge beeilte sich sogar, ging so zügig, dass er um ein Haar gestürzt wäre, als er die Terrasse erreichte.
»Du musst einen Notarzt rufen«, sagte Annemarie. Ihre Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. Thorsten steuerte weiter in ihre Richtung. Wahrscheinlich hatte der tapfere Kerl schon längst Hilfe geholt, deswegen war er auch so schnell wieder ins Haus gestürmt. Sie bemerkte das Messer in seiner Hand. Das Fleischermesser, welches in der Schublade genau neben dem Tranchiermesser lag. Liegen sollte. »Was willst du damit?«, stöhnte sie heiser.
Ohne zu antworten, beugte sich ihr Sohn vor. Seine Bewegungen wirkten seltsam abgehackt. Annemarie dachte an Science-Fiction Filme aus den Sechzigerjahren, in denen sich Roboter ähnlich mechanisch bewegten. Thorstens Augen waren halb geöffnet, dennoch schien er völlig abwesend zu sein. Ein weiteres Schmerzensfeuer unterbrach ihre Gedanken. Ihr kam es vor, als ob eine gewaltige Säge ihre Beine abgetrennt hätte. Aber ein Blick nach unten sagte ihr, dass sie ihre Gliedmaßen noch besaß. Nur steckte jetzt auch im rechten Oberschenkel ein Messer. Annemarie nahm all ihre Kraft zusammen und stieß einen gellenden Schrei aus. Ihr Sohn hatte den Verstand verloren und wollte sie töten.
*
Thorsten griff nach dem Fleischermesser. Mit einem Ruck zog er die Klinge aus der blutenden Wunde. Annemarie verdrehte die Augen und wurde ohnmächtig, ihr Kopf fiel nach vorn auf die Brust. Thorsten starrte auf den Nacken seiner Mutter. Er lächelte und hielt das Messer direkt über ihren Halsansatz. Mit einer geschmeidigen, aber kraftvollen Bewegung fuhr die Klinge durch Haut und Knochen und trennte den Kopf vom Rumpf. Annemaries Körper sackte fast augenblicklich zusammen, während aus ihrer Halsschlagader eine Fontäne hellroten Blutes sprudelte. Ihr Schädel fiel auf die Granitplatten und rollte bis zu einem Beet mit verblühten Maiglöckchen. Thorsten griff in ihr Haar und hob den Schopf auf. Hinter ihm ertönte ein Knurren. Thorstens Schäferhund war offensichtlich aufgewacht und auf die Terrasse getrottet. Jetzt bellte er mit überschnappender Stimme sein Herrchen an. Thorstens Finger lösten sich vom Haar seiner Mutter, und der Kopf knallte ein weiteres Mal auf die Maiglöckchen. Thorsten schwenkte das Messer und kam langsam auf den Schäferhund zu. Er konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen. Der Kopf des Hundes sah viel schöner aus als der seiner Mutter.
1
Verschlafen schlug Lenny die Augen auf. Einen Moment lauschte er den Vögeln, die draußen vor dem Fenster den neuen Tag begrüßten. Aus dem Nachbarzimmer drangen Geräusche zu ihnen herüber. Es klang, als würden Elefanten durch den Raum springen. Sein Blick fiel auf den Radiowecker, er stöhnte, es war kurz vor sechs, viel zu früh, um aus dem Bett geschmissen zu werden. Zumindest am Wochenende. Er zog sich die Decke über den Kopf. Vielleicht würden sie trotzdem noch eine Weile schlafen können. Aber seine Hoffnungen wurden bereits wenige Sekunden später zerschlagen, die Schlafzimmertür wurde geöffnet und einen Augenblick später spürte er, wie sich die Matratze am Fußende senkte. Jemand krabbelte über seine Schienbeine.
»Heute sind wir Katzen«, verkündete eine gut gelaunte, nicht mehr müde klingende Kinderstimme. Eine zweite Stimme miaute lauthals. Nina, die dicht an ihn gekuschelt lag, streckte sich. Kurz darauf gab sie ein lang gezogenes Seufzen von sich.
»Guten Morgen, Schatz«, sagte sie und strich ihm über die Haare. Sie hob ihre Bettdecke an. Sofort krochen Justin und Emily in die warme Festung. Vielleicht hatten sie Glück und die Kinder würden noch eine Weile im Ehebett schlafen. Manchmal klappte das. Heute jedoch schien keiner dieser Tage zu sein. Während Justin an seiner Nase zupfte, miaute ihm Emily immer lauter und penetranter ins Ohr. Sie drückte ihre Hände in sein Gesicht und krabbelte auf seinen Bauch.
»Papi, wir sind Katzen«, stellte sie dabei energisch fest. »Du musst uns streicheln oder Futter geben.«
»Katzen schlafen um diese Zeit«, gab er knurrend zurück. Jemand knuffte ihn in die Seite.
»Gar nicht«, sagte Justin laut. »Katzen schlafen nur mittags.«
Nina erhob sich gähnend. »Na, dann kommt mal mit ins Bad, ihr Katzen. Und lasst Papi noch einen Moment dösen.«
Emily trommelte mit ihren kleinen Fingern auf Lennys Bauch. »Katzen mögen kein Wasser. Die waschen sich nicht.«
»O doch.« Nina lachte und schlug die Bettdecke zurück. »Die sind bestimmt reinlicher als ihr Schmutzfinken. Und nun ab ins Badezimmer.«
Während Justin laut miauend vom Bett sprang, schnappte sich Nina Emily, die daraufhin herzlich zu kichern anfing. Lenny schenkte seiner Frau ein kurzes Lächeln.
»Danke.«
»Wir wecken dich, wenn es Frühstück gibt.«
Obwohl sich kein Schlaf mehr einstellen wollte, war die zusätzliche halbe Stunde unter der flauschigen Bettdecke die reinste Wohltat. Lenny hing einem schönen Traum nach, während die Kinder im Bad laut prustend gewaschen wurden. Als die drei die Treppe hinunter in die Küche stiefelten, schwang er sich summend aus dem Bett. Sein Magen knurrte, während der Rasierer über seine Wangen hobelte. Er freute sich auf das gemeinsame Frühstück mit seiner Familie. Vor sieben Jahren wäre es ihm nicht mal im Traum eingefallen, die Rolle eines Familienvaters zu übernehmen. Eigentlich hatte Lenny sich selbst nie für besonders familientauglich gehalten. Als seine Schwester vor mehr als zehn Jahren den ersten Nachwuchs präsentiert hatte, hatte er noch nicht mal Lust gehabt, dieses zerbrechliche, schreiende Bündel in den Arm zu nehmen. Das war ihm alles viel zu suspekt gewesen. Kinder waren für die Gesellschaft wichtig, keine Frage, es war ja auch gut, dass sich Leute diesen Problemen annahmen, aber er doch nicht. Er würde stattdessen lieber etwas anderes, ebenfalls Wichtiges für die Gesellschaft tun. Ehrenamtliche Arbeiten oder so. Nur nichts, was mit Schreihälsen im weitesten Sinne zu tun hatte. Lenny schloss die Tür zum Badezimmer und ging die Treppe hinunter. Nina hatte vom ersten Augenblick überhaupt keine Zweifel aufkommen lassen, dass sie sich eine Familie wünschte. Am Anfang ihrer Beziehung hatte für ihn festgestanden, dass sie ihn irgendwann sowieso verlassen würde, nämlich dann, wenn ihre innere Uhr angekündigt hätte, dass es allmählich Zeit für Kinder wäre. Nicht mal ansatzweise hatte Lenny in Erwägung gezogen, dass Nina vielleicht darauf spekuliert hatte, dass er der Vater ihres Nachwuchses sein würde. Er war ein Mann, kein Vater. Irgendwie hatte sich beides ausgeschlossen.
Lächelnd betrat er die Küche. Was für pubertäre Gedanken. Als sie schwanger geworden war, hatten sie beinahe auf der Stelle geheiratet. Und spätestens zu dieser Zeit war in seinem Kopf irgendwas abgelaufen, was noch heute schwer zu erklären war. Plötzlich hatte er sich auf das Baby gefreut, ja er war geradezu heiß darauf gewesen und hatte es kaum erwarten können, das Zimmer einzurichten, Möbel und die ersten Kleidungsstücke zu kaufen. Anfangs war Lenny davon überzeugt gewesen, dass dieses euphorische Gefühl sehr bald wieder verschwinden würde, aber dem war nicht so. Es war geblieben, bis heute.
Justin nickte ihm konzentriert zu. Der Junge balancierte vier Frühstücksteller auf seinen Händen und wankte hinüber zum Tisch, als würde er auf rohen Eiern laufen. Emily saß auf der Arbeitsplatte und sah stirnrunzelnd zu, wie Nina die dampfenden Ofenbrötchen aufschnitt.
»Was hast du, Mami?«, fragte sie.
»Die Brötchen sind sehr heiß.«
»Warum?«
»Weil sie aus dem Backofen kommen.«
»Warum müssen die Brötchen in den Backofen, wenn du nicht magst, dass sie heiß werden?«
»Sonst würden sie nicht schmecken.«
Emily zog an einer ihrer Haarsträhnen, die ihr über die Stirn fielen, und blähte ihre Wangen auf. Das tat ihre Tochter immer, wenn sie mit einer Antwort der Erwachsenen nicht zufrieden war. Lenny schüttelte grinsend den Kopf. Er konnte sich kein Leben mehr ohne seine Kinder vorstellen.
Während sich Justin und Emily auf ihre Plätze setzten und mit ihren Kindermessern im Takt auf den Tisch schlugen, fluchte Nina leise.
»Was ist denn bloß mit diesem blöden Herd los.« Sie blickte in den Kochtopf, der auf dem rechten vorderen Ceranfeld stand. »Ich habe die Platte angestellt, als wir runter kamen, aber das Wasser kocht immer noch nicht.« Lenny öffnete den Verschluss einer Orangensaftpackung und schaute auf das Bedienfeld des Herdes. Das Wahlrad für das vordere Feld war bis zum Anschlag aufgedreht. »Ich habe nicht vergessen, sie anzustellen«, bemerkte Nina mit säuerlichem Ton und gab ihm einen Knuff auf den Oberarm. Lenny lachte.
»Ich vergesse das schon hin und wieder. Zumindest drehe ich dann nicht voll auf. Wenn der Zeiger auf drei oder vier steht, dauert es ewig.«
»Ja, stimmt, du bringst da öfter mal was durcheinander.« Seine Hand strich über ihre Wange.
»Schade, dass wir heute Morgen nicht mehr kuscheln konnten«, sagte er leise. Sie nickte.
»Vielleicht geht die Horde heute wenigstens früh ins Bett. Dann könnten wir ein wenig … so Sachen machen.« Er lächelte und gab ihr einen Klaps auf den Hintern.
Justin warf sein Besteck auf den Teller. »Was ist denn mit den Eiern? Ich habe Hunger.«
»Die Eier dauern noch«, sagte Lenny, während er und Nina sich ebenfalls an den Tisch setzten. »Wir fangen schon mal an.«
Lenny hatte gerade die erste Hälfte seines Brötchens gegessen, als Emily die Hände vor der Brust verschränkte.
»Ich will heiße Milch«, verkündete sie. Justin nickte eifrig.
»Ich auch. Wenn es schon keine Eier gibt.«
Nina stand auf. »Kein Problem.«
Lenny schenkte sich Saft nach und erhob sich ebenfalls. Sowohl Nina als auch er tranken leidenschaftlich gern Saft. Zum Frühstück brauchten sie nichts anderes, auf Tee oder Kaffee konnten sie mit Leichtigkeit verzichten. Den Kindern war der Orangensaft jedoch meistens eine Spur zu herb, mehr als ein oder zwei Schlucke nahmen sie selten. Oft verlangten die beiden anschließend nach heißer Milch. Während Nina einen weiteren Topf aus dem Eckschrank fischte, holte Lenny die Milch aus dem Kühlschrank.
»Das Wasser kocht ja immer noch nicht«, rief sie, als sie den Deckel des ersten Topfes anhob. »Da stimmt doch was nicht. Das Ceranfeld muss kaputt sein.«
»Glaube ich nicht. Gestern hat es doch funktioniert.« Lenny schaute auf das flammende Rot, das ihm unter dem Kochtopf entgegenleuchtete, streckte die Arme aus und spürte sofort die stechende Wärme auf der Haut, als seine Hände in die Nähe der Ceranfläche kamen. »Mit dem Herd ist alles in Ordnung«, stellte er achselzuckend fest. »Vielleicht war der Topf nicht ganz sauber? Womöglich Rückstände von Geschirrspülmittel oder so?« Er beobachtete das Innere des Topfes, in dem das Wasser noch nicht einmal Bläschen bildete.
»Der Topf war sauber«, sagte Nina unmissverständlich.
Nickend konzentrierte sich Lenny wieder auf die Milch in dem zweiten Topf. Schon nach wenigen Minuten begann sie zu dampfen. Als sich die ersten Schaumkronen bildeten, schob er das Gefäß vom Herd. Nina hielt ihm Emilys Lieblingstasse hin. »Nun gieß schon ein.«
»Nur einen Augenblick.« Er nahm den Wassertopf vom Herd und platzierte den Milchtopf auf das rechte Feld. Es dauerte nur wenige Sekunden, bis die Milch erneut anfing, zu brodeln. »Mit der Herdplatte ist tatsächlich alles in Ordnung.« Er kippte die Milch in Emilys Lieblingstasse und in einen zweiten Becher für Justin. Während Nina zum Tisch ging, stellte Lenny den Wassertopf auf das Ceranfeld, auf dem eben die Milch erhitzt wurde. Wäre doch gelacht, wenn er dieses blöde Wasser nicht zum Kochen bringen würde.
»Ich will mein Ei«, quengelte Emily laut.
Nina stand auf. Ein gemütliches Frühstück sah irgendwie anders aus. »Ich hole Mineralwasser«, sagte sie und öffnete die Tür zum Keller. »Vielleicht stimmt etwas mit unserer Wasserleitung nicht.«
Kurze Zeit später kam Nina mit zwei Plastikflaschen zurück. »Wir kochen die Eier jetzt in stillem Wasser.« Sie nahm einen dritten Topf, füllte das Wasser aus den Flaschen hinein und stellte den Topf wieder auf das rechte vordere Feld. Als sie nach dem zweiten Wassertopf greifen wollte, hielt Lenny ihre Hand fest.
»Warte«, sagte er schnell. »Lass ihn auf der anderen Platte stehen. Ich will sehen, was passiert.«
Sie zuckte mit den Achseln. »Wie du meinst.«
Sie setzten sich zurück an den Tisch. Als Lenny seine zweite Brötchenhälfte gegessen hatte, brodelte das Mineralwasser. Nina legte die Eier hinein und fünf Minuten später waren sie endlich fertig. Während Emily mit dem Löffel fröhlich auf das Ei einschlug, schaute Lenny zum Herd. Warum kochte das Leitungswasser nicht? Sie wohnten in einem Neubaugebiet, keines der Reihen- und Einzelhäuser in dieser Gegend war älter als zwei Jahre. Ob tatsächlich etwas mit den Wasserleitungen nicht stimmte? Er verwarf den Gedanken. Immerhin wohnten sie schon seit über einem Jahr in diesem Haus und nie hatte das Wasser irgendwelche Probleme gemacht.
Als er eine halbe Stunde später den letzten Schluck seines Saftes austrank, weiteten sich Ninas Augen. »Schau mal«, sagte sie, nickte Richtung Herd und fuhr sich mit den Händen langsam durch ihr schulterlanges dunkelbraunes Haar.
Lenny drehte sich um. Endlich hatte das Leitungswasser angefangen, zu kochen. Das Wasser blubberte im Topf, und eine breite Dampfwolke zog hinauf zur Dunstabzugshaube.
Pfeifend holte Lenny seine Sporttasche aus dem Schlafzimmerschrank. Sonntags nach dem Frühstück ging es zum Volleyballspielen. Dieser Termin war unumstößlich. Gewisse Freiheiten musste man einfach beibehalten, auch wenn die Kinder immer ein wenig traurig schauten, wenn er seine Tasche packte. Sie hätten den Vormittag sicher auch gern mit ihrem Vater verbracht.
Emily stand am Türrahmen und machte ein langes Gesicht. »Spielst du gar nicht mit uns?«
Er gab ihr einen Stups auf die Nase und lachte. »Natürlich spiele ich nachher mit euch. Aber zuerst muss ich zum Training.«
»Volleyball ist blöd.«
Er schloss den Reißverschluss und schulterte die Tasche. »Zum Mittagessen bin ich doch schon wieder da.«
Es gab nur eine Straße, die aus dem Neubaugebiet herausführte. Als die Felder direkt vor dem Wald vor mehreren Jahren als Baugrundstücke ausgewiesen worden waren, war er einer der Ersten gewesen, der sich ein Grundstück reserviert hatte. Die Stadt Reinbek hatte lange mit der Erschließung gewartet, dabei war die Lage kaum zu übertreffen. Das Gebiet lag zwar ein wenig abseits der Kleinstadt, dafür aber mitten in der Natur. Und neben den unzähligen Wohnhäusern, die hier gebaut worden waren, hatten die Planer auch die Infrastruktur nicht vergessen. So gab es einen Supermarkt, einen Drogeriediscounter und einen Bäcker in unmittelbarer Nachbarschaft. Er setzte den Blinker und fuhr auf die Hauptstraße. Die Schule, in der das Training stattfand, befand sich am anderen Ende von Reinbek.
Fünfzehn Minuten später bog er auf den Parkplatz vor der Turnhalle ab. Obwohl sie eine Hobbygruppe waren, bei der jeder neue Volleyballfreund herzlich aufgenommen wurde, hätte Lenny sich gern etwas mehr Professionalität gewünscht. In letzter Zeit kamen vermehrt Leute zum Training, die Volleyball anscheinend als bequeme Möglichkeit sahen, mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen. Dagegen hatte Lenny grundsätzlich auch nichts einzuwenden, blöd war nur, dass diese Unterhaltungen vornehmlich während des Spieles stattfanden. Wurde Zeit, dass mal wieder ein paar sportlichere Menschen den Weg in die Gruppe fanden, sonst würde es für ihn hier bald zu langweilig werden.
»Hallo Lenny«, begrüßte ihn ein untersetzter Mann am Eingang, der genau in diese Labertaschenkategorie fiel. »Heute spielst du aber in unserer Gruppe, ja? Ich möchte auch mal gewinnen.«
Lenny vollführte eine kreisende Bewegung mit der Hand. »Wir tauschen nach einem Spiel doch sowieso immer querbeet die Leute.«
Sie gingen die Stufen hinunter und kamen in einen langen Flur, von dem verschiedene Türen abgingen.
»Ich muss noch mal wohin«, kündigte sein Sportsfreund laut an. »Ich hatte zum Frühstück gebratenen Bacon. Der tanzt jetzt ein bisschen zu ausgelassen in meinem Magen herum. Vielleicht krieg ich ihn wieder raus.«
Lenny lachte gequält. Auf diese Information hätte er gut und gerne verzichten können. Hastig öffnete er die Tür zur Umkleide und trat ein. Joachim saß auf einem Holzbänkchen und grinste ihn schelmisch an.
»Du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen«, stellte er fest.
»Einen Geist mit schwerem Magen.«
»Umso besser. Wir werden sie alle vom Erdboden schmettern.«
Lenny klopfte ihm auf die Schulter und setzte sich neben ihn. Joachim war in all den Jahren, in denen er in dieser Gruppe schon Volleyball spielte, zu einem echten Freund geworden. Obwohl zwölf Jahre älter, schmetterte Joachim beinahe noch besser als er. Und das sollte schon was heißen.
Joachim stand auf und reckte sich. Man sah seinem schlaksigen Körper auf dem ersten Blick nicht an, wie viel Power in ihm steckte. Sie gingen in die Halle, heute waren fast alle Leute zum Training gekommen. Sie konnten zwei komplette Mannschaften bilden. Die Aufteilung im ersten Match erwies sich als ungünstig, die Gruppe um Joachim und Lenny war einfach zu stark. Dabei hielt sich Lenny schon zurück. Wenn ein Ball nicht gerade direkt auf ihn zuflog, überließ er die Annahme seinen Mitspielern. Seine Gedanken schweiften ab. Er dachte an das nicht kochen wollende Wasser. Merkwürdig war das schon gewesen.
Als sie den Gegner zu null besiegt hatten, machten sie Pause. Joachim holte ein isotonisches Erfrischungsgetränk aus seiner Tasche und sah ihn fragend an. »Lenny, was ist mir dir? Ärger mit Nina oder den Kids?«
»Wieso?«
»Du wirkst ein wenig abwesend.«
»Ich hatte Ärger mit meinem Kochtopf. Oder dem Herd. Oder aber dem Wasser.« Lenny grinste, als er in Joachims fragenden Gesichtsausdruck schaute, und erzählte von den Vorkommnissen während des Frühstücks. »Es dauerte länger als eine Dreiviertelstunde, bis das Wasser endlich zu kochen anfing. Da waren wir schon längst fertig.«
Joachim trank einen großen Schluck. »Ich habe mal von einem Vorfall in Holland gelesen«, begann er. »Dort wurde ebenfalls ein Neubaugebiet aus dem Boden gestampft. Plötzlich wurden viele der Leute, die gerade frisch in ihre Heime gezogen waren, krank. Man rätselte einige Tage über die Ursachen, bis man bei Bauarbeiten eher zufällig auf den Grund des Phänomens stieß.« Joachim machte eine Pause und drehte den Deckel der Flasche zu.
»Und? Spann mich nicht auf die Folter«, drängelte Lenny.
»Nun, irgend so ein Rindvieh von Klempner hatte ein Verbindungsstück eines Abwasserrohres mit dem Trinkwasserkreislauf verbunden.«
»So was geht?«
»Theoretisch wohl ja. Ich glaube zwar, dass die Rohrleitungen für Trink- und Abwasser gänzlich unterschiedlich sind, aber möglich ist wahrscheinlich alles. Jedenfalls wurde das saubere Wasser kontinuierlich mit dem schmutzigen Wasser kontaminiert. Die Leute, die das Wasser dann direkt aus dem Hahn getrunken haben, wurden krank.« Jemand pfiff. »Lasst uns weitermachen.« Joachim stand auf und reckte sich. Noch bevor Lenny antworten konnte, hatte sich der Baconliebhaber bei Joachim eingehakt und schleifte ihn auf die andere Feldseite.
»Jetzt musst du aber für uns spielen«, sagte er streng.
Es wurden noch zwei weitere Spieler ausgetauscht und das folgende Match gestaltete sich wesentlich ausgeglichener. Das lag nicht zuletzt an Lenny. Er versuchte zwar, sich mehr ins Spiel einzubringen, war aber in vielen Situationen nicht auf der Höhe. Immer wieder musste er an das Wasser im Kochtopf denken. Was wäre, wenn in ihrer Wohnsiedlung auch etwas im Argen lag? Plötzlich hatte er Angst um seine Familie. Zum Glück tranken seine Kinder fast ausschließlich kohlensäurehaltiges Mineralwasser aus der Flasche, sie mochten nichts, was nicht sprudelte. Selbst Kindertee verschmähten sie. Dennoch beruhigte ihn dieser Gedanke nicht wirklich.
Als das zweite Spiel beendet war, hatte er es eilig, in die Umkleidekabine zu kommen. Joachim lief hinter ihm her. »Ich hoffe, ich bin nicht schuld, dass du noch nervöser als vorhin aussiehst?«, fragte er.
Lenny atmete laut aus. »Und wenn bei uns das Wasser auch verschmutzt ist?«
Joachim setzte sich auf die Bank und zog sein grünes Polohemd aus. »Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Die Sache in Holland war schon ziemlich verrückt. Außerdem dürfte das Wasser dort ganz normal gekocht haben, wenn man es erhitzte. Abkochen wäre in so einem Fall sogar gut gewesen, da es viele Bakterien abtötet.«
Lenny warf seine Shorts lustlos in die Sporttasche. »Ich habe dennoch ein komisches Gefühl. Kannst du nicht mal kurz bei uns vorbeischauen? Du bist doch Chemiker. Vielleicht fällt dir etwas auf.«
Joachim nahm sein Duschgel und nickte. »Wenn es dich beruhigt.« Er grinste. »Was macht Nina eigentlich zum Mittagessen?«
Als Lenny auf den Parkplatz trat, lehnte Joachim an einem der Bäume, hielt sein Handy ans Ohr und lachte laut. »Meine Frau hat mir die Erlaubnis gegeben, heute auswärts zu speisen.«
»Und deine Töchter?«
Joachim schaute ihn einen Augenblick lang an, als hätte Lenny den Verstand verloren. »Warte mal ab, bis deine Kinder langsam flügge werden. Meine Erstgeborene weilt heute den ganzen Tag bei der Familie ihres neuen Lovers, und Melanie ist immer froh, wenn sie nicht beide Alten auf einmal ertragen muss.«
Lenny lachte. »Es leben die Kinder.«
»Das kannst du laut sagen.«
Während der Fahrt rief Lenny zu Hause an und kündigte den Mitesser an. Nina freute sich auf Joachim, sie mochte es, wenn Trubel im Haus herrschte. Lenny fuhr auf die Hauptstraße und sah in den Rückspiegel, Joachims alter Volvo befand sich hinter ihm. Er trat auf die Bremse, als der Wagen die Zufahrtsstraße des Neubaugebietes erreichte. Das halbe Gebiet war Tempo-30-Zone, die andere Hälfte war als Spielstraße ausgewiesen. Behutsam fuhr er über einen steilen, gepflasterten Hügel auf der Fahrbahn und bog in seinen Carport ein. Er öffnete den Kofferraum und wartete auf Joachim, der auf der gegenüberliegenden Straßenseite parkte. Vor dem Zaun des Nachbarhauses stand Fred Iversen mit vor dem Bauch verschränkten Armen und diskutierte sichtlich aufgeregt mit einem Mann im dunkelblauen Overall. Fred schien sich über irgendetwas furchtbar aufzuregen, auf seinem markanten Gesicht glänzte der Schweiß. Fred wirkte mit seinem massigen Körper, der tadellosen Glatze und den abstehenden Ohren ohnehin wie ein gefährlicher Preisboxer. Fehlte eigentlich nur noch die breitgeschlagene Nase. Seine Nase war im Gegensatz zum übrigen Gesicht geradezu filigran. Seine braunen Augen bohrten sich förmlich in das Gesicht seines Gegenübers, Fred war generell ein recht aufbrausender Typ. Der Mann im Overall ging einen Schritt zurück. Hinter Fred stand seine Frau Sabine. Normalerweise sah sie mit ihren pechschwarzen langen Haaren, der Stupsnase und ihren strahlend blauen Augen ziemlich verführerisch aus. Lenny hatte sich schon manches Mal dabei erwischt, wie er ihr etwas zu lange hinterherschaute, wenn sie sich zufällig trafen insbesondere, wenn Sabine ihr charmantes Lächeln aufsetzte. Jetzt jedoch lächelte sie nicht, sondern hörte der Diskussion mit zusammengekniffenem Mund zu und hatte ihre Hände zu Fäusten geballt. Es sah so aus, als würde Sabine den armen Mann gleich verdreschen wollen. Sie blickte auf und bemerkte Joachim und ihn. Sofort entspannten sich ihre Gesichtszüge. Sabine lächelte und schlenderte auf sie zu.
»Wie war das Training?«, fragte sie und schob sich die ohnehin schon kurzen Ärmel ihres T-Shirts über die Schultern.
»Gut wie immer«, gab Lenny zurück und versuchte, nicht so sehr auf ihre braun gebrannte, makellose Haut zu achten.
»Ich würde gern mal mitkommen. Insbesondere das gemeinsame Duschen hinterher stelle ich mir cool vor.«
Joachim grinste wie ein Honigkuchenpferd. Noch ehe Lenny etwas erwidern konnte, gesellte sich Fred zu ihnen. Er grüßte ihn und Joachim kurz und stieß ein gefährlich klingendes Knurren aus. »Dieser Mistkäfer von einem Studenten«, sagte er.
»Was ist passiert?«, fragte Joachim.
»Dieser Hamster stellt sich mit seinem Lieferwagen doch einfach vor unsere Nase, um ein olles Sofa auszuladen.«
Lenny schaute auf den Bürgersteig, der am Haus der Iversens vorbeiführte. Der junge Mann startete eben den Motor und fuhr davon. »Na ja, das ist öffentlicher Parkraum«, sagte er langsam.
Erneut knurrte Fred. »Mir doch egal. Der Scheißkerl soll da nicht stehen. Versperrt mir die Sicht aus dem Fenster.« Er drehte sich halb auf die Straße und stierte dem Transporter hinterher.
»Wenn der Kerl da vorn wieder stehen bleibt, verpasse ich ihm eine Klatsche.«
Lenny seufzte. »Na, wir müssen. Das Mittagessen wartet.« Er öffnete die Pforte zu seinem Grundstück und huschte hinein. Hinter ihm schloss Joachim die Pforte gewissenhaft.
»Fred und Sabine sind besser als jedes Kino«, stellte er noch immer grinsend fest.
Jetzt war es Lenny, der knurrte. »Aber müssen sie ausgerechnet direkt im Nachbarhaus wohnen?«
»Seid Ihr schon mal aneinandergeraten?«
»Nein. Bisher nicht. Die beiden sind im Grunde so, wie man sich Nachbarn wünscht. Sie hören keine laute Musik, feiern keine großen Partys und gehen früh ins Bett.«
»Aber?«
»Fred neigt zu Streitereien. Mit mir und Nina kommt er gut aus, aber mit vielen Nachbarn hat Fred es sich bereits verdorben. Dabei wohnen die beiden erst seit einem halben Jahr in diesem Haus.« Lenny öffnete das Seitenfach seiner Sporttasche und holte einen Schlüsselbund hervor. Als sie vor der Haustür standen, knisterte es hinter dem Zaun auf der anderen Grundstücksseite. Karl Friese kniete in einem Beet und zupfte winzig kleine Unkrautpflanzen aus der Erde.
»Hallo Karl«, rief Lenny. »Bei dir hat Unkraut wirklich keine Chance.«
Karl sah auf und entblößte ein strahlend weißes Gebiss dritter Zähne. »Nicht mal einen Tag«, gab er nickend zurück.
Als sie in den Flur traten, stellte Lenny seufzend seine Tasche ab. »Jetzt habe ich aber Hunger.«
Nina steckte ihren Kopf aus der Küche. »Hi Joachim. Ihr kommt genau richtig.« Sie rief nach den Kindern und kurz darauf kamen Justin und Emily die Treppe herunter gerannt. Justin knuffte seinem Vater in den Bauch.
»Habt Ihr sie fertiggemacht?«, fragte er laut.
Lenny schüttelte den Kopf. »Wo hast du bloß diese Ausdrucksweise her?«
»Ja, wir haben sie fertiggemacht«, sagte Joachim und grinste Lenny an. »Das ist doch noch gar nichts. Warte mal ab, mit was für Worten er in ein paar Jahren um sich schmeißt.«
»Du hast es heute«, stellte Lenny fest und lachte. »Du willst mir wohl unbedingt Angst machen.«
Joachim strich Emily über die Haare und ging Richtung Küche. »Apropos Angst. Wie war das mit dem Wasser?«
»Ich zeige es dir.«
Nina hatte das Wasser nicht weggeschüttet. Der Topf stand neben der Spüle. Joachim näherte sich dem Gefäß, als könnte es jeden Augenblick explodieren, beugte sich darüber und schnüffelte laut. Dann steckte er seinen Finger hinein und rührte damit in der Flüssigkeit umher, bevor er das Licht unter einem der Hängeschränke einschaltete und den Topf darunter hielt. »Es riecht nicht«, stellte er fest und stellte den Topf wieder ab. »Und klar sieht das Wasser auch aus. Auf alle Fälle sind da keine Fäkalienrückstände drin.«
Nina atmete erschrocken ein. »Fäkalienrückstände?«, fragte sie besorgt. Lenny erzählte ihr die Geschichte aus Holland.
»Ich möchte das Wasser dennoch vorsichtshalber untersuchen«, sagte Joachim. »Ich würde gern eine Probe mit ins Labor nehmen.«
»Prima Idee«, stimmte Lenny zu. Es tat gut, dass sich Joachim so gewissenhaft um die Sache kümmerte. Wen sonst hätte er auf die Schnelle ansprechen können? Nina holte eine leere Plastik-Wasserflasche aus einem Korb hinter der Tür. Joachim stellte sie in das Spülbecken und kippte den Inhalt des Topfes hinein. Dann schloss er die Flasche sorgfältig.
»Ich möchte auch gern noch eine Probe aus der Leitung mitnehmen«, sagte Joachim. Lenny griff nach einer zweiten Flasche, hielt sie unter den laufenden Wasserhahn und stellte sie neben die erste. »Habt ihr einen wasserfesten Stift?«, fragte Joachim.
»Nein, aber kleine weiße Aufkleber«, antwortete Nina, öffnete eine Schublade und reichte ihm eine Folie.
»Ich will nur markieren, wo das ungekochte Wasser drin ist«, erklärte Joachim, während er einen Aufkleber quer über eine der Flaschen klebte. »So«, brummte er sichtlich zufrieden. Dann fiel sein Blick auf den gedeckten Tisch und seine Miene verfinsterte sich. »Was gibt es eigentlich zum Mittagessen?«
»Pizza.« Nina lachte. »Am Sonntag bestimmen die Kinder den Speiseplan. Meistens jedenfalls.«
Joachim nickte zufrieden. »Gut. Also nichts, was irgendwie mit Wasser zubereitet werden müsste. Ich möchte euch raten, auch heute Abend von jeglichem Wassergebrauch abzusehen. Ebenso morgen früh. So lange, bis ich erste Ergebnisse vorliegen habe.«
Lenny schnitt die Pizza in kindgerechte Stücke und ließ sich zufrieden auf seinen Stuhl fallen. Wie gut, dass Joachim unverzüglich seine Hilfe angeboten hatte. Jedenfalls fühlte er sich schon viel entspannter als noch heute Morgen. Emily sagte einen Gebetsspruch auf, den sie im Kindergarten gelernt hatte. Auch Justin kannte die Verse und fiel in das Gemurmel ein. Lenny schaute die beiden liebevoll an. Er nahm Ninas Hand und drückte sie fest. Alles war gut.
2
Joachim setzte sich in seinen alten Volvo und gähnte herzhaft. Heute Morgen ging es früher als sonst in die Firma. Er konnte sich noch immer nicht so recht vorstellen, warum das Wasser bei Lenny plötzlich so schwer kochen wollte. Wahrscheinlich war doch nur ein Wackelkontakt im Herd dafür verantwortlich. Immerhin hatte auch die Geschirrspülmaschine bei den Eggerts bereits nach wenigen Monaten ihren Dienst versagt. Der Motor oder die Pumpe oder was auch immer war durchgeschmort. Lenny hatte es ihm erzählt, aber so einen technischen Kram vermochte er sich nie lange zu merken. Bestimmt verhielt es sich mit dem Herd ähnlich, vielleicht hatte der Küchenlieferant einfach minderwertige Ware eingekauft. Dennoch konnte er Lenny gut verstehen. Gerade wenn die Kinder noch klein waren, machte man sich schnell alle möglichen Sorgen. Und für ihn bedeutete es nicht allzu viel Aufwand, das Wasser einmal gründlich durchzuchecken.
Die Neonröhren gaben summende Geräusche von sich, als Joachim das Licht einschaltete. Wieder gähnte er. Die allwöchentliche Montagsbesprechung fand um zehn Uhr statt. Bis dahin blieben ihm noch drei Stunden. Zeit genug, um die Wasserproben ausgiebig zu untersuchen. Das alte Radio, das sein Vater ihm Mitte der Sechzigerjahre geschenkt hatte, quäkte mit einem blechern klingenden Sound durch den Laborraum. Aus einem halbhohen Schrank an der Wand holte Joachim mehrere Reagenzgläser, stellte sie in eine Halterung und öffnete die Flaschen. Das Wasser sah noch immer völlig normal aus. Es roch nicht und war so klar, wie Wasser eben sein musste. Nachdem er das Wasser zusammen mit verschiedenen Flüssigkeiten in die Reagenzgläser getröpfelt hatte, ließ er sich auf seinen Stuhl fallen und betrachtete die Proben. In zwei Gläsern leuchtete ihm eine blaue Mischung entgegen. Zwei weitere Gläser waren trüb geworden. Brummend stand er auf. Blau bedeutete basisch. Der pH-Wert des Wassers war zu hoch. Und irgendwas war da noch, sonst wären die anderen Proben nicht trüb geworden. Ein Zusatzstoff vielleicht, der da nicht hingehörte. Zwecklos, darüber zu spekulieren. Die Mittel, die ihm in diesem Labor zur Verfügung standen, eigneten sich nicht für eine aussagekräftige Analyse. Außerdem war ihm noch immer nicht klar, wonach er eigentlich suchen sollte. Sein Labor war für umfangreiche Wassertests nicht ausgelegt. Ein Leitwert-Messgerät wäre nicht schlecht. Damit würden sich Rückschlüsse auf den Fremdstoffanteil im Trinkwasser ziehen lassen. Außerdem gab es Geräte, mit denen Schwebstoffe, Bakterien und Viren leichter erkannt werden konnten. Die Kollegen in den anderen Abteilungen verfügten über ein paar dieser Hilfsmittel, die er sich nun erst einmal mühsam zusammensuchen musste. Das würde einige Zeit dauern. Dabei hatte er versprochen, sich bereits am Vormittag mit ersten Ergebnissen zu melden. In Gedanken sah er Nina das Wasser aus Mineralwasserflaschen in Töpfe schütten, nur um kein Leitungswasser zu verwenden. Und wenn alles doch ganz harmlos war? Er war ihnen eine schnelle Antwort schuldig. Am wichtigsten war zunächst einmal herauszufinden, ob eine konkrete Gefahr für die Gesundheit vorliegen würde, wenn man das Wasser trinken würde. Und da hatte er schon eine Idee.
Joachim verließ sein Labor und rannte fast über den breiten hellen Flur, an dessen Wänden moderne Kunstwerke hingen. Sie standen hier im Dienste eines Konzerns, der Düngemittel herstellte. Da gab es auch Versuchstiere. Im Erdgeschoss befanden sich unzählige Käfige mit Mäusen, Ratten, Hamstern, Hörnchen und Kaninchen. Als er vor vielen Jahren in dieser Einrichtung zu arbeiten begann, hatte er ein beklemmendes Gefühl deswegen gehabt. Aber mittlerweile hatten sich alle seine Vorurteile aufgelöst. Den Tieren ging es dort unten besser als in vielen privaten Haushalten. Sie hatten geräumige Käfige. Doch das Wichtigste war, dass sie nicht sinnlos verheizt wurden. Die meisten Düngerarten mussten umweltverträglich sein. Neue Stoffe wurden den Tieren in die Nahrung gemixt. Oft kam es nur zu allergischen Reaktionen bei ihnen, von denen sie sich schnell wieder erholten. Nur selten starben Tiere in Folge der Entwicklung eines neuen Wirkstoffes. Zwar stellte der Konzern auch Giftstoffe her, die gegen Ameisen, Pilze oder Schnecken verwendet wurden, aber damit hatte man zumindest in dieser Zweigstelle nichts zu tun. Und das war ihm auch ganz lieb. Er klopfte an eine schlichte weiße Tür. Hoffentlich war Ina schon da.
Eine junge Frau mit blonden langen Haaren, die ihr bis zur Hüfte gingen, öffnete die Tür und schaute ihn skeptisch an. »Joachim. Meine Güte, bist du aus dem Bett gefallen? Oder hat dich deine Frau rausgeworfen?«
»Guten Morgen Ina«, sagte er fröhlich.
Sie winkte ihn hinein und zeigte auf eine röchelnde Kaffeemaschine. »Gerade aufgesetzt. Willst du?«
»Gern.«
»Also, was machst du schon hier? Seit ich dich kenne, warst du noch nie vor neun im Labor.« Obwohl die Maschine nicht fertig war, griff Ina nach der Kanne und schenkte zwei Becher voll. Es zischte, als mehrere Kaffeetropfen aus dem Filter auf die heiße Wärmeplatte fielen. Joachim nahm einen Schluck und verzog den Mund. Daran hätte er denken müssen. Ina war wegen ihres stets viel zu starken Kaffees in der ganzen Einrichtung berüchtigt. Niemand trank ihr Gebräu Marke Doppel-Herztod. Trotzdem nahm Joachim noch einen weiteren winzigen Schluck, immerhin wollte er heute etwas von ihr.
»Ich untersuche für einen Freund eine Wasserprobe und würde sie gern einigen Tieren zu trinken geben.«
Ina sah ihn mit hochgezogenen Augenbrauen an. »Woher stammt das Wasser?«
»Direkt aus einem Wasserhahn in einer Küche. Aber es kocht nur mühsam. Und nun ist die Familie beunruhigt.« Er zuckte mit den Achseln. »Deinen Kleinen wird nichts passieren. Ich vermute, dass es irgendwie verschmutzt ist. Wenn die Nager es nicht anrühren, weiß ich Bescheid.«
Ina griff in die Brusttasche ihres Kittels und warf ihm eine Magnetkarte zu. »Nimm dir, was du brauchst. Aber wenn die Viecher Durchfall kriegen, machst du die Käfige sauber.«
Joachim lachte und stellte seine Tasse zurück auf den Tisch. »Du bist ein Schatz.« Er drehte auf dem Absatz um und öffnete die Labortür. Was für ein erfolgreicher Verlauf. Ina, die Verantwortliche für alle Versuchstiere, hatte ihm praktisch einen Freifahrtschein ausgestellt, und der ungenießbare Kaffee hatte ihn auch nicht umgehauen.
Am Ende des Flurs im Erdgeschoss gab es eine massive Eisentür. Joachim steckte die Magnetkarte in einen Schlitz, und das Schloss knackte vernehmlich. Der Raum dahinter war hell und freundlich. Fenster, die von der Decke bis zum Boden reichten, ließen die Morgensonne hinein. An der Wand brummte eine Klimaanlage. Oft war er nicht in diesem Raum. Es überraschte ihn immer wieder, wie gemütlich es hier aussah. Ganz anders, als in den vielen Labors, die ihm während seiner Ausbildungszeit begegnet waren. Meistens waren die Versuchstiere in den dunkelsten Kellerräumen untergebracht und fristeten dort ein trostloses Dasein unter Kunstlicht. Dagegen wirkte dieser sonnendurchflutete Raum geradezu paradiesisch. Sämtliche Käfige waren auf der gegenüberliegenden Seite der Fenster aufgestellt. In stabilen, zwei Meter hohen Stahlregalen, standen sie in vier Ebenen übereinander. Ganz unten tummelten sich die Kaninchen, darüber die Hamster, Streifen- und Eichhörnchen und wiederum darüber die Ratten. In den obersten Käfigen befanden sich die Mäuse.
Es war erstaunlich ruhig. Immer wenn er hier war, verwunderte ihn die Stille. Kaum ein Tier raschelte oder quiekte. Das war schon irgendwie unheimlich. Joachim wandte den Blick von den Käfigen ab und schaute suchend in die Ecken. Dort standen der fahrbare Tisch und die kleinen Transportkäfige. Mit jeweils vier Exemplaren von allen Tieren wollte er arbeiten. Je zwei Tiere gleicher Gattung kamen in die Transportkäfige.
Als er alle Tiere verfrachtet hatte, stutzte Joachim. Ob das nicht doch ein wenig übertrieben war? Reichten nicht auch eine Handvoll Nager? Nein, je mehr, desto besser. Viele Tiere besaßen ausgeprägte Geruchs- und Geschmackssinne. Sie würden merken, wenn etwas mit dem Wasser nicht stimmte.
Aus einem Karton holte Joachim Dutzende kleiner Trinkflaschen und Keramiknäpfe. Dann schob er den Tisch vorsichtig zum Ausgang. Endlich drangen ein paar Geräusche an seine Ohren. Zwei der Mäuse piepsten leise. »Keine Angst. Euch passiert nichts. Da bin ich mir ziemlich sicher.« Joachim trug die Tiere aus einer Liste aus, die neben der Tür hing. Wenn man das vergaß, konnte Ina fuchsteufelswild werden. Etwas, was man ihr überhaupt nicht zutraute. Die Türen des Fahrstuhles standen offen, die meisten Kollegen kamen nicht vor acht zur Arbeit. Das passte ihm ausgezeichnet, so musste er nicht erst lange auf den Lift warten. Außerdem ersparte es ihm langwierige Erklärungen, wozu er all die Tiere brauchte.
Bevor sich der Fahrstuhl in Bewegung setzen konnte, sprang ein Mann in die Kabine. »Grad noch erwischt«, sagte er hechelnd und öffnete einen Knopf seines Mantels. »Guten Morgen Joachim.«
»Hallo Franz.«
»Du bist früh heute.«
»Ja.«
»Was hast du denn mit den ganzen Fellfreunden vor?«
Joachim verzog den Mund. Zu früh gefreut. »Nur einen kleinen Test.«
»Dafür sind das aber viele.«
»Ach, geht.«
»Na ja.« Es klingelte und die Türen öffneten sich.
»Wir sehen uns nachher bei der Besprechung, Joachim.«
»Ja, bis dann, Franz.«
Das gekochte Wasser konnte warten. Zunächst wollte Joachim sich auf das frische Leitungswasser konzentrieren. Die Näpfe und Trinkflaschen füllte er bis zu einer Markierung auf und stellte sie in die Käfige. Einige der Tiere trennte er voneinander und setzte sie in Einzelkäfige, auf diese Weise würde besser zu beobachten sein, wie viel Wasser jedes Tier trank. »Jetzt heißt es abwarten«, sagte er laut in den Raum hinein und ließ sich schnaufend auf seinen Stuhl fallen. Seine Finger griffen zum Telefon und wählten Lennys Nummer. Nina hob ab. Sie freute sich offenbar, von ihm zu hören. »Leider wird es noch eine Weile dauern, bis ich Ergebnisse habe«, sagte Joachim.
»Kein Problem. Ich habe genügend Mineralwasser im Haus«, antwortete Nina. »Wir werden das Leitungswasser nicht anrühren, bis du Entwarnung gegeben hast.«
Er versprach, sich zu melden, sobald es Neuigkeiten geben würde, und vertiefte sich in die Unterlagen eines Mitarbeiters zu einem bestimmten Düngerstoff.
Irgendwann wurde die Labortür geöffnet und ein hagerer Mann steckte den Kopf in den Raum. »Ich wollte dich zur Besprechung abholen.«
»Ist es schon soweit?«, fragte er überrascht und schaute auf die Uhr.
Der Kollege nickte ernst. »Ja. Und es stehen jede Menge Punkte auf dem Programm.«
Joachim atmete laut aus und erhob sich. »Na prima. Dann werden wir ja wieder bis zum späten Nachmittag tagen.«
»Mindestens«, erwiderte der Kollege.
3
Lenny lag auf dem Boden und starrte auf die Rückwand des Kühlgerätes. »Der Kompressor ist defekt«, stellte er fest.
Der Restaurantbesitzer, ein Ire namens Caine, hopste wie eine aufgescheuchte Möwe hinter seinem Rücken umher. »Ne. Der kühlt nicht mehr.«
Lenny seufzte. »Eben deswegen kühlt er nicht mehr.«
»Wenn Sie das Ding nicht wieder heil kriegen, können wir heute nicht öffnen.«
»Wir kriegen das Ding wieder heil. Keine Sorge.« Manchmal fragte Lenny sich, ob er diesen Beruf noch bis zu seiner Rente ausüben wollte. Doch was sollte er stattdessen machen? Er war nun einmal spezialisiert darauf, Großkühlschränke zu reparieren. Mit vierzig war es zu spät umzusatteln. Aber die ganze Hektik ging ihm mehr und mehr auf die Nerven. Solche Geräte standen nun mal meistens in Restaurants, Großküchen und Kantinen, da war es grundsätzlich eine Katastrophe, wenn ein Defekt auftrat.
Auch Caines Stimme schnappte nun fast über, als sich sein massiger Körper tänzelnd um den Kühlschrank bewegte. »Was für ein Unglück. Da liegt das ganze teure Lammfleisch drin. Wie schnell bekommen Sie einen neuen Kompressor?«
»Vielleicht kann ich den Fehler reparieren.«
»Und wenn nicht? Und wenn nicht?«
Das Schlimmste war, dass er für seinen Job eigentlich Ruhe brauchte. Moderne Kühlgeräte besaßen mitunter eine komplizierte Technik. Es war schwer, sich zu konzentrieren, wenn dauernd jemand lamentierte. »Womöglich ist es nur ein Wackelkontakt.«
Der Ire blieb abrupt stehen. »Ich habe an dem Ding nicht gewackelt«, rief er hektisch.
O Mann. Nur nicht weiter hinhören. Lenny zog an einem kleinen Draht, und endlich gab der Kompressor ein Lebenszeichen von sich. Wahrscheinlich hatte sich nur die Verbindung gelöst. Er stand auf und ging zu seinem Werkzeugkasten. »Mit diesem neuen Draht geht das Dingwieder heile«, sagte er beschwichtigend, als sein Blick das offensichtlich nervös zuckende Gesicht des Iren streifte. Sein Handy klingelte.
Sofort wurde der Ire noch fahriger. »Sie können jetzt nicht weg. Hier ist ein Notfall«, sagte er gehetzt.
Lenny lächelte ihm zu. »Ich will auch nicht weg. Keine Angst.« Er nahm sein Telefon und meldete sich.
Joachim war dran, und seine Stimme klang nervös. »Hallo Lenny.«
»Hallo Jo. Nina hat mich schon über deinen Anruf heute Morgen informiert. Wir bleiben bei Mineralwasser«, sagte er. Am anderen Ende der Leitung herrschte für einen Moment Ruhe.
Joachim räusperte sich. »Ach so, ja. Aber das ist es nicht. Inzwischen ist allerhand passiert. Komm her, so schnell du kannst.« Bevor Lenny antworten konnte, hatte Joachim aufgelegt. Joachim klang fürchterlich. Was hatte ihn so erschreckt?
Der Ire schaute ihn aufmerksam an. »Noch ein kaputtes Ding?« Lenny schüttelte den Kopf.
»Nein, nein«, sagte er schnell, nahm den Draht wieder auf und kniete sich hinter den Kühlschrank. Wurde Zeit, dass er die Reparatur zum Abschluss brachte.
Das Restaurant verließ Lenny im Laufschritt. Warum war Joachim so kurz angebunden gewesen? Hatte er womöglich etwas im Wasser entdeckt, oder wollte er ihn nur nicht bei der Arbeit stören? Joachim wusste, dass Lenny mitunter schlecht telefonieren konnte, wenn es bei einem Kunden, im wahrsten Sinne des Wortes, heiß herging.
Lenny fuhr los, stellte das Radio an und versuchte, auf das laufende Programm zu achten. Dennoch verließ ihn die Unruhe nicht, im Gegenteil, sie wurde permanent stärker. Als sein Auto auf den Firmenparkplatz der Laboreinrichtung fuhr, hatte er das Gefühl, als würde etwas in seiner Brust vor Aufregung gleich platzen.
Der Pförtner gab ihm eine leuchtend grüne Karte mit der Aufschrift Besucher, die an der Brusttasche seines schweren Arbeitshemdes angebracht werden musste. Der Weg zu Joachims Labor war ihm vertraut. Noch ehe er die Klinke zu fassen bekam, schwang die Tür auf.
Joachim schaute ihn mit großen Augen an. »Komm«, sagte er heiser. Auf seiner Stirn zeigten sich unzählige, kleine Falten.
»Was ist denn um Himmels willen passiert?«, fragte Lenny, während er in den Raum ging.
Anstatt zu antworten, rannte Joachim an ihm vorbei. Auf vier aneinandergeschobenen Tischen an der Seitenwand standen unzählige Käfige. Joachim stellte sich vor sie und schüttelte den Kopf. »Schau.«
Vorsichtig ging Lenny näher. Ihm war bekannt, dass hier im Labor hin und wieder Versuchstiere zum Einsatz kamen, und diese Vorstellung fand er grässlich. Da ihm die Freundschaft mit Joachim viel bedeutete, schnitt er das Thema nie an, wenn sie zusammen waren. Jeder hatte die eine oder andere Leiche im Keller, über die man nicht sprach. Joachim hatte sie im Labor. Lenny versuchte, diesen Gedanken beiseitezuschieben, während er sich neben Joachim stellte. Sein Blick fiel in die Käfige. Die Tiere sahen alle auch ziemlich friedlich aus. Sehr friedlich sogar. Die Kaninchen kuschelten an der Käfigwand miteinander. Die Mäuse lagen verstreut in ihren Gefängnissen herum. Zwei Eichhörnchen hatten sich einander gegenüber gelegt und die buschigen Schwänze um die kleinen, runden Körper geschlungen. In keinem der Käfige herrschte Trubel. Überall lagen die Tiere reglos auf dem Boden, als wären sie in eine geisterhafte Starre verfallen. Ihn überkam ein schrecklicher Verdacht. Er fasste Joachim an die Schulter. »Sie sind doch nicht etwa …«
»Tot?«, fragte Joachim. Lenny konnte nicht sagen, wie froh er war, als Joachim energisch den Kopf schüttelte. »Nein, die Tiere sind nicht tot. Aber sie sind völlig apathisch«, sagte er langsam.
»Apathisch?«
»Ja. Sie wirken, als hätte man sie ruhiggestellt. Wie Raubkatzen, denen man einen Beruhigungspfeil durch das Fell gejagt hat.« Joachim ging auf einen der Käfige zu und öffnete den Deckel. Zwei putzige braun-schwarz gefleckte Hamster saßen neben einer kleinen Schüssel und sahen aus, als ob sie schlafen würden. Joachim strich ihnen behutsam über das Fell. Sie rührten sich nicht. Er fuhr mit seinem Finger sanft um die Schnurrhaare des einen Tieres. Das Gesicht zuckte. Wahrscheinlich kitzelte Joachims kleiner Finger. Der Hamster machte eine unglaublich schwerfällige Bewegung und rutschte eine Handbreit zur Seite. Dann verfiel der Fellknäuel wieder in seine Starre. »So verhalten sich sämtliche Tiere«, stellte Joachim fest, als er den Käfig wieder schloss. »Sie schlafen nicht wirklich. Sie sind … einfach außer Gefecht gesetzt. Eben ruhiggestellt.«
Lenny schnaufte laut. »Das ist beängstigend.«
Joachim drehte sich um und schaute ihm in die Augen. »Beängstigend ist, dass die kleinen Racker heute Morgen allesamt noch quicklebendig waren. Und dann haben sie von dem Wasser getrunken, das ich aus deinem Wasserhahn habe.« Er deutete auf einen Käfig, in dem zwei Ratten mit ausgestreckten Beinchen auf dem Rücken lagen. Sie sahen aus, als wären sie vergiftet worden. Wenn man ganz genau hinschaute, konnte man jedoch die unscheinbare Fellbewegung sehen, die einem verriet, dass die kleinen Herzen noch schlugen. Joachim zeigte auf eine Flasche. »Heute ist ein warmer Tag. Insbesondere mein Labor heizt sich schnell auf, weil es nach Süden geht. Die Tiere haben ordentlich getrunken.« Joachim tippte auf eine schwarze Markierung an der Flasche im Käfig der Ratten. Der Wasserstand lag gut und gern einen daumenbreit darunter.
»Also hat das Wasser sie so apathisch gemacht?«, fragte Lenny.
»Das ist die einzige Möglichkeit.«
»Was ist in dem Wasser?« Joachim seufzte.
»Mit den Mitteln, die ich hier zur Verfügung habe, kann ich keine aussagekräftige Analyse machen. Ich brauche andere Geräte, muss Kollegen hinzuziehen. Das kann dauern.« Er zeigte mit beiden Händen auf die Käfige. »Aber klar ist, dass das Wasser hochgradig verseucht ist. Natürlich würde sich bei Menschen nicht sofort eine derart starke Reaktion einstellen wie bei diesen Tieren. Unser Organismus ist ja um ein Vielfaches größer und stärker.«
Lenny ging zum Schreibtisch und ließ sich auf den klapprigen Bürostuhl fallen. »Nicht sehr beruhigend«, sagte er schwach. »Mein Wasser ist verseucht. Wie kann das sein? Was ist da schiefgelaufen?«
Joachim setzte sich auf die Kante des Tisches. »Noch interessanter wäre, ob wirklich nur deinWasser verseucht ist.« Er faltete seine Hände in den Schoß und schaute sie einen Moment lang an. »Das piekfeine Schlosshotel mitten im Wald ist von euch doch nicht so weit entfernt«, stellte er fest.
»Stimmt. Man fährt etwa fünf Minuten auf der kleinen Waldstraße hinter unserem Neubaugebiet. Warum?«
»In zwei Wochen gibt es dort verdammt hohen Besuch.«
Lenny brauchte eine Weile, bis er verstand. »Natürlich. Das G8-Treffen. Die Politiker tagen an der niedersächsischen Küste, aber für ein Abendessen kommen sie alle zusammen ins Schlosshotel.«
»Dessen Wasser aller Wahrscheinlichkeit ebenfalls verseucht ist.«
Lenny schaute seinen Freund mit gerunzelter Stirn an. »Was willst du damit sagen?«
Joachim stieß sich vom Schreibtisch ab und ging zurück zu den Käfigen. »Verstehst du denn nicht?«, rief er aufgebracht und betrachtete die leblos daliegenden Tiere. »Jemand vergiftet das Wasser in eurer Gegend. Und zwar das gesamte Wasser, vom Schlosshotel bis hin zu eurem Neubaugebiet.«
Lenny hob abwehrend die Hände. »Moment, Moment«, sagte er verwirrt. »Du denkst, das ist Absicht?«
»Natürlich. Ich glaube, da wird ein Mittel ins Trinkwasser gegeben, das die Regierungschefs ruhigstellen soll. Terroristen hätten dann leichtes Spiel.«
»Ein Anschlag?«, fragte Lenny geschockt. Auf was für Ideen kam Joachim bloß.
»Könnte doch sein. Vielleicht wird die Dosis in den nächsten Tagen kontinuierlich erhöht.«
»Und dann? Man kann die Staatschefs der wichtigsten Industrienationen doch nicht so einfach aus dem Hotel schaffen, selbst wenn sie bewusstlos sind. Außerdem wird es dort von Sicherheitsbeamten nur so wimmeln. Die werden kaum alle von dem Wasser trinken.«