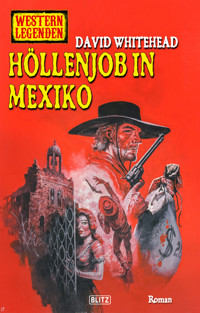3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Alfredbooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Nach seinem Abschluss an der West Point Military Academy war der in Mississippi geborene Sam Lockwood ins ferne Arizona-Territorium versetzt worden, wo er bald die feindliche Apacheria kennen- und schätzen lernte. Er wusste, dass die Apachen gefährliche Gegner waren und unerbittlich gegen ihre weißen Feinde ums Überleben ihres Volkes kämpften. Aber der Bürgerkrieg führte ihn nach Mississippi, wo er alle Schrecken eines wilden Konflikts erlebte und schließlich in Gefangenschaft geriet. Zusammen mit einigen anderen Männern erhielt er die Chance, in der Uniform der Unionstruppen wieder nach Arizona zurückzukehren und dort den Kampf gegen die Apachen fortzusetzen. Es gab jedoch einige Soldaten aus seiner Truppe, die nur an ihren eigenen Vorteil dachten - und der Wunsch nach Freiheit und schneller Beute ließ sie dabei über Leichen gehen … Sam Lockwood kämpft für Recht und Ordnung ist ein Gesamtband und beinhaltet folgende Romane von Ben Bridges: Sam Lockwood Band 1 - Trail in die Apacheria Sam Lockwood Band 2 - Lockwoods Gesetz
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 376
Ähnliche
Sam Lockwood kämpft für Recht und Ordnung
Ben Bridges
Published by BEKKERpublishing, 2019.
Inhaltsverzeichnis
Title Page
Sam Lockwood kämpft für Recht und Ordnung | – Sam Lockwood-Gesamtband – | von Ben Bridges
Klappentext:
Trail in die Apacheria | Ein Sam Lockwood-Roman – Band 1 | Kapitel Eins
Kapitel Zwei
Kapitel Drei
Kapitel Vier
Kapitel Fünf
Kapitel Sechs
Kapitel Sieben
Kapitel Acht
Kapitel Neun
Lockwoods Gesetz | Ein Sam Lockwood-Roman – Band 2 | Zum Buch:
Kapitel Eins
Kapitel Zwei
Kapitel Drei
Kapitel Vier
Kapitel Fünf
Kapitel Sechs
Kapitel Sieben
Kapitel Acht
Von Ben Biridges sind bis jetzt weiterhin in deutscher Erstveröffentlichung erschienen:
Sign up for Ben Bridges's Mailing List
Further Reading: 10 Marshal Western August 2016
About the Publisher
Sam Lockwood kämpft für Recht und Ordnung
– Sam Lockwood-Gesamtband –
von Ben Bridges
––––––––
IMPRESSUM
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E Books und BEKKERpublishing sind Imprints von Alfred Bekker
© Roman by Author
Englischer Orginaltitel: Lockwood’s Law
© Cover: Tony Masero mit Kathrin Peschel, 2019
Lektorat/Korrektorat: Kerstin Peschel
© dieser Ausgabe 2019 by Alfred Bekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen in Arrangement mit der Edition Bärenklau, herausgegeben von Jörg Martin Munsonius.
www.AlfredBekker.de
Klappentext:
Nach seinem Abschluss an der West Point Military Academy war der in Mississippi geborene Sam Lockwood ins ferne Arizona-Territorium versetzt worden, wo er bald die feindliche Apacheria kennen- und schätzen lernte. Er wusste, dass die Apachen gefährliche Gegner waren und unerbittlich gegen ihre weißen Feinde ums Überleben ihres Volkes kämpften.
Aber der Bürgerkrieg führte ihn nach Mississippi, wo er alle Schrecken eines wilden Konflikts erlebte und schließlich in Gefangenschaft geriet. Zusammen mit einigen anderen Männern erhielt er die Chance, in der Uniform der Unionstruppen wieder nach Arizona zurückzukehren und dort den Kampf gegen die Apachen fortzusetzen. Es gab jedoch einige Soldaten aus seiner Truppe, die nur an ihren eigenen Vorteil dachten – und der Wunsch nach Freiheit und schneller Beute ließ sie dabei über Leichen gehen ...
***
Sam Lockwood kämpft für Recht und Ordnung ist ein Gesamtband und beinhaltet folgende Romane:
Sam Lockwood Band 1 – Trail in die Apacheria
Sam Lockwood Band 2 – Lockwoods Gesetz
***
Trail in die Apacheria
Ein Sam Lockwood-Roman – Band 1
––––––––
Kapitel Eins
Die Geier waren zurückgekehrt. Eine Zeit lang beobachtete Sam Lockwood, wie sie mühelos durch die dünnen hohen Wolken über ihm dahinglitten, schwarz wie Kohle im orangefarbenen Sonnenlicht. Dann verdrängte er sie wieder aus seinen Gedanken. Er und seine Männer – ein bulliger, kahlrasierter Sergeant und sechs ausgemergelte Soldaten – verfolgten jetzt seit vier Tagen eine Spur, und die Geier hatten sie den ganzen Weg über begleitet.
Das war mittlerweile nichts Neues mehr.
Die Männer ritten in einer langegezogenen Kette im Abstand von etwa zwanzig Fuß nebeneinander. Jeder saß auf einem Fuchs und hielt einen stets schussbereiten Sharps-Karabiner, Modell 1859 oder einen Merill-Karabiner vor sich. Lockwood ritt etwa zwei Pferdelängen vor den Männern her. An seiner Seite ritt Sergeant Luther Kane.
In der großen, endlos scheinenden Weite der Wüste bewegte sich fast nichts. Nur die Pferdehufe wirbelten den alkalischen Staub vom trockenen Boden auf.
Lockwood richtete sich auf und versuchte, auf dem höchst unbequemen McClellan-Sattel eine bessere Sitzposition zu finden. Der Morgen war lang und hart gewesen, und die Mittagssonne schien jetzt so gnadenlos auf die Männer herab, dass man glaubte, alles beginne zu kochen.
Lockwood und seine Männer schienen in der Sonne zu zerfließen.
Sie hatten sechs Stunden gebraucht, um dieses eine Stück schmutzigen, gelblich-braunen flachen Landes zu durchqueren, auf dem grau-grüne Kreosotbüsche und Mesquitebäume wuchsen, zudem Eisenholzbäume, Opuntien, Yucca und Agaven. Sie standen in Gruppen hintereinander gestaffelt, und deshalb wirkten sie aus der Ferne eher, als ob Wellen aus einem fernen eisigen Meer herüberschwappten. Im Südwesten, gegenüber einer kleinen Gruppe von leuchtend gelben Paloverdebäumen, erhoben sich eingekerbte braune Felsen mit einem dicken runden Gipfel in den gnadenlosen gelbweißen Himmel. Die Felsen waren der einzige echte Orientierungspunkt, den sie in den letzten beiden Tagen gesehen hatten.
Lockwood atmete langsam durch die Nase aus und sagte sich, dass man für einen Landstrich wie diesen nur das Wort „gottverlassen“ anwenden konnte, für diese tausend Quadratmeilen der Apacheria, die sich vom Gila River bis hinunter zur mexikanischen Grenze erstreckten.
Und dennoch, hier fühlte er sich auf eine merkwürdige Weise zu Hause. Zu Hause und in Frieden. Das war schon irgendwie seltsam, denn Lockwood stammte ursprünglich aus Mississippi, wo sein Vater immer noch eine Baumwollplantage betrieb, und er konnte die Ursprünge seiner Familie bis in die Anfänge der Kolonialisierung Virginias verfolgen.
Bevor er die Militärakademie von West Point 1856 absolviert hatte, hatte er noch nie solche ausgedehnten Weiten wie hier im Westen gesehen. Aber in den fünf Jahren, in denen er hier draußen stationiert war und in denen er vom Second Lieutenant zum First Lieutenant und dann zum Captain befördert worden war, hatte er eine große Zuneigung zu diesem Land entwickelt, diesem Land der Einsamkeit und Gefahr, der Schönheit und der großen Chancen.
Er blickte über seine Schulter zurück und sagte: „Es wird immer heißer, Luther. Wir warten die große Mittagshitze unter den Bäumen dort ab und reiten später weiter.“
Mit einem heftigen Kopfnicken hob sich Luther Kane in seinem Sattel und bellte: „Ihr habt gehört, was der Captain gesagt hat.“
Zehn Minuten später erreichten sie den spärlichen Schatten.
Lockwood kümmerte sich zunächst um sein Pferd, nahm dann seine Feldflasche aus Blech, entfernte sich ein paar Schritte von den Männern und hockte sich hin. Er zog den Stopfen aus seiner Flasche, nahm einen Schluck von dem lauwarmen Wasser, umspülte damit einen Moment lang seine schmutzigen Zähne und schluckte es dann hinunter. Die ganze Zeit über ließ er seine Augen über die mit Büschen bewachsene Ebene und die zerklüfteten Felsgipfel weit dahinter schweifen.
Wissenshungrig wie er war, hatte er sich darum bemüht, sich die Namen jener Gipfel zu merken. Und das, obwohl er ihnen nie näher gekommen war als heute. Wahrscheinlich würde er sie auch nie besteigen können. Aber da waren die Namen ... Sierrita, Rincon, Apache Peak, Little Girl Mountains und andere, noch viel kompliziertere, die nur von wenigen Weißen ausgesprochen werden konnten.
Er schob den dunkelgrauen Hardee-Hut nach hinten. Lockwood war ein großer Mann mit flachem Bauch, etwa dreißig Jahre alt, leicht schielend und gelehrt wirkend, aber auch sonnengebräunt und mit athletischem Körperbau. Die hellblonden Haare trug er kurz, sein Kinn hatte seit vier Tagen kein Rasiermesser mehr erlebt.
Eigentlich sah er nicht aus wie ein Captain der US-Army. Die unbequeme und oft nicht zweckmäßige Uniformjacke hatte er abgelegt und trug stattdessen ein braunes, verstaubtes und verschwitztes Hemd, auf dessen Schulterpartie er etwas ungeschickt seine Rangabzeichen aufgenäht hatte. Außerdem trug er eine blaue Uniformhose, die er in seine schwarzen kniehohen Stiefel gesteckt hatte. Um seine schmale Hüfte trug er einen Infanteriegürtel, in dem in einem langen Holster ein Navy-Revolver Kaliber .36 steckte. An der rechten Hüfte hing ein Bajonett, achtzehn Inches lang.
Er und seine kleine Patrouille hatten gerade routinemäßig das Gebiet durchkämmt, als sie aus Fort Whipple darüber informiert wurden, dass zweihundert Meilen weiter nördlich ein Trupp von etwa zwanzig Mimbreno-Apachen ihr Stammesgebiet im benachbarten New Mexico verlassen hatte und sich nach Westen aufgemacht hatte. Die Indianer hatten eine Reihe kleiner Ranches am Rande der Apacheria überfallen, und Lockwood hatte den Auftrag erhalten, diesen Trupp aufzustöbern.
Luther Kane, der Mann mit den gewaltigen Fäusten und dem Quadratschädel, war etwa vierzig Jahre alt und hatte sehr traurig wirkende himmelblaue Augen. Er hatte etwas über die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen gemurmelt, als Lockwood seinen Soldaten den Befehl von Major Butler vorlas. Vielleicht hatte er auch recht. Immerhin durchritten sie ein riesiges Gebiet. Und es konnte geschehen, dass ein Apache neben einem stand und man ihn überhaupt nicht bemerkte. Aber wenn die Chancen auch nur eins zu tausend standen, die Spuren der halbwilden Indianerpferde auszumachen, dann mussten sie den Versuch unternehmen.
Lockwood und seine Patrouille hatten sich zum Schauplatz des jüngsten Massakers aufgemacht, einer kleinen, erst unlängst eröffneten Pferderanch. Der Besitzer hatte immer noch in einem Wagen gelebt und baute gerade erst sein Haus aus Grassoden. Aber als sie dort ankamen, war kein Haus aus Grassoden mehr erkennbar. Keine Soden, kein Wagen, nur ein paar Brandflecke auf dem Wüstenboden und ein paar zerbrochene Pfeile, einige verkohlte Pfosten ... und die Leichen.
Fünf Tote.
Zwei Männer, eine Frau, zwei kleine Mädchen.
Lockwood hatte die Apacheria lieben gelernt, und er hatte auch versucht, die Verhaltensweisen der Apachen, nach denen der ganze Landstrich benannt war, kennen zu lernen und sie zu verstehen. Als Soldat hatte er mit ihnen kaum Auseinandersetzungen gehabt, aber er ahnte, dass es Schwierigkeiten geben würde. Vor ein paar Monaten hatte Lieutenant George Bascom eine Einheit des Siebten Infanterieregiments zum Apache Pass geführt und dort dem Chiricahua-Häuptling Cochise fälschlicherweise vorgeworfen, einen Jungen namens Felix Tellez entführt zu haben.
Cochise hatte die Anklage natürlich bestritten, aber Bascom hatte versucht, ihn festzunehmen. Cochise konnte fliehen. Daraufhin nahm der Lieutenant einige seiner Männer gefangen. Das machte die Situation noch viel schlimmer. Als Vergeltung nahm Cochise einen Angestellten der Overland-Kutschenlinie als Geisel und versuchte, ihn gegen seine Männer auszutauschen. Dann jedoch eskalierte die Auseinandersetzung und die Gefangenen auf beiden Seiten wurden nach einem Kampf getötet.
Ja, da würde noch so mancher Ärger mit den Apachen heraufziehen, da war er sich sicher. Im Osten sprach man von einem drohenden Bürgerkrieg. Im Süden war man es leid, immer nur die Rolle der armen Verwandten des reichen Nordens zu spielen. Die Leute dort unten sahen es überhaupt nicht ein, dass sie ihr Recht auf Sklavenbesitz nur deshalb aufgeben sollten, weil ein paar Nordstaatler es ihnen vorschreiben wollten. Als Reaktion darauf hatten vor gerade einmal zwei Monaten Alabama, Florida, South Carolina, sein Heimatstaat Mississippi und mehrere andere ihre eigenen Regierungen gewählt. Die Amtseinführung von Jefferson Davis als Präsident des Südens kam einer Kriegserklärung gleich.
Als er zu Luther hinübersah, fragte er sich, ob dieses ganze Gerede von Sezession, von der Loslösung des Südens aus der Union, den Sergeanten überhaupt berührte. Luther stammte aus Tennessee, er hatte vermutlich eine Meinung zu all diesen Fragen, aber er diskutierte nie über Politik.
Dann kehrten seine Gedanken zurück zu den schrecklichen Bildern von Tod und Vernichtung, die er auf der Pferderanch gesehen hatte, und er kniff seine Lippen zusammen. Die beiden Männer waren einen langsamen Tod gestorben, einen stundenlangen Tod, und er war grausam gewesen. Die beiden Frauen und mindestens eines der Mädchen waren mehrfach vergewaltigt worden, bevor ihnen die Kehlen durchgeschnitten worden waren. Alle Leichen waren verstümmelt worden.
Dass es Kriege gab, verstand Lockwood und musste es akzeptieren. Aber was sich der Ranch ereignet hatte, war zu viel. Diese Brutalität hatte alle Grenzen überschritten.
Jetzt wollte er unbedingt die Reiter dieser halbwilden Pferde, die man Broncos nannte, einholen. Er wusste, dass der Rest seiner Männer so empfand wie er.
Es würde ihnen gelingen. Für Lockwood bestand keinerlei Zweifel daran, weil die Apachen ein halbes Dutzend Pferde bei dem letzten Überfall gestohlen hatten, sie jetzt nach Südwesten trieben und dabei Spuren hinterließen, denen selbst ein Blinder noch folgen konnte.
Außerdem bestimmten in dieser knochentrockenen Wüste der Apacheria die seltenen Wasserlöcher den Weg, den sie nehmen mussten, um nach Hause zu gelangen, ... und die Lage dieser Wasserlöcher war etwas, das Lockwood sich sehr genau eingeprägt hatte.
Die Apachen hatten einen Vorsprung von wenigen Tagen. Aber Lockwood konnte mit jeder Minute, die vorüberging, diesen Vorsprung verringern.
*
Am m Vormittag des folgenden Tages holten sie bereits die Apachen ein.
Zuerst sahen sie den Staub, einen dünnen senfgelb-farbenen Schleier, der eine halbe Meile vor ihnen in der Luft hing, und sofort hob Lockwood die Hand, damit die Patrouille hinter ihm stehen blieb.
Ohne weiter zu fragen schloss Luther Kane zu ihm auf, nahm ein kurzes ausziehbares Fernrohr hervor und reichte es ihm. Als Lockwood es vor sein Auge hielt, wischte sich der Sergeant über die zerfurchte schweißglänzende Stirn unterhalb der Uniformmütze mit dem ledernen Schirm. Er beobachtete den Captain voller Erwartung.
Einen Augenblick später spannten sich Lockwoods Kiefermuskeln an.
„Da sind sie“, murmelte er.
Er schob das Fernrohr wieder zusammen und gab es dem Sergeanten zurück. Dann wandte er sich an seine sechs Männer mit ihren wettergegerbten Gesichtern und den buschigen Backenbärten. „Da sind wohl fünfzehn bis zwanzig von ihnen vor uns, soweit ich das sagen kann“, erklärte er ihnen. „Ungefähr die Hälfte von ihnen hat sich um die gestohlenen Pferde gruppiert, der Rest reitet vorne.“
„Wir schießen sie ab, Cap’n“, schlug Luther vor. „Ich vermute, wir können einige von ihnen erledigen, bevor sie auch nur ahnen, dass wir hier sind.“
Lockwood hatte sich das auch schon überlegt. Diese Taktik war zwar nicht in West Point gelehrt worden, aber wenn man mit so gefährlichen Gegnern wie mit denen vor ihnen zu tun hatte, gab man ihnen die Chance, die sie ihren Opfern gelassen hatten – nämlich gar keine.
Er zog seinen Navy-Revolver Kaliber .36 hervor, spannte den Hahn und sagte dann leise: „Auf geht’s!“
Der Apache, der hinter den gestohlenen Pferden her ritt, war der Erste, der sie bemerkte. Trotz des Trommelns der Hufe in dieser schnell weiterziehenden Gruppe glaubte er, so etwas wie einen Schlachtruf hinter sich zu hören. Deshalb drehte er sich in seinem Sattel aus Hirschleder um, damit er einen Blick auf den Weg in der Staubglocke werfen konnte.
Er riss seine fast schwarzen Augen auf, als er acht blaugekleidete Soldaten auf sich zustürmen sah. Jeder von ihnen stieß Schreie aus, als ob er von Sinnen wäre.
„Pinda-lik-oyi!“, warnte er die anderen und deutet mit seinem kurzen Finger auf die heran nahenden Reiter. „Pinda-lik-oyi!“
Das Geschoss aus dem Navy-Revolver Kaliber .36 traf ihn im Gesicht, und er kippte von seinem sich aufbäumenden Pony. Blut spritzte in einem großen dunkelroten Bogen hervor.
Einen Augenblick später waren Lockwood, Kane und die anderen neben den Apachen und plötzlich waren die mit Kakteen bestandenen Bodensenken voller verschreckter Pferde, die in alle Richtungen davonliefen. Und da waren überraschte Indianer, die versuchten, ihre lebhaften Ponys unter Kontrolle zu halten und ihre Waffen in Anschlag zu bringen. Über allem lag das heisere Bellen der Revolverschüsse.
Es gelang den Soldaten, wie Luther vorhergesagt hatte, einige der Indianer von den Ponys zu schießen.
Bei Kampfübungen hatte Lockwood seinen Männern gegenüber immer klargemacht, dass es im Kampf keinen Platz für Wut geben dürfe. Wenn ein Mann eine Auseinandersetzung überleben wollte, dann musste er sich zu jeder Zeit besonnen und ruhig verhalten.
Darum gingen er und seine Männer überlegt und, soweit es ihnen möglich war, auch ohne Wutgefühle vor. Jeder suchte sich sein Ziel aus, betätigte den Hahn nur, wenn auch die Aussicht bestand, treffen zu können. Und auf diese wohlüberlegte Weise konnte die Patrouille sieben Apachen erschießen und zwei weitere verwunden, und das alles in den ersten dreißig Sekunden des Angriffs.
Aber dann hatten sie das Überraschungsmoment nicht mehr auf ihrer Seite, und die Apachen, die den ersten Angriff überlebt hatten, schlugen jetzt zurück. Einer riss sein geschecktes Pony herum und griff Luther direkt an. Sein langes, schwarzes, geöltes Haar flog um sein flaches, breites Gesicht, das sich jetzt in einem wilden Kriegsschrei verzerrte. In seiner rechten Hand hielt er einen gestohlenen Remington-Perkussionsrevolver Kaliber .44.
Luther riss scharf an seinen Zügeln, lenkte sein Pferd seitlich an dem Apachen vorbei, hob seinen Revolver und schoss dem Mann durch die Schulter. Der Krieger fiel seitlich von seinem Pony, schlug auf dem Boden auf, rollte sich weg, und während er versuchte, sich wieder aufzurichten, schoss Luther ein zweites Mal. Jetzt sackte er zusammen, seine Beine zuckten noch einmal heftig, und seine Lippen versuchten, sein Todeslied zu singen.
Dreißig Fuß weiter schrie der junge Private Lacey auf, als ein Apache, der in den ersten Momenten des Kampfes sein Pony verloren hatte, plötzlich aus dem aufgewirbelten Staub auftauchte und ihn mit der langen Spitze seines Speeres durchbohrte. Private Stevens sah, wie es geschah, schrie etwas Unverständliches und traf den Indianer im Kopf.
Private Taylors Pferd sackte unter ihm zusammen. Ein Pfeil mit Widerhaken an der Spitze steckte in der rechten Schulter des Tieres. Er befreite seine Füße aus den Steigbügeln und warf sich zur Seite, als ein Apache mit narbigem Gesicht vorbeistürmte und eine Keule in einem großen Bogen schwang. Der Apache zügelte sein Pony, riss es herum und versuchte noch einen Angriff, aber dann traf ihn die Kugel des Soldaten in der Kehle und er wurde nach hinten aus dem Sattel geschleudert.
Damit war der Kampf so gut wie vorbei. Für die Apachen war es keine Schande, aus einer Auseinandersetzung zu fliehen, wenn es keine Aussicht auf Sieg gab. In solch einem Augenblick war die Flucht nur vernünftig. Deshalb wendete der Erste der Überlebenden sein Pferd, dann folgten noch ein paar, ein vierter, ein sechster, sieben insgesamt. Die gestohlenen Pferde, die Toten und die Sterbenden überließen sie den Siegern.
Lockwood schrie: „Hinterher, Luther!“
Er hatte sich bereits an die Fersen des letzten der fliehenden Indianer geheftet. Das war ein untersetzter und muskulöser Krieger mit mächtiger Brust und breiten Schultern, so wie es typisch für die Menschen seines Volkes war. Jetzt trieb er sein graues Pony durch das Mesquitegestrüpp, aber Lockwoods Pferd war größer, stärker und besser ernährt. Der Abstand zwischen beiden schrumpfte schnell. Einen Augenblick später hatte Lockwood den Apachen eingeholt, riss sein Pferd zur Seite und versuchte, einen Zusammenprall der Tiere zu erzielen.
Als die Pferde zusammenstießen, stürzte das Indianerpony. Der Apache sprang ab, stolperte und fiel. Aber im nächsten Augenblick war er wieder auf den Beinen und versuchte so schnell wie er konnte, einen Pfeil auf die Sehne seines Bogens zu legen.
Lockwood hielt ein paar Schritte von ihm entfernt an, richtete die .36 auf ihn und befahl: „Fallen lassen!“
Selbst wenn der Apache kein oder nur wenig Englisch sprach, war die Bedeutung des Befehls klar. Um sicherzugehen, wiederholte Lockwood seine Anweisung auf Spanisch. Einen Augenblick lang blieb der Gesichtsausdruck des Apachen starr und er blickte ihn nur mit dunklen hasserfüllten Augen an. Dann riss er unvermittelt den Bogen hoch, und Lockwood blieb nichts anderes übrig, als ihn niederzustrecken.
Unglücklicherweise war er einen Augenblick zu langsam, um zu verhindern, dass der Apache seinen Pfeil abschoss.
Als der Krieger in einer Drehbewegung zu Boden ging, unterdrückte Lockwood einen Schmerzensschrei, weil der Pfeil in seinen rechten Arm kurz oberhalb des Ellenbogengelenks einschlug. Der Schmerz war ungeheuerlich. Aber als Luther und der Rest der Männer einen Moment später herbei ritten und der Sergeant sich zu ihm niederbeugte, um ihm zu helfen, deutete Lockwood mit einer Armbewegung an, sie sollten den anderen fliehenden Apachen nachsetzen. Er könne warten.
Luther überlegte einen Augenblick lang, dann trat er seinem Pferd in die Flanken. Bald schon waren die Apachen und ihre Verfolger im glänzenden Dunst verschwunden. Die mit Büschen bestandene Ebene, in der vor wenigen Minuten so viele Menschen umgekommen waren, war jetzt überraschenderweise gespenstig still.
Erst jetzt ließ Lockwood seinen Revolver los, und der landete auf der Erde neben den Hufen seines Pferdes. Er selbst schob sich aus seinem Sattel und fiel auf dem glühend heißen Sand auf die Knie. Blut lief in einem dicken roten Strahl seinen Arm hinunter und färbte seinen Ärmel rot. Es tropfte von seinen Fingerspitzen auf den Boden.
Kurz danach ließ der Schock der Verwundung ein wenig nach. Die Welt schien nicht mehr umkippen zu wollen. Ein kurz anhaltendes Schwindelgefühl ließ ihn gleichzeitig frieren und schwitzen. Er atmete einmal tief durch, hob seinen Revolver mit der linken Hand auf, richtete sich auf und griff nach den herabhängenden Zügeln.
Mit zusammengepresstem Mund blickte er auf den Pfeil, der aus seinem Arm herausragte. Er wusste, dass er ihn nicht herausziehen durfte. Wenn das nicht richtig gemacht wurde, würde die Spitze des Pfeils ein noch viel größeres Loch in seinen Arm reißen. Jetzt sollte er besser versuchen, den Blutfluss zu stillen und provisorisch einen Verband anzulegen. Später würde Luther dann den Pfeil mit Hilfe einer erhitzten Drahtschlinge entfernen.
Er hatte gerade den Verband angelegt, als es ihm vorkam, als ob jemand um Hilfe riefe. Fast erwartete er, dass Luther und die anderen bereits zurückkämen und dass sie ihre brutale Arbeit erledigt hätten. Er blinzelte nach Südosten, aber außer einigen der gestohlenen Pferde war auf der Ebene nichts zu sehen. Die Pferde hatten sich zu einer nervös umherlaufenden Herde etwa eine Viertelmeile zusammengefunden. Irgendwie hatten ihn wohl seine Sinne getrogen, er musste sich das alles nur eingebildet haben. Vermutlich hatte der Blutverlust ihn verwirrt.
Dann hörte er es wieder.
„Ist da jemand?“
Er drehte sich rasch um – zu rasch – und musste sich an seinem Pferd festhalten, um nicht umzufallen. Aber es ging jetzt um etwas anderes. Diese Stimme, sie gehörte Private Lacey.
Er lief so schnell wie er konnte zum Schauplatz des Kampfes. Sein Pferd trottete hinter ihm. Der Ort war übersät mit Körpern. Die meisten davon waren tote Apachen, aber es lagen auch einige tote Pferde dort. Fliegen schwirrten umher, der ganze Ort roch nach Blut und Pulverdampf.
Private Lacey lag etwa fünfzig Yards entfernt auf dem Rücken und presste seine Hände auf eine große Wunde in seinem Bauch, damit seine Gedärme nicht wie aufgeblähte rosafarbene Schlangen hervortraten.
Er starrte mit seinen blauen Augen in den Himmel und rief immer wieder: „Hört mich jemand?“
Lockwood schlurfte zu ihm und antwortete: „Ich komme, Soldat.“
Er stand einen Augenblick später neben ihm und beugte sich zu ihm hinab. Jetzt konnte er den Blutgeruch am intensivsten wahrnehmen.
Während er den Sterbenden ansah, fiel ihm auf, wie bleich dessen Gesicht geworden war, wie sehr seine Wangen eingefallen waren und auch, dass seine Lippen blutverschmiert waren. Er fühlte die Tränen in seinen Augen aufsteigen. Aber keine einzige Träne würde ändern können, was mit Lacey geschehen war, mit diesem freundlichen Jungen mit der leisen Stimme, der aus Ainsworth, Nebraska kam. Und niemand wusste, was er in seinem Leben noch hätte erleben können. Er legte eine Hand sanft auf die Schulter des Soldaten.
„Ich bin es, Tim.“
„Ich habe schon gedacht, ihr wärt alle davongeritten und hättet mich alleine gelassen“, stieß er hervor.
„Nein.“
„Darüber bin ich froh, Captain. Ich möchte nicht ... alleine ... sterben.“
Der Rekrut blickte immer noch in die Weiten des Himmels über ihm. Lockwood hoffte, dass er schon so weit aus dieser Welt getreten war, dass ihm die Geier, die dort direkt über ihm kreisten, nicht mehr auffielen. „Wir kriegen sie doch, Cap’n?“, fragte er. „Diese Apachen?“
„Ja, die kriegen wir.“
Diese Bestätigung schien Lacey nicht zu beruhigen. Er schluckte mit Mühen, dann sagte er: „Das ergibt alles keinen Sinn, oder?“
Lockwood schüttelte den Kopf. „Nein, nicht viel.“
„Ich meine ... dieser Rancher. Seine Familie. Die .... Apachen. Ich. Ich meine .... Wir sind alle Amerikaner. Das sind wir doch!“
„Ich denke schon.“
„Warum bringen wir uns dann alle gegenseitig um?“
Lockwood wusste darauf keine Antwort, und Lacey lebte auch nicht mehr lange genug, um sie zu hören. Plötzlich entwich die Luft in einem leisen Rasseln durch seine Kehle, und das Zucken in seinen ausgetretenen Gedärmen hörte einfach auf.
Lockwood neigte den Kopf und sein Gesicht versteinerte für einen Augenblick. Dann betete er mit krächzender Stimme: „Der Herr ist mein Hirte. Ich leide nicht Not. Auf grünender Weide lässt er mich lagern. Er führt an die Wasser der Ruhe ...“
Dann hörte er aus der Ferne Gewehrschüsse, die das Ende des gewalttätigen Apachentrupps signalisierten.
Wieder eine Gruppe von Amerikanern, die einander töteten.
*
Nach gut drei Wochen führten Lockwood und seine Patrouille endlich wieder ihre staubbedeckten Pferde durch das Tor von Fort Whipple, dem Hauptquartier der Army im Arizona-Territorium.
Während ihres langen Rittes nach Norden hatte Lockwood genug Zeit gehabt, sich einen ausführlichen Bericht über die Vorkommnisse während ihres Erkundungsrittes zu überlegen. Als nach dem sehr behelfsmäßigen chirurgischen Eingriff durch Luther endlich auch wieder Gefühl in seinen Arm zurückkehrte, gelang es ihm sogar, diesen Bericht zu Papier zu bringen. Nach der Ankunft führten Luther und die anderen Männer ihre Pferde zu den Stallungen, Lockwood ging quer über den Exerzierplatz zum Verwaltungsblock, wo er dem Adjutanten von Major Butler, Lieutenant Webb, seinen Bericht übergab. Danach suchte er noch den Arzt des Stützpunktes auf, damit der einen Blick auf Luthers Arbeit werfen konnte.
Lieutenant Webb wartete bereits auf ihn, als er den medizinischen Bereich verließ, und ein Zucken um die blauen Augen verriet, dass er sehr angespannt war. „Major Butler dankt für den ausgezeichneten Bericht“, sagte er. „Er möchte Sie sobald wie möglich in seinem Büro sehen, Captain.“
Lockwood hatte auf ein Bad und eine Rasur gehofft, aber das würde wohl warten müssen.
„Gibt’s Ärger?“, fragte er.
Webb zögerte einen Augenblick. „Diese Erklärung sollte ich lieber dem Major überlassen.“
Fünf Minuten später trat Lockwood in das überraschend kleine Büro mit seiner niedrigen Zimmerdecke und den mit dunklem Holz verkleideten Wänden. Diese waren zumeist mit Landkarten zugehängt. Ein großer, zerkratzter Schreibtisch nahm einen großen Teil des Raumes ein, und dahinter saß ein kleiner, übergewichtiger und ungepflegt wirkender Mann von Ende fünfzig mit Glatze und einem kurz geschnittenen, sehr schwarzen Schnurrbart. Als Lockwood die Tür hinter sich schloss, sah der Mann hinter dem Schreibtisch – Major Nathan B. Butler – von Lockwoods Bericht auf.
„Sam“, sagte er und erwiderte den militärischen Gruß, den Lockwood ihm mit seinem verletzten Arm entgegenbrachte. „Gut, dass Sie wieder da sind.“ Er deutete auf den Besucherstuhl und ließ sich wieder auf seinen eigenen fallen. Dann tippte er auf den Bericht und sagte: „Das haben Sie da draußen gut gemacht, Sam. Das war schon schlimm, dass Sie einen Ihrer Männer auf diese Weise verloren haben.“
Loockwood nahm auf dem Besucherstuhl Platz und fragte vorsichtig: „Haben Sie mich deswegen rufen lassen, Major?“
Butler blickte kurz auf den Schreibtisch. „Nicht wirklich“, antwortete er ruhig. Er nahm Lockwoods Bericht in die Hand, warf ihn in eine ohnehin schon überfüllte Ablage, dann deutet er auf das Telegramm, das darunter gelegen hatte. Als er wieder hochsah, hatte sein Gesicht einen besorgten Ausdruck angenommen. „Das kam erst heute Morgen“, sagte er dann, und seine Stimme wirkte ein wenig brüchig. „Jetzt ist es offiziell, Sam. Unser Land befindet sich im Kriegszustand.“
Die Nachricht traf Sam wie ein Schlag in die Magengrube und er musste schwer schlucken. Krieg? Bis jetzt konnte man all die politischen Unruhen im Osten übergehen und sich einreden, dass sich schon alles regeln würde und sich alles sowieso nicht auf einen auswirken würde.
Plötzlich fielen ihm die letzten Worte von Private Lacey ein. „Wir sind doch alle Amerikaner. Warum bringen wir einander um?“
„Und da gibt es keinen Zweifel?“, fragte er mit leiser Hoffnung. „Es hat so viele wilde Gerüchte in letzter Zeit gegeben ...“
„Es stimmt, Sam“, antwortete Butler. „Im Hafen von Charleston haben Auseinandersetzungen stattgefunden und im Navy Yard in Norfolk, Virginia. Lincoln hat fünfundsiebzigtausend Freiwillige aufgefordert, diesen Aufstand zu unterdrücken. Und aus sicherer Quelle habe ich erfahren, dass Davis bereits eine Armee einberufen hat, die halb so groß ist. Virginia, Arkansas, Tennessee und North Carolina haben sich alle der Konföderation angeschlossen ...“ Er schüttelte den Kopf und richtete dann seinen Blick auf den Mann gegenüber. „Die Frage ist“, setzte er dann langsam seine Worte fort, „was Sie jetzt tun wollen.“
Lockwood schüttelte den Kopf. Vor diesem Augenblick hatte er sich gefürchtet, nämlich dass er eine Entscheidung zu treffen hätte, von der gehofft hatte, sie nie treffen zu müssen. Aber welche Wahl hatte er wirklich?
Leise sagte er: „Ich muss nach Hause, Major.“
Butler nickte. „Nun“, antwortete er. „Das überrascht mich nicht. Ich hatte nur gehofft ...“
„Ja“, murmelte Lockwood. „Ich hatte auch Hoffnungen.“
Sein Bruder, der auf den Namen Joseph Elliott getauft worden war, den aber alle nur Joel nannten, sollte bald auch seinen Abschluss in West Point machen und dann zu seinem Bruder an der Grenze der Zivilisation, der frontier, kommen.
Darauf hatte sich Lockwood gefreut, weil er immer der Ansicht gewesen war, dass für beide hier im Westen die Zukunft liegen würde, nicht im Militär. Rancher wollte er irgendwann werden. Er erhob sich, aber in seinen Gedanken war er ganz weit weg.
„Sie werden morgen mein Rücktrittsgesuch haben, Major“, sagte er dann zerstreut. „Und bald danach werde ich mich auf den Weg machen müssen.“
Er grüßte wieder, dann streckte er dem Major die Hand entgegen. Der Major erhob sich und ergriff sie.
Vier der fünf Jahre, die Lockwood in der Army verbracht hatte, hatten sie zusammen im Arizona-Territorium gedient und es verband sie eine große Zuneigung zueinander und großer Respekt voreinander.
„Viel Glück“, sagte Major Butler ernst. „Gott möge sie beschützen, Sam.“
Lockwood drehte sich rasch um und verließ das Büro. Plötzlich hatte er sehr viel zu tun und er hatte viele Meilen vor sich.
Und am Ende der Reise wartete ein Krieg auf ihn.
Kapitel Zwei
An einem frühen Abend im April nur ein knappes Jahr später erhielt Lockwood, jetzt Major in der Konföderierten Armee, den Befehl, acht Männer des Zuges C der Dritten Mississippi-Brigade zu einer Erkundung des Geländes um den Peach Orchard bei Shilo, Tennessee mitzunehmen.
So war das nun einmal. Die ganze Gegend um Pittsburgh Landing – dem wichtigsten Ziel der vorrückenden Truppen der Armee des Südens – wimmelte nur so vor Unionssoldaten: Shermans und McClellans Männer standen im Norden und Nordosten, die Truppen von Prentiss im Westen, und Hurlbut befehligte seine Einheiten im Süden.
Man musste schon sehr geschickt und einfallsreich vorgehen, wenn man in der langen und gefährlichen Nacht angesichts der erdrückenden Übermacht der Unionssoldaten unentdeckt bleiben wollte. Aber bei Anbruch des folgenden Tages hatten sie die Stärke und die Positionen ihres Gegners ausgemacht und marschierten durch ein Waldgebiet bei Fraley Field, um mit den wichtigen Informationen zu ihren eigenen Linien zurückzukehren.
Der Krieg war bisher hart und erbittert geführt worden, genauso, wie Lockwood es erwartet und befürchtet hatte. Aber trotz verschiedener Auseinandersetzungen an Orten wie Wilson’s Creek, Cheat Mountain und Ball’s Bluff hatte keine der beiden Seiten größere Verluste erlitten oder Siege verzeichnen können. Es sei denn, man erwähnte General Thomas Jackson, der sich immerhin einen Spitznamen verdient hatte, „Stonewall“, weil er dem Angriff bei Bull Run in Virginia standgehalten hatte.
In der Zwischenzeit hatten Schiffe der Union damit begonnen, die Häfen der Konföderierten zu blockieren. Deshalb spürten die Südstaatler vermehrt den Druck, der auf sie ausgeübt wurde.
Das wurde besonders deutlich in dem Erscheinungsbild, das der zerlumpte, elende Zug hinter Lockwood bot. Die Männer trugen zerfetzte Kleidung und waren schlecht ausgerüstet. Keiner von ihnen besaß eine vollständige Uniform. Als er einen Blick auf seine Soldaten hinter sich warf, sah er nur ein paar richtige Uniformmützen. Andere trugen gestrickte Kappen oder Hüte. Die Jacken, mit denen einige von ihnen ausgestattet waren, waren grau und aus Sackleinen gefertigt. Manche trugen blaues Flanell oder grobe graue Hemden. Die Hosen waren schwarz oder grau und waren zumeist an den Knien geflickt.
Nur die glücklicheren der Männer besaßen Stiefel. Die weniger glücklichen marschierten in Schuhen, die für dieses unwegsame Gelände höchst ungeeignet waren.
Ihre Waffen waren auch nicht viel kriegstauglicher. Zwei altertümliche Musketen, ein britisches Enfield-Gewehr, ein paar Unions-Gewehre und gar eine Steinschlosspistole. Zudem führten einige der Soldaten die Navy-Pistolen Kaliber .36, die Gunnison und Griswold gefertigt hatten, mit sich.
Wie konnte man so einen Krieg gewinnen, fragte sich Lockwood.
Dann sah er den großen und schlanken Leutnant, der neben den Soldaten her marschierte. Sofort verflog all seine Trübsal und er verspürte einen großen Stolz, denn dieser Offizier war sein jüngerer Bruder Joel.
In mancherlei Hinsicht war Joel die jüngere und sanftere Ausgabe von Lockwood selbst. Er war jetzt dreiundzwanzig Jahre alt, hatte weißblondes Haar, intelligente, braune Augen und ein freundliches Lächeln, das er auch nach zwölf Monaten im Krieg noch nicht verloren hatte.
Lockwood hatte Major Butler erklärt, dass Joel in seinem letzten Jahr in West Point sei, als der Krieg erklärt wurde. Genau wie sein älterer Bruder war er sofort nach Hause zurückgekehrt, um für die Konföderation zu kämpfen.
Das hatte Lockwood nicht im Geringsten überrascht. Joel und er hatten schon immer ähnliche Meinungen vertreten. Es war für beide nur natürlich, dass sie es als eine Verpflichtung der Familie, ihren Freunden und dem Staat gegenüber ansahen, sich für den Kampf zur Verfügung zu stellen. Allerdings hofften sie beide inständig, dass sich dieser fürchterliche Krieg nicht mehr allzu lange hinziehen würde.
Aber ein Ende war nicht in Sicht. Im letzten Jahr hatten sie sich Seite an Seite in einem Dutzend kleinerer Konflikte und Scharmützel bewährt. Die Schlacht um Pittsburgh Landing, die ihnen jetzt bevorstand, würde aber eine größere und verlustreichere Auseinandersetzung werden. Aus diesem Grund war Lockwood froh darüber, dass Luther Kane bei ihm war.
An dem Morgen, an dem er Fort Whipple verlassen hatte, hatte Luther bei den Ställen auf ihn gewartet und bereits zwei Reittiere für die Reise gesattelt. Luther hatte ihn zackig gegrüßt und dann lediglich gesagt: „Ich reite also mit Ihnen, wenn Sie nichts dagegen haben, Cap’n. Ich habe Verwandte in Tennessee und ich beabsichtige nicht, gegen sie zu kämpfen oder sie im Stich zu lassen.“
Lockwood hatte den Gruß erwidert und ebenso lakonisch geantwortet: „Schön, dass Sie dabei sind, Luther.“
Ohne weitere Diskussionen waren sie hinaus in die Wüste geritten, die sie beide so sehr liebten, und waren innerlich auf einen fürchterlichen Krieg eingestellt.
Jetzt schimpfte Luther über die Männer, die durch den Schlamm vor ihm stapften: „Also Jungs, schließt jetzt einmal zueinander auf.“
„Schneller geht es nicht, Sarge“, antwortete Jeb Tyler, ein sommersprossiger Junge, der siebzehn Jahre alt war und von einer Farm bei Pleasant Hill stammte. „Die Nacht war sehr lang. Mir tun die Füße weh und ich bin müde.“
Ein paar Männer murmelten zustimmend.
Luther zeigte keinen Ärger über die fast rebellische Antwort. Da der Rotschopf stets guter Laune war und eifrig und loyal seinen Dienst versah, war er bei Vorgesetzten beliebt. Und weil er von Natur aus ein guter Schütze war und besonders mit dem Enfield-Karabiner Kaliber .577 sehr gut umgehen konnte, war er auch in Kämpfen sehr wichtig. Sein Gewehr trug er quer vor der Brust.
„Aber wir haben noch einige Meilen vor uns“, entgegnete der kahlrasierte Sergeant mit den traurigen blauen Augen. „Ich habe keine Ruhe, bis wir wieder bei unseren Leuten sind.“
„Ich vermute, dass wir das Camp von General Johnston gegen Mittag oder ein wenig später erreichen werden“, sagte Joel vom Ende der kleinen Marschkolonne her. „Aber bis wir da sind, sollten wir uns ruhig verhalten. Bis jetzt hatten wir keinen Ärger. Es macht keinen Sinn, dass die Yankees merken, dass wir hier durchk...“
Er hatte seinen Satz noch nicht beendet, als eine Gewehrsalve durch die Bäume peitschte und eine verheerende Wirkung zeigte.
Der Erste, der fiel, war Private Masterson, dem ein schweres Geschoss das halbe Gesicht wegriss. Während er auf dem Boden lag und noch mit den Gliedern zuckte, griff Private Adams nach seinem Arm, der sich plötzlich rot von seinem Blut färbte, und er begann, vor Schmerzen zu schreien. Private Loughlin, der unmittelbar hinter ihm marschiert war, wurde von einem weiteren Geschoss zur Seite gerissen. Er prallte gegen einen Baum und fiel dann mit dem Gesicht in den Schlamm. Der färbte sich rasch rot.
Lockwood riss seinen Colt aus dem Holster und bellte: „Deckung!“
„Zwischen die Bäume!“, schrie Joel und packte den verwundeten Adams.
Sie warfen sich hinter einen kleinen Erdhügel etwa zwanzig Fuß entfernt von ihnen und erwiderten das Feuer auf die unsichtbaren Ziele. Das Gewehrfeuer ließ den anbrechenden Morgen erzittern. Vögel flohen kreischend aus den Bäumen.
Lockwood fluchte, weil es ihm widerfahren war, dass er und seine Männer in diesen Hinterhalt geraten waren. Dann feuerte er immer wieder, immer wieder dahin, wo er ein Mündungsfeuer zu erkennen glaubte. Die Männer, die Luther gut ausgebildet hatte, folgten seinem Beispiel.
Aber diesen Kampf konnten sie nicht gewinnen, und Lockwood wusste das. Zwei seiner Männer waren bereits tot, ein weiterer schwer verwundet. Es blieben ganze sechs gegen, ja, gegen wie viele? Und wie gut bewaffnet?
Private Jackson, der neben Lockwood kauerte, versuchte gerade, mit seiner Rifle-Muskete Kaliber .58 auf ein Ziel anzulegen, als plötzlich sein Hut wegflog und ein dicker Strahl seines Blutes sich auf den kleinen Erdhügel vor ihnen ergoss. Mit Entsetzen wendete sich Lockwood zu ihm, sah das klar umrissene Loch in seiner Stirn, beobachtete, wie seine Augen nach hinten rollten und nur noch das Weiße sichtbar war.
Als Jackson seitlich wegsackte, schrie Joel: „Da! Links! Die wollen uns einkesseln!“
Zusammen mit Tyler nahm er die Büsche und das Unterholz unter Beschuss, wo man für einen Augenblick die blaue Farbe der Unions-Uniformen etwa achtzig Fuß entfernt unter den tiefhängenden Zweigen erkennen konnte. Einer der Unionssoldaten, der sich den Weg hinter sie bahnen wollte, riss plötzlich die Arme hoch und stürzte zu Boden. Tyler stieß einen wilden Kriegsschrei aus.
„Den hab ich erwischt!“
Ja, dachte Lockwood, den hast du erwischt. Aber dann fiel ihm ein, was Jim Lacey gesagt hatte, nur Augenblicke, bevor er dort unten vor einem Jahr in der Apacheria gestorben war. Wir sind doch alle Amerikaner, oder? Warum bringen wir uns dann auf diese Weise gegenseitig um?
Diese Frage hatte ihn verfolgt. Eine Antwort darauf hatte er bis heute nicht.
Dann entschied er innerhalb eines Augenblicks: „Luther! Halte eine weiße Fahne hoch!“
Als Joel das hörte, drehte er sich mit einem Ruck zu ihm um. Sein Gesicht spiegelte sein Entsetzen und seinen Unglauben wieder. „Sich ergeben?“ Eine Kugel schlug in den Erdhügel ein und ließ alle zusammenzucken. „Worüber redest du, Sam? Wir kämpfen bis zum Ende!“
Er hatte recht. Man könnte noch eine ganze Weile weiterkämpfen, gewiss. Und noch mehr Männer, noch mehr Amerikaner würden sterben. Aber wenn die Unionssoldaten sie erst einmal eingekesselt hätten, dann würden sie alle, er, Joel, Luther, Tyler und die anderen sterben.
Grundlos.
Es hatte bereits genug Blutvergießen und Sterben an einem Tag gegeben. Tote würden für alle Zeiten tot sein, aber für einen Kriegsgefangenen gab es immer noch eine Chance zu fliehen. Deshalb ignorierte er seinen Bruder und sagte: „Luther?“
Luther band ein nicht mehr sehr sauberes Taschentuch an den Lauf von Jacksons Gewehr, das vor ihnen auf dem Boden gelegen hatte. „Erledigt, Major“, antwortete er, und ohne dass er den Befehl dazu erhalten hatte, begann er, die Waffe oberhalb des Erdhügels hin und her zu schwenken.
Ein paar Augenblicke noch ging der Beschuss durch die Unionstruppen weiter. Lockwood und die anderen duckten sich so tief, wie sie konnten. Bei jedem der heftigen Einschläge der Geschosse in die Bäume zuckten sie zusammen. Irgendwann einmal musste jemand auf der anderen Seite die weiße Fahne entdeckt haben, verstand, was sie bedeuten sollte und gab seinen Männern den Befehl, das Feuer einzustellen. Noch eine Minute lange bellten die Schusswaffen weiter, dann hörte der Beschuss langsam auf.
Stille legte sich über das Waldstück. Nur das Stöhnen von Private Adams war zu hören, wenn er versuchte, seinen Arm zu bewegen.
Hinter dem Erdhügel sah Lockwood zu Luther, dann zu Joel. Der flüsterte: „Ich hoffe, du weißt, was du tust, Sam.“
Auf diese Bemerkung antwortete Lockwood nicht. Er ging ein hohes Risiko ein, weil er sich auf einen Gnadenakt des Gegners verließ. Es kam jetzt darauf an, wer auf der anderen Seite, das Kommando führte. Man konnte nicht ausschließen, dass der Befehlshabende dort drüben sie erschießen lassen würde.
Aber es war zu spät, jetzt noch eine andere Entscheidung zu treffen. Er schluckte schwer, legte seinen Colt nieder und hob die Hände als Zeichen dafür, dass sie sich ergeben würden.
Aber nichts geschah.
Nachdem Luther seine Waffe auf den Boden gelegt hatte, kam auch er aus der Deckung, dann Joel und schließlich auch die anderen Männer. Tyler stützte Adams.
Zuerst wirkte alles so, als ob niemand da wäre. Dann kamen immer mehr Unionssoldaten zischen den Bäumen hervor, zwanzig ... dreißig ... vielleicht vierzig. Jeder von ihnen hielt ein Colt-Gewehr oder einen Spencer-Karabiner auf die zerlumpte Gruppe von nur einem halben Dutzend Männer gerichtet.
Als sie näher kamen, pfiff Joel leise.
Schließlich schwärmten die Unionssoldaten aus und umstellten die kleine Gruppe. Ein paar angespannte Augenblicke lang starrten sich die Soldaten des Nordens und des Südens hasserfüllt an. Dann trat ein junger Offizier mit den geflochtenen Schulterstücken eines Captains auf der langen blauen Uniformjacke auf sie zu. In seiner rechten Hand hielt er einen Army-Colt, ein langer Säbel, der noch in der Scheide steckte, schlug gegen sein linkes Bein.
Er blieb vor Lockwood stehen und grüßte. „Ich gratuliere Ihnen zu Ihrer klugen Entscheidung, Major“, sagte er höflich. „Von nun an sollten Sie sich als Kriegsgefangene betrachten. Sie werden entsprechend behandelt werden.“
Sein Alter war nur schwer zu bestimmen. Vielleicht war er Ende zwanzig. Sein Teint war dunkel, er war ein gut aussehender Mann mit dichtem schwarzem Haar unter der Mütze und einem buschigen Backenbart. Als er Adams sah, rief er nach hinten: „Sergeant! Wir haben hier einen Verwundeten. Sorgen Sie dafür, dass er sofort versorgt wird.“
Ein Unteroffizier mit einem schmalen Gesicht besah sich Adams. Er schien nicht gerade erfreut zu sein über den Auftrag, einen der Feinde medizinisch zu versorgen, aber er kam dem Befehl unverzüglich nach. „Sir!“
„Und dann müssen wir bitte noch die Toten begraben.“
„Dexter! Smith! Peters! Sie haben gehört, was der Captain gesagt hat.“
Zu Lockwoods Erstaunen steckte der Captain dann seinen Revolver in sein Holster und streckte ihm seine rechte Hand als Geste der Freundschaft entgegen. „Mein Name ist Monroe, Major. Sehr erfreut, Sie kennenzulernen.“
Lockwood war immer noch ein wenig verblüfft über so viel gute Manieren, schüttelte ihm die Hand und stellte dann sich und Joel vor, der etwas zögernd fragte: „Will Monroe?“
Der Captain der Union sah ihn erstaunt an. „Also ...“ Dann hielt er inne und betrachtete Joel genauer. „Kenne ich Sie, Lieutenant?“
„Wir waren zusammen in West Point“, antwortete Joel. „Sie waren in ihrem letzten Jahr, als ich als Kadett anfing.“
Monroe schien jetzt Joel wiederzuerkennen und er nickte. „Tut mir leid, dass ich Sie unter diesen Umständen wiedertreffe“, sagte er dann und wendete sich wieder Lockwood zu. „Ich nehme an, dass Sie Erkundungen über unsere Truppenzahlen und über unsere Positionen eingeholt haben, Major?“
Ein verbittertes Lächeln legte sich über Lockwoods Züge. „Sie können vermuten, was Sie wollen, Captain.“
„Natürlich. Wir haben geahnt, dass Ihr Südstaatler Spähtrupps ausschicken würdet, um unsere Stellungen zu erkunden. Deshalb hatten meine Männer und ich den Befehl erhalten, dieses Gebiet auch in der Dunkelheit zu bewachen. Mir scheint, dass wir Sie nicht bemerkt haben, als Sie in unser Gelände eingedrungen sind ...“
„Aber Sie haben uns bemerkt, als wir es verlassen wollten“, beendete Lockwood seinen Satz.
Monroe schüttelte den Kopf. „Wissen Sie, es ist ironisch. Noch eine halbe Stunde, und wir hätten uns von hier zurückgezogen.“
„Ich nehme nicht an ...?“, wollte Joel sagen.
„Eigentlich würde ich Sie am liebsten weiterziehen lassen, Lieutenant, aber ich habe eine Pflicht zu erfüllen.“
Er nahm eine kleine Flasche aus einer Uniformjacke und reichte sie Lockwood. „Sie und Ihre Männer wirken sehr erschöpft, Major. Teilen Sie unter sich auf, was noch in der Flasche ist.“
Dann wendete er sich von ihnen ab und beaufsichtigte die Soldaten, die die Toten begruben. Luther kratzte sich am Kinn und meinte: „Wenn alle Yankees so sind, dann hätten wir uns schon vor langer Zeit ergeben sollen.“
Darauf antwortete Lockwood nicht, aber seine Selbstvorwürfe darüber, dass er aufgegeben hatte, lasteten nicht mehr so schwer auf seinem Gewissen.
Ein Stunde später, nachdem Lockwood über den Gräbern der drei Gefallenen ein paar Worte gesprochen hatte, hielt Monroe eine kurze Rede am Grab des einzigen Toten der Union. Dann begannen sie den Abzug. Luther kümmerte sich um den Abmarsch der konföderierten Soldaten. Da trat Monroe auf sie zu und bat um Rückgabe seiner Flasche.
„Ich wollte, ich könnte Ihnen einen schöneren Abschied bereiten“, sagte er und sprach dabei so leise, dass niemand mithören konnte. „Aber Sie müssen wissen, dass für Kriegsgefangene die Aussichten alles andere als rosig sind.“
„Wir werden sehen“, antwortete Lockwood.
„Ich hoffe inständig, dass Sie das überstehen werden, Sir“, entgegnete Monroe mit gerunzelter Stirn. „Besonders, wenn man Sie, wie ich vermute, ins Rattenloch bringen wird.“
Joel trat zu ihnen. „Rattenloch? Was soll das bedeuten?“
„Das ist der Name, den Gefangene ihrem Lager im südlichen Ohio gegeben haben“, erklärte er und konnte dem Blick der beiden anderen vor lauter Scham kaum standhalten. „Die Rebellen sagen, es gäbe keinen schlimmeren Ort unter der Sonne, und nach allem, was ich gehört habe, trifft das auf das Rattenloch wirklich zu.“
„Hoffen wir nur, dass man uns sonst wohin schickt“, murmelte Lockwood.
„Leider unwahrscheinlich“, antwortete Monroe. „Tut mir wirklich leid.“
Er grüßte, drehte sich um und ging. Lockwood sah ihm nach. Seinem angespannten Gesichtsausdruck war anzumerken, dass er allmählich verstand, wozu er seine Männer verdammt hatte. Plötzlich wurde der Gedanke an Flucht in ihm übermächtig, denn wenn das nicht mehr möglich war, dann wären sie wohl besser im Kampf gefallen und müssten nicht herausfinden, ob all das, was über das Rattenloch gesagt worden war, wirklich zutraf.
*
Regen!
Das Wasser floss über die Krempe von Lockwoods Hardee-Hut, und mit gesenktem Kopf setzte er mühsam einen Fuß voller schmerzender Blasen vor den anderen. Wann würde diese Sintflut wohl enden, fragte er sich die ganze Zeit über.
Irgendwie war ihm das Gefühl für Zeit abhandengekommen, aber es war sicherlich bereits mehr als eine Woche vergangen, seit er und seine Männer gefangengenommen worden waren.