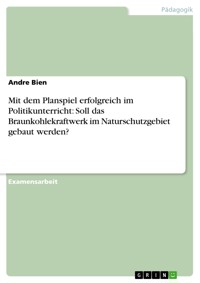36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Examensarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich Geowissenschaften / Geographie - Regionalgeographie, Note: 1,5, Technische Universität Dresden, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Bergbaulandschaften, wie sie sich heute im Mitteldeutschen Revier entwickelt haben, sind längst keine "Mondlandschaften" oder "Katastrophenregionen" mehr. Die ersten massiven Veränderungen dieser Gegenden wurden durch den Braunkohletagebau verursacht. Neben Eingriffen in den Naturhaushalt waren damit auch Umgestaltungen der sozialen und wirtschaftlichen Situation der Bevölkerung verbunden. Mit der raschen Einstellung fast aller Tagebaue, der Stilllegung der weiterverarbeitenden Betriebe und der Sanierung der Bergbauhinterlassenschaften fand wiederum ein Eingriff statt. Für die Menschen vor Ort war jener häufig gekennzeichnet durch den Zusammenbruch der wirtschaftlichen Strukturen und Verlust ihrer Arbeitplätze. In der Summe bieten die Tagebaulandschaften heute großflächig zusammenhängende Bereiche, die sich durch geringe Zerschneidung und wenige Störungen kennzeichnen. Aus Naturschutzsicht bedeutet die Sanierung ein erneutes Überprägen inzwischen gewachsener Strukturen mit dem Ziel, überwiegend forst- und landwirtschaftliche Nutzflächen herzustellen. Durch ausgedehnte Sanierungstätigkeiten in den stillgelegten Braunkohletagebauen der ostdeutschen Reviere richtete man diese Gegenden allmählich für eine Nachnutzung her. In den entstehenden Seenlandschaften werden besondere Potenziale für Erholung und Tourismus gesehen. Dabei wird eine hohe Verantwortung an die Gemeinden weitergegeben, selbst individuelle Gestaltungs- und Entwicklungskonzepte zu erstellen und umzusetzen. Denn die entstehende Seenlandschaft und die großflächigen Aufforstungen bieten, neben dem in weiten Teilen heute schon greifbaren Gewinn an Umwelt- und Lebensqualität, vor allem neue wirtschaftliche Perspektiven als gewinnbringende Ressource für Wertschöpfung und Erholung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2008
Ähnliche
Page 1
Page 2
Zielstellung der Examensarbeit
Nach diversen Fernsehberichten über den Leipziger Süden, den jahrelangen Streitigkeiten bei geplanten Umsiedlungen, die Diskussion um die Zukunft der Braunkohle als Energieträger und die aktuelle Debatte über den Klimawandel ließen das Bestreben aufkommen, diesen Raum in einer Arbeit näher zu betrachten. Dabei hatte ich die Intension, nicht alles bis in alle Einzelheit zu beleuchten oder etwa durch Fachspezifika die Vorgänge unnötig kompliziert zu darzulegen. Als angehender Lehrer ist es mir wichtiger, einen Gesamteindruck zu erhalten. Bedeutsam hierbei ist das Überblickswissen anzuwenden und sich mit der Landschaft vertraut zu machen.
Mit dieser Arbeit wird versucht, den Südraum Leipzig so umfassend wie möglich und so detailliert wie nötig, vorzustellen. Sicherlich können aufgrund der Eingrenzung der Seitenzahlen, nicht alle Themen aufgegriffen werden, die sicherlich einer Ausführung bedürften. Dennoch habe ich mit der Auswahl an physischgeographischen und wirtschaftsgeographischen Aspekten versucht, wichtige Vorgänge ausführlich darzulegen.
Der Leser soll nach der Lektüre angehalten sein, sich selbst ein Bild vor Ort machen zu wollen, bzw. sich Informationen zu den angesprochenen Themen einzuholen. Mein Anspruch war es ebenso, diese Lektüre interessierten Lehrerkollegen zur Verfügung zu stellen, die eine Sachanalyse über diesen Raum oder der Einzelaspekte durchführen möchten. Weiterhin kann anhand der Informationen eine Exkursion in das Gebiet vorbereitet oder durchgeführt werden. Die dazu angegebene Literatur bietet die Möglichkeit sich in eines der angesprochenen Themen näher einzulesen, denn es wurde eine Vielzahl an Aufsätzen und Monographien über diese Region verfasst.
Page 5
1. Einstieg
Die Bergbaulandschaften, wie sie sich heute im Mitteldeutschen Revier entwickelt haben, sind längst keine "Mondlandschaften" oder "Katastrophenregionen" mehr. Die ersten massiven Veränderungen dieser Gegenden wurden durch den Braunkohletagebau verursacht. Neben Eingriffen in den Naturhaushalt waren damit auch Umgestaltungen der sozialen und wirtschaftlichen Situation der Bevölkerung verbunden. Mit der raschen Einstellung fast aller Tagebaue, der Stilllegung der weiterverarbeitenden Betriebe und der Sanierung der Bergbauhinterlassenschaften fand wiederum ein Eingriff statt. Für die Menschen vor Ort war jener häufig gekennzeichnet durch den Zusammenbruch der wirtschaftlichen Strukturen und Verlust ihrer Arbeitplätze.
In der Summe bieten die Tagebaulandschaften heute großflächig zusammenhängende Bereiche, die sich durch geringe Zerschneidung und wenige Störungen kennzeichnen. Aus Naturschutzsicht bedeutet die Sanierung ein erneutes Überprägen inzwischen gewachsener Strukturen mit dem Ziel, überwiegend forst- und landwirtschaftliche Nutzflächen herzustellen.
Durch ausgedehnte Sanierungstätigkeiten in den stillgelegten Braunkohletagebauen der ostdeutschen Reviere richtete man diese Gegenden allmählich für eine Nachnutzung her. In den entstehenden Seenlandschaften werden besondere Potenziale für Erholung und Tourismus gesehen. Dabei wird eine hohe Verantwortung an die Gemeinden weitergegeben, selbst individuelle Gestaltungs- und Entwicklungskonzepte zu erstellen und umzusetzen. Denn die entstehende Seenlandschaft und die großflächigen Aufforstungen bieten, neben dem in weiten Teilen heute schon greifbaren Gewinn an Umwelt- und Lebensqualität, vor allem neue wirtschaftliche Perspektiven als gewinnbringende Ressource für Wertschöpfung und Erholung.
Die Literaturfülle zu diesem Thema fallen recht unterschiedlich aus. Im physisch geographischen Teil war es weniger schwierig, Material über den Naturraum zu erhalten. Mannsfeld, Pietzsch, Wagenbreth und Eissmann haben durch ihre Publikationen das Gebiet umfassend beleuchtet. Bei den Problemen Rekultivierung und Sanierung, Entstehung der neuen Seen und deren Nutzungsmöglichkeiten, Naturschutz und die gesellschaftlichen Veränderungen zeigte sich, dass diese Themen meist im Zeitraum von 1997-2003 ausgiebiger behandelt wurden. Neuere Literatur zu finden gestaltete sich schwierig. Eine große Hilfe bot dabei das Internet und die Monographien von Berkner, Kabisch, Linke sowie dem Landesamt für Umwelt und Geologie in Sachsen.
Page 6
Abbildungen und Tabellen stammen aus der angegebenen Literatur. Aufgrund der Fülle an Bildern und Illustrationen habe ich mich dafür entschieden, der Arbeit eine CD-Rom beizufügen, auf denen die Abbildungen zu sehen sind.
Die Fotos sind größtenteils private Aufnahmen, welche im August letzten Jahres entstanden sind. Es war selbstverständlich ein Anliegen von mir, die Gegend und die angesprochenen Probleme selbst einmal kennen zu lernen.
Im Titel der Arbeit wird vonBergbaufolgelandschaftengesprochen, obwohl es sich mit dem Gebiet des Südraumes Leipzig nur um faktisch eine Bergbaufolgelandschaft handelt. Dennoch sehe ich nach Beendigung meiner Recherchen und der kurzen Stippvisite, diese Region mit einer gewissen inneren Differenzierung. Denn nach dem Ende des Raubbaus an der Natur blieben hauptsächlich zwei denkbare Verwendungszwecke der beschädigten Gebiete. Zum einen das Feld des Naturschutzes und zum anderen der lukrative Tourismuszweig. Und da sich die Räume so unterschiedlich, aufgrund der differenzierten Nutzungsmöglichkeiten entwickeln, sehe ich den Raum südlich von Leipzig als eine großräumige Bergbaufolgelandschaft mit mehreren integrierten, kleinräumigen Bergbaufolgelandschaften.
Page 7
2. Physisch- Geographische Einordnung
Nach Mannsfeld zählt das Gebiet zumLeipziger Land.Die gesamte Landschaft südlich von Leipzig gehört zum geologischen Komplex von Nordwestsachsen und wird begrenzt durch das Dreieck Leipzig- Altenburg- Riesa. Dieser Sektor wird nicht durch jüngere Störungslinien klar abgetrennt, sondern höchstens unscharf durch die alten Strukturen des Variskischen Gebirges. Die Südostgrenze bildet der Schiefermantel des Granulitgebirges, im Norden dient das Altmoränengebiet der Dahlener Heide als Grenzlinie und die Westabgrenzung formen die Elster- und Pleißenaue sowie die Braunkohlenreviere von Borna und Altenburg. (Abb.1) Nordwestsachsen besteht geologisch aus zwei miteinander verzahnten Komplexen. Zum einen der östliche Teil rund um die Orte Oschatz, Wurzen und Rochlitz, die zum Nordsächsischen Vulkanitkomplex aus dem Unterperm zählen; und zum anderen der westliche Teil, welcher alsLeipziger Tieflandsbuchtbekannt ist. (Wagenbreth 1989: 150) Die beigefügte Karte (Abb.2) zeigt die in Sachsen vorkommenden Naturraumtypen und die markierte Stelle verweist auf den Betrachtungsraum.
2.1 Das Landschaftsbild vor und nach der Braunkohle- Landschaftswandel
Der Südraum Leipzig (Abb.3) zählt zu dem verdichteten Raum um das Oberzentrum Leipzig im Ballungsraum Leipzig- Halle- Dessau. Je nach Literaturgrundlage und Eingrenzungskriterien fallen die Angaben über die Größe des Betrachtungsraumes relativ unterschiedlich aus. In der vorliegenden Arbeit wird bei den Größenangaben der Landkreis Leipziger Land als Maßstab verwendet. Darin leben auf einer Gesamtfläche von 752 km² ca. 146.816 Einwohner (Stand: 31.Dezember 2006) Dies entspricht einer Bevölkerungsdichte von 195 Einwohnern je km². Einem Wert der, trotz des deutlichen Rückgangs gegenüber dem Ausgangsniveau 1990 um etwa 9%, eindeutig über dem Mittelwert der Bundesrepublik Deutschland von 231 Einwohnern pro km² liegt. (Berkner 2004: 11)
Die ganze Region des Südraums Leipzig wurde erst vor annähernd 1000 Jahren gerodet und nutzbar gemacht. Ein dichtes Netz von Kleinstädten und Dörfern entwickelte sich in den folgenden Jahrhunderten und prägte die agrarisch genutzte Kulturlandschaft nachhaltig. Es entwickelten sich nutzbare Böden mit hohem Ertragspotential. Man bezeichnete diese Gegend auch als „harmonische Landschaft“, die gekennzeichnet war durch den Wechsel von Acker-und Auenlandschaften, kleinen Wäldern und dem Vorteil der unmittelbaren Nähe zur Messestadt Leipzig. M. Luther, J. S .Bach, G. Silbermann und F. Schiller sind nur einige herausra-
Page 8
gende Persönlichkeiten, die sich in dieser Gegend von der Natur und ihrer Landschaft inspirieren ließen.
Vor den bergbaulichen Eingriffen bestand die Landschaft der Leipziger Tieflandsbucht aus einem ebenen bis flachwellige Gebiet eiszeitlicher Ablagerungen. Dadurch konnten sich die Täler der Weißen Elster, Pleiße, und Whyra als flache und breite Täler einschneiden. Die Landschaften aus eiszeitlichen Ablagerungen trugen fruchtbare Felder, die Talauen wiederum bestanden aus herrlichen Wiesen und dichten Auenwäldern. Diese von der jüngsten Erdgeschichte geformten Landschaftstypen sind aber nur noch lokal erhalten geblieben, zum Beispiel dieAuenlandschaft im Whyratalbei Borna.
Doch mit dem Aufkommen der Braunkohlenindustrie und den Großtagebauen setzte ein umfangreicher Kulturlandschaftswandel ein. Bauerndörfer wurden zu großen Industriedörfern, ganze Wohnsiedlungen für die neuen Arbeiter und deren Familien wurden aus dem Boden gestampft. Aus den Äckern und Auen wurden Ausgrabungs- und Haldenflächen. Zurückblieb eine Mondlandschaft mit gewaltigen Rekultivierungsdefiziten für die nachfolgenden Generationen.
Seit etwa 120 Jahren wird dieser Bereich durch den Braunkohlebergbau umgestaltet. Die ausgekohlten Zonen werden in mühsamer Arbeit wieder rekultiviert und dem Menschen und der Natur zur Nutzung wieder übergeben. Dennoch werden die Bergbaufolgelandschaften ihr ursprüngliches, natürlich geprägtes Relief nicht zurückerlangen.
In den letzten 17 Jahren wurde der Südraum Leipzig zu einer der größten „Landschaftsbaustellen“ Europas. Im Zuge der Wiedernutzbarmachung entstanden und entstehen Tagebaurestseen mit ca. 70km² Gesamtfläche sowie umfangreiche Aufforstungen, die eine langfristige Erhöhung des Waldanteils von 7% auf 18-20% erwarten lassen. Die Vision des Neuseenlandes, eine Verbindung von Verbliebenem und „neuen Orten“ in Form von Inseln, Hügeln, Wegen und Bauwerken einzugehen, tragen zur Rückgewinnung, der beinahe verloren gegangenen kulturlandschaftlichen Identität bei.
Nach wie vor, hat die Gegend mit den Erblasten des Raubbaus an der Natur zu kämpfen. Neben den vielen Arbeitsplätzen, die nach dem Zusammenbruch der Braunkohleindustrie wegfielen, ist die Natur bemüht, die ihr zugefügten Wunden mit Hilfe des Menschen zu heilen. Zum Ende der einleitenden Gedanken stehen noch jeweils 4 Thesen, die die positiven und negativen Aspekte und das Image der Region charakterisieren sollen.
Page 9
„Es wurden 3 Milliarden Tonnen Kohle gewonnnen und 10km³ Massen bewegt. Das entspricht den regionalen Umlagerungen der quartären Eiszeit mit der Beschleunigung um den Faktor 1000“.(Abb.5)2.2 Geologie des Leipziger Südraumes(Abb. 6)
Neben einer ausführlichen Darstellung der Erdgeschichte im Leipziger Neuseenland, vom Prätertiär über die eigentliche Braunkohlezeit im Tertiär bis hin zum Pleistozän und Holozän, soll in diesem Abschnitt der Arbeit ebenso auf die Begriffe der Kohle und Braunkohle selbst eingegangen werden. Neben der Definition, Entstehung, Einteilung, Förderung und Aussagen zu den weltweiten Reserven, wird die Braunkohle mit ihren vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten vorgestellt. Um nicht den Anspruch der Arbeit zu verwässern, das Gebiet des Neu-seenlandes zu charakterisieren, soll die Braunkohle an sich nur kurz und komprimiert angesprochen werden.