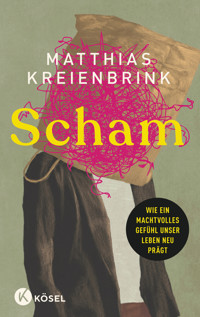
16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kösel-Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Ein neuer Blick auf ein starkes Gefühl - informativ, aufklärend und überraschend
Jeder kennt das Gefühl der Scham – und keiner mag es. Scham ist kaum kontrollierbar und kann deshalb leicht missbraucht und instrumentalisiert werden. Das gilt heute mehr denn je: Durch die sozialen Medien hat die Scham ein großes Comeback erlebt. Scham ist wieder zur Waffe geworden.
Matthias Kreienbrink zeigt, wie Scham entsteht und in welchen Bereichen sie besonders häufig auftritt. Und er lässt Menschen zu Wort kommen, deren Leben von Scham geprägt wurden, oder die kreative Wege aus der Scham aufzeigen – darunter auch bekannte Personen wie Ulrich Matthes, Kevin Kühnert oder Samira El Ouassil.
Auf eindrucksvolle Weise und informativ zeigt er dabei auch auf, welche positiven Seiten die Scham eigentlich hat – und welche Bedingungen es braucht, um diese Emotion wieder produktiv werden zu lassen für uns und die Gesellschaft, in der wir leben.
»Jeder schämt sich, aber keiner spricht darüber – aus Scham. Matthias Kreienbrink durchdringt dieses unbehagliche, heftige Gefühl so einfühlsam wie analytisch und enthüllt dabei die politischen, wirtschaftlichen, psychologischen sowie soziologischen Dimensionen unserer Verlegenheit. Nach der bewegenden Lektüre schämt man sich selbstbewusster.«
Samira El Ouassil, Autorin, Schauspielerin und Podcasterin
- Warum Scham aktueller ist denn je
- Scham hat hohe gesellschaftliche Relevanz
- Mit Anregungen für Wege aus der Scham
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 294
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Das Buch
Das Thema Scham ist aktueller denn je. Durch die sozialen Medien hat die Scham ein großes Comeback erlebt. Scham ist wieder zur Waffe geworden. Über Beschämungen werden Menschen wieder diszipliniert und auf einen vermeintlichen Makel reduziert. Die Scham stellt Menschen bloß und hinterlässt tiefe Wunden. Aber Beschämung führt nur zu Abwehr oder Flucht. Wie lernen wir stattdessen, wieder ohne Beschämung zu sprechen – und ohne Ohnmacht auf sie zu reagieren? Und hat die Scham vielleicht sogar gute Seiten?
Der Journalist Matthias Kreienbrink bietet mit seinem informativen und virtuosen Buch einen empathischen Rundgang durch das oft tabuisierte Gefühl der Scham. Mit dem Hintergrund seiner eigenen »Schambiografie« führt er wichtige Aspekte der Scham zusammen und beleuchtet sie mit aktuellen und überraschenden Bezügen neu. Kreienbrink zeigt zunächst, wie Scham entsteht, welche Rolle die Sprache dabei einnimmt und wie sie als Machtinstrument eingesetzt wird. Unter anderem mit der Familie, der Schule, der Sexualität, dem Bereich Macht und Politik und den sozialen Medien präsentiert der Autor klassische Felder, in denen Scham gehäuft auftritt. Er lässt Menschen zu Wort kommen, die in ihrem Leben von Scham geprägt wurden, User, die Shitstorms ausgesetzt waren, und Menschen, die durch Scham an Angststörungen oder Depressionen leiden. Auf sehr anschauliche Weise werden dadurch die Mechanismen, Auswirkungen und Folgen der Scham deutlich – verbunden mit konkreten Vorschlägen, Wege aus der Scham zu finden.
Der Autor
Matthias Kreienbrink ist als Gesellschafts- und Digitaljournalist tätig und studierte Literatur- und Geschichtswissenschaft an der Freien Universität Berlin. Heute schreibt er als freier Journalist für DIEZEIT, Der Spiegel, die Süddeutsche Zeitung und die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung und arbeitet als CvD bei t3n.
MATTHIAS KREIENBRINK
Scham
WIEEINMACHTVOLLESGEFÜHLUNSERLEBENNEUPRÄGT
Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Copyright © 2025 by Matthias Kreienbrink
Copyright Originalausgabe © 2025 by Kösel-Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die
Michael Meller Literary Agency GmbH, München
Umschlaggestaltung: zero-media.net, München
Umschlagmotiv: Ukususha/istock; FinePic®, München
Redaktion: Dr. Daniela Gasteiger, München
Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
ISBN 978-3-641-32613-5V003
www.koesel.de
Für Papa – mild und leise, wie er lächelt
Inhalt
Einleitung: Wir alle haben eine Schambiografie
Arbeit mit der Scham
Was will dieses Buch?
1 Was ist Scham?
Der Stress in unserem Gehirn
Die Sprachlosigkeit der Scham
Die Macht der Beschämung
Produktive und destruktive Scham
2 Kinderstube
Die Geburt der Scham
Druck am Tisch
Virtuelle Welten mit beschämten Eltern
3 Die Schule der Scham
Wer sind wir?
An die Tafel, bitte!
Beschämende Ertüchtigung
Der Schulhof ist jetzt überall
4 Peinliche Körper
Scham und Ekel
Perverse Menschen
Die Auflösung des Körpers
5 Beschämtes Arbeiten
Alte und moderne Scham
Burnout und Scham
Die unbegehrten Berufe
Neue Ausschlüsse
6 In der Krise und am Lebensende verstecken wir uns
Psychiatrie, online und offline
Das beschämte Ende
Richtig Abschied nehmen
7 Die neue Macht der Scham
Das ABC der Beschämung
Die Mikrobeschämung
Beschämender Stillstand
8 Wege aus der Scham
Die Psyche entlasten
Die eigene Geschichte neu erzählen
Widersprüche aushalten
Protest als Gegengift gegen die Scham
Die Probebühne im Kopf
Lob des Zweifels
Humor und Nähe
Nachsicht üben
Danksagungen
Zum Weiterlesen
Anmerkungen
Einleitung: Wir alle haben eine Schambiografie
Die Scham kennt mich ziemlich gut. Und ich sie inzwischen auch. Dafür haben die Jahre gesorgt, in denen ich mich nun schon mit ihr beschäftige. Scham ist eine Emotion, die jeder von uns schon im Körper gespürt hat: Schweiß bricht aus, die Wangen werden rot, der Blick senkt sich – bloß niemandem in die Augen schauen. Nur leider tut sich nie der Boden auf, damit wir darin versinken können. Seit Jahrtausenden begleitet die Scham die Menschheit, auch wenn diese immer wieder versucht hat, sie loszuwerden. Sie drängt sich einfach auf.
Auch Sie, liebe Leser*innen, kennen die Scham sicherlich. Sie werden sich an Ihre erste prägende Bekanntschaft mit diesem Gefühl erinnern. Und es gibt sicherlich schamvolle Situationen aus Ihrer Vergangenheit, die Sie heute noch verschlossen halten, weil Sie wissen, dass dieses unangenehme Gefühl sofort wieder Ihren Körper ergreifen wird, wenn Sie sich erinnern. Darum möchte ich Ihnen am Anfang dieses Buchs erzählen, welche Erfahrungen ich mit der Scham gemacht habe, sowohl persönlich als auch in meinem Beruf. Indem ich die Schamgeschichten aus meiner eigenen Schambiografie erzähle, möchte ich die vielen Felder anreißen, in denen diese Emotion unser aller Leben bestimmt. Meines wie auch Ihres. Zur Scham gehört, exponiert zu sein. Darum werde auch ich mich an dieser Stelle exponieren, bevor wir meine Geschichte hinter uns lassen, den Blick weiten und uns zu den vielen Stationen auf den Weg machen, in denen die Scham unser aller Leben und unsere Gesellschaft prägt, von der Kindheit bis zum Tod.
Zu einer meiner ersten Erinnerungen gehört eine Begegnung mit der Scham. Meine beiden Schwestern, meine Mutter und ich gingen in einem Wald spazieren. An der Hand meiner Mutter lief ich durch diesen sonnigen Tag, brabbelte vor mich hin, zeigte auf Dinge, die ich im Dickicht sah. Ein Kind eben, das selbstverloren existiert. Doch dieser Existenz wurde ich abrupt gewahr, als ich am Arm meiner Mutter entlang nach oben schaute – um festzustellen, dass ich überhaupt nicht in das mir so vertraute Gesicht blickte.
Nein, da war eine mir fremde Frau, die mich grinsend ansah. Plötzlich brach um mich herum Gelächter aus. Meine Mutter und meine Schwestern schauten mich amüsiert an und mir lief es heiß den Rücken runter: Ich hatte die falsche Hand gegriffen und lief bereits seit Minuten nichts ahnend an der Hand einer fremden Frau. Noch schlimmer, meine Familie hatte das gesehen und sich köstlich amüsiert. Sie hatten nur darauf gewartet, bis auch ich entdeckte, was sie längst wussten. Ich brach in Tränen aus.
Der Vorfall war eine Nichtigkeit, lapidar und alltäglich. Gleichzeitig aber war er ein so prägendes Erlebnis, dass es mir auch etwa 35 Jahre später im Gedächtnis ist. Hier hatte ich die Scham erstmals in ihrer vollen Wucht erlebt. Die Öffentlichkeit, die dazugehört; meine Familie und die anderen Menschen drum herum, die mich ansahen. Der eigene Fehltritt; die Peinlichkeit, die falsche Person an der Hand gegriffen zu haben. Diese Ungerechtigkeit, dass niemand meine Schmach erkennen wollte. Und als einziger Ausweg fiel mir damals ein, die Augen zu verschließen und die erschütternde Erfahrung zu beweinen. Diese Scham ist ohne Absicht aufgetreten. Keine*r der Beteiligten wollte mich beschämen – und dennoch schämte ich mich.
Die absichtliche und verletzende Beschämung trifft noch härter und hinterlässt mitunter größeren Schaden. Sie frisst sich ins Gehirn und verändert das Verhalten. Sie will bloßstellen und demütigen.
Über ein Jahrzehnt nach dem Spaziergang sitze ich im Klassenzimmer einer katholischen Realschule in meiner Heimatstadt Osnabrück. Ganz hinten an der Wand hängt ein Foto. Es zeigt mich als stark übergewichtigen Jungen. Hochrot, Schweiß im Gesicht, der Pullover sitzt unvorteilhaft – zu eng, zu kurz und irgendwie schief. Ich versuche auf dem Foto zu grinsen, aber es will mir nicht so recht gelingen. Aufgenommen wurde es während einer Klassenfahrt in Südtirol. Es zeigt das Ende einer beschwerlichen Wanderschaft durch die Berge, während der ich und zwei übergewichtige Klassenkameradinnen mit einem Jeep abgeholt werden mussten, weil uns die Puste ausgegangen war. Allein das hatte ich schon als sehr beschämend empfunden.
Ich erinnere mich noch gut an die vorwurfsvollen Blicke der Mitschüler*innen, als wir sie am Ziel der Wanderschaft, einem abgelegenen Gasthof, wiedertrafen. Wir waren natürlich früher dort als sie. Ich schämte mich damals für meinen Körper und seine Unfähigkeit, diese Strapazen zu meistern. Während ich in meiner Kindheit noch der »Spargeltarzan« gewesen war, wurde ich nun in der Schule »Schnitzel« genannt. Dick, so gut wie keine Freunde, unbeliebt.
Das Foto an der Wand im Klassenzimmer fasste all das Erlebte für mich zusammen. Es hing nicht zufällig da. Mitschüler*innen hatten es dort platziert, um mich zu beschämen. Sie wussten, dass mir das Foto unangenehm war. Lehrer*innen, denen dieses einsame, traurige Foto dahinten an der Wand wohl eigentlich hätte auffallen sollen, sagten und taten nichts.
Wenn ich heute darauf zurückblicke, sehe ich einen in sich zusammengesunkenen Jungen, der diese Bloßstellung über sich ergehen lässt. Es ist eine typische Reaktion auf die Scham: Resignation und Rückzug. Diese Scham zog sich durch die meisten Tage meiner Zeit auf der Realschule. Im Sportunterricht wurde ich als Letzter gewählt, und alle schauten ganz genau hin, wenn ich versuchen sollte, über den Bock zu springen. Vom Schwimmunterricht ganz zu schweigen.
Immer häufiger fehlte ich in der Schule, weil ich dieses Mobbing, wie man es heute nennen würde, nicht mehr aushielt. Aber je öfter ich fehlte, desto mehr rückte ich in den Mittelpunkt. Auch für die Lehrer*innen wurde ich zu dem merkwürdigen Schüler, der andauernd fehlte. Der, der in seinem »Aufsatz nur seinen eigenen Namen richtig geschrieben« hat, wie mir eine Lehrerin vor der gesamten Klasse vorwarf.
Ob ich nun fehlte oder nicht, ich stand ständig im Mittelpunkt – und die Scham folgte mir bis ins Wochenende und in die Ferien. Jeder Gedanke an die kleinen und großen Demütigungen in der Schule lief mir heiß durch den Körper. Zum Glück war es noch eine Zeit ohne soziale Medien. Damals lernte ich wortwörtlich am eigenen Leibe, wie destruktiv die Scham sein kann, wenn sie von anderen Menschen als Waffe benutzt wird. Es machte einigen Mitschüler*innen offensichtlich Freude, mich beschämt zu sehen. Denn das ist ja das Interessante an dieser Emotion: Sie tritt unmittelbar auf und ist für alle sichtbar. In ihrer Heftigkeit ist sie kaum zu kontrollieren, denn wie sollte man dem Gesicht auch sagen, jetzt bitte nicht rot zu werden? Mich hinterließ die Scham damals vor allem sprachlos. Da war keine Schlagfertigkeit mehr da. Keine Worte, die ich zurückschleudern konnte. Keine Kreativität.
Arbeit mit der Scham
Ich unternahm in den folgenden Jahren mehrere Versuche, auf weiterführenden Schulen einen ordentlichen Abschluss zu machen. Denn in der Realschule hatte ich kläglich versagt. Aber auch wenn die Mitschüler*innen jetzt deutlich freundlicher zu mir waren, blieb diese Scham in mir – sie hinterlässt Misstrauen. Schließlich begann ich eine Ausbildung als Koch, arbeitete für mehrere Jahre in unterschiedlichen Küchen und entschied mich schließlich, mein Abitur auf dem Abendgymnasium nachzuholen. In der Zwischenzeit hatte ich abgenommen, war etwas selbstsicherer geworden. Nach drei Jahren absolvierte ich das Abitur und begann direkt im Anschluss mein Studium. Der Weg an die Freie Universität Berlin war also schon selbst ein Weg aus der eigenen Scham-Paralyse.
Aus heutiger Sicht lässt sich leicht ein Zusammenhang konstruieren zwischen meinen Erfahrungen als Jugendlicher an dieser Realschule und meinen Forschungsinteressen viele Jahre später. Ich studierte Deutsche Philologie und Geschichtswissenschaft, wobei Emotionstheorien in den Mittelpunkt rückten. In meinem Masterstudium konzentrierte ich mich auf die Ältere Deutsche Literatur, las den Parzival von Wolfram von Eschenbach oder Tristan und Isolde von Gottfried von Straßburg – immer auf der Suche nach Emotions-Darstellungen in diesen höfischen Romanen. Hier schämten sich die Menschen sehr vehement.
Es machte mir große Freude, diese alten Texte nach Beschreibungen von Scham abzusuchen, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu dem heutigen Empfinden dieses Gefühls zu entdecken. In der Grundstruktur funktioniert unsere Gesellschaft noch recht ähnlich wie damals. Die Scham zeigt uns die Grenzen des Akzeptierbaren und der gesellschaftlich anerkannten Normen auf. Und sie ist ein Sanktionsmittel, mit dem die Menschen bestraft werden, die diese Grenze überschreiten.
Der große Unterschied aber ist, dass unsere Gesellschaft heute sehr viel heterogener ist als die ohnehin schon überraschend diverse mittelalterliche. Sie ist aufgeteilt in Subkulturen und Communitys, die alle ihre eigenen Regeln haben. Vor allem in den sozialen Medien wird die Scham heute als Mittel benutzt, um Menschen zurechtzuweisen. In einer immer komplexer werdenden Welt dient sie als Mittel, Diskussionen zu vereinfachen, in Gut und Böse einzuteilen. Die sozialen Medien werden in mehreren Kapiteln Thema sein, besonders aber in Die neue Macht der Scham.
Nach der Universität schrieb ich meine ersten Artikel für größere Medien. Und auch hier spielte von Anfang an, ohne dass es eine bewusste Entscheidung von mir gewesen wäre, die Scham häufig eine Rolle. Es ging neben den schon erwähnten sozialen Medien um Sportunterricht, Haarausfall, Übergewicht, Homophobie. Themen, über die ich mich immer wieder mit Psycholog*innen und Wissenschaftler*innen unterhielt, zu denen ich Betroffene befragte und Studien las. Es zeigte sich ein Bild von einer Gesellschaft, in der die Scham immer noch und wieder eine große Rolle spielt. Auch wenn sie sich seit dem Mittelalter stark gewandelt hat.
Im Rückblick kann ich heute sagen, dass meine frühen Erfahrungen mich auf den Weg gebracht haben, den ich heute begehe. Sie haben mein Leben und meine Arbeit so sehr beeinflusst, dass ich nun dieses Buch schreibe. So gewinnt diese destruktive Emotion für mich einen Sinn. Aber erst mit großem Abstand.
Was will dieses Buch?
In diesem Buch soll es aber eben nicht um mich gehen – auch wenn viele Aspekte, die hier behandelt werden, Teil meines Lebens waren und sind. Dieses Buch soll eine Annäherung an die Scham sein, so wie sie unsere Gesellschaft und damit unser Leben heute strukturiert und prägt. Und es soll um die Frage gehen, wie wir uns von schambesetzten Diskursen distanzieren können, die heute einen großen Teil der gesellschaftlichen Auseinandersetzungen bestimmen.
Es ist schon viel über die Scham geschrieben und gesprochen worden. Teile dieser Literatur und viele Gespräche sind auch Grundlage dieses Buchs. Aber mehr soll es um die Frage gehen, wieso die Scham denn wieder so an Macht gewonnen hat – in einer Gesellschaft, in der doch eigentlich (fast) alles erlaubt ist. Denn wir haben uns doch emanzipiert von der Scham. Wir wollen nicht mehr, dass sie unser Leben bestimmt, sagt, was wir dürfen und nicht dürfen. Doch genau in diesem Bestreben haben wir die Scham wieder verwandelt, in die schärfste Waffe, die wir in unserer so komplexen Realität haben. Schambesetzte Sprache ist an vielen Stellen zu finden: Sei es in den Debatten um Identität, den gesellschaftspolitischen Diskursen zum Klimawandel, dem Backlash zu gendergerechter Sprache, Fragen der Erziehung oder den Diskussionen darüber, was wir lesen und essen »dürfen« oder was gute und richtige Arbeit und der korrekte Umgang mit psychischen Erkrankungen ist. Boomer, Gendergaga, Flugscham oder woke sind nur einige der Begriffe, die wir heute lieber nutzen, als den produktiven Austausch zu suchen. Und das sorgt dafür, dass wir in vielen Bereichen als Gesellschaft nicht so richtig von der Stelle kommen. Denn es scheinen nur noch Fronten zu existieren. Einsicht und Veränderung kann in diesen Konflikten kaum gedeihen.
Viele der Diskurse, die unsere Gesellschaft aktuell prägen, lassen sich durch das Schlüsselloch der Scham neu und konturenreicher sehen. Dadurch können wir die Gesellschaft und ihre vielen Komplexitäten neu verstehen. Einerseits ist die Beschämung ein Schutz. Sie wird eingesetzt, um Menschen auszuschließen und sich selbst auf der richtigen Seite eines Konflikts zu verorten. Andererseits ist die Scham ein Marker dafür, eine bestimmte Grenze überschritten zu haben – egal, ob diese Grenze nun gerechtfertigt ist oder nicht.
Zunächst ist wichtig, zu verstehen, was Scham überhaupt ist. Dieser Frage nähert sich das Buch aus verschiedenen Perspektiven an. Die Sozialwissenschaften haben eine andere Antwort darauf als die Sprachphilosophie oder die Neurowissenschaft. Anschließend schreiten wir in den einzelnen Kapiteln die Stationen unseres Lebens ab, von der frühen Sozialisation in der Familie bis zur letzten Auseinandersetzung mit Krankheit und Siechtum. Es geht um gestresste Eltern und Kinder, die erleben, was es heißt, Teil einer Familie mit wenig Geld zu sein. Um das Klassenzimmer, in dem Scham noch immer zur Disziplinierung genutzt wird – und das durch die sozialen Medien gleichzeitig immer öffentlicher wird. Wir schauen auf Arbeitsplätze, in denen wir uns verwirklichen sollen, und die Scham, wenn das nicht passiert. Wir stellen die Frage, was Sex Positivity ist und wo diese Positivität ihre Grenzen hat. Und wir betrachten die Psychiatrie, die seit jeher von Scham umstellt ist.
An all diesen Stationen trifft alte auf neue Scham. Es geht nur noch selten um die großen Gesten. Menschen werden wie gesagt nicht mehr öffentlich mit geschorenen Haaren und Schild um den Hals bloßgestellt. Die Scham versteckt sich heute besser – sie ist dadurch aber nicht weniger mächtig. Das ist Thema im Kapitel Die neue Macht der Scham, das sich ganz den modernen Formen der Scham und Beschämung im öffentlichen und politischen Diskurs widmet. Einsicht und konstruktive Lösungen finden wir hier nur noch selten, stattdessen überwiegen gegenseitige Anschuldigungen. Schließlich aber soll es um die Frage gehen, welche Wege es heraus aus den Einbahnstraßen Scham und Beschämung gibt. Ich stelle Handreichungen vor, um die Scham hinter sich zu lassen – oder sie zumindest produktiv zu nutzen. Denn auch das ist wichtig zu zeigen: Scham hat einen Zweck. Ohne sie kann Gesellschaft nicht funktionieren. Aber es muss immer die Möglichkeit geben, aus der Scham zu lernen. Zu verstehen, wieso gewisse Grenzüberschreitungen nicht in Ordnung sind – und dass eine Veränderung des Verhaltens lohnend sein kann. Dafür braucht es aber Vorbedingungen: Sowohl muss der Grund für die Beschämung verstanden als auch die Grenzüberschreitung als solche anerkannt werden. Und das trifft immer seltener zu.
In allen Kapiteln dieses Buchs werden auch Menschen von ihren eigenen persönlichen Erlebnissen erzählen. Dabei geht es nicht nur darum, die Scham nahbarer und verständlicher zu machen. Vor allem soll die Komplexität dieser Emotion greifbar werden. Denn eines soll dieses Buch nicht: vereinfachen. Es geht nicht darum, Gut und Schlecht ausfindig zu machen, soziale Medien und (post-)moderne Diskurse zu verdammen. Diese Vereinfachung hat uns schließlich genau in die Situation geführt, in der wir sind. Eine Situation, in der die Scham so machtvoll ist wie lange nicht.
1
Was ist Scham?
Um über Scham sprechen zu können, müssen wir wissen, was sie überhaupt ist. Dabei wird sich zeigen: Die Sprache zu finden, um die Scham zu beschreiben, sie einzufangen und gefügig zu machen, ist eine Herausforderung. Denn Scham hat viele Gesichter und wandelt sich ständig – auch wenn ihr Kern immer gleich bleibt. Sie ist zunächst in unserem Hirn. Wenn wir uns schämen, erhitzen Neurotransmitter und Hormone unseren Körper, machen die Hände schwitzig und treiben uns die Röte ins Gesicht. Die Scham versteckt sich aber auch in unseren Wörtern, tritt aus Sätzen heraus, die wir sprechen und schreiben. Sie ist ein regulierendes und machtvolles Instrument in unserer Gesellschaft, das bestimmt, wie wir zusammenleben können – und wie nicht. All das kann sie zu einer Waffe machen. Durch beschämende Sprechakte werden Menschen abgewiesen, aus dem gesellschaftlichen Diskurs verdrängt. Ihnen wird die Macht über ihr Sprechen und ihre Identität genommen. Gleichzeitig ist die Scham eine unverzichtbare Emotion. Ohne sie ist gesellschaftliches Zusammenleben nicht möglich.
Wir wollen uns in diesem Kapitel diese verschiedenen Facetten der Scham ansehen. Auch wenn ich dabei nicht die gesamte Forschung dazu abdecken kann, wird deutlich, wie vielfältig diese Emotion und ihre Funktionen sind. Die Scham ist nur auf den ersten Blick recht simpel gestrickt.
Der Stress in unserem Gehirn
Die wohl einfachste Antwort auf die Frage, was Scham ist, lautet: Stress. Ganz so einfach ist es dann aber doch nicht. Das Gehirn ist ein komplexes Organ, in dem viele Prozesse gleichzeitig und nebeneinander ablaufen. Und ebenso vielschichtig ist auch die Scham: Sie ist stets ein Spiegel einer Gesellschaft, ihrer vielen Normen und Regeln. Dennoch kann uns ein Blick in unseren Kopf helfen, die Scham etwas besser zu verstehen.
Wenn wir etwas erleben, für das wir uns schämen, passiert im Gehirn das: »Neuronal betrachtet kommt es zur Ausschüttung von Stresshormonen. Die Blutgefäße weiten sich, es kommt zu Anspannung, wir werden rot im Gesicht, die Hände schwitzen«, erklärt der Psychologe Sören Krach, Professor am Social Neuroscience Lab, das an das Institut für Psychiatrie und Psychotherapie der Universität Lübeck angeschlossen ist. Er forscht schon seit vielen Jahren zur Scham und anderen sozialen Emotionen. Unter anderem macht er mit Magnetresonanzuntersuchungen die Scham im Gehirn sichtbar.
Vor allem Cortisol und Adrenalin überfluten in einer mit Scham verbundenen Stresssituation unser Gehirn. Beide Stoffe haben einen biologischen und auch evolutionären Nutzen: Der Herzschlag erhöht sich, der Blutdruck steigt. Dadurch werden wir in den Fight-or-Flight-Modus versetzt. Wir kommen in die nötige körperliche Anspannung, um entweder zu flüchten oder uns einem Kampf zu stellen. Die meisten dieser physischen Symptome, wie etwa das Erröten, sind oft zunächst auf eine Peinlichkeit zurückzuführen. Die Peinlichkeit kann etwa ein kleines Fehlverhalten sein. Die Scham ist das, was von ihr im Gehirn zurückbleibt. »Scham überdauert. Die gräbt sich tief ein«, sagt Sören Krach.
Für das Schamerleben ist vor allem der präfrontale Cortex wichtig. Er ist Teil des Frontallappens im Gehirn und sitzt ziemlich genau hinter unserer Stirn. Er ist auch für Empathie zuständig1 – eben die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen. Wenn wir Scham erleben, stellen wir uns nämlich vor, wie andere auf uns reagieren könnten. Der präfrontale Cortex unterstützt damit eine Änderung der Perspektive, die eine Vorbedingung für das Sich-Schämen ist.
Wenn wir uns schämen, schweben wir ein wenig über uns.2 Wir schauen von außen auf die Situation, sehen uns selbst – und, vor allem, wie wir betrachtet werden. Die Scham ist der Blick der anderen auf uns. Wie wir diesen Blick von außen deuten, macht die Scham so interessant. Dabei müssen die anderen nicht mal anwesend sein. »Das können auch internalisierte Normen und Ideale sein«, sagt Sören Krach. Es ist unsere Gesellschaft mit ihren Normen und Geboten, die da auf uns blickt.
Sicherlich hat sich jeder von uns schon mal für etwas geschämt, das niemand gesehen hat: Für einen Riss in der Hose, den wir schnell noch mit dem Mantel kaschieren. Oder für die leeren Pizzakartons, das dreckige Geschirr und unser wirres ungewaschenes Haar, wenn wir mehrere Tage nicht die Wohnung verlassen haben. Im Gehirn ist gespeichert, »was sich gehört«. Auch wenn wir ganz allein für uns gegen diese Normen verstoßen, können wir uns schämen. In diesem Fall erschafft sich das Gehirn sein urteilendes Gegenüber einfach selbst.
»Dafür sind auch die Spiegelneuronen zuständig. Durch sie erkennen wir Emotionen in anderen und können sie direkt nachempfinden«, erklärt Sören Krach. Darum spüren wir oft selbst eine leichte Scham, wenn wir eine Person beobachten, die sich gerade offensichtlich schämt. Sie wird rot, wendet den Blick ab, und wir erkennen: Das ist ihm oder ihr gerade sehr unangenehm. Und dann leiden wir mit. Sören Krach hat diese empathische Reaktion in seiner Studie When Your Friends Make You Cringe3 (dt. Wenn deine Freunde dir peinlich sind) erstmals nachgewiesen: als neuronale Reaktion im Hirn, wenn man die Gefahr miterlebt, dass Freunde oder Fremde in einer sozialen Situation degradiert werden. Nur eines von vielen Beispielen, wie selbst die Scham der anderen uns unangenehm sein kann.
Es wird angenommen, dass die Spiegelneuronen eine wichtige Rolle spielen, wenn wir neue Verhaltensnormen lernen und unsere zwischenmenschlichen Interaktionen steuern.4 Das Verhalten und die Emotionen anderer Menschen prägen demnach also unser Gehirn. Dieses spiegelt konstant die Menschen in seiner Umgebung. Dadurch spüren wir womöglich den Blick der anderen so stark auf und in uns, und das schon seit Tausenden von Jahren. Es gibt Theorien, die andeuten, dass die Scham zum Überleben des Menschen unabdingbar war.5 Bei den Urmenschen war die Scham demnach zielgerichteter, simpler. Es ging ums Überleben. Scham war ein Zeichen, dass man gegen eine Norm oder Regel der Gemeinschaft verstoßen hat und Gefahr lief, ausgestoßen zu werden. Denn ein Urmensch, der sich bei der Jagd nicht in seine Rolle fügte, riskierte das Überleben der ganzen Gruppe. So erfüllte die Scham einen evolutionären Zweck, sie sicherte den Bestand der Gruppe.
Auch heute zeigt uns Scham oft noch Grenzen auf. Öfter aber ist sie diffus, mitunter gar destruktiv. Und im schlimmsten Fall macht sie krank. Der Psychiater und Psychoanalytiker Léon Wurmser hat in den 1990er-Jahren das Bild der Maske geprägt.6 Es besagt, dass Scham sich verstecken kann. Dann ist sie der Grund für ein psychiatrisches Störungsbild: Wir schämen uns so sehr, dass wir erkranken. Die Scham bleibt als eigentlicher Grund aber unerkannt. Die Erkrankung ist die Maske, die die darunterliegende Scham versteckt.
Heruntergebrochen können wir uns das so vorstellen: Ein Mensch erlebt etwas, das in ihm starke Scham auslöst. Jede Erinnerung an diesen Moment bringt wieder die Stressreaktion im Hirn in Gang: Cortisol und Adrenalin. Dieser Stress wiederum kann eine Gegenreaktion im Menschen auslösen. Vielleicht verdrängt die Person die Erinnerung. Oder sie meidet jede Situation, die diese Scham wieder hervorrufen kann. Das können Orte sein; vielleicht die U-Bahn oder ein Einkaufszentrum, in dem man eine Panikattacke bekommen hat. Es können aber auch zwischenmenschliche Situationen sein. Körperliche Nähe oder konfrontative Gespräche etwa, die ein Mensch in einer von Missbrauch geprägten Beziehung erlebt hat. Durch diese sich wiederholenden Handlungsmuster verfestigt sich die Scham weiter, sie wird chronisch.7 So kann sich aber auch beispielsweise eine Angsterkrankung entwickeln, die das Leben eines Menschen stark einschränkt.8
Oder aber die Scham wird laut Léon Wurmser selbst zur Maske – und unter ihr liegt noch Schlimmeres verborgen. Kriegserlebnisse, Missbrauch oder Vernachlässigung. Insbesondere also Situationen, in denen unsere körperliche Selbstbestimmung und Unversehrtheit verletzt wird. Anstatt über diese Erfahrungen zu sprechen, macht uns die Scham stumm. Sie ist dann ein Abwehrmechanismus. Die Scham tritt in den Vordergrund des Empfindens der Person, die ein traumatisierendes Erlebnis hatte. Sie erschwert damit das Verarbeiten der eigentlichen seelischen Verletzung. Die Scham kann sich also wortwörtlich in unser Hirn fressen. Dadurch spielt sie etwa oft eine tragende Rolle bei einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS).9 Die Scham erschwert, dass Betroffene die Störung aufarbeiten. Wenn das Gehirn zu lange in diesem Stressmodus bleibt, kann das sogar zu Verlust von neuronalem Gewebe führen.10 Das Gehirn verändert sich also, wenn wir uns ständig schämen.
Häufiger aber ist es eine andere Scham, die wir erleben – eine, die uns ins Stolpern bringt, statt uns direkt zu Boden zu drücken. Alltägliche Erlebnisse, kleine Reibungen. Der Kontrolleur in der U-Bahn, wenn wir keinen Fahrschein haben. Der vergessene Geldbeutel, während die Schlange an der Kasse immer ungeduldiger wird. Situationen, die unsere Unzulänglichkeiten deutlich machen, aber wohl nicht zu psychiatrischen Störungen führen werden.
Unser individuelles Schamempfinden hängt von vielen Faktoren ab, die in diesem Buch noch eine große Rolle spielen werden. In der Kindheit legen Erziehung in der Familie und die frühe Sozialisation in Kindergärten und Schulen den Grundstein. Aber auch im weiteren Verlauf unseres Lebens kann ein starkes Schamerleben noch gravierende Auswirkungen auf unser Selbstbild haben – und damit auch, wie wir forthin selbst kleinste Schamerfahrungen wahrnehmen. Minderwertigkeitsgefühle kennt wohl jeder. Sie resultieren oft aus schamhaften Erfahrungen. Es sind Momente, in denen wir zurückgewiesen oder bloßgestellt wurden. Oft aus Gründen, für die wir nichts oder nur wenig können. Unser Aussehen, unsere Gefühle, unsere Fähigkeiten.
Während eine Person die Nacktheit an einem FKK-Strand genießt, kann genau diese Situation für eine andere der blanke Horror sein. Die eine blüht auf, wenn sie vor vielen Menschen einen Vortrag halten soll. Der andere kann nächtelang nicht schlafen, geht im Kopf alle peinlichen Momente durch, die während des Referierens passieren könnten, und wird schon beim ersten Wort rot und unsicher. All das basiert auf der Ansammlung von Erfahrungen, die Individuen im Laufe ihres Lebens machen und verarbeiten – oder eben nicht.11
Dennoch hat die Scham auch etwas Universelles, Verbindendes. Sie basiert auf den gleichen Vorgängen in unserem Hirn. Wir werden rot, wir schwitzen, wollen im Boden versinken. Das können wir nicht steuern, es kommt aus uns heraus, eben weil im Gehirn die Signale aus allen Rohren feuern. Es zeigt, dass wir Menschen sind: Menschen, die in einem Gefüge mit anderen Menschen leben und durch dieses Gefüge geprägt wurden.
Die Sprachlosigkeit der Scham
Wir stehen an einem öffentlichen Ort. Vielleicht auf dem Alexanderplatz in Berlin, vielleicht auf dem Stachus in München. Jemand kommt direkt auf uns zu. Wir kennen diese Person nicht. Doch sie streckt den Finger aus, zeigt auf uns und schreit: »Schäm dich!« Und das tun wir dann wohl auch, uns bleibt kaum etwas anderes übrig, selbst wenn der Ausruf keine Grundlage hat, nichts vorgefallen ist. Wird schon stimmen – unser erster Reflex scheint es zu sein, davon auszugehen, dass wir uns schämen müssen. Denn: Alle Menschen schauen auf uns. Was mag in ihren Köpfen vorgehen? Was denken sie über uns? Über den Grund, wieso diese Person gesagt hat, dass wir uns schämen sollen? Am besten verlassen wir den Ort eilig. Wegen zwei Wörtern.
Wir sehen, Sprache hat Macht. Und Scham kann durch Sprache ziemlich einfach ausgelöst werden: Das kann durch Beleidigungen geschehen. Öffentlich ausgeplauderte Geheimnisse. Oder Bemerkungen zu Teilen unseres Körpers, die wir selbst nicht mögen. Deine Nase ist zu groß. Oder schlicht die Aufforderung aus dem Blauen heraus, dass wir uns schämen sollen. Weil es eben funktioniert.
Gleichzeitig fehlen uns oft die Worte, wenn wir erklären wollen, wieso wir uns schämen. Sobald wir versuchen, das mit unserer Sprache zu fassen, kommt mit ihr auch die Scham zurück. Je stärker uns bestimmte schamvolle Momente geprägt haben, desto schwieriger fällt es uns, diese Scham in uns zu beschreiben. Wir werden rot, wenn wir nur daran denken.
Um diese beiden Aspekte der Scham in unserer Sprache soll es gleich gehen: Wie einfach es ist, mit Worten Scham auszulösen. Und wie schwer, sie mit Worten wieder aus uns rauszusprechen. Vorher aber wollen wir uns kurz in die Vergangenheit unserer Sprache begeben. Die ganze Macht der Scham zeigt sich schon im Ursprung des Begriffs. Zunächst reisen wir etwa 800 Jahre zurück ins Jahr 1200. Das Hochmittelalter ist die Blütezeit des höfischen Romans, in dem die Scham eine wichtige Rolle spielt. Sie ist das Gegenteil der Ehre – ein Konzept, das in unserer modernen Gesellschaft nur noch selten von Bedeutung ist. Wer sich schämen muss, hat gegen die Regeln verstoßen, die die Ehre herstellen. Das Wort Scham war damals ziemlich produktiv, es tauchte oft und in vielen Kontexten auf.12 Jemand konnte sich schamelich fühlen, also schamhaft. Oder es kam zu Schamesröte, schame-rôt. Beides Wörter, die wir heute auch noch kennen. Genauso aber konnte die Scham als Lob auftreten. Es gab das Schame-lop – und damit ist genau das gemeint, wonach es klingt: ein Lob, das einen beschämt.
Die Sprache des deutschen Mittelalters ist also sehr redselig, wenn es um die Scham geht. Eine Gesellschaft, in der diese Emotion eine tragende Rolle spielt, erweitert ihren Wortschatz entsprechend. Auch wir tun das. Wir kennen heute beispielsweise die Fremdscham.13 Dieses Wort gibt es so in kaum einer anderen Sprache. Die Frage, wieso gerade die Deutschen das Bedürfnis hatten, diesen Begriff in ihren Wortschatz aufzunehmen, ist wohl ein zu weites Feld.
Um der Scham bis an ihre sprachlichen Ursprünge zu folgen, müssen wir noch sehr viel weiter in die Vergangenheit reisen. Schätzungsweise 6000 Jahre, denn da entstanden die indogermanischen Sprachen. Wann genau, dazu gibt es nur Theorien. Von dieser indogermanischen Sprachfamilie stammen viele der noch heute gesprochenen Sprachen ab, auch das Mittelhochdeutsche und damit unsere moderne deutsche Sprache. Die Scham geht auf die indogermanische Wurzel kam oder kem zurück. Diese Wörter können übersetzt werden mit zudecken, verschleiern oder verbergen.14 In dem Wort Scham steckt also schon der Wunsch, sich zu verbergen. Die Menschen kennen das Gefühl seit vielen Tausend Jahren – und seitdem suchen sie auch nach Worten dafür.
»Während wir bei anderen Emotionen wie der Liebe oder dem Zorn eine reichhaltige Sprache haben, um sie zu beschreiben, sieht es bei der Scham ganz anders aus«, sagt die Philosophin Eva-Maria Engelen von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Sie forscht schon seit vielen Jahren zur Scham und hat Bücher geschrieben, wie Emotionen und Sprache zusammenwirken.15
Nehmen wir die Liebe als Beispiel: Der französische Philosoph Roland Barthes etwa hat allein zur Liebe und ihrer Sprache ein Buch geschrieben.16 Er stellt darin Fragmente dieser Sprache dar, wie das Schwärmen, die Zärtlichkeit und natürlich die Eifersucht. All diese Begriffe sind Teil eines Vokabulars, mit dem wir auch die feinsten Verästelungen der Liebe beschreiben können. Nicht umsonst ist der Liebesroman eines der beliebtesten Genres auf dem Buchmarkt. Wir haben bei der Liebe also Muster, auf die wir, wenn wir von unseren Emotionen erzählen, zurückgreifen können. Sprachliche Formen, die bereitstehen, um komplexe Vorgänge in unserem Kopf für alle verständlich zu machen – auch für uns selbst.
Bei der Scham aber herrscht Stille.17 Diese Emotion will sich nicht so recht in Worte fassen lassen. »Wir beschreiben die Situation, in der wir uns geschämt haben. Aber wie sich diese Emotion für uns angefühlt hat – das nicht«, sagt Eva-Maria Engelen.
Anders als die Scham können wir andere als negativ bewertete Emotionen wie Angst auch verklären. Sie wirkt aus zeitlicher Distanz betrachtet und in eine für uns bereitstehende Sprache gepackt nicht mehr so bedrohlich. In der Rückschau können wir sie in einen Kontext setzen. Vielleicht ist das, wovor wir Angst hatten, wieder aus unserem Leben verschwunden, weil wir selbst darauf hingearbeitet haben. Vielleicht sind wir durch die Angst sogar stärker geworden, haben etwas aus ihr gelernt. Wir geben ihr jedenfalls durch unsere Sprache einen Sinn, damit sie nachträglich in unser Leben und seinen Lauf passt. Das kann im Gespräch mit Freunden geschehen oder in einem inneren Monolog. Wir legen uns diese prägenden Momente so zurecht, dass wir weiterhin die Hauptfigur unserer Geschichte sind. Wir können Macht über die Emotionen und ihre Auswirkungen auf unser Leben haben.
Mit unserer Scham geht das nicht, sie ist hartnäckiger. »Die Scham in der Erinnerung an die Situation geht nicht weg. Sie bleibt. Sie kann immer wieder abgerufen werden«, so Eva-Maria Engelen. Nehmen wir die Situation, die ich anfangs beschrieben habe: den öffentlichen Platz, die Person mit dem auf uns gerichteten, erhobenen Finger, den Ausruf: »Schäm dich!« »Im Nachhinein würde ich versuchen, das einzuordnen: War das eine verrückte Person? Vielleicht eine Theaterinszenierung, um zu schauen, wie die Leute reagieren? Oder ein Experiment eines Psychologen?«, überlegt Eva-Maria Engelen. Und trotzdem: Würden wir uns diese Situation wieder gedanklich aufrufen, wir würden uns höchstwahrscheinlich wieder schämen. Wenn auch nur kurz. »Das Signal flackert wieder auf«, sagt Eva-Maria Engelen. Damit ist die Scham wohl die einzige Emotion, die erst mal nicht kleiner wird, wenn wir über sie reden – es braucht mehr als das, nämlich eine Veränderung der Perspektive: Wie wir auf die Scham blicken und uns zu ihr verhalten. Das wird in den folgenden Kapiteln immer wieder wichtig sein, besonders in Wege aus der Scham.
Das erste Merkmal der Scham, wenn sie durch Sprache ausgedrückt werden soll, ist also das: Sie lässt sich kaum fassen, ist flüchtig – und, auch wenn wir sie mit vielen Worten verbrämen, immer noch unangenehm.
Das zweite Merkmal der Scham ist, dass sie nicht von irgendwoher kommt. Oft beschämen uns andere Menschen, durch eine verletzende Sprache, Vorwürfe oder Bloßstellungen. Scham folgt oft auf einen Sprechakt, auf Worte, die ausgesprochen werden, um zu beschämen. »Beschämen ist zurechtweisen. Damit wird versucht, den anderen in den eigenen Wertekanon einzugliedern«, sagt Eva-Maria Engelen. Darum sind die genauen Worte (fast) egal. Es geht mehr um das Motiv dahinter. Man kann es wohl übergriffig nennen. Ziel ist, jemanden so zurechtzuweisen, dass diese Person sich schämt. Dabei spielen, wie die Philosophin es anspricht, die Wertvorstellungen und Verhaltensnormen der beschämenden Person die größte Rolle. »Du sprichst zu laut.« »Du läufst komisch.« »Du hast dich falsch verhalten.« Damit hat die sprachliche Beschämung einen erzieherischen Charakter. Sie will Menschen dazu auffordern, sich einer Norm oder einem Gebot entsprechend zu verhalten – oder sie will verletzen, weil eine Person gegen eine (vermeintliche) Norm oder ein Gebot verstoßen hat. »Dieser Sprechakt weist auf Normen hin, die mir aber selbst mitunter gar nicht bewusst sind. Es ist ein Signal, das nicht mehr tut, als darauf hinzuweisen, dass man gegen etwas verstoßen hat. Es erklärt nicht«, sagt Eva-Maria Engelen.





























