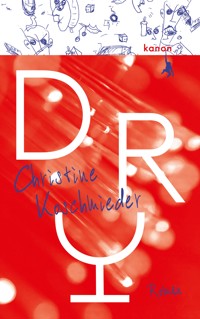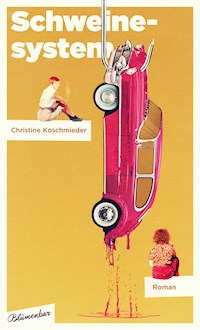Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kanon Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Exkursion ins Sumpfgebiet unserer SeeleNach dem Erfolg von »Dry« schreibt Christine Koschmieder über Sex und Intimität. Persönlich, mutig und lustig erkundet sie die Körpererfahrungen, die sie und andere Frauen im Lauf ihres Lebens gemacht haben.Gerade hat sie die Suchtklinik verlassen, da steht Christine Koschmieder vor einer neuen Herausforderung: Bisher hatte sie Sex meistens mit Hilfe von Alkohol. Aber wie lassen sich Intimität, Liebe und Sex ohne Betäubung erfahren? Und woher kommt ihre Angst vor Nähe eigentlich? Aus ihrer Biografie, aus unserer Kultur, oder ist sie einfach da? Mit 50 Jahren begibt sich Christine Koschmieder auf eine Exkursion ins »Sumpfgebiet unserer Seele«. Sie besucht Freundinnen, Ex-Lover und eine Sexualtherapeutin. Sie befragt sich und andere nach Nacktheit und Erregung, Grenzsetzung, Pornographie, OnlyFans und Selbstermächtigung. Sie folgt den Spuren, die ihre Beziehungen hinterlassen haben. Am Ende weiß ihr Kopf fast alles, aber ihr Körper noch nicht. Und dann fängt das eigentliche Abenteuer der Intimität an.»Ich hatte Sex, und ich habe drei Geburten und zwei Abtreibungen hinter mir. Ich kenne also meinen Körper. Was ich allerdings bis heute nicht gut kann: körperliche Nähe herzustellen und eine Sprache dafür zu finden. Das will ich jetzt ändern.«»Christine Koschmieder sucht nach einer Sprache für Sex, und dabei stellt sich heraus, dass es eigentlich um eine Sprache für (fast) alles geht, was wichtig ist. Eine mutige Memoir über das Verhältnis zum eigenen Körper, über die Angst vor Intimität, über Selbstbestimmtheit in Zeiten von OnlyFans und nicht zuletzt über die Frage, was Lust mit Vertrauen zu tun hat.«»Man verlässt dieses Buch verändert, mit einem tieferen Blick auf sich selbst und zärtlicher gegenüber anderen.« Teresa Bücker
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 219
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
CHRISTINE KOSCHMIEDER wurde 1972 in Heidelberg geboren und lebt in Aken / Elbe. Sie arbeitet als Autorin, Übersetzerin und Literaturagentin. Ihr Debütroman Schweinesystem (2014) war für den aspekte-Literaturpreis nominiert, ihr Roman Dry (Kanon, 2022) war ein Erfolg beim Publikum und in der Presse. Mithu Sanyal sagte über Dry: »Ein überwältigender Roman über Sucht und Sehnsucht und die große Angst vor großer Nähe.«
Es hat sich viel geändert, seit Christine Koschmieders Großmutter in den 80ern in Zeitschriften nackte Brüste abgeklebt hat. Das Sprechen über Anatomie, Sexualität und Geschlechteridentität scheint leichter geworden zu sein. Aber bei aller Veränderung und Neubewertung bleibt ein Terrain seltsam schambehaftet: sobald es nämlich um Nähe und Intimität geht.
Auf ihrer Exkursion ins »Sumpfgebiet unserer Seele« skizziert Christine Koschmieder eine Landkarte, auf der sie Sexualität, Scham und Aushandlungsprozesse markiert. Sie erkundet, wie Sexualität und Körperlichkeit in den 60er, 70er und 80er Jahren gelebt und vermittelt wurden. Sie besucht Freundinnen, einen Ex-Lover und eine Sexualtherapeutin. Sie fragt nach Nacktheit und Erregung, Grenzsetzung und Selbstermächtigung, und nicht zuletzt danach, wie Körper dazu eingesetzt wurden und werden, um Grenzen abzustecken und Themen zu besetzen.
»Ich hatte Sex, und ich habe drei Geburten und zwei Abtreibungen hinter mir. Ich kenne also meinen Körper. Was ich allerdings bis heute nicht gut kann: körperliche Nähe herzustellen und eine Sprache dafür zu finden. Das will ich jetzt ändern.«
CHRISTINEKOSCHMIEDER
SCHAMBEREICH
Über Sexsprechen
Für Libby, Skylar und Patrick
Ich bewundere eure Offenheit, euren Respekt und eure Verletzlichkeit.
»Wir haben nichts zu verlierenaußer unserer Angst«
Rio Reiser
Inhalt
TEIL I|KARTIERUNG
HOW I GOT HERE
SUMPFGEBIET DER SEELE
ICH BRAUCHE EINE LEGENDE
DAS BADEZIMMER MEINER ELTERN
VON DER JUNGFRÄULICHKEIT ZUR GEZÄHNTEN VAGINA
DIE JUNGS MIT DEN ZOLLSTÖCKEN. VERMESSUNG DER SEXUALITÄT
ES ROCH NACH KAFFEE. AN DEN SEX ERINNERE ICH MICH NICHT
OWN IT. DIE BETÄUBUNG BEENDEN
TEIL II|ANEIGNUNG
MEIN KÖRPER, EIN UNLAUTERER WETTBEWERB
BREAK THE DULL STEAK HABIT
VON KÖRPERN UND IHREN STANDPUNKTEN
DINGE, AN DIE ICH MICH ERINNERE
GIRL INTERRUPTED
WIE, DU KANNST SEINEN SCHWANZ NICHT ANFASSEN?
GEHT NICHT UMS ANFASSEN. GEHT UMS LOSLASSEN
VON WEICHEN HAAREN UND HARTEN KÖRPERN
DON’T SIT SO FAR AWAY. DIE SACHE MIT DER INTIMITÄT
TEIL III|VERBINDUNG
PENIS, ODER: ICH WILL, WAS SIE HAT
GESPRÄCHE, DIE NIEMAND FÜHREN WILL
I WOULD DRINK YOUR BATHWATER. ONLYFANS UND AUTONOMIE
PINKELN MÜSSEN IN SPANIEN
AB MORGEN HAB ICH GUTEN SEX
AM WASSER
BEIPACKZETTEL. KEINE GEBRAUCHSANWEISUNG
QUELLENVERZEICHNIS
ENDNOTEN
DANKE
TEIL I|KARTIERUNG
HOW I GOT HERE
“How had I wound up naked, and roasted like a half-done chicken, in a seedy dump in Paris? And where the hell was I going next?”
Erica Jong, Fear of Flying
1973. Elisabeth und Wolfram finden Blau schöner als Rosa. Also werde ich im blauen Strampler durchs Dorf gefahren. Wer sich über den Kinderwagen beugt, dem entfährt, »ä Buu, wie schee«, ein Junge, wie schön. Nein, ein Mädchen, stellt meine Mutter klar. »Aa net schlimm.«
Als ich neun oder zehn bin, höre ich zum ersten Mal den Vergleich von Brüsten mit einem Bügelbrett. Er kommt von meiner Mutter, und es sind ihre eigenen Brüste, über die sie spricht, und offensichtlich ist das nichts, was man sein will: Flach wie’n Bügelbrett. Die anderen zweidimensionalen Brüste, die ich sehe, sind auf der Titelseite einer Illustrierten. Genauer gesagt: Brüste, die ich nicht sehe. Weil meine Großmutter sie mit Leukoplaststreifen abgeklebt hat. Brüste, wenn sie flach oder abgebildet sind, sind nicht erstrebenswert.
Als ich II oder 12 bin, will ein Mädchen in der Bravo von Dr. Sommer wissen, ob sie sich Sorgen machen muss, zu eitel zu sein, weil sie jedes Schaufenster, an dem sie vorbeikommt, als Spiegel benutzt. Ich weiß nicht mehr, was Dr. Sommer antwortet, aber bis zu diesem Moment wäre ich nie auf die Idee gekommen, mein Aussehen in einer Schaufensterscheibe zu überprüfen. Ab diesem Moment schon.
Als ich 12 oder 13 bin, lese ich in der Bravo zum ersten Mal über Selbstbefriedigung. Und von Gegenständen, die Mädchen sich dazu einführen: Kerzen, Gurken, Möhren. Bis dahin wäre ich nie auf die Idee gekommen, mir eine Kerze oder Gurke einzuführen. Ich finde den Duschbrausekopf aber auch danach viel besser geeignet. Oder wenn wir Heiraten spielen, uns nackt aufeinanderlegen und so lange aneinander reiben, bis wir zum Orgasmus kommen, von dem wir nicht wissen, dass er so heißt, und den wir voreinander zu verbergen versuchen, warum auch immer, Selbstbefriedigung hat uns niemand verboten. In mein Fünfjahrestagebuch im Postkartenformat, das nur fünf Zeilen für jeden Tag vorsieht (weswegen ich lange Worte abkürze), findet sich ab dem Jahr 1983 mehrmals wöchentlich der Eintrag »abends selbst befr.«.
Mit 15 renne ich mit einer Flasche Erdbeersekt in der Hand durch die Gänge und rufe, »Die machen sich ihr Leben kaputt.« Wir sind auf Klassenfahrt, und die, das sind die anderen Mädchen aus meiner Klasse, und ihr Leben machen sie sich meiner Ansicht nach kaputt, weil sie nichts dabei finden, sich mit den Jungs zum Knutschen und Fummeln zu verabreden, obwohl sie gar nicht ineinander verknallt sind. Körperlichkeit und Sex ohne Liebe, das geht gar nicht. Glaube ich da noch.
Mit 17 liege ich mit aufgeknöpftem Kleid und ohne Unterhose nachts am Strand von Monterosso. Ich erinnere mich an die Kieselsteinchen, die sich mir in den Rücken drücken, und frage mich, ob der Junge, mit dem ich den ersten Geschlechtsverkehr meines Lebens zu haben versuche, wohl merkt, dass ich noch einen Tampon drin habe.
Ein paar Monate später liege ich nackt in einem Schlafsack auf dem Teppich vor dem Kamin im Haus meiner amerikanischen Gast-Eltern, und mein damaliger Boyfriend versucht, seinen Schwanz in mir zu verstauen. Ob uns das gelungen ist und wie wir uns dabei gefühlt haben, kann ich nicht mehr sagen, weil ich mich davor, wie so oft im späteren Leben, betrunken habe, um meine Scham und Versagensangst zu überwinden, ohne überhaupt sagen zu können, wofür ich mich eigentlich geschämt habe und worin meine Versagensangst bestand.
Mit 24 kauere ich nackt auf einem Hocker in einem gekachelten Raum neben einem Heizkörper, und es riecht nach Kaffee. Eine Freundin, die bei der Geburt dabei ist, hat die Hebamme dazu gebracht, in der Schwesternküche Kaffee zu kochen und den Kaffeesatz in den Kreißsaal zu bringen. Der Kaffeesatz von frisch gebrühtem Kaffee soll einem Dammriss vorbeugen. Der Damm hält, und kurz darauf halte ich ein winziges Kind mit ziemlich blauen Fußsohlen im Arm.
Mit 27 sitze ich auf einer Waschmaschine in Fulda, und der Mann, mit dem ich mein zweites Kind zeugen werde, steht mit heruntergelassenen Hosen vor der Waschmaschine, und sein Schwanz steckt in mir, und ob irgendeiner von uns zum Orgasmus gekommen ist, weiß ich nicht mehr, aber dass es wunderbar war, das weiß ich noch. Wenig später bin ich mit demselben Mann in das Dorf gefahren, in dem ich aufgewachsen bin, habe ihn mit an den Waldrand meiner Kindheit genommen und zu den Brombeerhecken meiner Kindheit, und hinter der Brombeerhecke haben wir uns ausgezogen und ins Gras gelegt und miteinander geschlafen, und auch das war sehr schön.
Mit 29 gibt es nur noch ein sehr kleines Fenster für Sex, weil der Mann ein Nebennierenrindenkarzinom und kaum noch Lust auf Sex hat, außer wenn er seine monatliche Hormondosis bekommt, die an und für sich der Nebennierentätigkeit dient, aber nebenbei auch libidosteigernd wirkt.
Mit 31 bin ich frisch verwitwet und Mutter zweier kleiner Kinder und betrunken am Rande der Besinnungslosigkeit, als ich mit einem Mann im Bett lande, mit dem mich nichts verbindet außer der gleichzeitigen Anwesenheit am selben Ort, und offensichtlich landen wir nicht nur im Bett, offensichtlich kommt es auch zu Geschlechtsverkehr, trotzdem muss ich mich in der Schwangerenkonfliktberatung nicht dafür rechtfertigen, warum ich die daraus resultierende Schwangerschaft nicht austragen werde.
Mit 34 habe ich Sex mit dem Rücken im Türrahmen einer riesigen teilsanierten Altbauwohnung und bin froh, dass der Mann den Sex initiiert, weil wir sonst wohl nie welchen hätten, was nicht an meiner mangelnden Zuneigung oder Erregung liegt, sondern daran, dass ich Sex nie initiiere.
Mit Anfang 40 bin ich mit einem Mann zusammen, mit dem ich die Scham und die Peinlichkeit verlernen will, wir sind radikal ehrlich, und ich kann ihm dabei zugucken, wie er sich selbst einen runterholt, und schicke ihm per Handy Fotos, auf denen ich mir Erdbeeren in die Vagina einführe. Beim Sex gucken wir uns in die Augen, und hinterher spüre ich das Sperma in meinen Schamhaaren und an der Oberschenkelinnenseite antrocknen, ich mag das Gefühl des Attachments, verbunden zu sein, markiert zu sein, gemeint zu sein.
Ein halbes Jahr später liege ich nackt auf dem Fußboden, während der Mann, von dem ich mich gesehen gefühlt habe, seine Gürtelschnalle schließt und sagt, dass er nichts spürt, nicht mit mir schlafen kann. In den folgenden Wochen erweist sich seine radikale Ehrlichkeit als sehr perforiert und der Schwanz, den er dafür hasst, dass er nicht mit mir schlafen kann, als ehrlicher als er selbst.
Ein Mann bietet mir eine Affäre an und erscheint zu unserer Verabredung im weißen Hemd und mit einer langstieligen Rose, nicht ahnend, dass mich jede konventionell romantische Geste abschreckt. Langstielige Rosen, Candle-Light-Dinner, stimmungsvolle Musik, alles, was sich als Taktik, als Zeichen einer geplanten Annäherung lesen lässt, erzeugt Abwehr in mir. Ich mag Kerzen. Blumen auch. Nur der Versuch, Romantik zu instrumentalisieren, der ist mir suspekt. Ein paar Monate später schließe ich mich mit dem Mann auf dem Streckenabschnitt zwischen Minden und Osnabrück auf der Zugtoilette ein, und wir versuchen, ganz unromantisch Sex zu haben. Was sich als akrobatisch nicht zu meisternde Herausforderung erweist. Aber verrucht fühlt es sich an.
Mit einem anderen Mann lege ich mich auf der Frankfurter Buchmesse nackt in ein Hotelbett, ohne dass wir mehr tun, als den Arm umeinander zu legen. Und am nächsten Tag tun wir genau dasselbe gleich noch einmal. Erst zwei Wochen später schlafen wir auf einem Hotelboot in Prag miteinander, und mir bedeutet es sehr viel, nicht von Sex, den wir hatten, zu schreiben, sondern davon, dass wir miteinander geschlafen haben. Der Mann wird nicht lange bleiben, aber er wird mich auf eine Weise berührt haben, die macht, dass ich berührbar bleiben will. Weswegen ich mich kurz darauf nackt auf einen Tisch setze, mir eine Papiertüte über den Kopf stülpe, die Arme um die angewinkelten Knie schlinge und das Foto als Header für mein Facebook-Profil verwende.
In den Jahren dazwischen sammle ich Know-How und Erfahrungen. Ich masturbiere vor dem aufgeklappten Laptop zur CrashPad-Series, einem queeren Porno-Format. Ich lasse mir bei OMGyes von anderen Frauen vorführen, wie sie masturbieren, wie sie zum Orgasmus kommen. Ich installiere eine Fruchtbarkeits-App und lerne die Konsistenz meines Zervixschleims zu lesen. Ich kauere bei einem Workshop zur weiblichen Ejakulation neben zwölf anderen Teilnehmer:innen über meinem Frotteehandtuch und stimuliere mit dem Zeigefinger mein Prostatagewebe. Ich suche nach Begriffen für weibliche Erregung und finde als Entsprechung für das, was im Englischen und bei Männern Boner heißt, vier mäßig überzeugende englische Slangbegriffe: Lady Boner, Swollen Lips, War Flute, Throbbing Clit. Meine kläglichen Versuche, sie ins Deutsche zu übertragen, machen die Sache nicht besser: Damenständer, Schwelllappen, Kriegstrommel und Clit-Alarm.
Während ich diese Auszüge aus meiner Sexualität protokolliere, stelle ich fest, dass es Situationen gibt, bei denen mir das schwerer fällt als bei anderen. Und dass das an den Begriffen liegt. Begriffen, die ich in einer bestimmten Situation verwendet habe. Begriffe, die sich von denen unterscheiden, die ich heute dafür verwende. Mit welcher Selbstverständlichkeit ich Sex haben gesagt und damit ganz eindeutig (und ausschließlich) Geschlechtsverkehr mit Penetration gemeint habe. Wie ich mich gewundert habe, warum mein Jungfernhäutchen, an dessen Existenz ich damals noch geglaubt habe, nie gerissen ist. Dass ich Vulva schreiben will, was aber der historischen Wahrheit nicht gerecht wird. Was wir zu haben und zu kennen glaubten, war eine Scheide oder eine Vagina. Wie ich »selbst befr.« in mein Tagebuch schreibe und damit abkürze, dass ich mich selbst befriedigt habe, weil ich den Begriff »masturbieren« noch nicht kenne.
Aber es sind ja nicht nur die Vorstellungen des Sichtbaren, Spürbaren und Greifbaren, die sich verändert haben. Es sind auch Bereiche hinzugekommen, für die keine Begriffe vorhanden waren, weil auch die Vorstellung davon zumindest in meiner Welt nicht vorhanden war. Ich meine damit Phänomene und Sachverhalte, für die wir keine Begriffe hatten, weil die Aspekte, Fragen und Gewissheiten, mit denen diese Begriffe sich befassen, in meiner Welt lange keine Sichtbarkeit hatten. Keinen Platz hatten. Nicht verhandelt wurden. Oder eben einfach: Gewissheiten waren. Und zwar Gewissheiten, die anzuzweifeln so lange keine Notwendigkeit bestand, bis sie als Ungewissheiten vor mir standen. In Gestalt einer Vierzehnjährigen, die darum bittet, einen OP-Termin für sie zu vereinbaren, weil ihre Schamlippen ihr nicht normal erscheinen. In Form einer lesbischen Sexszene, die ich in einen Roman hineingeschrieben habe, von der mir eine lesbische Freundin nachweist, dass die Szene der typischen Klischeevorstellung entspricht, die heterosexuelle Cisgender-Personen von lesbischem Sex haben. Als ergänzende Zeile in Social-Media-Profilen, auf denen immer mehr Menschen die Pronomina benennen, mit denen sie gekennzeichnet werden wollen. Als Stimme meiner Freundin Linda, die macht, dass mir am Telefon der männliche Vorname rausrutscht, unter dem ich sie vor 17 Jahren kennengelernt habe.
Es hat sich viel geändert, seit meine Großmutter nackte Brüste auf den Titelseiten von Illustrierten mit Leukoplaststreifen überklebt hat und ich mich als Zwölfjährige gefragt habe, ab welcher Körpertemperatur die Kerze, die ich mir gerade eingeführt hatte, wohl zu schmelzen anfängt. Meine Tochter weiß mehr über Klitoris-Stimulatoren als ich, Vibratoren heißen Satisfyer und stehen in Drogerieregalen, und Bildschirme lassen sich nicht zensieren. Und trotzdem bleibt bei allen zurecht in Frage gestellten Gewissheiten, bei allem entlarvtem anatomischen Humbug, bei aller hilfreichen und notwendigen Dekonstruktion von Geschlechterstereotypen, unabhängig davon, wie einfach verfügbar der Zugang zu erregenden Bildern und Sex Education geworden ist, eine Konstante: die Scham.
Jedes Mal, wenn ich mit anderen über Sexualität sprechen will, gerate ich an Grenzen, und zwar immer an den Stellen, die über darstellbare Techniken, anatomische, erotische und pornographische Abbildungen, Selbsterkundung und Dienstleistungen hinausgehen. Wenn wir uns dem Terrain annähern, das mit Nähe und Intimität zu tun hat. Für dieses Terrain gibt es keine allgemeingültige Landkarte, auf die wir zeigen und uns berufen können.
Ich muss an die vielen unterschiedlich markierten und mit Legenden versehenen Karten in meinem alten Diercke-Weltatlas denken, den wir im Erdkundeunterricht verwendet haben, an Karten, die die geopolitische Ordnung von Orten und Staaten zu einem bestimmten Zeitpunkt abbilden: die DDR, die BRD, die Sowjetunion, das Deutsche Reich in den Grenzen von 1848. Orte, Gebiete und Machtverhältnisse, die heute nicht mehr gültig sind, von denen es aber sinnvoll ist, sie und die Bedingungen ihres Zustandekommens zu kennen. So eine Karte möchte ich erstellen. Ich möchte meine eigene Sexualität kartieren und die Sexualität, in die sie hineinragt. Ich möchte mit dem Finger über die verschiedenen Gebiete dieser Landkarte reisen und an Orten und bei Themen verweilen, die mir wichtig erscheinen. Einige dieser Orte sind sehr intim und markieren meine eigenen Erfahrungen, und für einige Orte habe ich die Landkarten anderer zu Hilfe genommen, die über Sexualität, Scham und Aushandlungsprozesse nachdenken. Schließlich gibt es neben meiner Sexualität auch noch die erforschte Sexualität und die Sexualität der anderen.
In der Deutschen Nationalbibliothek bestelle ich Bücher zu Sexualforschung und Kritischer Sexualwissenschaft. Ich befrage das Internet zu Intimität, Frigidität und Sexualität, gucke auf Netflix alle drei Teile von The Principles of Pleasure und das Biopic über Alfred Kinsey. Ich bitte meine Social-Media-Crowd um Lektüretipps zu Sex, Intimität und Scham. Ich lese mich von Erica Jong zu Annie Ernaux, von Esther Perel zu Katherine Angel, von Laurie Penny zu Mithu Sanyal und Margarete Stokowski durch. Ich bräuchte nur noch einen Münzeinwurfschlitz, um auf Knopfdruck zehn Minuten die jeweiligen Positionen zu referieren, ich bin randvoll mit Wissen und Bildern und Kontext über Sexualität und Intimität und Sexualpolitik. Ich weiß nur nicht, was davon auf meine Karte gehört.
Um das »Sumpfgebiet der Seele«, wie die Schamforscherin Brené Brown die Scham nennt, zu erkunden, muss ich mich gar nicht mit allem befassen, was andere über Sexualität gedacht, erforscht und herausgefunden haben. Ich muss nur den Spuren folgen. Spuren, die ich hinterlassen habe – mein Körper, meine Scham, meine Beziehungen –, und Spuren, die andere hinterlassen haben. Ich muss sie nur fragen. Meine Freundin K., um unsere Prägungen zu vergleichen, und was wir davon bewusst oder unbewusst weitergeben. Meine Tochter, um mit ihr über ihre Prägung durch mich zu sprechen. Die Tochter einer Freundin, weil sie etwas macht, was für mich in diesem Alter unvorstellbar gewesen wäre: sie betreibt einen OnlyFans-Account, über den sie Abonnent:innen erotische/pornographische Bilder und Videos von sich zugänglich macht. Den Mann, mit dem ich drei Monate zusammengelebt habe: um herauszufinden, warum ich häufig nehme, was mir angeboten wird, ohne mich zu fragen, ob ich es eigentlich will. Eine Sexualtherapeutin, die mir helfen soll, statt zwanghafter Sehnsucht künftig echte Nähe zu empfinden.
Und dann befestige ich einen Packpapierbogen an der Betonwand meiner Plattenbauwohnung und zeichne die Umrisse einer fiktiven Landkarte darauf. Auf der Landkarte verteile ich willkürlich Begriffe, die mir im Spannungsfeld Sex, Scham und Schweigen relevant erscheinen. Erst, als ich mit etwas Abstand auf meine Landkarte gucke, fällt mir auf, dass der Begriff, der am meisten Unbehagen in mir auslöst – Betäubung –, ganz links außen steht, im äußersten Westen. Am entferntesten davon, ganz tief im Osten, steht Es tun. Im Norden, etwa auf der Höhe von Hamburg, liegt die Nackte Wahrheit, südwestlich bei Freiburg Zahlen, Statistiken + Ansprüche, ebenfalls im Süden, ungefähr auf der Höhe von Augsburg und München, Bewusstsein und Women’s Lib, weiter Richtung Osten, zwischen Weimar und Gera, Intimität. In der Mitte der Karte, zwischen allen Claims, hocke ich. Also das Foto von mir, das jahrelang mein Facebook-Profil geziert hat: nackt und mit einer Papiertüte über dem Kopf. Wie klug ich damals schon war. Wie blind ich damals noch war.
Womit der erste Schritt klar ist: Mit Tüte über dem Kopf kann ich das Gelände nicht sehen. Wenn ich von hier aus weiterkommen will, muss die Tüte vom Kopf. Ich will mich dem stellen, was ich warum getan und was ich warum nicht getan habe. Warum ich so vieles von dem, was stattgefunden hat, nur betäubt geschehen lassen konnte. Und warum so vieles von dem, was nicht stattgefunden hat, aus Scham nicht stattgefunden hat. Damit die Dinge sich ändern können. Denn am Ende läuft es ja auf die Frage hinaus, warum nicht etwa die Tatsache, dass ich keinen Sex gehabt habe, mich traurig macht, sondern der Sex, den ich hatte.
SUMPFGEBIET DER SEELE
“If you put shame in a petri dish it needs three things to grow exponentially: secrecy, silence and judgment.”
Brené Brown
Im Waldstück an der Straße zwischen Dessau und Aken sind in regelmäßigen Abständen Schilder an den Baumstämmen angebracht: Betreten verboten. Lebensgefahr. Kampfmittelräumung. Zu DDR-Zeiten haben sowjetische Truppen den Wald genutzt. Kein Mensch weiß, wie viele Kampfmittel hier noch rumliegen.
Von allen Orten, die wir am liebsten nicht betreten würden, weil von vornherein klar ist, dass dort Schmerz, Ekel oder andere unangenehme Gefühle warten, gehört die Schamzone vermutlich zu denen, deren Betreten sich am wenigsten erschließt. Klar, eine Zahnarztpraxis ist auch nicht gerade ein Sehnsuchtsort, genauso wenig wie die Verhörzelle, die Paartherapiepraxis oder die Bank vor dem Prüfungsraum. Nur dass bei diesen Beispielen die Motive klar sind. Wir wissen, warum wir diese Orte aufsuchen. Auch bei größtem Widerwillen ist das nötig, damit sich etwas ändert. Aber das Schamgebiet? Worin besteht der Mehrwert, die Notwendigkeit, sich diesem Bereich meiner Karte anzunähern, den die Schamforscherin Brené Brown “Swampland of the Soul”, Sumpfgebiet der Seele, nennt? Warum sollte ich mich Erinnerungen und den damit einhergehenden Gefühlen aussetzen, die schon beim Gedanken daran den Impuls auslösen, sich wegzuducken, ihnen so schnell wie möglich wieder zu entkommen?
Weil ich gar keine Wahl habe. Mein “Swampland of the Soul”, mein Schambereich, liegt nicht außerhalb meiner selbst. Meine Schamgefühle trage ich mit mir herum, sie bestimmen meine Entscheidungen, meine Beziehungen, meine Sexualität, überhaupt alles, bei dem ich physisch anwesend bin und das ich mit meinem Körper tue (oder eben nicht tue). Das heißt, ich kann mich zwar weigern, da genauer hinzugucken. Ich kann mich aller möglichen Manöver bedienen, sie abzuwehren (und wie sich herausstellen wird, habe ich das auch viele Jahrzehnte ziemlich eindrucksvoll versucht). Aber entkommen kann ich ihnen nicht. Scham lebt davon, dass wir versuchen, sie weiträumig zu umfahren. Scham ist eine Instanz, deren Macht und Fortbestand von der Angst abhängt, die wir vor ihr haben, von unseren Vermeidungsstrategien, die wir pflegen, um uns ihr nicht auszusetzen. Davon zehrt sie. Es gibt Dinge, die wir aus Scham nicht tun, und Dinge, über die wir aus Scham nicht sprechen. Beides hat Konsequenzen. Und zwar Konsequenzen, die viel weitreichender sind, als Nicht-Tun und Nicht-Ansprechen erwarten lassen würden.
Eine Funktion von Scham ist und war ganz klar, dafür zu sorgen, dass in einer Gesellschaft niemand zu sehr aus der Reihe tanzt und alles seine Ordnung hat (und behält): »In allen Gemeinschaften sind Formen der Demütigung, die ein gezieltes Auslösen von Schamgefühlen anderer Personen in erzieherischer oder feindseliger Absicht darstellen, eine scharfe soziale Sanktion. Bis ins 19. Jahrhundert wurden Beschämungen in Form von Schand- und Ehrenstrafen gezielt als Machtinstrument der Staatsgewalt eingesetzt. Verurteilte wurden an einen Pranger gefesselt und schutzlos den Schmähungen der Passanten ausgesetzt. Heute ist die Redewendung, jemanden an den Pranger zu stellen, für öffentliche Bloßstellungen in den Sozialen Medien und der Presse gebräuchlich.«1 Ähnlich, aber mehr auf einzelne Individuen zugeschnitten, ist Funktion Nr. 2: Scham, die uns und andere vor Bloßstellung schützt, davor, beschämt zu werden. Wir sprechen von der Schamgrenze, die symbolisch den Intimbereich einer anderen Person eingrenzt und die es nicht zu übertreten gilt, um weder diese Person noch uns selber der Scham auszusetzen, etwas zu sehen, zu hören oder mitzubekommen, das uns oder sie beschämen würde. Das sind die Funktionen von Scham, die wir reflektieren können und die viel mit kulturellen und sozialisationsbedingten Werten zu tun haben.
Und dann gibt es da noch diesen wesentlich unbekannteren Nebenschauplatz von Scham. Den Teil, der mit Bindung und Ver-Bindung zu tun hat. Die neuere Forschung interessiert sich für den Zusammenhang zwischen Kontaktbedürfnis und Bindung von Säuglingen zu einer Kontaktperson und datiert das Entstehen von Schamgefühl auf den Entwicklungszeitraum zwischen dem ersten und zweiten Lebensjahr – auf den Zeitpunkt, ab dem Kinder kognitiv in der Lage sind, zwischen sich und anderen Menschen zu unterscheiden. Es handelt sich dabei um eine Scham, die mit Zurückweisung einhergeht. Damit, dass die Bezugsperson, deren Blick wir suchen, den Blick von uns abgewendet hat. Eine Person, von der wir es erhoffen oder erwarten, gibt uns nicht, was wir gerade brauchen. Und damit resultiert die empfundene Scham aus der Diskrepanz zwischen einem Bedürfnis und dem, was das für die Bedürfnisbefriedigung auserkorene Gegenüber tut oder eben nicht tut. »Scham hat ihren Ursprung gerade nicht darin, dass man etwas Verbotenes tut oder ist, sondern im Abreißen der Kommunikation, der Verbindung mit den Anderen. Sie entsteht in dem Moment, in dem diese Verbindung plötzlich nicht selbstverständlich, und die eigene Abhängigkeit dadurch umso entsetzlicher deutlich ist.«2
Damit wird Scham zum Whistleblower. Sie verweist auf etwas, das wir möglicherweise abwehren und nicht wahrhaben wollen, das aber wesentliche Hinweise auf eine Diskrepanz zwischen dem, was wir wollen, und dem, was wir sind, liefert. Scham, so Lea Schneider, der ich den entscheidenden Hinweis auf diese übersehene Funktion von Scham verdanke, »deutet in die Richtung unserer Bedürfnisse, deutet darauf, was wir uns wünschen, was wir, vielleicht ohne dass wir es vorher hätten formulieren können, als unseren Kern verstehen. Auf das, was uns wirklich interessiert«.3 Passend dazu vergleicht die Deutsche Hebammen Zeitschrift Scham mit einem »Sensor, der Alarm schlägt«, der, ähnlich wie andere unangenehme Gefühle – Angst, Traurigkeit oder Ekel –, auf eine Gefährdung hinweist. Nur dass es im Fall von Scham eben keine äußere oder körperliche Gefahr ist, sondern der Finger der Scham nach innen zeigt, auf etwas, das in uns liegt. Wenn es etwa an die Selbstachtung geht, weil wir bestimmte Werte, mit denen wir uns identifizieren, aufs Spiel setzen oder einem selbstgesetzten Anspruch nicht gerecht werden. Und damit ist eigentlich auch klar, warum wir Scham von allen Gefühlen am stärksten abwehren – wer setzt sich schon gerne mit dem Verlust der (Selbst-)Achtung auseinander?
Also fahren wir die Abwehr hoch: Zynismus, Arroganz, Projektion und Aggressivität sind beliebte Manöver, sich Schamgefühlen zu entziehen. Auch Suchtverhalten wird oft als Instrument der Schamabwehr angeführt, was auf der Hand liegt, wenn ich bedenke, dass Alkohol vor allem eingesetzt wird, um bestimmte Gefühle nicht aushalten zu müssen. Ich habe eine ganze Weile gebraucht, um zu erkennen, dass ich mich nicht nur für mein Trinken schäme, sondern dass ich trinke, um mich bestimmten Gefühlen nicht aussetzen zu müssen. Eines davon war Scham. Aber unabhängig davon, ob das Mittel der Wahl Betäubungstrinken oder ein Schutzwall aus Zynismus und Arroganz ist, der innere Schamabwehrscout ist sehr einfallsreich, Vorwände aufzufahren, um uns am Sumpfgebiet unserer Seele vorbei zu manövrieren: auf der anderen Route gibt es mehr Tankstellen oder Pommesbuden, die Strecke ist kürzer, die Landschaft schöner. Tankstelle, Pommes, Landschaft, die besten Gründe überhaupt. Mit Schamabwehr bringen wir unsere Routenentscheidungen selten in Verbindung.
Wie kommt es dann aber, dass es immer wieder Menschen gibt, die sich trotz Schamabwehr, trotz Widerstand diesem unangenehmen Gefühl stellen, das Risiko eingehen, aus einer Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden? Denn ähnlich wie Lea Schneider identifiziert auch die Schamforscherin Brené Brown die Angst vor Zugehörigkeitsverlust, den Verlust einer Verbindung, als eines der wirkmächtigsten Motive, das uns vor bestimmten schambesetzten Themen abbiegen und einen Umweg suchen lässt.
Ich weiß, dass ich niemanden zwangsrekrutieren kann, sich in meinen Line Dance of Shame einzureihen. Aber ich habe ein ziemlich schlagendes Argument dafür, warum es notwendig sein kann, über diese unangenehmen Dinge zu sprechen: Wenn sie nämlich nicht nur mir unangenehm sind. Bei Phänomenen und Erfahrungen, die keine Ausnahme sind, geht es nicht allein um die individuelle Erfahrung, die jemand damit gemacht hat, sondern auch um die Funktion, die sie innerhalb einer Gesellschaft einnehmen. Oder, um es drastischer zu formulieren, um die Funktion, die diesen Erfahrungen zugewiesen wird, damit eine Gesellschaft so funktionieren kann, wie sie funktioniert.