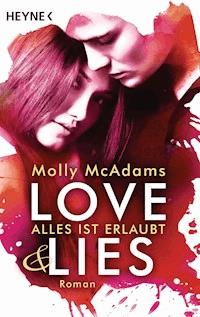5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Erotik
- Sprache: Deutsch
Schmerz ist nur der Anfang... Am Morgen nach Heiligabend fand man das erste Opfer: eine junge Frau, in einer dunklen Ecke des Wiener Praters an ein Kreuz genagelt. Nach dem dritten bestialischen Mord ist sich die Polizei sicher, dass der Täter aus dem Sadomaso-Milieu stammt. Aus diesem Grund wird Marcus Wolf zu den Ermittlungen hinzugezogen. Einst arbeitete er für die Mordkommission, heute betreibt er ein Edelbordell und kennt die Szene wie kaum ein Zweiter. Und schon bald weisen alle Spuren darauf hin, dass der Mörder seine Opfer in Wolfs Club findet ... Ein Nerven zerfetzend spannender Erotik-Thriller der ganz besonderen Art – und ein intimer Blick hinter die Kulissen der Sadomaso-Szene!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 759
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
AndrasSchatten
Erotischer SM-ThrillerEdel Elements
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Epilog
Schlussbemerkung des Autors
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Epilog
Impressum
HINWEIS AN DIE LESER
Die Handlung dieses Romans, alle Lokalitäten und Begebenheiten sind frei erfunden. Es gibt Parallelen zu den Lebensgeschichten mancher Menschen, die mir lieb waren und sind. Doch es sind nur verfremdete Parallelen. Im Hinblick auf die Darstellung der Gewaltszenen im Roman möchte ich darauf hinweisen, dass Gewalt in sadomasochistischen Beziehungen eine bestimmte Funktion hat. Es ist eine Handlung, die im beiderseitigen Einverständnis dem Zweck der Lustgewinnung der Beteiligten dient, also eben nicht von gewaltbereiten Tätern an hilflosen Opfern ausgeübt wird.
Andras, November 2007
Kapitel 1
M O N T A G
Es ist ein früher Januarmorgen. Die Nacht ist noch nicht dem Tag gewichen; zwar kündigt sich in der Ferne die Dämmerung an, aber davon ist in dieser stillen Straße noch nichts zu sehen. Die Häuser sind zu hoch, und über uns, könnten wir sie sehen, ist die Nacht noch dunkel und unbezwungen. Es ist der zweite Januar, der Tag nach dem Tag des Katers.
Dunst, oder vielmehr Frühnebel, schwebt über der Straße, die Lampen der Straßenlaternen schneiden helle Kegel in das Grau. Die Autos am Straßenrand glänzen von gefrorenen Kristallen. Ein Anlieger schabt an den Scheiben seines Wagens, während der Motor läuft und der Auspuff grauen Qualm dem Nebel hinzufügt. Hier in der Stadt ist der Schnee fast vollständig verschwunden, sind nur grauschwarze Reste an den Straßenkanten zu sehen. Ich bedauere dies, denn irgendwie beruhigt mich das Geräusch von unter den Reifen knirschendem Schnee, gibt eine weiße Landschaft jedem Hintergrund eine gewisse Majestät.
Als wir vor knapp zwei Stunden von meinem Landhaus außerhalb Wiens aufbrachen, erstreckte sich eine solche weiße Landschaft weit um uns herum; ich lasse die Auffahrt zum Chateau nicht räumen, und heute Morgen war ich dankbar dafür, gab mir die langsame Fahrt bis zur Hauptstraße doch Gelegenheit, meine Gedanken zu sammeln.
Ich beuge mich vor, nehme die Thermoskanne aus dem Halter, schenke mir Kaffee ein. Für einen Moment sehe ich Caros fein gezeichnetes Profil, als wir unter einer der Straßenlaternen hindurchfahren. Wir fahren nicht schnell, zu rasen wäre nicht standesgemäß für den alten Rolls.
»Dort vorne ist es«, sage ich.
Caro nickt nur.
Auch sie weiß, wohin wir fahren, und hat es genauso wenig eilig wie ich.
In der Ferne, vor uns, am Ende der Straße, wird das regelmäßige Wechselspiel zwischen Licht und Schatten von einem Scheinwerfermast gebrochen, sein Licht, anders als das diffuse der Laternen, ist grell und klar, schneidet einen scharfkantigen Quader in den Dunst, doch das, was beleuchtet wird, ist hinter einer hohen Ziegelsteinmauer verborgen.
Das gleißende Licht von dem Lichtbaum, die Stille, der Nebel, all das wirkt surreal auf mich. Die zwei Polizeiwagen, die Ambulanz mit erleuchtetem Innenraum, aber mit abgeschaltetem Blaulicht, der junge Polizist, der mit gesenktem Kopf gerade den Zugang zu dem Hof weiträumig mit Absperrband verklebt ... Meine Vergangenheit hat mich eingeholt.
Ein stämmiger Mann, breite Schultern, dunkler, knöchellanger Mantel, die Hände in die Taschen gesteckt, steht dort, seine Atemfahne der einzige Hinweis, dass er lebt, so still ist er.
Malowsky. Es ist acht Jahre her.
Ich sehe den Fahrer der Ambulanz, er lehnt an der offenen Tür des Rettungswagens und raucht eine Zigarette. Das Innenlicht des Fahrzeugs wirkt übertrieben grell in der Düsternis dieser Straße, an der Grenze zwischen Nacht und Tag. Alles ist bereit für den schnellen Eingriff, für den Notfall. Aber der Mann schaut nur gedankenverloren ins Leere und raucht, ist fast so still wie Malowsky.
Der junge Polizist, der mit dem Absperrband, wahrscheinlich ist er kaum älter als vierundzwanzig oder fünfundzwanzig, sieht zu Boden, als er das Band befestigt; seine Bewegungen sind mechanisch, er stockt hin und wieder, prüft, ob er diese einfache Arbeit richtig ausführt, als könne er sich nicht auf seine Hände und Sinne verlassen.
Ich weiß jetzt schon, dass es schlimm werden wird, denn es ist nicht eine ruhige Stille, die von den Menschen ausgeht, sondern eine, die schneidet.
Jeder hier hat zu viel gesehen, auch Malowsky; der das aber nie zugeben wird.
Ich will nicht hier sein.
Es gibt eine breite Tür in dieser Mauer aus Backstein, aus Metall ist sie. An vielen Stellen ist die Farbe bereits abgeplatzt, am unteren Rand mischt sich das Rot der Grundierung mit dem Rost. Die Tür ist zu drei Vierteln geschlossen, in der Öffnung steht eine stämmige Frau; das grelle Licht beleuchtet sie so von hinten, dass es aussieht, als strahle sie selbst. Kurze blonde Haare, sie raucht, trägt einen hellen Mantel und grellgelbe Gummistiefel. Irgendwie wirken die Farben in dem Schwarz-Weiß aus Dämmerung und Schatten mehr als absonderlich, fremd.
Auch sie blickt, wie Malowsky, in unsere Richtung, als Caroline den Rolls so gleichmäßig zum Stehen bringt, dass nicht einmal der Kaffee in meiner Tasse schwappt.
Caro steigt aus, groß, trimm, schlank und sexy in ihrer Chauffeursuniform, öffnet mir mit einer knappen, aber perfekten Verbeugung den Wagenschlag. Der junge Polizist erwacht aus seinen düsteren Gedanken, als er Caros wohlgerundetes Hinterteil wahrnimmt, das sich ihm unter dem dünnen schwarzen Stoff so verführerisch präsentiert.
Frauen sollten nie erfahren, was sie allein mit ihrem Anblick bei Männern auslösen können; bei Caro ist es zu spät, sie weiß es schon. Genauso wie sie weiß, dass die Blicke des Polizisten auf ihrem Hintern ruhen.
Malowsky ist älter geworden in den letzten acht Jahren, aber nicht minder missbilligend. Das Doppelkinn, von korrektem Kragen und Krawatte eingeschnitten, quillt mehr denn je hervor und zittert, ein Zeichen, das bei ihm für alles stehen kann, von gerechter Empörung bis hin zu mörderischer Wut.
Ich trinke den letzten Schluck Kaffee und stelle die Tasse auf dem Tablett vor mir ab, mustere ihn durch die offene Tür.
Er ist einen Monat jünger als ich, beide sind wir sechsundvierzig, aber auf ihm lasten die Jahre schwerer, die Furchen in seinem Gesicht sind tiefer, die Nase grobporig und ständig gerötet. Seine buschigen Augenbrauen sind grau wie sein Haupthaar, sie gleichen den Borsten einer Drahtbürste. Die Augen liegen tief in den Höhlen, sie sind von fahlem, wässrigem Blau. Ich kann sie jetzt nicht sehen, es ist zu dunkel, aber ich habe sie nicht vergessen.
»Marcus«, sagt er, als ich mich anschicke, den Wagen zu verlassen, aber das ist alles; weder geht er einen Schritt vor, noch hält er die Hand hin, noch nickt er mir zu.
So soll es also sein. Ich verharre kurz, ein Bein ausgestreckt, die eine Hand am Griff der Tür, die andere an der Säule der Türöffnung, dann entfalte ich mich aus dem Wagen und stehe vor ihm. Er weicht etwas zurück und blickt zu mir auf, und nun weiß ich, wie sehr er mich noch immer verachtet, dass er dieses Ressentiment auch nach all den Jahren nicht aufgeben will.
»Dieter«, antworte ich ihm im gleichen Tonfall, so neutral, dass man es mit einer Feinwaage hätte messen können.
Ich bereue es bereits, überhaupt auf seinen Anruf reagiert zu haben. Seine Feindseligkeit ist so deutlich, dass ich versucht bin, wieder in den Wagen zu steigen und davonzufahren.
Als ich in der Nacht den Anruf erhielt, war ich mehr als unwillig zu kommen, wollte nicht einmal das Telefonat entgegennehmen. Wollte nichts von dem hier.
Caro wand sich gerade am Kreuz im blauen Salon. In letzter Zeit treibt es uns beide öfter in diesen Raum, er ist am besten ausgestattet, am besten geeignet für unsere Spiele. Zwei feine rote Linien zogen sich ihren anmutigen Rücken entlang, parallel, mit einer leichten Kurve am oberen Ende und gekrönt von einem kleinen Tropfen rubinroten Blutes. Schweiß stand auf ihrer fast durchscheinend weißen Haut, ihre Füße bewegten sich unruhig, die Hände ballten und entspannten sich in den Fesseln. Ihr Atem hatte bereits diesen gewissen Rhythmus, der mir sagt, wo auf ihrem Weg sie sich befindet. Unter der Haut an ihren Flanken spielten Muskelstränge, als sie an der Grenze schwebte.
Nur zwei Schläge ...
Die kleine Bullenpeitsche, oder auch Snake, ist ein neues Ding für uns, ein Spiel, das mir schon immer äußersten Respekt abnötigte. Es waren unsere ersten gemeinsamen Schritte in diese Richtung, die anmutig geschwungene Peitsche in meiner Hand eher noch ein Spielzeug im Vergleich zu einer echten Bullenpeitsche.
Unsere ist knapp über zwei Meter lang, aber nicht ohne einen gewissen beißenden Charme. Eine echte Bullenpeitsche kann bis zu neun Meter lang sein, das Ende mit dem Schnalzer erreicht Schallgeschwindigkeit. Dieses Leder kann filettieren oder Knochen brechen. Oder auch dem ungeübten Anfänger ein Ohr oder andere wichtige Körperteile abschlagen. Die Snake hingegen ist kurz und leicht genug, dass man damit streicheln kann oder auch beißen, aber nicht einmal ansatzweise so gefährlich.
Caro und ich haben uns lange darauf vorbereitet, mit der Snake zu spielen, sie wie ich ... Ich sehe noch, wie sie still dasaß und zusah, während ich übte, zuckte, als ein Schlag die Wärmflasche traf, die ich als erstes Übungsziel aufgehängt hatte.
Sie war es, die ungeduldig auf die Peitsche wartete, sie fühlen und erleben wollte. Doch ohne dieses Instrument zu beherrschen, traute ich mich nicht, ihrem Willen nachzugeben, ich wollte auf keinen Fall Schaden anrichten.
Nichts, dachte ich vergangene Nacht, hätte mich in dem Moment dazu bringen können, unser Spiel zu unterbrechen, aber wer auch immer es war, er läutete nun schon zum zweiten Male durch, wieder so lange, bis die Verbindung automatisch getrennt wurde.
Meine Konzentration schwand, und auch Caro erwachte zusehends aus ihrer Trance.
Also hob ich beim nächsten Läuten ab, bereit, den Anrufer, wer auch immer es sein mochte, in die tiefsten Höllen zu verdammen.
»Malowsky hier«, hörte ich eine Stimme, die ich vergessen glaubte, aber dennoch sofort erkannte, noch bevor ich meinen Namen sagen oder meinen Unmut kundtun konnte. »Das hier ist nicht meine Idee«, fuhr er fort. »Krüger sagte mir, ich soll dich anrufen. Ich habe hier eine Tote, eine junge Frau. Sie wurde von einem Perversen zu Tode gefoltert und an ein Kreuz genagelt. Es ist das dritte Opfer in der Serie. Krüger meint, du könntest helfen. Wahrscheinlich, weil du selbst einer von diesen Perversen bist.«
Malowsky. Immer noch so höflich wie eh und je. Ich hatte von dem letzten Mord gehört. Wer nicht?! Man hatte das Mädchen am Morgen des Sechsundzwanzigsten gefunden, zwei Tage nach Heiligabend, an ein Kreuz genagelt in einer dunklen Ecke des Praters. Sechzehn Jahre alt war sie gewesen. Ein gefundenes Fressen für die Presse, irgendjemand hatte sich schmieren lassen und Einzelheiten verraten, Einzelheiten, die für die Journalisten wie Blut auf Haie wirkten. Ein besonders bekanntes und unqualifiziertes Blatt ließ sich zu »Masomord am Prater« herab, eine billige, effekthascherische Schlagzeile, aber der Name blieb hängen und erhitzte die Gemüter.
Ich sah auf meine Hand herab; noch immer hielt ich die handgearbeitete Peitsche in der Hand. Caro war mittlerweile wieder in dieser Welt, blickte über ihre Schulter zu mir, die Augen teilweise von dem rabenschwarzen Vorhang ihres Haares bedeckt. Dennoch war die Frage in ihnen unmissverständlich ... Was konnte es sein, dass ich ihm gestattete, diesen speziellen Moment zwischen uns zu zerstören?
Als sie den Kopf wandte, wurden die beiden kleinen Blutstropfen von ihrem Haar verwischt. Ein roter Schatten auf der weißen Haut.
Sie wartete auf mich, und ich stand da, mit dem Hörer in der Hand, und ließ mich von Malowsky angiften. Aber ich konnte nicht einfach auflegen.
»Wie starb sie?«, fragte ich und war überrascht über den Klang meiner Stimme; sie war nüchtern, distanziert, fast desinteressiert.
»Wie die anderen beiden auch. Letztlich wurde sie zu Tode gepeitscht.«
»Ich komme.« Konnte ich denn etwas anderes sagen? »Wo ist der Tatort?«
»Seilerstraße 14. Ich wusste, dass du dir das nicht entgehen lassen kannst. Ist genau dein Ding, nicht wahr? Vielleicht sollte ich dich fragen, ob du ein Alibi hast?«
Langsam legte ich den Hörer auf die Gabel, dann, genauso langsam, die Snake auf das Kissen, auf dem Caro sie mir gereicht hatte.
Ich ging hinüber zu ihr, strich ihr über das Haar und löste ihre Ketten, hielt sie, als sie mir entgegenfloss, und legte sie sachte auf das Bett. Während ich die Striemen reinigte und einrieb, erklärte ich ihr den Grund des Anrufs.
Sie zitterte, ich spürte die Muskeln ihres Rückens unter meinen Fingerspitzen beben, dann lag sie still und sah zu mir hoch. Sie suchte etwas in meinen Augen, fand es und sah dann zu unserer Snake hinüber. In ihren Augen stand eine Frage, ich schüttelte als Antwort leicht den Kopf.
Sie seufzte fast unhörbar; eher bemerkte ich es daran, wie sich ihre Brust hob und senkte, dann schmiegte sie sich an mich.
»Finde das Schwein. Danach sehen wir weiter, ja?« Sie küsste mich.
Als Dank für ihr Verständnis war sie es, die den Rolls aus der Garage holen und in ihrer dünnen Chauffeursuniform den Schnee davor wegschippen durfte. Ich stand daneben, rauchte eine Zigarette, genoss den Anblick ihrer Brustwarzen, die in der Kälte steif wurden und sich durch den dünnen Stoff deutlich abzeichneten, und versuchte mir vorzustellen, was dieser Anruf für mich bedeutete.
Jetzt steht sie neben mir, aufrecht, korrekt, die linke Hand noch immer am Griff der Tür. Ich bin ihr im Weg, so kann sie die Tür nicht schließen, also steht sie nur da und wartet. Hier in der Stadt ist es nicht so kalt wie auf dem Hof des Chateaus, aber sie kommt aus dem warmen Wagen, fröstelt ein wenig. Der elastische Stoff der Uniform ist ihr zentimetergenau auf den Leib geschneidert; so, wie sie dasteht, mit durchgedrücktem Kreuz, stolz und kerzengerade, verbirgt die Uniform nichts vor den Blicken meines ehemaligen Kollegen, der sie mit einem zugleich verachtenden, aber auch lasziven Blick betrachtet und – wie ich auch – sieht, wie sich ihre Brustwarzen erneut unter dem dünnen Stoff hervorheben. Sein Blick hält dort einige Sekunden inne, wandert entlang der Linie ihrer Hüfte und der kraftvollen Anmut ihrer Beine hinunter zu den Schnürstiefeln mit den Acht-Zentimeter-Absätzen. Dann ruht sein Blick auf dem Rolls, einem Oldtimer, nun über siebzig Jahre alt, und verharrt anschließend auf mir. Ich habe mich passend in der Epoche des Wagens gekleidet, der Schwalbenschwanz mit Mantel, Schal, Zylinder und Gehstock gehört zu Caros Uniform, ergänzt und verbindet uns.
»Was hat eine von deinen Huren hier zu suchen?«, knurrt Malowsky und schiebt das Kinn aggressiv vor. »Willst du ihr zeigen, wo es endet? Schick sie in den Hof, dann sieht sie, was ihr passieren kann!«
Ich bin stolz auf Caro, sie zuckt nicht einmal mit den Wimpern. Ihr Gesicht zeigt höfliche Geduld, als sie wartet, dass ich zur Seite trete und sie den Wagenschlag schließen kann. Nur die Nüstern ihrer schmalen Nase beben.
Ich lege den Zylinder in den Wagen, auch den Gehstock, bevor hier etwas absichtlich falsch verstanden wird, und gehe auf Malowsky zu. Ich bin fast zwei Kopf größer als er, und er macht einen kleinen Schritt zurück. Dann fängt er sich, reckt verärgert den Hals und rollt die Schultern, wie ein Boxer vor einem Kampf. Er war einmal Boxer, fällt mir ein, aber jetzt ist er einen halben Schritt zurückgewichen und verliert so den Kampf, bevor er beginnt.
»Malowsky«, sage ich gefährlich leise, sodass er sich anstrengen muss, mich zu hören, obwohl meine Nase fast die seine berührt. »Du weißt nicht, was du sagst. Tust du es aber noch einmal, sorge ich dafür, dass du morgen schon stempeln gehst.«
»Und wie willst du das anfangen? Verrat’s mir!«, grinst er, sicher in der Autorität seines Berufs.
»Die kleine Tänzerin. Erinnerst du dich?«, sage ich so nahe an ihm, dass er meinen Atem spüren muss.
Er erinnert sich, ich sehe es in seinen Augen. Es ist gute zehn Jahre her. Vielleicht hatte er wirklich etwas falsch verstanden, sie behauptete, er sei angetrunken gewesen, aber es war und blieb eine Vergewaltigung. Sie traute sich nicht, etwas zu sagen, er war bei der Sitte, sie arbeitete als Tänzerin in einer Bar.
Ich erfuhr es durch Zufall, aber das war Jahre später. Bis eben habe ich keinen Beweis gehabt, dass die Geschichte stimmt, außer dass ich der Frau geglaubt habe, aber jetzt sehe ich in seinen Augen die Wahrheit.
Er schluckt. Er weiß sehr wohl, dass wir keine Freunde sind, und meine Augen sagen ihm, dass ich nicht eine Sekunde zögern würde, meine Drohung wahr zu machen.
Caro steht noch immer dort, der Unterschied in ihrer Haltung nur erkennbar, wenn man jeden Muskel, jeden Millimeter an ihr kennt ... Sie mit ihrem feinen Gehör hat durchaus verstanden, was ich zu ihm gesagt habe, und sie wartet auf den Gnadenstoß.
Manchmal ist auch meine Caro ein blutrünstiges kleines Biest.
Plötzlich weiß ich, was hier los ist. Dieser Mord hat ihn berührt. Getroffen. Er ist voll gerechtem Zorn auf den Täter, und in seinen Augen gibt es nur geringe Unterschiede zwischen dem Täter und mir.
Mit zu dem Problem gehört, dass Malowsky auch noch ein guter Polizist ist. Er ist unbestreitbar ein Arschloch und ein Tyrann. Es gibt nur wenige Polizisten bei der Sitte, die sich nicht ab und an eine Muschi genehmigen; die Versuchung ist sehr groß, schließlich ist das in manchen Bereichen Zahlungsmittel. Vor gut fünfundzwanzig Jahren, als wir beide bei der Polizei anfingen, hätte kein Hahn danach gekräht, es war nicht nur üblich, sondern wurde fast schon erwartet. Heute ist das anders.
Aber Malowsky ist verdammt gut. Er hat schon seit langer Zeit kein Privatleben mehr, sein Leben findet auf dem Revier und auf der Straße statt, er ist eine verdammte geifernde Bulldogge, die sich in einen Fall festbeißt und nicht eher locker lässt, bis er gelöst ist. Seit drei Jahren ist er bei der Mordkommission, sein Ziel seit jeher, und mit seiner Erfahrung ist er beinahe der perfekte Mann für den Job. Es ist keine Seltenheit, wenn er drei Schichten arbeitet, und sein Gedächtnis ist nachgerade perfekt.
Wenn er einen Verdächtigen verhört, reicht oft schon seine Ausstrahlung von gerade eben noch kontrollierter Gewalt, die Androhung des Unaussprechlichen in seinem Blick, um manchen auf der Stelle umkippen zu lassen.
Die Spannung in seinen Schultern, der geduckte Kopf, die geballten Hände ... genau diese Androhung von Gewalt zeigt er auch jetzt, nur bin ich keiner von seinen Verdächtigen.
»Malowsky«, sage ich so ruhig ich kann. »Es gibt einen Grund, weshalb wir beide hier sind. Das ist wichtig. Unsere Differenzen nicht.«
Einen Moment lang funkelt er mich noch an, dann atmet er durch und nickt.
»Es ist schlimm, nicht wahr?«, frage ich ihn leise.
Er wirft mir einen harten Blick zu, dann verlässt ihn die ganze Anspannung, er nickt nur, ich meine sogar einen leisen Seufzer von ihm zu hören. Er macht einen Schritt zur Seite. Lässt mich passieren.
Caro schließt hinter mir den Wagenschlag. Ich sehe sie an.
»Warte im Wagen auf mich. Lass den Motor laufen.« Sie nickt und geht um den Wagen herum, ein Schauspiel, das sowohl Malowsky als auch der junge Polizist aufmerksam verfolgen; dem jungen Mann gönne ich den Anblick, Malowsky nicht. Er weiß es.
Dann halte ich auf das Tor zu, in dem noch immer die Frau mit den grellgelben Gummistiefeln steht. Sie stößt sich mit der Schulter von dem Pfosten des Tores ab und nickt mir zu. In der linken Hand hält sie einen schwarzen Zigarillo, in der rechten einen kleinen silbernen Aschenbecher. Sie mustert mich.
»Hi, Stella«, sage ich.
»Es geschehen noch Zeichen und Wunder«, antwortet sie in ihrer rauchigen Stimme, die ein Saxofon und eine dunkle Jazzkneipe brauchte und nicht einen kalten Wintermorgen, an dem der Tod riechbar in der Luft liegt. Stella – Dr. Feinschild – ist nur noch selten an den Tatorten anzutreffen, sie ist die Chefpathologin für Wien und Umgebung. Wie jede andere Millionenstadt liefert ihr die große alte Dame Österreichs täglich neue Kunden und täglich mehr von dieser Arbeit, als ein Mensch haben sollte.
Als ich bei der Polizei anfing und zum ersten Mal durch die Pathologie gezerrt wurde, stand sie schon so da, in derselben Haltung, mit demselben silbernen Handaschenbecher. Mit demselben abschätzenden Blick. Demzufolge ist sie nun wahrscheinlich über das Pensionsalter hinaus, doch wenn sie immer noch arbeitet, dann ist es nur gut für Wien. Sie zu ersetzen dürfte fast unmöglich sein.
»Der verlorene Sohn kehrt zurück«, fügt sie hinzu und lächelt, ein überraschendes Lächeln in ihrem Gesicht, das warme Augen und eine verhängnisvolle Ähnlichkeit mit dem eines Pferdes aufweist. Dieses Lächeln jedoch, warm, offen, mit großen nikotingelben Zähnen, bringt eine Wärme herüber, die ich, wie ich nun merke, vermisst habe.
Ich will ihr ein Antwortlächeln schenken, es ist schon halb auf meinen Lippen, als ich über ihren Kopf hinweg den Innenhof sehe, das Kreuz, das darin steht. Hier, in diesem verlassenen Hof, liegt noch Schnee, fast weiß oder zumindest hellgrau, und scheinbar eingeätzt darin, zu Füßen des Kreuzes, eine Fläche, die im unbarmherzigen Licht des Scheinwerfers glitzert. Der Raureif reflektiert ein kräftiges frisches Rot in meine Augen, auch der Körper auf dem Kreuz, erstarrt in einer letzten Agonie, ist in diesen Hauch von Kristallen gehüllt und glitzert im harten Licht des Scheinwerfermasts.
Das Kreuz steht etwas versetzt im hinteren Drittel des Innenhofes. Unter der dünnen Schneedecke erkenne ich die Konturen alter Autoreifen, die verrostete Tür eines Personenwagens, sie gehört zu einem alten BMW, wie ich abwesend feststelle, dann eine Teppichstange, knapp über den Zementfundamenten, so verrostet, dass sie schief steht und auf einen Windstoß wartet, und ein verdorrter Strauch, dem das an ihm haftende Eis scheinbar neue eisige Blüten gibt.
Ich sehe all dies, weil ich woanders nicht hinschauen will, weil sich meine Augen scheuen vor dem, was ich zuvor über Doktor Feinschilds Schulter im Bruchteil einer Sekunde gewahrt habe.
Seitlich in einer Ecke, einige Meter entfernt von dem Kreuz, erkenne ich drei weitere Gesichter, nur eines davon aus anderen Tagen vertraut. Tomas Marks nickt mir zu, er war zuletzt Leiter der Spurensicherung; seine Anwesenheit wie auch die von Stella Feinschild sagen mir, dass man diese Sache sehr, sehr ernst nimmt.
Die beiden anderen Gesichter gehören zu einer jungen Frau und einem jungen Mann. Die beiden Beamten sehen mich misstrauisch und vielleicht auch vorwurfsvoll an, ein Frack passt nicht zu dieser Szene, und sie stehen hier, mit all den Instrumenten und Gerätschaften ihres Handwerks, und müssen warten. Auf jemanden, der nicht einmal den Anstand besitzt, sich passend zu kleiden.
Ich wische den Gedanken weg, passend gekleidet ist ein Moment in der Modegeschichte, Tod währt ewig.
Ein sorgsam abgesteckter Bereich sagt mir, wohin ich meine Füße setzen darf. Ich nähere mich dem Kreuz, ich kann nicht anders, selbst als ich langsamer werde, weiß ich, dass ich bald zu nahe bin.
Hinten aus dem Kellereingang des verlassenen Hauses tritt jetzt eine weitere Gestalt, Malowskys neuer Partner, glaube ich ... Ein schlanker junger Mann, der sich fröstelnd in eine dicke blaue Skijacke hüllt. Er mustert mich mit Feindseligkeit in den Augen, will mich nicht hier haben. Da sind wir schon zwei, ich würde mich am liebsten auch umdrehen und gehen, mit all dem hier nichts zu tun haben.
»Sie müssen Wolf sein«, sagt er, nimmt sich ein Beispiel an Malowsky und behält die Hände in den Taschen seiner Jacke. »Er meint, Sie stehen auf so etwas. Macht Sie geil.« Seine Stimme ist leise, zischelnd. Er ist ein würdiger Partner für Malowsky, er versprüht Gift, achtet aber darauf, dass niemand es hört. Eine Schlange, bösartig und feige. Er wiederholt die Worte eines anderen. Aber Malowsky war nicht immer so, wie er heute ist, er hat Grund, die Welt zu hassen. Er glaubt auch, einen Grund für seinen Hass auf mich zu haben. Ich kann Malowsky nicht mehr mögen, aber wir waren einmal Freunde, und vieles an ihm verdient auch heute noch meinen Respekt. Dieser junge Mann hier, er ist kaum dreißig, hat davon nichts. Er ist klein, eher schmächtig, aber wahrscheinlich trainiert er regelmäßig, irgendetwas Männliches wie Kickboxen. Seine Augen ... mir gefallen seine Augen nicht. Sie sind geweitet, und er blickt in das Licht des Lampenmastes. Ist Malowsky mittlerweile blind geworden? Oder kümmert es ihn einfach nicht mehr, dass sein Kollege Drogen nimmt? Letzteres, nehme ich an, es ist die einzige Erklärung.
»Sie sind Gref, nicht wahr?«, frage ich ihn, aber ich vergesse ihn im nächsten Moment, denn mein Blick traut sich nun doch heran an das Kreuz, fokussiert auf ein einziges Detail, eine schlanke, schmale Hand, zierlich, mit blutigen Fingerspitzen, geballt, obwohl ein silberner Nagel durch die Handfläche sie am hellen Holz des Kreuzes fixiert.
Falls Gref etwas erwidert, dann höre ich es nicht mehr, ich bin weg, sehe nur noch dieses eine Detail: ihre Hand. Das Holz ist hell, fast so hell wie ihre Haut. Eine dünne rote Spur führt von ihrer Hand hinunter zur unteren Kante des Balkens, trotzt dort der Schwerkraft, läuft an der Unterseite entlang, um in einem gefrorenen Tropfen zu enden. Ich folge dem alten, nur geahnten Tropfenfall, sehe im Schnee vor meinen Füßen das gesprenkelte Rot. Ich schließe die Augen einen Moment, ein Fehler, denn ich rieche etwas. Die Kälte dämpft die anderen Gerüche des Todes, das, was folgt, wenn Blase und After sich entspannen, den Geruch des Blutes; die Kälte bindet dieses Miasma, was bleibt, ist ein anderer Geruch, ein Duft, geschaffen, auch in der Kälte zu wirken, ein Parfüm, eher ein Hauch davon, eine Erinnerung, eine leichte Note, nicht schwer, ein Parfüm, wie es eine junge Frau oder ein Mädchen tragen würde. Bevor ich es verhindern kann, will ich mehr sehen, mehr als nur ein Detail, und ich richte den Blick auf das Kreuzstück, den Kopf.
Sie war, sie ist blond. Ihr Haar ist fein, das Einzige an ihr, was nicht erstarren will. Der Kopf ist zur Seite und nach hinten gelegt. Stacheldraht bohrt Wunden in ihre Kopfhaut, ihr Mund ist aufgerissen, gestorben, als dieser letzte Schmerz sie mitnahm, gefroren durch die Kälte. Ihre grauen Augen sehen mich an.
Sie scheinen fokussiert auf mich, als ob es meine Augen wären, in die sie zuletzt geblickt hätte. Eine glitzernde Spur, kristallklar, nicht rot, läuft von ihrem Auge am Mund vorbei zu der Spitze ihres Kinns; auf dem Weg ändert sie die Farbe, bis auch dieser gefrorene Tropfen Tränen rötlich glänzt.
Mir wird schlecht.
Sie ist ein Kind gewesen, kaum älter als vierzehn oder fünfzehn. Nein, denke ich, als mein Blick unwillkürlich ihrem ausweicht und über ihren Körper wandert. Eine Frau ... vielleicht, es ist mir unmöglich, ihr Alter einzuschätzen. Meine Augen wandern wieder zu ihrem jungen Gesicht zurück, zurück zu diesem letzten Blick.
Ihre Augen halten mich, als wolle sie mich nicht gehen lassen, als fordere sie, dass ich sie ansehe. Sie hat junge Augen, ihre Augäpfel besitzen noch dieses strahlende Weiß, das im späteren Leben so selten wird.
Während sie mich mit ihrem toten Blick bannt, zwingt sie mich dazu, sie wahrzunehmen. Ich sehe die Spuren einer scharfen Klinge, sehe die unterschiedlichen Striemen, sehe, spüre und fühle, was ihr angetan wurde, kann mich dem nicht entziehen und will es auch nicht, als sei ich es ihr schuldig. Als ich langsam zurückweiche, verbleibt ihr Blick an der Stelle, an der ich eben gestanden habe. Ich schaue nach unten, auf meine Füße, ich befinde mich innerhalb des Bandes, innerhalb des Bereichs, den die Spurensicherung bereits klärte, den sie als den sichersten Weg zum Opfer auswies.
Ich gebe Tomas Marks ein Zeichen. Ich habe vollständig vergessen, dass ich nicht mehr sein Vorgesetzter bin, aber er kommt zu mir und folgt meinem Blick. Der Schnee zu meinen Füßen ist durch unzählige Spuren vermatscht. Ich trete diesen einen kleinen Schritt vor, befinde mich wieder im Bann ihres Blicks.
»Er stand genau hier«, sage ich leise zu Tomas. »Und er hat meine Größe.« Erneut kostet es mich Mühe, mich von diesen toten Augen zu lösen, und ich bin erleichtert, in das Gesicht eines Mannes zu blicken, der sich damals nicht der allgemeinen Hysterie und Empörung anschloss. »Ihr habt diesen Bereich schon erkennungsdienstlich erfasst?«
Er blickt von mir zu den Augen des toten Mädchens, dann auf den Boden, nickt. »Ja, Marcus. Aber«, er räuspert sich, »es waren schon zu viele hier. Deine Größe? Wieso?«
Ich schaue zu ihr zurück, dann wieder zu ihm.
»Wenn ich hier stehe, sieht sie mir genau in die Augen, Tomas. Ganz exakt.« Ich schlucke, die Stimme will im Moment nicht. Der Blick ist nicht für mich bestimmt, doch ertappe ich mich dabei, ihm ausweichen zu wollen. Es ist keine Ekstase in ihrem Blick zu finden, nur Schmerz, aber auch keine Angst. Er hat sie nicht gebrochen. Es ist ein Blick der Verachtung, ein Blick, lebendig gehalten durch die Kälte. »Sie sah ihren Mörder an, als sie starb.«
Ich mustere sie nun, Zentimeter für Zentimeter, sie verlangt es von mir, zwingt mich dazu. Auch wenn ich wegsehen will, findet mein Blick jedes Detail, sehe ich, was ihr wie angetan wurde. Krüger hatte recht, verdammt soll er sein. Ich hatte gehofft, es wäre nicht so.
Mein Magen zieht sich weiter zusammen, ich kämpfe verzweifelt gegen die aufkommende Übelkeit.
Ein letztes Mal sehe ich in ihre Augen, begegne diesem Blick und weiß, dass ich den Mörder für sie finden werde.
Kapitel 2
Irgendetwas haben wohl auch die anderen gespürt. Gref oder Graf oder wie auch immer dieser kleine Mistkerl heißt, macht mir Platz, die anderen scheinen zu warten. Ich nicke Stella zu, sie weiß, dass ich bald mit ihr reden werde, aber nicht hier, nicht heute, nicht jetzt. Stella hat schon umso vieles mehr als ich gesehen, aber ich spüre in ihrem Blick, dass auch sie sich vor diesem Bild nicht schützen kann. Oder will.
»Malowsky«, sage ich. Er blickt mich an, öffnet den Mund, schließt ihn wieder. »Ich bin dabei«, teile ich ihm mit. »Ich melde mich.« Er nickt, sieht mir hinterher, als ich an ihm vorbeigehe.
Caro steht neben dem Rolls, als ich den Hinterhof verlasse, öffnet mir mit einem verschmitzten, vielsagenden Lächeln die Tür, ihre Zunge gleitet über die halb offenen Lippen. Doch ihr Lächeln schwindet, während sie in meinem Gesicht liest. Sie vergisst ihre Rolle.
»So schlimm?«, fragt sie leise. Ich nicke. Sie langt vor mir in den Wagen, will nach etwas greifen. Meine Hand schnellt vor, packt ihr Handgelenk, ich lasse sie los und halte ihr die offene Handfläche hin. Langsam legt sie mir einen Gummi in die Hand, benutzt, gefüllt, verknotet, noch warm. Sie sucht meinen Blick, ist unsicher. Ich werfe einen Blick hinüber zu dem jungen Polizisten, der das Absperrband befestigt hat und jetzt verzweifelt in jede Richtung schaut, nur nicht in unsere.
Ich lege den Gummi wieder neben die Bar, dort, wo sie ihn ursprünglich abgelegt hat, und steige ein.
»Nach Hause, Caro.«
Sie schließt wortlos die Tür, geht um den Wagen herum, setzt sich hinter das Lenkrad. Langsam fährt sie rückwärts, sie wendet den Kopf, doch sie blickt nicht nur nach hinten, sie sucht immer noch mich.
Ich beuge mich vor, schiebe die Trennscheibe zur Seite. »Halte kurz an«, sage ich ihr, als wir dem Blickfeld der Polizei entronnen sind.
Sie hält an, sitzt ganz ruhig, ganz still, wartet.
Ich greife durch die Öffnung, nehme ihr die Chauffeursmütze ab, löse ihr Haar so, dass es sich wie schwarzes Metall über ihre Schultern ergießt. Es ist ein Signal, das Spiel ist vorbei, sie ist wieder meine Freundin, Vertraute, meine Liebe, meine Partnerin und meine Frau.
Ich halte inne, bin still, sie auch.
»Ich habe gemerkt, dass er dich bewundert hat, mehr als Malowsky dich verachtete, deshalb gab ich dich ihm.« Ich schlucke. »Wenn er sah, was ich sah«, fahre ich leise fort, »so hast du ihm nun einen anderen Eindruck gewährt, ein anderes Bild, ein Bild des Lebens und der Freude. Dafür wird er dir ewig dankbar sein.«
Ich streiche ihr über die Wange, greife ihr unters Kinn, drehe ihren Kopf mit leichtem Druck zu mir, die Haltung ist unbequem, aber sie sieht mich offen an.
»Wurde er dir gerecht? Schenkte er dir Freude?«
Sie lächelt leicht, bewegt ihr Gesicht so, dass sie einen leichten Kuss auf meine Handfläche setzt.
»Er verstand es nicht. Ich habe ihn vollständig überrumpelt. Aber ja, ich glaube, in diesem kurzen Moment hat er mich geliebt. Er schenkte mir Freude.« Ihre Stimme ist voll, klar, weich wie Honig. Ihre Stimme kann mich träumen lassen, manchmal verbiete ich ihr das Sprechen nur, damit ich mich darauf freuen kann, sie wieder zu hören, wenn ich es dann erlaube.
»Wenn du sagst, dass ich helfen konnte, ihn das vergessen zu lassen, was ich in deinem Blick sehe, dann bin ich froh für ihn«, sagt sie leise.
Ich antworte nichts, sehe sie nur an.
Das Spiel ist vorbei, sie kann sein, wie sie ist, also hebt sie fragend eine Augenbraue.
Ich versuche zu lächeln, ob es mir gelingt, weiß ich nicht, aber ich versuche es. Ich rieche ihr Haar, zusammen mit der Winterluft, sehe, dass sie in der Eile ihren Lippenstift nicht korrigieren konnte, er ist leicht verschmiert. Sehe in ihren Augen die Tiefe ihrer Seele.
»Ich versuche das Gleiche«, antworte ich ihr leise. »Ich will in dich eintauchen und vergessen. Aber das geht nicht. Das darf ich nicht.« Ich nehme ihre Hand, um sie zu küssen. »Fahr uns nach Hause.«
Es wäre vielleicht besser gewesen, in der Stadt zu bleiben, Krüger auf dem Präsidium aufzusuchen, Dinge abzustimmen, aber im Moment bin ich dazu nicht imstande. Caro fährt, schwimmt elegant und souverän im Verkehr mit, der am Anfang – es ist schließlich Morgen, und der Berufsverkehr quillt in die Stadt – einfach nur fürchterlich ist. Der alte Rolls ist seit drei Wochen fertig, seit zwei Wochen spielen wir dieses Spiel. Der Rolls ist nicht mehr wirklich so alt, vieles an ihm wurde an die heutigen Bedürfnisse des Straßenverkehrs angepasst. Dennoch ist er, nach heutigen Maßstäben, nicht sicher. Mit ein Grund, warum Caro so fährt. Ein überraschender Effekt ist, dass diese alte majestätische Dame ihren Weg fordert. Die Leute machen Platz, als ob sie einer Königin den Weg räumen, es ist etwas anderes, als sich hektisch durch den Verkehr zu drängeln.
Heute kann ich die Muße gebrauchen. Ich atme tief durch, rieche Leder, Wachs, eine Rose und Carolines unverwechselbaren Duft, werde erinnert an das Parfüm, das ich roch.
Man sagt, dass der Geruchssinn derjenige Sinn ist, der am direktesten mit Erinnerungen verknüpft ist. Vor meinem geistigen Auge sehe ich eine junge Frau, ganz in Lack gehüllt, an einer der Stangen, die rund um die Tanzfläche des Dominions stehen, leuchtende graue Augen folgen fasziniert der Showeinlage auf der Bühne, weiße scharfe Zähne beißen in ihre Unterlippe, sie zieht die Luft hart ein, als sich auf der Bühne die maskierte Frau, festgezurrt auf den offenen Sprungfedern eines alten Bettes, rückwärts aufbäumt, während die Gerte in der Hand des Meisters die Stelle zwischen ihren offenen Schenkeln küsst.
Ich stehe neben ihr, unterhalte mich mit Friedrich, einem meiner treuesten Gäste, als ein zufälliges Spiel von Luftströmen mir dieses Parfüm in die Nase weht. Ich werfe ihr einen Blick zu, mir erscheint sie zu jung für den Club, aber heutzutage ist dies schwer zu erkennen. Ihr Busen bebt, als sie atmet, schnell, fast hyperventilierend; freizügig in dem Mieder aus Lack, bietet er einen reizenden Hintergrund für den altmodisch wirkenden schwarzen Modeschmuck, der sich verführerisch in das Tal zwischen ihrem Busen ergießt.
Ich fühle ihre Erregung, eine kleine Venus mit schlanken Fesseln, schmaler Taille und großen Augen. Eine Alice im Wunderland.
Eine Stimme in meinen Gedanken sagt, du kannst sie nehmen, aber ich winke innerlich ab. Ich habe, was ich brauche und so lange gesucht habe, sie reizt mich nur durch ihre Jugend, die scheinbare Unschuld und das Fieber in ihren Augen.
Ich wende mich wieder der maskierten Frau auf dem Metallbett zu, ihre Augen suchen und halten mich, als sie sich mit einem unterdrückten Stöhnen aufbäumt. Sie trägt eine Opernmaske, eigentlich überflüssig, aber ein Element der Show, es gibt ihr etwas Mysteriöses, Unbekanntes, und diese dunklen Augen gehören Caro ...
»Caroline«, sage ich, ihr voller Name, da ich das Spiel vorhin beendet habe. »Wann war das, als George dich im Dominion vorführte?«
Seitdem wir uns gefunden haben, bin ich in solchen Dingen faul geworden. Zwar bin auch ich imstande, mein Gedächtnis nach jenem Tag zu durchforsten, Caro jedoch hat, wie viele Frauen, für diese Belange einen besonderen Kopf.
»Zwölfter November.« Sie sucht meine Augen im Rückspiegel. »Meine Füße tun immer noch weh, wenn ich daran denke.« Ja, richtig, die Bastonade.
Ein anderes Bild drängt sich vor meine Augen, sie auf dem Boden, die Füße gespreizt an die Pfosten des Bettes gekettet, ihr Kopf nach hinten gerissen, das Gesicht verklärt von dem Schmerz, den sie spürt, als dieser eine Schlag die Haut anreißt.
Ich schiebe das Bild zur Seite, ihr Gesicht ähnelt zu sehr einem anderen, die gleichen geweiteten Augen.
Ich vertraue Caro mit allem, das ich bin, habe und liebe, aber ich habe dieses eine Geheimnis vor ihr: Ich bin kein echter Sadist. Mich erregt es, ihre Erregung spüren zu können, aber ich muss jedes Mal darüber hinwegkommen, dass es Schmerz und Erniedrigung sind, die sie dorthin bringen.
Wenn ich sie leiden sehe und nicht ich es bin, der ihren Schmerz kontrolliert, dann leide ich. Sie wird es aber nie erfahren.
Der Mörder fühlte sein Opfer nicht. Das ist es, was ich von dem Tatort mitnehme ... ein Mangel an Gefühl für Alice. Mein Name für sie, in der Nacht, in der ich sie das erste Mal sah, am 12. November.
»Warum fragst du?« Carolines Blick teilt sich zwischen dem Rückspiegel und der Straße vor uns. Der Rolls schwankt, als ein Idiot mit deutlich über zweihundert Sachen an uns vorbeischießt. In alten Zeiten war die Höchstgeschwindigkeit des Rolls gerade mal neunzig, mit dem neuen Motor wäre es möglich, hundertsechzig zu fahren, aber die Nadel steht auf hundert. Exakt hundert.
Hinter uns schwenkt ein Lastwagen aus, den Blinker hatte er bereits gesetzt, bevor der Idiot ihn überholte. Nun kriecht der Laster an uns heran, ist neben uns. Das Dröhnen seines Motors ist fern, der Rolls abgekapselt von der Umwelt, eine Kunst, welche die Erbauer dieses Wagens schon damals beherrschten.
»Ich erinnere mich, sie an jenem Abend im Dominion gesehen zu haben. Sie stand am Rand der Tanzfläche, und sie hätte gern mit dir getauscht.«
»Sie?« Caroline sucht meinen Blick. »Das Opfer?«
Ich nicke. »Das war vor der Bastonade, richtig?«
Sie lächelt leicht. »Ich glaube, danach wollte niemand mehr mit mir tauschen. George ist ja sonst ganz okay, ich mag ihn auch, aber wenn es um seine Spezialität geht, ist er ein Bastard.« Sie wirft mir einen Blick zu. »Und du auch. Ich musste den Rest des Abends stehen.«
Es ist Small Talk. Sie weiß, dass mich das, was ich sah, erschütterte, sie weiß auch, dass Alice, oder wie immer sie auch hieß, wahrscheinlich gern getauscht hätte, um diesem Schicksal zu entrinnen.
Wir biegen von der Hauptstraße ab, hier ist nicht mehr geräumt, der Rolls-Royce schaukelt, als wir den Asphalt verlassen. Eine weite Spur zieht sich vor uns die Allee entlang, eine Spur im Schnee, die wir vor wenigen Stunden, vor einer Ewigkeit, selbst gezogen haben. Es war Nacht vorhin, nun bricht ein grauer klarer Tag an.
In der Ferne sehe ich eine Krähe kreisen, sie erscheint mir sehr groß, vielleicht ist es ein Rabe, es soll hier welche geben.
Ich rolle das Fenster herunter, nehme den Gummi von der Bar und werfe ihn hinaus. Caro folgt seinem Flug mit den Augen.
»Marcus?«
»Ja?«
Schweigen. Ich warte. Sie wird sagen, was sie sagen will.
»Ich hasse den Geschmack von Gummi«, sagt sie leise. Ich nicke, ich weiß es. Sie sagt nichts weiter, es ist genug. Caro ist meine Sklavin, es ist mein Recht, sie jedem zu geben, und für mich hat es einen besonderen Reiz, wenn ich weiß, dass sie sich einem Wildfremden hingibt, nur weil ich es will. Dabei gibt sie sich aber nicht dem anderen, sondern indirekt mir. Es ist Hingabe an mich.
Heutzutage kann man aber auf Gummis nicht verzichten. Nun, das ist auch nicht ihre Bitte.
Für einen Moment bin ich abgelenkt, dann sehe ich wieder das Gesicht von Alice, ihr Gesicht vom Rand der Tanzfläche, das andere Gesicht dränge ich zur Seite. Ich habe Caro gehört, aber es ist nicht der richtige Zeitpunkt, darauf einzugehen.
Sie blickt wieder nach vorn, fährt konzentriert. Es ist nicht so, dass Caro nicht mitfühlt, eher das Gegenteil, es ist sogar denkbar, dass sie darum gebeten hat, um mich abzulenken, ich traue es ihr zu.
Ich schaue auf die altmodische Uhr, über der Bar, unter der Blumenvase. Sie muss aufgezogen werden, ist mechanisch, und dennoch weiß ich, dass sie auf die Sekunde stimmt, denn es ist Caros Aufgabe, dafür zu sorgen. Wie auch für die einzelne rote Rose in der Vase am unteren Rand der Trennscheibe. Wir haben kein Gewächshaus, es ist ihr Geheimnis, woher diese Rose stammt, aber seit zwei Wochen, seitdem wir den Rolls nutzen, befindet sich dort jeden Morgen eine frische Rose.
Ich bemerke selbst, dass ich mich gedanklich noch mit Kleinigkeiten befasse, mich ablenke, nur weil ich nicht an das denken will, was ich an diesem Kreuz sah. Ich schrecke noch immer vor dem Bild zurück. Es wird Zeit, dass sich das ändert.
Inzwischen ist es kurz vor neun, mitten in der Nacht für die meisten Leute, die abends das Dominion bevölkern. Ich strecke die Hand aus, öffne ein Fach aus poliertem Holz, nehme das Funktelefon heraus.
Es ist neu, ein anderes als das, was ich gestern noch benutzt habe. Im Rückspiegel sehe ich Caros Augen, sie lächelt amüsiert.
Sie ist fasziniert von diesen Dingern, mag all die kleinen Spielereien und ist eine Virtuosin im Schreiben von SMS. Sie ist achtzehn Jahre jünger als ich, und dies ist einer der wenigen Punkte, an denen ich merke, dass uns eine Generation trennt.
Ich suche das Rufnummernverzeichnis, rolle schließlich den Balken auf »Klaus B. priv. Home« und drücke die Taste mit dem grünen Hörer. Es läutet endlos, ich werde daran erinnert, wie gestern Nacht unser Telefon uns penetrant in die Welt zurückriss, die wir zu vergessen suchten. Die Verbindung wird unterbrochen, offensichtlich hat Klaus einen guten Schlaf.
Zwischen den alten Linden taucht das Chateau auf, malerisch mit Schnee verziert, selbst jetzt, acht Jahre später, kann ich kaum glauben, dass dies alles mir gehört, dass dies mein Heim ist.
Es verdient den Namen »Chateau« nicht wirklich, es ist ein imposantes Gebäude, das im späten 19. Jahrhundert im Stil des Spätbarocks errichtet wurde, eine Kopie, aber ungleich tauglicher als ein Original. Drei Stockwerke, achtzehn Zimmer, davon vier Salons im Erdgeschoss, im linken Seitenflügel ein Ballsaal, rechts die Stallungen, nun eine Garage für unsere Fahrzeuge. Der Hof ist unter dem Schnee mit Kopfstein gepflastert. Der Haupteingang befindet sich die Treppe hoch, im ersten Stock. Vor ihm, in der Mitte der runden Auffahrt, ein verschneites Blumenbeet sowie ein leicht kitschiger Amor, mit Schnee und Eiskristallen drapiert; er gehört zu dem Brunnen in der Mitte.
Ich finde ihn kitschig, aber Caro mag ihn. Ich sage mir immer wieder, wie wichtig Konsequenz ist und dass ich ihr schon gesagt habe, dass ich ihn entfernen lassen wolle, das war vor drei Jahren, aber ich befürchte, diese Entscheidung ist nicht die meine.
Die Geschichte des Chateaus ist genauso obskur wie verrucht. Erbaut wurde es als eine diskrete Spielwiese des Adels, nicht unähnlich den Lustschlösschen früherer Epochen, aber dies war 1899. Zwar diente das Haus hauptsächlich dem einen lusterfüllenden Zweck, aber schließlich gehörte es sich, es mit Stil, Würde und Anstand zu tun. Also fügte man auch noch die Basis für andere Genüsse hinzu, eine große Bibliothek, in der die Herren mit der Bildung des Geistes prahlen konnten, eine für damalige Verhältnisse moderne und großzügige Küche, damit das Kulinarische nicht zu kurz kam, und natürlich waren seit jeher Pferde für den gepflegten Morgenausritt ein Muss. Zur körperlichen Ertüchtigung ein Gymnasium und, hinter dem Haus, ein Schwimmbassin in der Art eines türkischen Bades, das mit einem Jugendstil-Gewächshaus überdacht wurde, sodass man es auch im Winter nutzen konnte.
Der Erste Weltkrieg und der Fall Habsburgs bescherten diesem Lustgewinn ein jähes Ende. In den letzten Kriegsjahren und für Jahre danach wurde das Anwesen als Hospital genutzt. Einer der Salons im Erdgeschoss wurde weiß gekachelt, die französischen Türen herausgerissen und durch eckige, geradezu abstoßend hässliche Stahlrahmenfenster ersetzt – mehr Licht für den Arzt bei seinem blutigen Handwerk.
Zwei Jahre, bis 1926, stand es leer und fand sodann weitere Verwendung als Klinik, diesmal nicht für Kriegsopfer, sondern für die geschundenen Geister. Sieben Jahre lang war es das Landruhheim, eine psychiatrische Klinik für Frauen, bis ein Skandal ungeheuerlichen Ausmaßes den Direktor in den Selbstmord trieb und es übereilt geschlossen wurde. Im Spätsommer 1938 wurde das Anwesen von den Nazis entdeckt, von der Partei erworben und wieder seinem ursprünglichen Zweck zugeführt. In den Zimmern im dritten Stock warteten arische Mädchen auf die Offiziere, um sie mit ihren Schößen zu belohnen. Keine Gummis für die Damen, schließlich war arischer Nachwuchs aus gezielter Paarung erwünscht.
1945 wurden die Besitzer ausgetauscht; es waren nun die Amerikaner, die hier militärisch organisierte Entspannung fanden, vielleicht waren es dieselben Frauen. 1947 verplapperte sich ein amerikanischer Posten gegenüber einem Journalisten, hastig wurde eine Decke über die Sache gebreitet, und eines Tages waren die Amerikaner einfach nicht mehr da.
Das Haus stand leer bis Mitte der Fünfziger, ein Ausflugsrestaurant versuchte sich hier, später wieder einmal eine Klinik, diesmal gezielt auf die Falten und das unerwünschte Gewebe von Frauen spezialisiert, die ein Vermögen zahlen sollten, um den Ort verjüngt und schlank zu verlassen.
Mit seiner Vorgeschichte war es jedoch wohl kaum verwunderlich, dass das Anwesen nur in einer Funktion wirklichen Erfolg haben würde. Ende der Sechzigerjahre kaufte eine sorgsam durch Mittelsmänner abgeschirmte Person das Anwesen und verwandelte es in ein Edelbordell, ein Unterfangen, das weitaus erfolgreicher war als alle früheren Unternehmen. Bis 1998 blieb es dabei. Dann verstarb der geheimnisvolle Besitzer.
Es stellte sich heraus, dass er mein Großonkel war, ein Mann, den ich in meiner Kindheit nur einmal gesehen habe, ein streng wirkender Herr in korrektem dunklen Anzug, mit Augen, die einen zu durchbohren schienen.
Diese Augen sind das, woran ich mich erinnern kann, und seine Worte zu mir und meiner Mutter. »Ein gescheiter Kerl. Gut gemacht.«
Welch Lob für eine Nichte, die Witwe eines Polizisten, der im Dienst umkam und die nun bei acht Familien putzte, damit wir etwas zu essen hatten ... Meine Mutter hasste ihn, aber warum, erfuhr ich nie. Heute kann ich es mir denken.
Sie starb vor ihm, und natürlich dachte er selbst nicht im Traum daran, mir etwas zu vererben. Ein Hundeheim sollte stolzer Besitzer des Chateaus werden, wie es im Volksmund hieß. Einhundertsiebenundsiebzig Millionen Schilling, sechs Morgen Land, das Chateau, weitere Häuser in der Stadt, unzählige andere Dinge ... sollte noch mal jemand sagen, lasterhaftes Leben lohne sich nicht! Onkel Wilhelm wurde achtundneunzig Jahre alt und starb im Schoße einer Minderjährigen. Nein, seien wir ehrlich, er starb in ihrem Hintern.
Nichts von alledem wusste ich damals, ich versuchte, bei der Polizei etwas Sinnvolles zu tun, war darauf fixiert, das Böse zu bekämpfen und nebenbei Karriere zu machen.
Nur war das Testament rechtlich nicht gültig, irgendetwas war vergessen oder übersehen worden, ich weiß es nicht mehr, vielleicht fehlte das Datum, vielleicht sogar die Unterschrift.
Ich persönlich denke, dass der Anwalt meines Onkels, einst ein Jugendfreund meiner Mutter, dem alten Lüstling und Geizkragen einen letzten Streich spielte, denn er bot sich schnurstracks an, mich zu vertreten. Zwei Monate später war ich Besitzer dieses Anwesens und anderer schöner Dinge, darunter eines Dutzends Grazien, überraschenderweise als Inventar aufgeführt.
Mit achtundneunzig war es für Onkel Wilhelm nicht immer einfach gewesen, seinen Spaß zu haben, der alte Lustmolch musste motiviert werden, das Außergewöhnliche reizte ihn – und die Jugend. Dass er als alter Päderast starb, kümmerte ihn wahrscheinlich wenig, angeblich starb er mit einem Lächeln ... Aber die Tatsache, dass der Schoß, nein, der Hintern zu einem dreizehnjährigen Mädchen gehörte, war schon Skandal genug; dass es sich um die zwei Monate zuvor weggelaufene Tochter eines lokalen Politikers handelte, gab das Öl ins Feuer, aber dass das Anwesen, immer noch an zwei Tagen die Woche für handverlesene Gäste geöffnet, nun jemandem gehörte, der als Polizist ehemals sogar bei der Sitte gewesen war und so gleichsam auch Tugendwächter hätte sein sollen, gab den letzten Zündstoff.
Ich schloss das Anwesen in dem Moment, als alles unterzeichnet war, aber dies war eine ganze Weile nach dem Skandal. Erbschaften ziehen sich länger hin als Skandale, und bis zu der letzten Unterschrift führte der Verwalter des Anwesens dieses nach den Wünschen meines Onkels fort.
Malowsky war es, der den Stein ins Rollen brachte. Wir waren nicht länger Freunde, nur wusste ich es noch nicht. Es war nicht direkt Neid, es war die Bitterkeit in ihm, dass mir all dies in den Schoß fiel und er, Jahre vorher, zusehen musste, wie seine Frau starb, weil er das Geld für die notwendige Operation in den Vereinigten Staaten nicht auftreiben konnte. Er verpfändete und verkaufte alles, was er hatte, und mehr, doch es reichte nicht für diese eine spezielle Klinik, es musste also eine andere sein, und sie starb dort während der OP.
In seiner Bitterkeit konnte ihm keiner helfen, unsere Freundschaft gefror, war vorbei, bevor ich es merkte. Ich vertraute ihm, er nutzte es aus, um mich von der Karriereleiter zu stoßen, aber hauptsächlich, um seiner Bitterkeit gerecht zu werden.
Niemand konnte mir etwas vorwerfen. Rechtlich gesehen war ich noch nicht in der Lage, auf das Management des Chateaus einzuwirken, und dieses wollte so lange wie möglich das exklusive Gehalt beziehen, das ihm vertraglich zustand. Teilweise wurden exorbitante Summen für die »dienstleistenden Personen« bezahlt, all das vertraglich geregelt. Ich hätte für eine vorzeitige Schließung und den entsprechenden Verdienstausfall ein Vermögen zahlen müssen. Es gab keine rechtliche Handhabe gegen mich, aber das war auch nicht notwendig. Schließlich wurde mir ja nur »nahegelegt«, meinen Hut zu nehmen.
Eine Weile blieb das Chateau geschlossen. Dann sah ich die Bücher ein, realisierte die Zahlen und öffnete es wieder.
Das Management musste gehen, einige mir durch ihre polizeilichen Akten sehr wohl bekannten Personen wurden aus der Gästeliste gestrichen, die Damen ausbezahlt.
Die Sitte ging der ganzen Angelegenheit nach. Ich war an der Untersuchung nicht beteiligt, man vermutete einen Interessenkonflikt. Dennoch, für mich vollständig unverständlich, entging den Kollegen die Tatsache, dass auf dem Chateau nach wie vor zwei minderjährige Mädchen lebten.
Ich korrigierte dies auf meine Weise. Jetzt sind sie nicht mehr minderjährig und arbeiten immer noch für mich ... Jacqueline, eine kleine, süße, ruhige Frau mit leuchtenden Augen und schnellen graziösen Bewegungen, zaubert in der Küche kulinarische Sensationen, Amber, eine verspielte Katze in Menschengestalt, verwaltet meine EDV und hält die Technik auf neuestem Stand. Ich finanzierte ihnen das Studium und eine Zukunft, ein Versuch, das auszugleichen, was mein Onkel ihnen an Kindheit nahm.
Zu meiner Überraschung bestanden beide darauf, ins Chateau zurückzukehren. Sie brachten mich mit ihren Verführungskünsten an den Rand des Wahnsinns, während mich dieser unbestimmte Gedanke verfolgte, dass es nicht erlaubt sei. Ich vergaß dabei, dass auch sie irgendwann volljährig geworden waren. Eines Tages steckten sie ihre hübschen Köpfe mit Caro zusammen und arbeiteten einen Schlachtplan aus ... und ich unterlag mit Genuss.
Ab und zu, eigentlich selten und nur bei besonderen Gelegenheiten, sind Jacqueline und Amber auch mal in den öffentlichen Räumen zu finden. Dann packt es sie, und sie mischen sich aus einer Laune heraus unter die anderen Mädchen, wobei Caro diskret über Amber wacht. Amber ist blond, zierlich, klein ... mein Onkel fand sie mit elf. Als ich von ihr erfuhr, war sie beinahe sechzehn. Jetzt ist sie vierundzwanzig und hat ihr Leben ansonsten fest im Griff. Aber sie ist die einzige mir bekannte Person, die wirklich keine Grenzen zu haben scheint. Sie weiß es selbst, deshalb gibt sie sich so selten, aber wenn sie es tut, passt Caro auf sie auf.
Doch all das lag damals noch in der Zukunft. Der alte Verwalter, der um diese Dinge wusste und sie übersah, wurde entlassen, und mir fehlte ein neues Management.
Es gab viele Bewerber um den Posten, ich wollte die Arbeit nicht selbst tun, sah mich aber fast dazu genötigt, da ich keinen der Kandidaten mochte. Dann klopfte es eines Tages an der Tür zu meinem Büro, sie kam herein und teilte mir mit, dass sie meine neue Managerin sei.
Zweiundzwanzig Jahre alt, ein Summa-cum-laude-Jura-Abschluss mit Schwerpunkt Wirtschaftsrecht, aus bester, alteingesessener Wiener Familie.
Ich fragte sie, warum ausgerechnet sie dies tun wolle. Mit ihren Qualifikationen, mit ihrem Charisma, das den Raum flutete, hatte sie überall Chancen, wieso also hier?
Die Antwort war genauso einfach wie überraschend. In diesem Haus hatte ihre Urgroßmutter ihren Urgroßvater kennen- und lieben gelernt; von daher war sie schon immer an dem Anwesen interessiert und fühlte sich ihm verbunden. Zum anderen, so erklärte sie mir, sei ihr die Szene nicht fremd, sie sei zwar in der eigenen Neigung eher devot und submissiv, aber sehr wohl imstande, auch zu dominieren.
Das Chateau bediente diese besondere Klientel, wie ich bald herausgefunden hatte. In den vorangegangenen Monaten hatte ich fast alles gesehen, was ich vorher für undenkbar gehalten hatte. Meine Arbeit bei der Sitte tat ein Zusätzliches, um meine Bildung in diesem Bereich abzurunden, und ich wusste also, was sie meinte, aber ich konnte den Bezug zu mir bis dahin nie erkennen.
Doch als sie mich dann ansah und mir sagte, ich könne sie in jeder Beziehung testen, sie sei in jeder Kapazität extrem belastbar, und als sie mit dieser flinken Zunge ihre Lippen befeuchtete, wurden mir die Knie weich und die Hose eng. Zum ersten Mal explodierten in meiner Fantasie die Bilder, die ich zuvor nur bei anderen gesehen hatte, und diesmal waren sie und ich die Akteure.
Also führte ich sie wortlos in eines der speziellen Zimmer, und sie folgte mir mit einem Glanz in den Augen, der sich verstärkte, als sie das spezielle Bett sah, ein Monstrum, das allerdings den Vorteil besaß, fast jede Form annehmen zu können und in jeder Konfiguration das Opfer hilflos und offen fixierte.
Ich befahl ihr, sich auszuziehen, sah so zum ersten Mal diesen exquisiten Körper, Alabaster, gekrönt von dem Haar, so schwarz wie das Gefieder eines Raben.
Ich verfiel in einen Rausch an Farben und Eindrücken, befahl ihr, dieses und jenes Gerät auszuprobieren, und als sie auf dem Bettgestell lag, unbequem verspannt, weit offen, ergriff ich zum ersten Male in meinem Leben den Rohrstock.
Sie fieberte mir entgegen, es war, als ob sich alles an ihr mir entgegenreckte, darum bat, ja, sich geradezu sehnte, den heißen Kuss zu spüren. Jedes Mal, wenn der Stock sie brennend liebkoste, hob sich ihr Schoß, spannten ihre Fesseln sich mit einem harten Schlag, die Sehnen und Muskeln unter ihrer Haut spielten und fühlten sich an wie Bänder aus Stahl, als ich die Hände über sie gleiten ließ.
Wieder und wieder geschah es, hob sich ihr Schoß in die Luft, dann traf der Stock ihre Beine, überzog die weiße durchscheinende Haut mit einem geröteten Muster. Ich war in einem Wahn, verloren, aber ich verlor sie nicht. Ich konnte mit ihr fühlen, in ihr, jeden einzelnen Schlag, ging mit ihr auf diese wahnwitzige Reise, aber ich verlor nicht das Ruder aus der Hand, zu deutlich konnte ich sie sehen, riechen und lesen.
Ihre Schönheit ist die eines Kunstwerks, eine Schöpfung, wie es nur ein einziger Meister erschaffen kann. Ihre blasse durchscheinende Haut, das schwarze Haar, diese ausdrucksvollen Augen ließen sie zerbrechlich wirken, was sie nicht ist. Ihr Aussehen, das selbstsichere Auftreten und ihr geschulter Verstand, all dies schreckte Männer ab, nahm ihnen den Mut, sich ihr zu nähern. Selbst als sie ihre Neigung entdeckte und sich freiwillig dem Schmerz ergab, waren ihre Schönheit und scheinbare Zerbrechlichkeit oft ein Hindernis für sie und ihre Partner.
Aber ich selbst konnte in jenem Augenblick nicht denken, nur fühlen, und ich fühlte, wie sie um etwas bat, was ich zuerst nicht bemerkte, ein wortloses Flehen. Ich spürte die Wellen ihrer Erregung, dass sie ihrem Orgasmus entgegenfieberte, dann landete der Stock zentral zwischen ihren Beinen, von oben hineingeschlagen, genau und exakt zwischen ihren Lippen, exakt auf diesen einen empfindlichen Punkt, den sie mir entgegenreckte ... Sie schrie, die Ketten strafften sich mit einem harten Schlag, ihr ganzer Körper bäumte sich auf, unnatürlich, die Gesetze der Schwerkraft Lügen strafend, für zwei, drei, vier, fünf Sekunden ... bis sie in Zuckungen und Nachbeben niedersank.
Es gibt einen Punkt, ab dem ich ihr nicht mehr folgen kann, sie frei davonfliegt, nur ein dünner Faden uns verbindet. So war es auch damals, sie war nicht mehr von dieser Welt. Aber ich sah ihr Gesicht ... und der Rohrstock hob sich erneut ... Diesmal traf er dort mit Absicht, wohin meine ungeübte Hand zuvor aus Versehen gezielt hatte.
Als ich sie später in den Armen hielt und ihr über das Haar strich, während sie zitterte und in mich zu kriechen versuchte, wusste ich bereits, dass sie die einzige Frau für mich war.
Zwei Wochen später heirateten wir.
Hatte ich zuvor ein paar ungenaue Vorstellungen über meine zukünftige Frau gehabt, so hätte ich mir jedoch nie träumen lassen können, wie die Erfüllung meines Lebens tatsächlich sein würde. Es gab einen Preis, den sie zahlen musste. Ihr Vater, ein stocksteifer Bankier, wandte sich von ihr ab, enterbte sie und verbot ihr das Haus. Ich kam damit nicht zurande, aber Caro sagte in einem bitteren Ton, dass es nicht anders zu erwarten gewesen wäre. Mit ihrem Vater hätte sie nie reden können.
So heil, wie ich dachte, war ihre Welt auch nicht gewesen. Ihre Mutter starb, als sie klein war, ein Autounfall, ich erfuhr erst später, dass sie wohl volltrunken am Steuer gesessen haben muss, mit ihrem Liebhaber an ihrer Seite. Ganz klassisch, der Gärtner – ein Skandal, der erfolgreich vertuscht wurde. Nur durfte in dem Haus nicht mehr über ihre Mutter gesprochen werden.
»Es gab nie jemanden, mit dem ich reden konnte«, vertraute sie mir einmal an. »Keinen außer Uomi.«
Ihre Urgroßmutter, Frau Winter, musste eine formidable Frau sein. Ich hoffte, sie auch einmal kennenzulernen. Sie telefonieren fast jeden Tag. Nur zu Hause ist Caro schon lange nicht mehr gewesen.
An all dies denke ich, als das Chateau zwischen den Linden auftaucht. Vielleicht weiß Caro meine Gedanken zu lesen, denn im Rückspiegel sehe ich einen ganz bestimmten Blick, und sie befeuchtet ihre Lippen mit flinker Zunge.
Ich bemerke nicht, dass sie einen Knopf drückt. Das Tor der Garage hebt sich scheinbar von allein, gemächlich gleitet der Rolls an seinen Platz, das fast unmerkliche Surren des Motors erstirbt.
Für einen Moment begegnen sich unsere Blicke im Rückspiegel, dann steigt sie aus, öffnet mir die Tür. Ich stehe vor ihr, rechts neben dem Rolls parkt ihr knallroter Mini, mit dem sie wie eine gesengte Sau zu fahren pflegt. Ich greife sie an den Armen, drehe sie herum, reiße ihr die engen Hosen hinunter bis zu den Knien, werfe sie auf die Motorhaube des Mini, eigentlich etwas zu tief für meine Knie, aber egal.
Sie stöhnt auf, als ich ihr mit einer Hand brutal die Arme nach hinten reiße, meine andere Hand ihr nicht minder rücksichtslos einen harten Klaps auf die Möse gibt. Ich drücke sie nieder, ihr Gesicht gegen die Scheibe ihres geliebten roten Flitzers, und dringe mit einem langen tiefen Stoß bis zum Anschlag in sie ein.
Ein tiefer Seufzer entrinnt ihr, als wir so verharren, ich fühle sie um mich, sie war schon recht feucht, aber jetzt spüre ich, wie ihre Wärme um mich pulsiert ... Ich bewege mich nicht, ich drücke sie nur an ihren Wagen, halte sie in diesem schmerzenden Griff, die Arme brutaler hinter ihrem Rücken hochgedrückt, als ich es je bei einem Verhafteten getan habe ... und genieße sie um mich herum, ihre Wärme, sie, ihre Augen, die ich in der Reflexion der Windschutzscheibe sehen kann, ihr Zittern und Beben, als auch sie versucht, still zu sein. Sie weiß, was ich will, aber sie will sich bewegen.