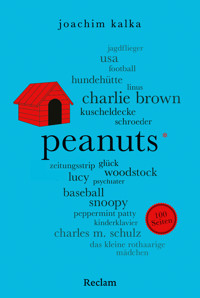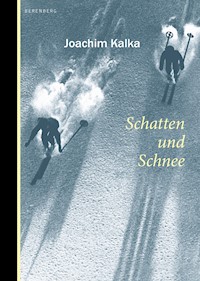
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Berenberg Verlag GmbH
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Lucky Luke schießt bekanntlich schneller als sein Schatten, Peter Schlemihl verkauft den seinen, während sich der Schatten von Peter Pan selbständig macht und wieder angenäht werden muss (was ihn nicht davon abhält, weiterhin ein Eigenleben zu führen). Die Toten streifen durch das Schattenreich, Gespenster werfen keinen Schatten, doch all das vergessen wir im Sommer, wenn wir im Schatten dicht belaubter Bäume Kühlung (und eine Liebelei?) finden. Und das Gegenstück zum Schatten? Ist natürlich der Schnee! Schnödes geforenes Wasser, aber mit Zauberkräften. Schneit es, wird die Welt eine andere, ob bei Patricia Highsmith, Tania Blixen oder Dostojewski. Und bei Winnie the Pooh lernen wir, wie es ist, sich snowy zu fühlen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 174
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Joachim Kalka
SchattenundSchnee
Inhalt
Schatten
Schnee
ANMERKUNGEN
Happiness, when you are a reader, is frequent.
JORGE LUIS BORGES, This Craft of Verse: The Charles Eliot Norton Lectures 1967–1968
Die schwarzen Krähen auf dem weißen Feld:
Der Anblick macht mein Herz erregt.
GEORG BRITTING, »Krähen im Schnee«
Dieses Buch ist, wie man sofort erkennen wird, das Ergebnis vielfältiger Lektüren, und ich möchte mir meine Leser ihrerseits gerne so vorstellen, wie Walter Benjamin das in seine Lektüre versunkene Kind beschreibt, das schließlich aufsieht, »über und über beschneit mit Gelesenem« (Einbahnstraße).
Es ist offensichtlich, daß irgendeine Vollständigkeit der Topik meiner beiden Themen nicht im Entferntesten beabsichtigt ist. Ich habe die Züge untersucht, die mich besonders interessieren und zu denen ich etwas zu sagen wußte. So fehlen gewichtige Beispiele (Platons Höhlengleichnis). Einige sehr naheliegende Verbindungen wurden nicht hergestellt – aus Respekt (Durs Grünbeins Schnee und Schalamows Gulag-Schilderungen) oder aus Abneigung (die Bergfilme von Leni Riefenstahl und Arnold Fanck). Anderes entfiel, weil es bereits sehr stark besetzte Motive noch stärker pointiert hätte, was überflüssig erschien – zu Kälte, Tod und Entropie hätte man natürlich den Satz zitieren können, der durch die ganze düstere Fernsehserie Game of Thrones hallt: »Winter is coming.«
Zuerst war ein mehr oder weniger symmetrisches Diptychon Schatten / Schnee geplant; die Ungleichgewichtigkeit der beiden Teile hat sich dann ergeben. Ein Subtext des Buches ist natürlich das Schwarz und das Weiß, das Schattendunkel und die Schneehelle. Es wäre vielleicht reizvoll gewesen, die Schatten-Kapitel und die Schnee-Abschnitte durcheinanderzuwürfeln, was einen pittoresken Schwarz-Weiß-Wechsel ergeben hätte. Doch schien es am Ende besser, es dem Leser zu überlassen, diese Bezüge nach Belieben herzustellen. Ich verdanke zur Erkenntnis des Schwarz (und damit auch des Weiß) viel den Studien von Max Raphael und Michel Pastoureau. Wie farbig beide Kategorien sind, lehrt natürlich die Dichtung. »Schnee fiel, und blaue Finsternis erfüllte das Haus«, heißt es in Trakls Prosagedicht »Traum und Umnachtung« (1915 in Sebastian im Traum).
Der Mond, umwallt von Wolken, schwimmt
Im feuchten Blau der Luft;
Der Forstteich, matt versilbert, glimmt
Durch zarten Nebelduft;
Die Glut, vom Hirtenkreis umwacht,
Verschwärzt, entflackernd, rings die Nacht;
Eintönig rollt vom Brunnenrohr
Der Wasserstrang, der sich verschlürft,
Und zarte graue Schatten wirft
Schräghin das Kirchentor.
JOHANN GAUDENZ VON SALIS-SEEWIS, »Die Herbstnacht« (1816)
In solchen Mondschein-Gedichten des späten achtzehnten und frühen neunzehnten Jahrhunderts wird das Grau zuerst als eine Farbe entdeckt, und zwar als eine schöne, »falbe«, »zarte« Farbe: »Und zarte graue Schatten wirft / Schräghin das Kirchentor.« Man kann den Umriß einer winzigen Anthologie andeuten: »Der Purpur, der im Westen funkelt, / erblasset in ein falbes Grau« (Albrecht von Haller, »Doris«); »Des Dörfchens Weidenkranz verschwimmt im grauen Duft« (Sophie Mereau, »Vergangenheit«, in Schillers Musenalmanach auf 1796). Dieses Grau erinnert uns daran, daß das Schwarz des Schattens natürlich stets subtil farbig ist und vor allem in verschiedenen Graustufen abgetönt.
Der Schatten ist etwas, das wir im Alltag kaum recht wahrnehmen, das aber größter (ästhetischer) Aufmerksamkeit würdig wäre. Und der Schnee ist und bleibt etwas Erstaunliches. Wir können uns das am besten vergegenwärtigen durch Nachrichten aus Weltgegenden, wo es nur sehr selten schneit. Alabama in den fünfziger Jahren (Harper Lee, To Kill a Mockingbird, 1960; Kapitel 8); ein kleines Mädchen erzählt:
Am nächsten Morgen wachte ich auf und starb fast vor Angst. Meine Schreie holten Atticus halbrasiert aus seinem Badezimmer.
»Das Ende der Welt ist da, Atticus! Tu bitte etwas!« Ich zerrte ihn zum Fenster und deutete hinaus.
»Nein, ist es nicht«, sagte er. »Es schneit.«
Jem fragte Atticus, ob das so weitergehen würde. Er hatte auch noch nie Schnee gesehen, aber er wußte, was es war. Atticus sagte, er wüßte auch nicht mehr über Schnee als Jem. »Aber ich glaube, wenn er so wäßrig ist, dann geht er bald in Regen über.«
Das Telefon klingelte und Atticus stand vom Frühstückstisch auf, um abzunehmen. »Das war Eula May«, sagte er, als er zurückkam. »Ich zitiere: ›Insofern es in Maycomb County seit 1885 nicht geschneit hat, ist heute keine Schule.‹«
Je kleiner das Buch, desto auffälliger wird die Neigung des Autors zu Umständlichkeiten und Abschweifungen. Für diese mag ich mich nicht geradezu entschuldigen, doch bitte ich die Leser, sie zu verzeihen. »Snowflakes are perfect … Stars are perfect … Not us! Not us!«, sagt Nicolas Cage in Norman Jewisons Moonstruck (1987) mit großem Nachdruck.
Die Übersetzungen sind, wenn dies nicht anders vermerkt ist, von mir. Für wichtige Hinweise habe ich Wolfgang Matz und Lothar Müller zu danken.
Wie schon vorhergegangene Bücher möchte ich auch diese Doppelstudie als »Montage-Essay« bezeichnen; der Begriff scheint mir immer ein wenig zu hoch zu greifen, aber ich wüßte keinen besseren für diese Produkte von Addition sowohl wie Kontrastierung. Die Wappentiere all meiner Versuche wären die Elster und der Maulwurf, die für den Sammeltrieb und das Herstellen unterirdischer Verbindungen stehen können. Dieser siebte Essayband, dessen Publikation mir der Verlag ermöglicht hat, soll nicht ohne meinen herzlichen Dank an die (großartig beiläufige) Generosität von Heinrich von Berenberg erscheinen.
Schatten
Wie ein Schatten auf der Mauer
Der den Kalk zu Staub zerfrißt.
Unauflöslich bleibt die Trauer,
Die aus schwarzem Honig ist.
KARL KROLOW, »Verlassene Küste«
Hier saß ich, wartend, wartend, – doch auf nichts,
Jenseits von Gut und Böse, bald des Lichts
Genießend, bald des Schattens, ganz nur Spiel […]
FRIEDRICH NIETZSCHE, »Sils-Maria«
You might say he had to make the sun shine on him so that he could see his shadow and feel alive.
JOHN LE CARRÉ, A Murder of Quality (1960)
Er verließ dann die Kammer und stieg die Treppen hinauf, wobei er dort, wo das Licht es gestattete, die Eleganz seines eigenen Schattens beobachtete.
DINO BUZZATI, Il deserto dei tartari (1940; Kapitel VII)
[…] noch als ich nach Sachsen zurücklief und meinen
armen, armerudernden Schatten
schräg an die Wand warf im Lauf.
THOMAS ROSENLÖCHER, »Die Neonikone« (1988)
Was könnte enger sein als die Verbindung des Schattens mit dem Gegenstand, der ihn »wirft« – mit, sagen wir, seinem Menschen? Wenn man sich eng an jemanden anschließt und immer neugierig seine Gesellschaft sucht, mag es heißen: Ich wurde damals sein Schatten. »Je devins son ombre.« (Ziemlich zu Beginn von Jacques Cazottes Le Diable amoureux, 1772.) Folgt die Polizei oder der Privatdetektiv konsequent einem Verdächtigen, so wird dieser »beschattet«. Schon 1889 wird in R. L. Stevensons und Lloyd Osbournes The Wrong Box der Dialog geführt (an einem Höhepunkt der komplizierten Intrigenhandlung, Kapitel XIV):
»Michael!« schrie Morris auf. »Michael auch hier!«
»Auch hier«, erwiderte der Anwalt, »hier und überall, mein Guter; jeder Schritt, den du tust, wird gezählt; spezialisierte Detektive folgen dir wie dein Schatten, sie berichten mir jede Dreiviertelstunde, es werden keine Kosten gescheut.«
Das ist eine ironisch übertreibende Suada, welche die sensational fiction der Zeit nachahmt; der Schatten gehört bereits als Topos dazu. Der unauffällig dem zu Beobachtenden Hinterhergehende wird zu einem nicht abzuschüttelnden, schwer faßbaren Wesen, das an dem Verfolgten »hängt«. Das führt zu ironischen Reflexionen: »Er läßt sie beide beschatten, hat er gesagt – ich hoffe, nicht von den Polizisten aus Chilthorpe, die mir um einiges zu massiv aussehen, um als Schatten durchzugehen.« (Ronald Knox, The Three Taps. A Detective Story Without a Moral, 1927) Und doch kann nichts so konsequent die Formulierung »Er folgte ihm auf Schritt und Tritt« einlösen wie der Schatten.
Es ist, eben weil die Verbindung des Schattens mit unserem Körper so unauflöslich eng ist, eine wiederkehrende Frage, welche die Phantasie stellt: Und wenn sich die beiden doch trennen könnten? Es wird dies zu einem der wichtigsten Elemente der Schatten-Mythologie: die plötzliche paradoxe Unabhängigkeit des Schattens. Er kann eben doch vom Menschen »leise gelöst«, aufgehoben, zusammengerollt und gefaltet werden, wie dies in Chamissos Peter Schlemihl geschieht, oder man kann ihn durch ein Mißgeschick verlieren wie in Barries Peter Pan. Das sind die beiden berühmtesten Geschichten unserer Literatur vom Schattenverlust. (Hugo von Hofmannsthals Libretto zu Richard Strauss’ Oper Die Frau ohne Schatten, 1919, ist ein stark symbolisch überfrachtetes Märchen vom Schattenmangel, nicht vom Verlust.)
Adalbert von Chamissos Peter Schlemihls wundersame Geschichte erschien, von Fouqué herausgegeben, 1814. Sie wurde, obwohl Chamisso selbst an den großen Erfolg des Textes nicht anzuknüpfen vermochte, für die mit ihm befreundeten Romantiker um E. T. A. Hoffmann höchst fruchtbar – in ihrem meisterlich unauflösbaren Ineinander von Alltäglichkeit und Wunderbarem führt sie exemplarisch das »serapiontische Prinzip« vor, das in Hoffmanns Serapionsbrüdern entwickelt und diskutiert wird. Hoffmann selbst hat dann Schlemihl im siebten der 1814–15 erschienenen Fantasiestücke in Callots Manier (»Die Abenteuer der Silvesternacht«) ein Denkmal gesetzt. Dort wird die »Geschichte vom verlorenen Spiegelbilde« erzählt, ganz offen ein Parallelunternehmen zum Schlemihl, und wir lesen von einer Begegnung des Autors/Erzählers in der Silvesternacht, in einer Gastwirtschaft der Jägerstraße (nahe Unter den Linden), wo es zu einem grotesken Auftritt zwischen einem hochgewachsenen, anfangs in die Betrachtung von Pflanzenexemplaren vertieften Herrn und einem »kleinen dürren Mann« kommt.
Der Große war, wie vernichtet, totenbleich in den Stuhl zurückgesunken, er hatte den Kopf in beide Hände gestützt, und aus der tiefsten Brust atmete schwer ein Seufzer auf. »Was ist Ihnen?« fragte ich teilnehmend. »O mein Herr«, erwiderte der Große, »jener böse Mensch … hat mich zurückgeführt in mein tiefstes Elend. Ach – verloren, unwiederbringlich verloren habe ich meinen – Leben Sie wohl!« Er stand auf und schritt mitten durch die Stube zur Tür hinaus. Alles blieb hell um ihn – er warf keinen Schlagschatten. Voll Entzücken rannte ich nach – »Peter Schlemihl – Peter Schlemihl!« rief ich freudig, aber der hatte die Pantoffeln weggeworfen. [Die Schlemihl über seinen zauberischen Siebenmeilenstiefeln trägt; JK] Ich sah, wie er über den Gendarmesturm hinwegschritt und in der Nacht verschwand.
Die unmittelbar zuvor erschienene Erzählung Chamissos beginnt trügerisch realistisch im unsympathischen Neureichenmilieu einer norddeutschen Hafenstadt, die Hamburg zumindest ähnelt. Der eben zu Schiff angelangte, in dürftigen Umständen befindliche Erzähler hat ein Empfehlungsschreiben an einen protzigen Millionär, der ihn im Park seines Landhauses empfängt. In der schwatzenden Gesellschaft – »keine Seele kümmerte sich weiter um mich« – fällt dem Erzählenden ein »stiller, dünner, hagrer, länglicher, ältlicher Mann« in grauem Rock auf, der eilfertig und servil alles, was gerade von irgend jemandem benötigt wird (ein Pflaster, ein Fernrohr), aus der Tasche zieht.
Man hätte sich gern auf den Rasen am Abhange des Hügels der ausgespannten Landschaft gegenüber gelagert, hätte man die Feuchtigkeit der Erde nicht gescheut. Es wäre göttlich, meinte wer aus der Gesellschaft, wenn man türkische Teppiche hätte, sie hier auszubreiten. Der Wunsch war sobald nicht ausgesprochen, als schon der Mann im grauen Rock die Hand in der Tasche hatte und mit bescheidener, ja demütiger Gebärde einen reichen, golddurchwirkten, türkischen Teppich darauszuziehen bemüht war. Bediente nahmen ihn in Empfang, als müsse es so sein, und entfalteten ihn am begehrten Orte. Die Gesellschaft nahm ohne Umstände Platz darauf; ich wiederum sah betroffen den Mann, die Tasche, den Teppich an, der über zwanzig Schritte in der Länge und zehn in der Breite maß, und rieb mir die Augen, nicht wissend, was ich denken sollte, besonders, da niemand etwas Merkwürdiges darin fand.
Das Unheimlichste an der zu Recht berühmten Geschichte bleibt in der Tat diese »graue« Unauffälligkeit des – wie uns dann klar wird – Satans. Dieser kennt alle unsere Wünsche und vermag sie zu erfüllen, aus seiner unerschöpflichen Tasche bringt er sogar »drei gesattelte Pferde« hervor. Niemand findet etwas dabei. Und dann begibt es sich, daß der graue Mann den bestürzten Erzähler »mit leiser, unsicherer Stimme« anspricht, »ungefähr im Tone eines Bettelnden«.
»Möge der Herr meine Zudringlichkeit entschuldigen, wenn ich es wage, ihn so unbekannter Weise aufzusuchen, ich habe eine Bitte an ihn. Vergönnen Sie gnädigst –« – »Aber um Gottes Willen, mein Herr!«, brach ich in meiner Angst aus, »was kann ich für einen Mann tun, der –«, wir stutzten beide und wurden, wie mir deucht, rot.
Zum Interessantesten dieser Geschichte gehört diese gemeinsame »ertappte« Verlegenheit von Verführer und zu Verführendem, welche die beiden sich hier in einem kleinen pas de deux des Unbehagens winden läßt. Sie spiegelt sich in einem Doppelgängergedicht Chamissos (»Erscheinung«), wo einer nach Mitternacht nach Hause geht:
Und meinem Hause nah, dem wohlbekannten,
Gewahrt’ ich, und ich stand versteinert fast,
Daß hinter meinen Fenstern Lichter brannten.
[…] Ich rief: »Wer bist du, Spuk?« – Er rief zugleich:
»Wer stört mich auf in später Geisterstunde?«
Und sah mich an, und ward, wie ich auch, bleich.
Der graue Mann bietet nun Schlemihl einen Tausch an: Für seinen Schatten kann er aus den Zauberdingen wählen, die sich in der unergründlichen Tasche befinden, »die echte Springwurzel, die Alraunwurzel, […] das Tellertuch von Rolands Knappen, ein Galgenmännlein zu beliebigem Preis; doch das wird wohl nichts für Sie sein; besser Fortunati Wünschhütlein, neu und haltbar wieder restauriert; auch ein Glückssäckel, wie der seine gewesen.« (Den dramatischen Text Fortunati Glücksäckel (sic) und Wunschhütlein. Ein Spiel hatte Chamisso 1806 verfaßt.) Der Glückssäckel – »von starkem Korduanleder« – besteht die Probe und gibt bei jedem Griff, den Schlemihl tut, zehn Goldstücke preis.
»Topp! der Handel gilt; für den Beutel haben Sie meinen Schatten.« Er schlug ein, kniete dann ungesäumt vor mir nieder, und mit einer bewundernswürdigen Geschicklichkeit sah ich ihn meinen Schatten, vom Kopf bis zu meinen Füßen, leise von dem Grase lösen, aufheben, zusammenrollen und falten und zuletzt einstecken. Er stand auf, verbeugte sich noch einmal vor mir und zog sich dann nach dem Rosengebüsche zurück. Mich dünkt’, ich hörte ihn da leise für sich lachen. Ich aber hielt den Beutel bei den Schnüren fest; rund um mich war die Erde sonnenhell, und in mir war noch keine Besinnung.
Die Geschichte von Peter Pan ist mit ihrer Utopie des Niemals-Erwachsen-Werdens von einer fast pathologischen Sentimentalität, und doch gehört sie zu den genuinen mythopoetischen Leistungen ihrer Epoche. Die stolz infantile Hauptfigur taucht in einem bürgerlichen Kinderzimmer auf; sie wird in Kürze die Kinder dazu überreden, mit ihr nach »Neverland« zu gehen. Vor allem soll – dies gehört zu den schwer erträglichen, übergefühligen Zügen des Stücks – das Mädchen Wendy den lost boys von Neverland eine Mutter sein. Aber zunächst gibt es ein unmittelbares Körper-Problem: Peter Pans Schatten hat sich abgelöst.
WENDY Kein Wunder hast du geweint.
PETER Ich hab nicht geweint. Aber ich kriege meinen Schatten nicht dazu, daß er haftet.
WENDY Er ist ja abgegangen! Wie schrecklich. (Schaut auf die Stelle, wo der Schatten gelegen hat.) Peter, du hast ihn mit Seife ankleben wollen!
PETER (schnippisch) Na und?
WENDY Den muß man annähen.
PETER Was heißt annähen?
WENDY Du bist furchtbar ignorant.
PETER Nein, bin ich nicht.
WENDY Ich nähe ihn dir wieder an, mein kleiner Mann. Aber wir brauchen mehr Licht. (Sie berührt etwas, und zu seinem Erstaunen wird das Zimmer hell.) Setz dich hierhin. Es wird wohl etwas weh tun.
PETER (immer noch irritiert über ihre Bemerkung) Ich weine niemals.
J. M. BARRIE, Peter Pan, or, The Boy Who Would Not Grow Up, Erster Akt (1904)
Das Annähen funktioniert; der Schatten »erwacht und ist ebenso froh, wieder bei Peter zu sein, wie dieser froh ist, ihn zurückzuhaben.« Schatten und Peter Pan tanzen zusammen. Peter inszeniert sich nun lustvoll. »Er würde auch fliegen, um Wendy noch mehr zu beeindrucken, wenn ihm klar wäre, daß Fliegen etwas Ungewöhnliches ist.«
Wenn sich der Schatten in einer Art subversiver Auflehnung gegen den Menschen von diesem emanzipieren und damit beginnen kann, eigene Bewegungen auszuführen, mag umgekehrt der Mensch (wenn er sehr, sehr schnell ist) im Wettbewerb mit seinem Schatten obsiegen und dessen Bewegung mühelos hinter sich lassen: So zeigt in den Comics der mythische lawman des Wilden Westens, Lucky Luke, seinem Schatten den Meister. Die Alben dieses Helden stehen unter dem Motto: »Lucky Luke – l’homme qui tire plus vite que son ombre«. Er schießt – »zieht« – schneller als sein Schatten, und die ikonische Illustration zeigt es: Der Cowboy schießt bereits, während die Hände seines Schattens an der Wand noch über dem Gürtel schweben. So oder so haben wir hier eine Unabhängigkeitserklärung des Schattens beziehungsweise eine Deklaration der Unabhängigkeit vom eigenen Schatten, der nicht mehr schlicht identisch mit uns ist. In dieser Autonomie liegt eine sentimentale Chance, die der amerikanische Schlager gelegentlich ergriffen hat: Ich bin allein, aber mein Schatten ist da und leistet mir Gesellschaft. »Me and my shadow, strolling down the avenue«. In erweiterter Form: »We’re not a crowd, we’re not even company: my echo, my shadow and me«. Diese Liedchen, im Frank-Sinatra-Register gesungen, gehören zu der Erfahrung, daß man spät und allein eine leere Straße hinuntergeht, wo der Lampenschein und der Hall der Schritte einen Überschuß produzieren, so daß die Einsamkeit sich einen Augenblick lang bevölkert. »An meiner Hand / wandert mein letzter Begleiter: der Schatten.« (Oskar Kanehl, »Herbstnächtlicher Gang«, Die Aktion, 1914)
Als in der vorletzten Szene von Niebergalls »Lokalposse, in der Mundart der Darmstädter« Datterich (1841) der dem Stück seinen Namen gebende große Unruhestifter, Parasit und Opportunist hinausgeworfen worden ist, bemerkt ein Dabeistehender lakonisch: »Der is awwer enausgefloge, wie e Schatte.« In diesem Bild scheint sich die zähe Beharrlichkeit des Gemaßregelten, der dem jungen Handwerksgesellen Schmidt nicht von der Seite wich, solange noch eine Flasche Wein gratis zu erwarten stand, und an ihm klebte wie sein »beeser Geist«, zu verbinden mit der Flüchtigkeit und Geschwindigkeit des Schattenhaften.
Und es werden kommen hundert gen Mittag an Land
Und werden in den Schatten treten
BERTOLT BRECHT, Die Dreigroschenoper: Lied der Seeräuber-Jenny
Der Schatten ist zunächst für uns stets das Doppel eines Gegenstandes – insbesondere das eines Menschen. Doch der Schatten ist auch das diffuse Dunkel, die ersehnte Negation der Sonnengrelle, das, was der Fußgänger in heißen Sommern reflexhaft sucht, ohne nachzudenken, der massive Schatten der Gebäude oder der spielerisch bewegte der Baumkronen.
In heißen Ländern sucht der Kluge stets den Schatten auf; »nur tolle Hunde und Engländer gehen in der Sonne«. Die in dieser oder ähnlicher Form sicher schon lange Zeit zirkulierende Redewendung, die vielleicht ursprünglich das eingeborene Kopfschütteln angesichts des absurden Verhaltens der Kolonialherren spiegelte, wurde 1932 von Noël Coward als Couplet ausformuliert.
Mad dogs and Englishmen go out in the midday sun!
The Japanese don’t care to
The Chinese wouldn’t dare to
Hindus and Argentines sleep firmly from twelve to one
But Englishmen detest a
Siesta …
In the Philippines
They have lovely screens
To protect you from the glare,
In the Malay States
There are hats like plates
Which the Britishers won’t wear.
At twelve noon
The natives swoon
And no further work is done,
But mad dogs and Englishmen go out in the midday sun!
Vernünftig, ja »natürlich« ist es, den Schatten zu suchen und die Sonnenhitze zu meiden. Die unbegreifliche Neigung der Briten, sich der Mittagsglut auszusetzen, ist komisch (wie jedes Insistieren darauf, daß der Mensch den Naturprozessen nicht unterworfen ist).
Die Erfrischung durch den Schatten in der Hitze wird allgemein begehrt; es hat jedoch etwas Absurdes, darauf zu bestehen: Dies hier ist mein Schatten. Zu dieser Absurdität ließe sich zunächst eine Zeichnung aus dem vergessenen Comicstrip Toonerville Folks von Fontaine Fox heranziehen. Dieser Strip brachte (im Gegensatz zu der klassischen Form der täglichen Aneinanderreihung von vier Bildchen) jeden Tag eine einzige größere Zeichnung im Kontext der skurril-gemütlichen Kleinstadtwelt des imaginären Toonerville. Und 1938 sah man einmal ein Blatt, auf dem eine Familie in schwelgerischer Genießerpose im Schatten eines Baumes sitzt. Doch der Baum gehört diesen Leuten nicht, er steht auf dem Grundstück der Nachbarn, sie sind nur die Nutznießer des Sonnenstandes, und die Nachbarin in ihrem eigenen schattenlosen Garten, wo der Baum steht, aber keine Kühlung spendet, sieht sich so unerträglich provoziert durch das unverdiente Behagen der Leute nebenan (»Just look at ’em! Sittin’ out there in the shade of OUR tree!«), daß sie, zu allem entschlossen, eine Axt schwenkt. Die Beischrift lautet: »The Famous Wortle Family – Wilkins Family Feud«, etwa: »Der legendäre Krieg zwischen den Wortles und den Wilkins«. (Feud ist etymologisch verwandt mit »Fehde«; klassischerweise bezeichnet das Wort den Haß zwischen zwei Familien. Berühmt sind etwa der blutige historische feud zwischen den Hatfields und den McCoys 1878–91 in den Appalachen und der tödliche feud zwischen den Shepherdsons und den Grangerfords in Mark Twains Huckleberry Finn.) Hier nun entzündet sich die groteske Fehde zwischen zwei Kleine-Leute-Haushaltungen am unverdienten Genuß des fremden Schattens …
Das ist so etwas wie die Übersetzung einer sehr alten Geschichte ins Neidisch-Kleinbürgerliche: jener Geschichte, die Wieland im vierten Buch seiner Abderiten