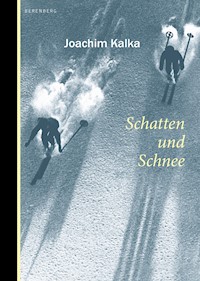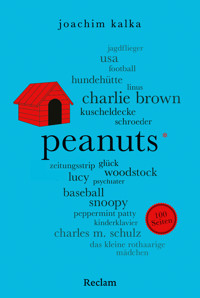
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Reclam 100 Seiten
- Sprache: Deutsch
Zum 75. Geburtstag der Peanuts – die Geschichte eines Phänomens »Dieser sehr liebevoll gezeichnete Strip ist im Grunde von hochneurotischer Schwärze: ein düsteres Märchen vom fortwährenden Scheitern. Trotzdem ist diese merkwürdige Legierung aus brutaler Gemeinheit, Zutraulichkeit und Komik ein Meisterwerk.« Charlie Brown, Lucy, Linus mit seiner Decke, Schroeder am Klavier und natürlich der Tagträumer Snoopy: Was fasziniert uns eigentlich so an diesen Kindern (und dem Hund) mit ihren Spielen und Ritualen, die doch im Grunde nichts Besonderes erleben? Kalka zieht die Schmusedecke weg von diesem daily strip, einem der bedeutendsten der Nachkriegs-USA. Er zeigt, welche Strömungen der amerikanischen Gesellschaft sich in den Peanuts spiegeln und inwieweit ihr Autor, Charles M. Schulz, sich in seinem Comic selbst verewigt hat. »Die Sorgen und Nöte der Peanuts sind kein billiger Ersatz, kein im kindgerechten Maßstab verkleinertes Modell der Menschenwelt, sondern das reale Welttheater kleiner und großer Leute selbst.« Denis Scheck Mit 4-farbigen Abbildungen und Infografiken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 121
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Joachim Kalka
Peanuts. 100 Seiten
Reclam
Für Tommaso
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist ausgeschlossen.
Durchgesehene und aktualisierte Ausgabe 2025
RECLAMS UNIVERSAL-BIBLIOTHEK Nr. 962374
2017, 2025 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Covergestaltung: zero-media.net
Umschlagabbildung: © Katakari/Shutterstock.com
Bildnachweis siehe Anhang
Infografik: Infographics Group GmbH
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2025
RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN978-3-15-962374-0
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-020780-2
reclam.de | [email protected]
Inhalt
Vorstadtstraßen, ein paar Kinder, ein Hund
Eine typische amerikanische Kindheit
Die überraschungsreichste Hundehütte der Welt
Weltmeister des Tagtraums
Egal, wie: Von der Stillung religiöser Bedürfnisse
Möglichkeiten des Schneemannbaus
Mehr braucht es nicht: Beethoven und ein kleines Spielzeugklavier
Erklär mir, Liebe!
Auch hier geschieht, was längst geschah
Vom Glück des Unabänderlichen
»So muss sich Leo gefühlt haben … Leo Tolstoi!«
Grausamkeit und Gutmütigkeit
Lektüretipps
Bildnachweis
Leseprobe aus Asterix. 100 Seiten
Vorstadtstraßen, ein paar Kinder, ein Hund
»Er erinnert mich an irgendjemand … Jetzt weiß ich es: Charlie Brown!«
Quentin Tarantino, Kill Bill, Volume 1 (2003)
Die wimmelnde Welt der Comics zerfällt in zwei eigentlich radikal verschiedene Formen: einerseits haben wir das Heft, das Comic Book (Batman, Donald Duck, The Fantastic Four), und andererseits den in der Tageszeitung (in drei oder vier Bildchen) abgedruckten daily strip. Diese Grundformen sind innerhalb gewisser Grenzen variabel – für Asterix war zum Beispiel lange Zeit der Abdruck in einem wöchentlich erscheinenden Magazin (Pilote) charakteristisch, wo jeweils wenige Seiten erschienen, die nach dem Abschluss der Geschichte dann insgesamt als Album herauskamen (und so ihre eigentliche Form erreichten). Die erfolgreichen daily strips lassen sich zwar auch zu Sammlungen kumulieren (und haben im Wochentagsrhythmus meist eine glücklich anomale Nebenform mit größeren graphischen und narrativen Möglichkeiten, die Sunday page), doch bleibt das Erzählen vom Minimalismus der kleinen Tagesportion geprägt – und der Notwendigkeit, nach drei Bildchen im vierten eine gewisse Pointe zu setzen.
Unter den daily strips der Nachkriegs-USA ist Peanuts von Charles M. Schulz der bedeutendste, neben Garry Trudeaus Doonesbury (ab 1970, seit einigen Jahren stockend und nur durch Wiederabdruck älterer Episoden in den Zeitungen präsent), Bill Wattersons Calvin and Hobbes (1985 bis 1995, seither Wiederabdrucke) und – dies von den hier genannten der jüngste und einzig noch fortlaufende Strip – Dilbert von Scott Adams (seit 1993). Vielleicht ist der Peanuts-Strip auch der einzige, der als komplexe und doch ewiggleiche Mythologie den Vergleich mit den Superheldensagas der Comic Books aushält, wenn wir vergleichend in diesem Zeitraum bleiben: die großen Schöpfungen Disneys wie Mickey Mouse und Donald Duck reichen in die Zwischenkriegszeit zurück, auch wenn Carl Barks erst nach dem Krieg den Entenhausen-Mythos auszuziselieren begann. Im Vergleich mit den anderen erwähnten Strips erkennt man sogleich eine Besonderheit: Die Schöpfung von Charles M. Schulz ist prima facie nicht politisch, nicht gesellschaftskritisch, nicht in dem Maß satirisch wie die anderen. Sie ist eine Geschichte – im Lauf der Jahrzehnte ein kleines Geschichtenuniversum – von ein paar Kindern (und einem Hund) in einer typischen amerikanischen Vor- oder Kleinstadt des Mittleren Westens; einfach gezeichnet – zu Beginn noch mit unbeholfener Einfachheit, dann sehr souverän schlicht. Nach und nach wird nach falschen Anläufen das eigentliche Thema des Strips sichtbar: Das permanente Scheitern, das sich insbesondere in der Hauptfigur Charlie Brown verkörpert, jedoch auch das Leben der meisten anderen bedeutenden Gestalten prägt. Die Charlie-Brown-Figur trägt gewisse Züge des Produzenten Schulz, der einmal geschrieben hat: »Als ich klein war, glaubte ich, mein Gesicht sei so unscheinbar normal, dass die Leute mich nie erkennen würden, sobald sie mir an einem unerwarteten Ort begegneten. Ich war aufrichtig überrascht, wenn ich in der Innenstadt von St. Paul mit meiner Mutter Einkäufe machte, und ein Mitschüler oder eine Lehrerin, die zufällig vorbeikamen, mich wiedererkannten. Ich hielt meine so gewöhnliche Erscheinung für eine perfekte Verkleidung. Diese seltsame Denkweise führte zu Charlie Browns rundem, gewöhnlichem Gesicht.« (Wie die weiteren hier zitierten Äußerungen Schulz’ zu seiner eigenen Schöpfung stammt diese Einlassung aus dem Band Peanuts Jubilee: My Life and Art with Charlie Brown and Others, New York 1975.)
Der noch junge Charles M. Schulz mit einem noch relativ frühen Charlie Brown. Man kann der Zeichnung den Stil der früheren Jahre ablesen und doch gleichzeitig erkennen, wie konstant die Figuren des Strips über Jahrzehnte hinweg geblieben sind.
Als zweite Hauptfigur tritt nach und nach der Hund Snoopy hervor, ursprünglich nach dem Familienhund aus der Kindheit von Schulz modelliert (»Ich habe das generelle Aussehen von Spike verwendet, mit ähnlicher Zeichnung des Fells«). Im Gegensatz zu dem ewig erfolglosen Charlie Brown ist Snoopy zumindest in seinen zahlreichen und endlosen Tagträumen (etwa als Kampfflieger im Ersten Weltkrieg) glücklich. (Dieses Glück wäre einer Kinderfigur hier so umstandslos nicht gestattet.) Die markanteren Kindergestalten, die Charlie Brown umgeben, haben alle irgendwelche obsessiven Züge, die sie der Charlie-Brown-Normalität entkleiden – der kluge Linus kann sich nicht von seiner Schmusedecke trennen und frönt einer absurden Privatreligion, in welcher der »Große Kürbis« an Halloween die Stelle des Weihnachtsmanns an Heiligabend besetzt; Schroeder lebt ganz im Bann seiner Beethoven-Manie; die kratzbürstige Lucy kommt mit ihrer hoffnungslosen Verliebtheit in Schroeder an die Grenzen ihres Egoismus; Sally, Charlie Browns Schwester, begreift weder die Details noch die Gesamtheit ihres Schulunterrichts (und ist mit ihrer Mischung aus Rücksichtslosigkeit und Verletzlichkeit vielleicht die am stärksten realistisch aufgefasste Gestalt des Strips). Peppermint Patty (eine Figur, die erst 1966 in einem etwas späteren Stadium der Saga auftaucht) leidet unter ihrer großen Nase und ihrer mangelnden Attraktivität; dieses ebenfalls quasi realistische (pubertäre) Element ist jedoch weniger charakteristisch als beispielsweise ihre langanhaltende Unfähigkeit, Snoopy als Hund zu identifizieren (»that funny-looking kid with the big nose«). Insgesamt könnte man etwas abstrakt konstatieren: die Glücksmöglichkeiten der Figuren liegen in der Obsession, in der Distanz zur Realität. Die farblose »realistische« Normalität Charlie Browns nimmt ihm die Möglichkeit des relativen Glücks. Ohne charakteristische Obsession kann man in den Peanuts eigentlich nichts werden. Als Franklin im Jahr 1968 den Strip betritt, begegnet er einer rätselhaften Inszenierung nach der anderen – Snoopy auf der Hundehütte, Lucy an ihrem Psychiatrie-Stand, Linus, der vom Great Pumpkin erzählt, Schroeder, der es von Beethovens Geburtstag hat. Als er sich erschrocken zurückzieht, scheint damit auch sein Schicksal besiegelt: Er wird fortan ein nettes, aber kaum weiter interessantes Mitglied der Statisterie des Strips sein.
Die innere Chronologie der Peanuts ist interessant; das später wie naturhaft selbstverständliche Personenensemble hat sich über einen Zeitraum von zwanzig Jahren versammelt. Der Strip beginnt 1950 mit vier Figuren: Charlie Brown, Patty, Shermy, Snoopy. Charlie Brown und Snoopy sollen zu den Eckpfeilern des Strips werden; der Junge Shermy und das blonde Mädchen Patty (nicht zu verwechseln mit der erwähnten, Jahrzehnte später auftauchenden Peppermint Patty) werden zusammen mit zwei anderen häufig agierenden Figuren der Frühzeit, der dunkelhaarigen Violet und dem ewig schmutzigen, doch netten Jungen »Pig-Pen« im Lauf der Zeit reine Statisten, die ab etwa 1960 nur noch in seltenen Gruppenszenen (meist Auftritten der Baseballmannschaft) sichtbar werden. 1951 lernen wir Schroeder kennen, 1952 erscheinen Lucy Van Pelt und ihr Bruder Linus, 1959 wird nach einer längeren Pause der Personalerweiterung Charlie Browns Schwester Sally geboren (was den Bruder zu dem großartigen, verwirrt-überglücklichen Schrei »I’m a father!« veranlasst), 1961 kommt Frieda mit den – von ihr ständig betonten – Naturlocken und einer rasch einsetzenden Antipathie Snoopy gegenüber, der sich partout nicht wie ein normaler Hund gebärden will. Nach einer zweiten Pause erscheint 1966 Peppermint Patty, die ein genuin neues, aktivistisches, die anderen Figuren verwirrendes Tempo vorgibt, und es folgt wie erwähnt (gewiss als Folge einer nicht unsympathischen, aber kaum ästhetisch produktiv zu nennenden political correctness) 1968 Franklin. 1970 hebt sich aus dem Schwarm der gelegentlich um Snoopy her auftauchenden (und beispielsweise in seiner Hütte kartenspielenden) Vögel ein Individuum heraus: Woodstock. 1971 begegnen wir der kleinen Freundin Peppermint Pattys, Marcie; sie war ursprünglich (damals hieß sie noch Clara) eines von drei kleinen Mädchen, die Peppermint Patty im Sommerlager als tent monitor beaufsichtigte, und sie hat die Marotte, dieses alten Autoritätsverhältnisses wegen zu Patty immer »Sir« zu sagen (»Don’t call me Sir!« ist die unvermeidliche Antwort). 1972 wird als letzte einigermaßen bedeutsame Figur Lucys und Linus’ Bruder Rerun geboren. Lucy klagt, sie habe eine kleine Schwester haben wollen, stattdessen ist es wieder ein Bruder – »a rerun!«, eine schiere Wiederholung (wie ein Film, der im Fernsehen schon gelaufen ist). Linus greift die Formulierung auf: So werden wir ihn nennen. – Die Geschwister Snoopys (Spike, Belle, Marbles und so weiter), welche kraft der Eigenlogik von Snoopys Tagtraumszenarien mit einer gewissen Zwanghaftigkeit eines nach dem anderen erscheinen, tragen wenig zur charakteristischen Erzähllandschaft des Strips bei; man könnte allenfalls für Spikes melancholische Wüsteneinsamkeit unter Kakteen, Tumbleweeds und Kojoten eine gewisse Ausnahme machen.
Gelegentlich, in wenigen Fällen (vergleicht man dies mit anderen Strips), tauchen in der longue durée des Strips neue Figuren auf, die sich als unbrauchbar herausstellen. Am Interessantesten ist der gescheiterte Versuch, Snoopy eine Katze an die Seite zu stellen (eine richtige Katze, nicht die mythisch-unsichtbare »Katze nebenan«, die World War II heißt). Die eifersüchtige Frieda, die Snoopy für hochnäsig hält, will ihn kurz nach ihrem Erscheinen 1961 im Strip durch diese Konkurrenz demütigen; doch die Katze – Faron, nach dem von Schulz bewunderten Country-Sänger Faron Young benannt, was der Autor erst lange Zeit später preisgab – bringt es auf nur etwa zehn Episoden. Ebenso sonderbar erscheint der Versuch, einen erstaunlich guten Baseballspieler in Charlie Browns Team einzuschleusen: José Paterson, einen mexikanisch-schwedischen Freund von Peppermint Patty, der es ebenfalls nur auf ein halbes Dutzend Tagesstrips bringt (um dann Jahre später ein- oder zweimal als Baseballstatist im Hintergrund erneut sichtbar zu werden). Eine Begabung wie die seine ist im Kontext des Strips, der das ständige Scheitern umkreist, ebenso unbrauchbar wie dies ein weiteres Tier wäre, das entweder wie Snoopy zu einer Art menschlichem Wesen mutieren müsste oder aber die Sonderrolle des »humanen« Snoopy ständig unbeholfen in Frage stellte.
Schulz bei einem Besuch im ersten den Peanuts gewidmeten Vergnügungspark, wenige Monate vor der Eröffnung 1983 (»Camp Snoopy« in Buena Park, Kalifornien).
Peanuts war ein vom Syndikat oktroyierter Name, den der Schöpfer des Comicstrips, Charles M. Schulz (1922–2000), immer hasste – begreiflich, da dieser alberne Titel die nicht unkomplexen Figuren auf kleine, quasi anonyme Komik-Kinderchen reduzierte, mit einer Bezeichnung, die so etwas wie gesunde Vulgarität suggeriert. Allerdings muss man jedoch sagen, dass Schulz’ eigener Titelvorschlag L’il Folks (»Kleine Leutchen«) kaum besser war und Peanuts an süßlicher Jovialität eigentlich noch weit übertraf. Der Strip begann 1950 zu erscheinen und endete mit dem Tod des Autors. Die heute noch in vielen Zeitungen abgedruckten Peanuts-Strips sind Wiederaufnahmen alter Folgen. Die an den Strip oberflächlich anknüpfenden abendfüllenden Zeichentrickfilme (seit 1969; Fernsehfilme seit 1965) verwenden das (oberflächlich betrachtet) ähnlich gezeichnete Personal und einige Standardsituationen des Comics, stehen aber der subtilen Ästhetik des Strips völlig fern und bleiben hier ebenso außerhalb der Betrachtung wie die von Schulz einigermaßen naiv in Schutz genommenen endlosen Merchandising-Produkte, all die T-Shirts, Kaffeebecher und Plastikfiguren; es lässt sich an alledem lediglich ablesen, dass es sich um einen der (außerhalb des Superheldengenres) sehr seltenen Comics handelt, welche eine Berühmtheit erreicht haben, die gar nicht mehr von der konkreten Lektüre abhängt. Die Peanuts-Gestalten gehören wie Tarzan oder Sherlock Holmes zu der relativ überschaubaren Gruppe von Figuren der popular culture, die von Millionen Menschen erkannt und in ihren legendären Zügen identifiziert werden, ohne dass diese je eine Zeile der entsprechenden Texte gelesen beziehungsweise einen einschlägigen daily strip gesehen hätten.
Wie bei vielen großen, später kanonischen Comics ist zu Beginn der Duktus des Zeichners noch banal und unbeholfen; es wird ein paar Jahre dauern, bis Schulz seine Meisterschaft entwickelt hat, einen traumwandlerisch sicheren minimalistischen Strich, der den wenigen, immer wiederkehrenden, einfach aufgefassten Figuren eine wunderbare Ausdruckskraft verleiht. Doch ist, anders als etwa bei Asterix, wo zu Beginn zwar ebenfalls die graphische Unbeholfenheit auffällt, die Erzählung aber schon ihre wesentlichen Merkmale entwickelt hat, bei den Peanuts zunächst auch die Narration noch ganz in einer (in der Rückschau fast peinlichen) Banalität gefangen, die Geschichte noch ganz auf das Register einer stereotypen Kleinkinder-Komik gestimmt. Die Geschichtchen weisen zurück auf die Witzzeichnungen über kleine Kinder, die Schulz zuvor als Small Fry publizierte. Schulz hat dargelegt, dass man seine frühen Strips nicht ex post an der Souveränität der späteren Jahre messen dürfe. Damals reihte er sich noch ganz in eine Tradition ein, die er einmal beschrieb als: »winzige Kinder, die zu großen Erwachsenen hochschauen und sehr subtile Bemerkungen machen« – »tiny children looking up at huge adults and saying very sophisticated things«. Zu den Kunstgriffen, mit denen er sich von dieser Stereotypie löste, gehört die nach einigen Stockungen radikal durchgeführte Abschaffung der Vertikalen, des Aufschauens nach oben: Es gibt keine sichtbaren Erwachsenen in seinem Strip, und auch das gelegentliche Anreden unsichtbarer Verwandter, die außerhalb des Bildrahmens bleiben, verliert nach und nach seine (stets geringe) Bedeutung. Die Figuren treten auf einer einzigen, quasi egalitären Kinder-Ebene auf; der Hund, der anfangs sozusagen unterhalb dieser Ebene agiert, wird bald durch seine anthropoide Verwandlung eine wichtige (fast gefährlich dominante) Figur auf demselben Level.
Die von Schulz überlieferten Zeichnungen vor den Peanuts haben etwas rührend Altbackenes. Ein kleiner Junge überreicht seiner Mutter eine Vase: »Alles Gute zum Geburtstag, Mom, und wenn es dir nicht gefällt, dann, hat der Mann gesagt, kann man sie gegen einen Hockeypuck eintauschen.« Trotzdem enthalten diese Versuche gelegentlich Züge, die zumindest optisch später beibehalten werden: Einer der frühen Cartoons für die Saturday Evening Post zeigt zwei kleine (sehr kleine) Jungen, die mit ihren Eishockeyschlägern oben auf der Eisfläche eines zugefrorenen runden Vogelbads stehen – Jahrzehnte später kehrt dieses Bild in den Peanuts wieder, mit Snoopy und Woodstock.
»Das grundlegende Thema der Peanuts war von Anfang an die Grausamkeit, die unter Kindern existiert.«
Die Figuren haben sich langsam entwickelt, in Richtungen, die dem Autor anfangs noch völlig verborgen waren. Ein zentrales Element jedoch prägt den Strip sofort und beschließt einen großen Teil seiner späteren Entwicklung in sich: die unbekümmerte kindliche Grausamkeit. »The initial theme of Peanuts was based on the cruelty that exists among children.«* (Schulz) Tatsächlich kommen vor allem in der Frühzeit die gegenseitigen rituellen Beleidigungen und Beschimpfungen kleiner Kinder ständig vor (der Urlaut »Nyaah! Nyaah!« spielt hier eine große Rolle; als Sally später ihrem Bruder Charlie Brown einmal dieses beleidigende Geräusch ins Gesicht schleudert, ist er verstört).