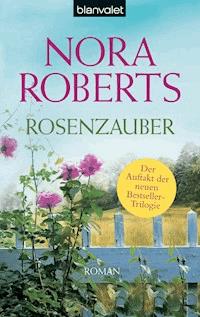9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Schatten-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Fallon trägt eine schwere Verantwortung: Sie wurde mit den Kräften geboren, die notwendig sind, um die Welt vom Bösen zu befreien. Doch dafür muss sie ihrer geliebten Familie den Rücken kehren und von der kleinen Farmerstochter zur mutigen Kriegerin werden. Gleichzeitig tritt immer wieder Duncan in ihr Leben, mit dem sie etwas Tieferes verbindet, als sie sich eingestehen will. Um den dunklen Mächten Einhalt zu gebieten, muss Fallon durch eine harte Schule gehen und ungeahnte Kräfte mobilisieren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 710
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Das Buch
Fallon Swift ist dreizehn Jahre alt, als sie mit dem Magier Mallick die sichere Farm ihrer geliebten Familie verlässt, um ihre Ausbildung zu beginnen. Sie ist die Auserwählte, die mit den in ihr vereinten Kräften aller magischen Wesen die Armee gegen das Böse anführen soll, das sich nach der zerstörerischen Pandemie auf der Erde breitmacht. Während ihres Trainings lernt sie, mit Schwert und Magie zu kämpfen, und entwickelt sich vom kleinen Landmädchen zu einer strategischen Kriegerin, die bereit ist, sich mutig dem Mörder ihres leiblichen Vaters zu stellen. Nur eins kann sie noch aus der Bahn werfen – Duncan, den sie aus ihren Visionen kennt und später in New Hope tatsächlich trifft. Zwischen ihnen besteht eine besondere Verbindung, die keiner von ihnen leugnen kann. Mit ihm und seiner Zwillingsschwester Tonia bereitet Fallon den Zusammenschluss von magischen und nichtmagischen Überlebenden auf den entbehrungsreichen Krieg gegen die dunklen Mächte vor, doch Hinterhalt, Verrat und Intrigen schleichen sich in die Gesellschaft ein und die ganz große Schlacht steht erst noch bevor.
Pressestimmen
»Eine der besten Autorinnen der Welt.« The Washington Post
Die Autorin
Nora Roberts wurde 1950 in Maryland geboren. Ihren ersten Roman veröffentlichte sie 1981. Inzwischen zählt sie zu den meistgelesenen Autorinnen der Welt. Ihre Bücher haben eine weltweite Gesamtauflage von 500 Millionen Exemplaren überschritten. Mehr als 195 Titel waren auf der New-York-Times-Bestsellerliste, und ihre Bücher erobern auch in Deutschland immer wieder die Bestsellerlisten. Nora Roberts hat zwei erwachsene Söhne und lebt mit ihrem Ehemann in Maryland.
Mehr Informationen über die Autorin und ihr Werk finden sie hier.
Besuchen Sie die Autorin auf www.noraroberts.com
Nora Roberts
Schattendämmerung
Roman
Die Originalausgabe Of BLOOD AND BONE (Chronicles of The One, Book 2)erschien 2018 bei St. Martin’s Press, New York Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Vollständige deutsche Erstausgabe 09/2019 Copyright © 2018 by Nora Roberts Published by Arrangement with Eleanor Wilder Copyright © 2019 der deutschsprachigen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck ISBN: 978-3-641-22483-7
Für Kayla, die einmal klug und stark sein wird
Inhalt
ERSTER TEIL
Die Entscheidung
ZWEITER TEIL
Werden
DRITTER TEIL
Visionen
VIERTER TEIL
Das Schwert und der Schild
FÜNFTER TEIL
Reisen
Erster Teil
DIE ENTSCHEIDUNG
So nah ist Größe unserm Staub, So nahe Gott dem Menschen, Dass, wenn du musst ihm sagt die Pflicht,Ich kann der Jüngling spricht.
– Ralph Waldo Emerson
Prolog
Es hieß, ein Virus habe das Ende der bisherigen Welt verursacht. Doch es war Zauberei, Magie so schwarz wie eine mondlose Mitternacht. Das Virus war ihre Waffe, ein schwirrender Pfeilhagel, lautlos treffende Kugeln, eine gezackte, geschliffene Klinge. Und dennoch waren es Unschuldige, die das Verderben verbreiteten und Milliarden von Menschen einen plötzlichen, schmerzhaften, hässlichen Tod brachten – durch eine kleine Berührung etwa, den Gutenachtkuss einer Mutter.
Viele, die diesen ersten Schock überlebten, starben durch eigene oder fremde Hand, als die dornigen Ranken von Irrsinn, Kummer und Angst die Welt erstickten. Andere, die weder Schutz noch Nahrung, Medikamente oder sauberes Wasser fanden, verdorrten einfach, starben, auf Hilfe und Hoffnung wartend, die niemals eintrafen.
Alle Technik brach zusammen, Stille und Dunkel kamen über die Welt. Regierungen stürzten, verloren Rückhalt und Macht.
Das Verderben kannte kein Pardon. Mit stets gleicher Gier raffte es Staatsoberhäupter ebenso dahin wie Bewohner der Städte und Farmer auf dem Land.
Aus der Finsternis flackerten seit Jahrtausenden erloschene Lichter auf und erwachten. Zauberer der weißen wie der schwarzen Magie erstanden aus dem Chaos. Entfesselte Kräfte boten die Wahl zwischen Gut und Böse, Dunkel und Licht.
Manche entschieden sich für die dunkle Seite.
Übernatürliche teilten sich, was von der Welt geblieben war, mit den Menschen. Und die, die sich auf die dunkle Seite schlugen – Magische wie Nichtmagische –, verwandelten große Städte in Trümmerwüsten, jagten jene, die sich vor ihnen versteckten, oder bekämpften sie, um sie zu vernichten, zu versklaven, in deren Blut zu schwelgen, während Leichen den Boden übersäten.
Panisch agierende Regierungen befahlen ihren Militärs, Überlebende aufzusammeln und Übernatürliche »unter Kontrolle« zu halten. Ein Kind, das eben seine Flügel entdeckt hatte, konnte sich so womöglich im Namen der Wissenschaft auf einem Labortisch fixiert wiederfinden.
Geistesgestörte verfielen einem religiösen Wahn, schürten Furcht und Hass, stellten eigene Armeen auf, um zu liquidieren, was »anders« war. Magie, so predigten sie, komme aus der Hand des Teufels, und jeder, der sie besitze, sei ein Dämon und müsse zurück in die Hölle geschickt werden.
Räuberische Raider durchstreiften die Städteruinen, machten Highways und Landstraßen unsicher, brandschatzten und töteten aus purer Lust. Immer wieder fanden Menschen Mittel und Wege, um anderen Grausames anzutun.
Wer sollte sie in einer derart aus den Fugen geratenen Welt aufhalten?
Und doch gab es immer wieder Gerüchte über das Kommen einer Kriegerin. Sie, die Tochter der Tuatha de Danann, würde verborgen bleiben, bis sie ihr Schwert und ihren Schild aufnahm. Bis sie, die Eine, das Licht gegen die Finsternis anführen würde.
Doch aus Monaten wurden Jahre, und die Welt blieb zerrüttet. Hetzjagden, Raubzüge, Plünderungen dauerten an.
Manche versteckten sich und schwirrten nachts umher, um sich mit dem Nötigsten zu versorgen oder genug zu stehlen, um über den nächsten Tag zu kommen. Andere begaben sich auf eine plan- und ziellose Wanderschaft. Wieder andere flüchteten in die Wälder, um zu jagen, oder auf das Land, um etwas anzubauen. Einige bildeten Gemeinschaften, die mit wechselhaftem Erfolg um ihr Überleben kämpften in einer Welt, in der eine Handvoll Salz kostbarer war als Gold. Und manche, etwa die, die New Hope fanden und formten, bauten wieder auf.
Als die Welt zusammenbrach, hatte Arlys Reid darüber berichtet – von dem Sprechertisch aus, den sie in New York von ihrem Vorgänger übernommen hatte. Sie hatte beobachtet, wie die Stadt um sie herum in Flammen aufging, und sich am Ende dafür entschieden, all jenen, die sie noch hören und die noch fliehen konnten, die Wahrheit bekannt zu geben.
Sie hatte den Tod direkt vor Augen gehabt, hatte selbst getötet, um zu überleben.
Sie hatte die Albträume und die Wunder gesehen.
Zusammen mit einer Handvoll Leuten, darunter drei Babys, hatte sie den verlassenen Ort gefunden, den sie New Hope nannten. Dort hatten sie sich eingerichtet.
Nun, im Jahr vier, hatte New Hope mehr als dreihundert Bewohner, eine Bürgermeisterin und einen Gemeinderat, eine Polizei, zwei Schulen – eine davon lehrte Zauberei und Magie –, einen Gemeinschaftsgarten mit Küche, zwei Farmen, eine davon mit einer Getreidemühle, ein Krankenhaus – samt kleiner Zahnarztpraxis –, eine Bücherei, eine Waffenkammer und eine Bürgerwehr.
Es gab Ärzte, Heiler, Kräuterkundige, Weber, Nähkreise, Installateure, Mechaniker, Zimmerleute, Köche. Einige von ihnen waren diesen Berufen schon in der alten Welt nachgegangen. Die meisten jedoch hatten sie erst in der neuen erlernt.
Ein bewaffneter Sicherheitsdienst bewachte New Hope rund um die Uhr. Und auch wenn Kampf- und Waffentraining auf freiwilliger Basis blieben, nahmen die meisten Bewohner daran teil.
Das New-Hope-Massaker im ersten Jahr blieb eine offene Wunde in den Herzen und Gedanken der Menschen hier. Diese Wunde und die Gräber der Toten führten zur Aufstellung der Bürgerwehr und der Rettungsmannschaften, die ihr Leben riskierten, um andere zu retten.
Arlys stand auf dem Gehsteig, schaute auf New Hope und wusste genau, weshalb das alles wichtig war. Wichtiger als bloß zu überleben, so wie in jenen ersten schrecklichen Monaten, und sogar wichtiger als der Wiederaufbau in den darauf folgenden Monaten.
Es ging um die Hoffnung auf ein lebenswertes Leben, die der ganze Ort verkörperte.
Es war wichtig, dachte sie erneut, als Laurel, eine Elfe, an diesem kühlen Frühlingsmorgen herauskam und die Veranda des Hauses fegte, in dem sie wohnte. Weiter die Straße hinauf putzte Bill Anderson das Schaufenster seines Ladens, in dessen Regalen er alle möglichen nützlichen Dinge zum Tauschhandel bereithielt.
Fred, die junge Medizinpraktikantin, die zusammen mit Arlys den Horror der U-Bahnschächte auf dem Weg aus New York heraus durchlebt hatte, arbeitete gerne im Gemeinschaftsgarten. Fred, mit ihren Zauberschwingen und ihrem nie endenden Optimismus, lebte jeden Tag voller Hoffnung.
Rachel – Ärztin und eine sehr gute Freundin – erschien auf dem Gehsteig, öffnete die Tür der Klinik und winkte.
»Wo ist das Baby?«, rief Arlys.
»Er schläft – wenn ihn Jonah sich nicht wieder geschnappt hat, sobald ich mich umgedreht habe. Er ist einfach hin und weg.«
»Wie es ein Papa sein sollte. Ist heute nicht dein Check-up nach sechs Wochen, Frau Doktor?«
»Die besagte Doktorin hat ihrer Patientin bereits Entwarnung gegeben, und den Schreibkram erledigt Ray. Wie geht’s dir?«
»Großartig. Ich bin aufgeregt. Ein bisschen nervös.«
»Ich werde einschalten – und sobald du fertig bist, möchte ich dich hier in der Klinik sehen.«
»Ich werde kommen.« Bei ihrer Antwort legte Arlys eine Hand auf ihren Babybauch. »Dieses Baby hier ist bestimmt schon überfällig. Wenn es noch lange dauert, werde ich bald nicht mal mehr watscheln können.«
»Wir sehen es uns an. Guten Morgen, Clarice«, sagte Rachel, als die erste Patientin des Tages den Gehsteig entlangkam. »Komm gleich rein. Viel Glück, Arlys. Wir hören dir zu.«
Arlys lief langsam weiter – und blieb stehen, als sie jemanden ihren Namen rufen hörte.
Sie wartete auf Will Anderson – ihr Nachbar aus Kindheitstagen, derzeitiger stellvertretender Bürgermeister von New Hope und, wie sich herausgestellt hatte, die Liebe ihres Lebens.
Er legte eine Hand auf ihren Bauch und küsste sie. »Soll ich dich zur Arbeit begleiten?«
»Klar doch.«
Hand in Hand gingen sie zu dem Haus, in dem er während seiner ersten Monate in der Gemeinschaft gewohnt hatte. »Ist es okay für dich, wenn ich dabei bin und zuschaue?«
»Wenn du willst, aber ich weiß nicht, wie lange der Aufbau dauern wird. Chuck ist optimistisch, aber …«
»Wenn Chuck sagt, wir können das, dann klappt es.«
Ihr Magen krampfte sich zusammen; sie atmete laut aus. »Es ist gut, wenn du mitkommst.«
Chuck war während des Verderbens ihre wichtigste Informationsquelle gewesen, ein Hacker und IT-Genie, der nun für die gesamte Technik von New Hope zuständig war. Im Keller, natürlich. Der Typ war eine überzeugte Kellerassel.
»Ich will dich bei der Arbeit sehen«, fügte Will hinzu.
»Und wie nennst du das, was ich zu Hause für das New Hope Bulletin mache?«
»Auch Arbeit, und einen Segen für die Gemeinschaft. Aber jetzt reden wir von einer Liveübertragung, Baby. Und das ist dein eigentlicher Job.«
»Ich weiß, einige machen sich Sorgen wegen des Risikos, dass wir zu viel Aufmerksamkeit auf uns lenken könnten – eine falsche Art von Aufmerksamkeit.«
»Das ist es wert. Glaub mir, Chuck weiß, was er tut, und wir werden zudem die magischen Schilde in Betrieb haben. Wenn du einen Menschen da draußen erreichen kannst, kannst du auch hundert erreichen. Viele wissen noch immer nicht, was eigentlich los ist, wo sie Hilfe, Sachen, Medikamente kriegen können. Das ist wichtig, Arlys.«
Wichtig, sehr wichtig, war für sie, wenn er nach einer Rettungsaktion, bei der er sein Leben aufs Spiel gesetzt hatte, wieder heil nach Hause kam.
»Ich habe gerade darüber nachgedacht, was wichtig ist.« Sie blieb vor dem Haus stehen und wandte sich ihm zu. »Zuallererst bist du das.«
Sie gingen um das Haus herum zur Kellertür.
Drinnen war ein vormaliges großes Familienzimmer zum Traum eines Computer-Freaks umgemodelt worden – sofern dieser davon träumte, einzelne Baugruppen, Kabel, Festplatten und Motherboards zusammenzuschustern, alte Computer auszuschlachten, Desktops und Laptops neu zu konfigurieren oder verschiedenste Bildschirme aufzustellen.
Chucks Traum war das wohl, dachte sie.
Er saß an einer der Tastaturen, mit Kapuzenpulli und Cargohose und einer verkehrt herum aufgesetzten Baseballmütze auf schlohweiß gefärbten Haaren. Sein kleiner Spitzbart war im Gegensatz dazu leuchtend rot.
Auf dem Boden tummelte sich Fred mit drei Vierjährigen zwischen einer Menge Spielzeug; beim Aufstehen schüttelte sie ihren Lockenkopf.
»Hier ist das Allroundgenie! Ich bin Produktionsleiterin, Mädchen für alles und Kameraassistentin.«
»Ich dachte, das Mädchen für alles bin ich.« Von der Lehne des durchgesessenen Sofas, auf dem Chuck, wie Arlys wusste, häufig schlief, warf Katie ein Auge auf ihre drei Kinder.
»Zweites Mädchen für alles und Aufpasserin auf diese Energiebündel hier.«
Katie blickte auf ihre Zwillinge Duncan und Antonia. »Sie sind aufgeregt. Ich hoffe nur, sie – und alle anderen auch – wissen, was wir tun.«
»Wir bringen es für Arlys und Chuck zum Laufen«, sagte Duncan und grinste seine Mom an. »Ich und Tonia.«
»Los!«, kicherte Tonia und erhob eine Hand. Duncan presste seine Handfläche an ihre. Licht erglühte.
»Noch nicht.«
Hannah, blond und rosig im Vergleich zum dunklen Haar der Zwillinge, stand auf. Sie tätschelte das Bein ihrer Mutter, wie um sie zu trösten, und ging dann weiter zu Arlys. »Wann kommt das Baby raus?«
»Bald. Hoffe ich.«
»Kann ich zuschauen?«
»Äh …«
Katie lachte, stand auf und nahm Hannah auf den Arm. »Das würde sie tatsächlich tun.«
»Na, ich weiß ja nicht, Kleine.« Chuck drehte sich in seinem Stuhl herum. »Aber du bist bei der ersten Sendung des Rundfunks von New Hope mit dabei.«
»Sind wir auf Sendung?«
Er grinste Arlys zu und grüßte sie mit hochgerecktem Finger. »Gleich. Wir brauchen nur noch ein bisschen Hilfe von unseren Energiebündeln.«
Die Zwillinge sprangen auf, ihre Augen leuchteten.
»Noch nicht, noch nicht.« Dieses Mal hielt Arlys sie zurück. »Ich muss mir erst noch meine Aufzeichnungen ansehen, und … ein paar Sachen. Nur ein paar Minuten.«
»Wir rennen dir nicht weg«, erwiderte Chuck.
»Okay, ämmhh, bin gleich so weit.«
In einem Moment aus der Fassung geraten, in dem sie das gar nicht erwartet hatte, ging sie mit ihrem Ordner noch einmal hinaus. Fred folgte ihr.
»Du brauchst nicht nervös zu werden.«
»Oh, Gott, Fred.«
»Im Ernst. Du kannst das doch so gut. Du hast das immer hervorragend gemacht.«
»Ich habe den Sprechertisch in New York bekommen, weil alle anderen tot waren.«
»Deshalb hast du ihn zu diesem Zeitpunkt übernommen«, korrigierte Fred sie. »Aber irgendwann hättest du ihn so oder so bekommen.«
Fred trat zu ihr und legte ihr eine Hand auf die Schulter. »Weißt du noch, was du an diesem letzten Tag getan hast?«
»Ich habe heute noch Albträume davon.«
»Was du getan hast«, fuhr Fred fort, »als Bob diese Pistole auf dich richtete, live im Fernsehen. Du hast durchgehalten. Und was du getan hast, als er sich umbrachte, während der Sendung, als er direkt neben dir saß? Du hast durchgehalten, und mehr noch. Du hast direkt in die Kamera gesehen und die Wahrheit gesagt. Das alles hast du ohne Aufzeichnungen gemacht, ohne Teleprompter. Weil das dein Job ist. Den Leuten die Wahrheit zu sagen. Und genau das machst du auch jetzt.«
»Ich weiß auch nicht, warum ich gerade so nervös bin.«
»Die Hormone vielleicht?«
Arlys rieb sich lachend den Bauch. »Vielleicht. Hämorrhoiden, Sodbrennen und Hormone. Ein Baby zu kriegen ist ein Abenteuer.«
»Ich kann sie kaum erwarten, diese Abenteuer.« Mit einem Seufzer blickte Fred über den Garten. »Ich will unzählige Babys.«
Arlys hoffte, diese eine Geburt glimpflich zu überstehen – und zwar hoffentlich bald.
Aber jetzt hatte sie einen Job zu machen.
»Okay. Okay. Wie sehe ich aus?«
»Bewundernswert. Und als deine Maskenbildnerin werde ich dich für die Kamera noch pudern und dir Lippenstift auftragen. Dann wirst du großartig aussehen.«
»Ich liebe dich, Fred. Wirklich.«
»Ah, ich dich auch. Ganz wirklich.«
Sie ließ Fred pudern und malen, probte ein paar Zungenbrecher, nahm einen Schluck Wasser, machte ein paar Yoga-Atemübungen.
Als sie wieder ins Zimmer ging, sah sie dort ihren Schwiegervater auf dem Sofa sitzen, umringt von den Kindern.
»Bill, wer passt denn auf den Laden auf?«
»Den hab ich für ’ne Stunde geschlossen. Ich will mein Mädchen live und direkt erleben. Deine Leute wären stolz auf dich. Deine Mom, dein Dad, Theo, sie würden sehr stolz sein.«
»Betrachte das hier als deinen Sprechertisch.« Chuck klopfte auf einen Stuhl vor einem seiner vielen Tische. »Du blickst in diese Kamera. Sie ist bereits justiert. Das, was wir hier machen, liebe Leute, ist eine sch… eine verdammte Simultanübertragung. Wir haben Amateurfunk, Echtzeit- und Bildübertragung gleichzeitig am Laufen. Ich beobachte dich am Monitor, und zwar von dort drüben. Aber kümmere dich nicht um den Mann hinter den Kulissen. Es ist deine Show, Arlys.«
»Okay.« Sie setzte sich, rückte den Stuhl zurecht. Öffnete ihren Ordner, nahm das Foto des letzten Weihnachtsfests mit ihrer Familie heraus und lehnte es an eine Tastatur. »Ich bin so weit.«
»Fred gibt dir den Countdown. Okay, Kids, lassen wir es krachen.«
»Sag nicht krachen!« Katie riss die Hände hoch. »Du hast keine Ahnung.«
»Wir machen das schon.« Tonia wackelte vor Entzücken mit dem Po. »Wir machen es. Los, Duncan!«
»Los.« Er grinste seiner Schwester zu, und sie legten die Hände aneinander. Licht schimmerte durch ihre Finger.
»Genau das meine ich!« Chuck flitzte von Monitor zu Monitor, juchzte vor Freude. »Das ist es, was ich sage. Wir sind voll drauf, und das meine ich wortwörtlich.«
»Arlys.« Fred stellte sich hinter die Kamera. »In fünf, vier …«
Sie beendete den Countdown mit den Fingern und hielt bei der Null mit einem Lächeln die Hand nach vorn.
»Guten Morgen, dies ist Arlys Reid. Ich weiß nicht, wie viele mich hören oder sehen können, aber wenn Sie diese Nachrichten empfangen, geben Sie sie weiter. Wir werden so oft wie möglich auf Sendung gehen, Ihnen Informationen geben, die Wahrheit sagen, berichten. Und Sie, wo immer Sie sind, wissen lassen, dass Sie nicht allein sind.«
Sie atmete durch und legte eine Hand fest auf ihren Bauch.
»Vier Jahre nach dem Verderben bestätigen Quellen, dass Washington, D. C. noch immer instabil ist. Das Kriegsrecht bleibt in der Metropolregion in Kraft, und Gangs der sogenannten Raider oder der dunklen Übernatürlichen verüben weiterhin Angriffe und Überfälle. In Arlington, Virginia, durchbrachen Widerstandskräfte die Sicherheitsvorkehrungen eines Sammellagers. Augenzeugenberichten zufolge wurden mehr als dreißig Insassen befreit.«
Sie sprach zweiundvierzig Minuten lang. Berichtete von den Bombardements in Houston, Texas, vom Angriff der Purity Warriors auf eine Gemeinschaft in Greenbelt, Maryland, von Brandstiftungen und geplünderten Häusern.
Doch sie endete mit Geschichten über Menschlichkeit, Mut und Freundlichkeit. Von der mobilen Klinik, die mit Pferd und Wagen entlegene Lager sowie Schutzunterkünfte für Obdachlose aufsuchte, von Rettungen und karitativen Essensausgaben.
»Bleibt vorsichtig!«, sagte sie, »aber denkt daran, vorsichtig zu sein ist nicht genug. Lebt, arbeitet, tut euch zusammen. Wenn ihr eine Geschichte habt, eine Nachricht, wenn ihr einen geliebten Menschen sucht und euch an mich wenden könnt, werde ich davon berichten. Ihr seid nicht allein. Dies ist Arlys Reid von Radio New Hope.«
»Und fertig.« Chuck stand auf und schüttelte die Fäuste. »Geile Supersache!«
»Geile Supersache!«, wiederholte Duncan.
»Ups.« Chuck brüllte vor Lachen, weil Katie für einen Moment die Augen schloss, dann hüpfte er hinüber zu Duncan und Tonia und hielt die Faust hoch. »Hey, absolut supergeil, Kids. Faustcheck. Na los! Faustcheck.«
Sie neigten die Köpfe aneinander, reckten beide ihre kleinen Fäuste hoch und schlugen sie an seine.
Die sprühte Funken. »Wow!« Er tanzte ein wenig umher, während er auf seine Knöchel blies. »Massive Überspannung. Das liebe ich.«
Fred blinzelte die Tränen zurück. »Es war einfach fantastisch, megageil!«
Will küsste Arlys auf den Kopf. »Du haust mich um«, sagte er.
»Es hat … sich gut angefühlt. Sobald ich drin war, war es richtig gut. Wie lang war ich auf Sendung?«
»Zweiundvierzig fantastische Minuten lang!«
»Zweiundvierzig.« Sie drehte sich mit ihrem Stuhl. »Ich hätte die Zwillinge nicht so lange mitmachen lassen sollen. Das tut mir wirklich leid, Katie. Ich habe einfach nicht mehr dran gedacht.«
»Denen geht es bestens. Ich habe auf sie aufgepasst«, versicherte ihr Katie. »Die können jetzt ein schönes langes Nickerchen vertragen.« Sie blickte zu Hannah, die zusammengerollt auf Bills Schoß schlief. »Wie ihre Schwester. Du siehst auch aus, als würde dir ein bisschen Schlaf guttun. Das muss dich viel Energie gekostet haben. Du bist ein wenig blass.«
»Genau genommen glaube ich, dass ich vor fünf Minuten oder so Wehen gespürt habe. Vielleicht sogar noch früher. Aber ich dachte, das sind nur meine Nerven.«
»Du – was? Jetzt?«
Arlys ergriff Wills Hand. »Ich bin ziemlich sicher, wir sollten Rachel aufsuchen. Und ich glaube, es ist … Okay!«
Sie hielt sich mit einer Hand am Tisch fest und drückte mit der anderen Wills Hand.
»Atmen«, ordnete Katie eilends an, legte eine Hand auf Arlys’ steinharten Bauch und begann, in Kreisen darüberzureiben. »Atme hindurch – wie du’s im Unterricht gelernt hast.«
»Unterricht, dass ich nicht lache. Da hat es nicht so weh getan.«
»Atme hindurch«, wiederholte Katie gefasst. »Du hast gerade die erste Simultanübertragung von Radio New Hope mit Wehen überstanden. Dann kannst du auch durch eine Kontraktion hindurchatmen.«
»Es lässt nach. Es wird schwächer.«
»Danke, lieber Gott«, murmelte Will und krümmte seine schmerzenden Finger. »Aua.«
»Glaub mir, von Aua ist das himmelweit entfernt.« Arlys atmete heftig aus. »Ich brauche jetzt wirklich Rachel.«
»Ich auch.« Will stemmte sie hoch. »Aber immer mit der Ruhe. Dad?«
»Ich bekomme ein Enkelkind.«
Katie nahm Hannah von seinem Schoß. »Geh mit ihnen.«
»Ich bekomme ein Enkelkind«, wiederholte Bill.
»Fred?« Arlys schaute nach hinten. »Kommst du nicht mit?«
»Echt? Darf ich? Oh, oh Mann! Ich laufe voraus und sage Rachel Bescheid. Oh Mann! Chuck.«
»Oh nein, danke, ich bleibe hier. Nichts für ungut, Arlys, aber – nö.«
»Schon gut.«
»Wir bekommen ein Baby!« Fred breitete die Flügel aus und flog zur Kellertür hinaus.
Duncan trat an die Tür und schaute ihnen allen nach. »Er will raus.«
Katie verlagerte Hannah auf ihrem Schoß. »Er?«
»Mhm.« Tonia gesellte sich zu Duncan. »Was tut er da drin?«
»Das ist eine andere Geschichte«, erklärte ihr Katie. »Kommt, Kinder, Zeit nach Hause zu gehen. Gute Arbeit, Chuck.«
»Der beste Job überhaupt.«
In den nächsten acht Stunden lernte Arlys eine Reihe von Dingen. Das erste und vordringlichste war, dass Kontraktionen im Verlauf der Wehen erheblich kräftiger wurden und verdammt viel länger andauerten.
Auch lernte sie, und das war keine Überraschung, dass Fred ein fröhliches und unermüdliches »Mädchen für alles« war. Und Will – ebenfalls keine Überraschung – ein Fels in der Brandung.
Man berichtete ihr – als nette Ablenkung –, dass ihre Sendung mindestens noch zwanzig Meilen weit entfernt empfangen worden war, und zwar von Kim und Poe, die mit einem Laptop mit Akku unterwegs gewesen waren.
Und sie lernte ganz gewiss, warum Wehen Wehen hießen.
An einem Punkt brach sie so heftig in Tränen aus, dass Will die Arme um sie schlang. »Es ist fast überstanden, Baby. Gleich hast du’s überstanden.«
»Darum geht es nicht. Lana. Ich habe an Lana gedacht. Oh Gott, Will, oh Gott, das allein durchstehen zu müssen! Ohne Max, ohne Rachel, ohne uns. Dabei ganz allein zu sein …«
»Ich glaube nicht, dass sie ganz allein war.« Fred strich über Arlys’ Arm. »Das glaube ich wirklich, wirklich nicht. In dieser Nacht – ich konnte es fühlen. Viele von uns. Die Geburt der Einen. Sie war nicht allein, Arlys. Ich weiß es.«
»Versprochen?«
»Ehrenwort.«
»Okay. Okay.« Will wischte ihre Tränen weg, und sie brachte ein Lächeln zustande. »Fast überstanden?«
»Er hat nicht ganz unrecht. Zeit zu pressen«, sagte Rachel zu ihr. »Will, stütze ihr den Rücken. Bei der nächsten Kontraktion pressen. Bringen wir dieses Baby auf die Welt.«
Sie presste, hechelte, presste, hechelte, und acht Stunden, nachdem sie Radiogeschichte geschrieben hatte, brachte Arlys ihren Sohn auf die Welt.
Und sie lernte noch etwas. Die Liebe konnte einschlagen wie ein Blitzstrahl.
»Sieh ihn dir an! Sieh ihn dir an.« Erschöpfung wich einem benommenen Liebesgefühl, als sich das Baby in ihren Armen wand und weinte. »Oh, Will, sieh ihn an.«
»Er ist wunderschön, du bist wunderschön. Gott, ich liebe dich.«
Rachel trat zurück und rollte die schmerzenden Schultern. »Will, möchtest du die Nabelschnur durchtrennen?«
»Ich …« Er nahm die Schere, die Rachel ihm reichte. Als er sich zu seinem Vater umdrehte, sah er Tränen auf dessen Wangen.
Er hatte durch das Verderben Enkelkinder verloren. Ebenso seine Tochter und seine Ehefrau.
»Ich glaube, der Großvater sollte das tun. Wie wär’s?«
Bill wischte sich unter der Brille die Augen. »Das ehrt mich. Ich bin Großvater geworden.«
Er durchschnitt die Nabelschnur, und Fred ließ dabei Regenbogen durch den Raum schwingen. »Ich bin eine Tante, ja? Eine Ehrentante.«
»Ja, das seid ihr.« Arlys konnte den Blick nicht von dem Baby abwenden. »Du, Rachel und Katie. Die Ursprünge von New Hope.«
»Er hat eine gesunde Farbe.« Rachel betrachtete den Kleinen genau. »Ich werde meinen Neffen gleich an mich nehmen müssen. Ihn für dich sauber machen, wiegen und messen.«
»Gleich. Hallo, Theo.« Arlys drückte einen Kuss auf die Stirn des Babys. »Theo William Anderson. Wir werden die Welt für dich zu einem besseren Ort machen. Wir werden alles tun, was wir können, um sie besser zu machen. Das verspreche ich dir.«
Sie strich mit einem Finger um Theos Gesichtchen – so winzig, so süß, so ihres.
Das ist Leben, dachte sie. Das ist Hoffnung.
Das ist der Grund für beides.
Sie würde jeden Tag arbeiten und kämpfen, um das Versprechen zu halten, das sie ihrem Sohn gegeben hatte.
Sie drückte ihn an sich und dachte erneut an Lana, an das Kind, das Lana unter dem Herzen getragen hatte.
An die Eine, die verheißen war.
Kapitel 1
Auf der Farm, wo sie geboren wurde, lernte Fallon Swift, wie man Pflanzen anbaute, pflegte und erntete, wie man dem Land Achtung entgegenbrachte und es nutzte. Sie lernte, sich durch Felder und Wälder zu bewegen, still wie ein Schatten, zu jagen und zu fischen. Achtsam mit dem Wild umzugehen, nicht mehr zu erlegen, als benötigt wurde, und es nicht aus bloßem Spaß oder Ehrgeiz zu töten.
Sie lernte, die vom Land erhaltene Nahrung in der Küche ihrer Mutter oder auf einem Lagerfeuer zuzubereiten.
Ihr wurde klar, dass Nahrung mehr war als Eier, die man frisch aus dem Hühnerstall holte, oder eine gut gegrillte Forelle. Nahrung bedeutete Überleben.
Und sie lernte zu nähen – auch wenn es ihr nicht gefiel, die Zeit still sitzend mit Nadel und Faden zu verbringen. Des Weiteren lernte sie, Leder zu gerben, alles andere als ihr Lieblingszeitvertreib, und sie konnte, wenn sie keine Wahl hatte, auch Garn spinnen. Kleidung, so lernte sie, war nicht einfach etwas, das man an sich trug. Sie schützte den Körper, gleich einer Waffe.
Sie respektierte Waffen und hatte schon früh gelernt, ein Gewehr zu reinigen, ein Messer zu schärfen, einen Bogen zu bespannen.
Sie erlernte den Umgang mit Hammer und Säge, um die Zäune instand setzen und Reparaturen an dem alten Farmhaus durchführen zu können, das sie so sehr liebte wie die Wälder.
Ein starker Zaun, eine solide Wand, ein Dach, das den Regen abhielt, boten mehr als ein glückliches Zuhause. Auch sie bedeuteten Überleben.
Und, auch wenn sie die Gabe bereits in sich trug, erlernte sie Zauber und Magie. Eine Flamme mit dem Atem zu entzünden, einen magischen Kreis zu ziehen, eine kleine Wunde mit ihrem inneren Licht zu heilen, zu beobachten und zu sehen.
Dabei war ihr immer bewusst, dass Zauber mehr war als nur eine Gabe, die es zu schätzen, ein Können, das es zu üben galt; er war eine Waffe, die mit größter Sorgfalt zu handhaben war.
All dies bedeute zu überleben und würde ihr bei ihrem eigenen Überleben helfen.
Denn trotz Nahrung, Wohnung, Kleidung und Waffen, trotz Zauber und Magie hatten nicht alle überlebt. Und auch in der bevorstehenden Zeit würden nicht alle überleben.
Sie erfuhr von der Welt, die vor ihrer Geburt existiert hatte. Einer Welt voller Menschenmassen, einer Welt riesiger Städte mit in den Himmel ragenden Gebäuden, in denen gelebt und gearbeitet worden war. In dieser Welt waren die Menschen wie selbstverständlich durch Luft und Meer, über Straßen und Gleise gereist. Einige waren sogar ins Weltall geflogen und auf dem Mond gelandet.
Ihre Mutter hatte in einer großen Stadt gelebt, in der Stadt New York. Aus den Geschichten, die man ihr erzählte, den Büchern, die sie verschlang, wusste Fallon, dass es ein Ort voller Menschen gewesen war, voller Lärm und Licht und Dunkel.
Eine Art Wunderort für sie, ein Ort, den sie eines Tages sehen wollte.
Sie stellte ihn sich nachts oft vor, wenn sie wach lag und die Feen beobachtete, die draußen vor ihrem Fenster tanzten.
Es hatte Krieg gegeben in dieser Welt, und Bigotterie und Grausamkeit, genau wie heute. Sie wusste von diesen früheren Kriegen aus den Büchern, den Erzählungen. Und sie wusste von den noch immer wütenden Kriegen von Besuchern, die auf der Farm einkehrten.
Ihr Vater war einmal ein Soldat gewesen. Er hatte sie gelehrt zu kämpfen – mit ihren Händen, ihren Füßen, ihrem Verstand. Sie lernte, Landkarten zu lesen und anzufertigen, und sie stellte sich vor, eines Tages mithilfe solcher Karten Reisen zu unternehmen – dass sie einmal reisen würde, wusste sie von Anfang an.
Anders als ihre Eltern hatte sie keine Verbindungen zu der Welt vor dem Verderben, das so viele getötet hatte. Milliarden, wie es hieß. Viele erinnerten sich immer noch mit Schrecken daran, als diese großen Städte dem Untergang durch Feuer anheimfielen, an den Irrsinn, die schwarze Magie; an die Grausamkeit und die Gier der Menschen.
Wenn sie Ausblicke auf Zukünftiges erhaschte, wurde ihr klar, dass es zu noch mehr Feuer, Blut und Tod kommen würde. Und sie würde Teil davon sein. Deshalb lag sie oft nachts wach, mit ihrem Teddybär im Arm – das Geschenk eines Mannes, den sie erst noch kennenlernen musste.
Wenn diese Zukunftsvisionen sie zu sehr aufwühlten, schlich sie manchmal aus dem Haus, während ihre Eltern und Geschwister schliefen, um draußen zu sitzen, wo die kleinen Feen flimmerten wie Glühwürmchen. Wo sie die Erde riechen konnte, die Feldfrüchte, die Tiere.
Meistens jedoch schlief sie den stillen und unschuldigen Schlaf eines Kindes mit liebenden Eltern und drei nervigen kleinen Brüdern; den eines gesunden Kindes mit einem suchenden Geist und einem tatendurstigen Körper.
Manchmal träumte sie auch von ihrem Erzeuger, dem Mann, mit dem ihre Mutter in New York gelebt hatte, dem Mann, den ihre Mutter geliebt hatte. Dem Mann, Fallon wusste es, der gestorben war, damit sie am Leben blieb.
Er war ein Schriftsteller gewesen, eine Führungsperson, ein großer Held. Sie trug seinen Namen, wie sie auch den Namen des Mannes trug, der sie in die Welt gebracht hatte, der sie erzog und lehrte. Fallon für Max Fallon, ihren Erzeuger. Swift für Simon Swift, ihren Vater.
Zwei Namen, dachte Fallon, gleichermaßen bedeutungsvoll. So wie ihre Mutter zwei Ringe trug, einen von jedem der Männer, mit denen sie eine tiefe Liebe verband.
Und obwohl sie ihren Vater so sehr und aufrichtig liebte wie ein Kind nur lieben konnte, war sie voller Fragen über den Mann, der ihr die Farbe ihrer Augen und ihres Haars gegeben hatte, und der ihr in der Vereinigung mit ihrer Mutter besondere Kräfte vererbt hatte.
Sie las seine Bücher – alle Bücher waren Geschenke – und betrachtete das Foto von ihm auf deren Rückseiten.
Einmal, sie war erst sechs Jahre alt gewesen, hatte sie es sich mit einem von Max Fallons Büchern im Lesezimmer gemütlich gemacht. Auch wenn sie nicht alles darin verstand, gefiel ihr, dass es von einem Zauberer handelte, der mit Hilfe von Magie und Verstand gegen böse Mächte ankämpfte.
Als ihr Vater hereinkam, wollte sie das Buch schuldbewusst vor ihm verbergen. Ihr Dad verfügte nicht über Zauberkünste, aber er hatte viel Verstand.
Er hatte sie samt dem Buch hochgehoben und sie sich dann auf den Schoß gesetzt. Sie liebte es, wie er nach der Farm roch – der Erde, den Tieren, allem, was wuchs.
Manchmal wünschte sie, Augen wie die seinen zu haben, die von Grün bis Gold changierten oder in denen sich diese Farben einfach vermischten.
»Das ist ein gutes Buch.«
»Hast du’s gelesen?«
»Ja. Meine Mom hat sehr gern gelesen. Deshalb haben sie und mein Dad dieses Bücherzimmer eingerichtet. Du brauchst nichts vor mir zu verstecken, Baby. Gar nichts.«
»Weil du mein Daddy bist.« Sie wandte sich ihm zu und presste ihr Gesicht an sein Herz. »Du bist mein Daddy.«
»Ich bin dein Daddy. Aber ich hätte das nicht werden können ohne Max Fallon.« Er drehte das Buch um, sodass sie beide das Bild des gut aussehenden Mannes mit den intensiven grauen Augen betrachten konnten. »Ich hätte mein hübschestes aller Mädchen nicht, wenn er nicht deine Mom geliebt hätte und sie ihn. Wenn sie dich nicht gemacht hätten. Wenn er sie und dich nicht so geliebt hätte und nicht so tapfer gewesen wäre und sein Leben geopfert hätte, um dich zu schützen. Ich bin ihm wirklich dankbar, Fallon. Ich verdanke ihm alles.«
»Mama liebt dich, Daddy.«
»Ja, das tut sie. Ich bin ein Glückspilz. Sie liebt mich, und sie liebt dich, und Colin und Travis.«
»Und das neue Baby, das kommt.«
»Ja.«
»Es ist kein Mädchen.« Ein gewaltiger, sorgenvoller Seufzer folgte dieser Feststellung.
»Tatsächlich?«
»Sie trägt wieder einen Jungen in sich. Warum kann sie keine Schwester für mich machen? Warum macht sie immer Brüder?«
Sie hörte das Lachen in seiner Brust, als er sie herzte. »Das wäre eigentlich mein Part. Zumindest glaube ich, dass es so ist.«
Beim Sprechen strich er über ihr langes schwarzes Haar. »Und ich vermute, das bedeutet, dass du einfach weiterhin mein Lieblingsmädchen sein musst. Hast du deiner Mom schon gesagt, dass es ein Junge ist?«
»Sie will es nicht wissen. Sie mag es, überrascht zu werden.«
»Dann werde ich es ihr auch nicht sagen.« Simon küsste sie auf den Kopf. »Unser Geheimnis.«
»Daddy?«
»Hmmm?«
»Ich kann nicht alle Wörter lesen. Einige sind zu schwer.«
»Na, soll ich dir das erste Kapitel vorlesen, bevor wir an unsere Arbeit gehen?«
Er setzte sie so, dass sie sich zusammenrollen konnte, öffnete das Buch und begann.
Sie hatte nicht gewusst, dass The Wizard King Max Fallons erster Roman gewesen war – oder vielleicht hatte ein Teil von ihr es gewusst. Aber sie würde sich immer daran erinnern, dass ihr Vater es ihr vorgelesen hatte, Kapitel um Kapitel, jeden Abend vor dem Zubettgehen.
So lernte sie von ihrem Vater Güte und von ihrer Mutter edelmütig und großzügig zu sein. Sie erfuhr Liebe und Licht und Respekt in dem Zuhause, in der Familie und dem Leben, das ihr geschenkt worden war.
Über Krieg, Elend und Kummer hörte sie von Reisenden, die auf die Farm oder ins nahe gelegene Dorf kamen.
Sie bekam Lehrstunden in Politik und ärgerte sich, weil die Menschen zu viel redeten und zu wenig taten. Und wozu war Politik gut, wenn Berichte besagten, die Regierung – was für ein diffuses Wort – habe im dritten Jahr nach dem Verderben den Wiederaufbau begonnen, nur um noch vor dem Ende des fünften Jahres wieder zu fallen?
Nun, im zwölften Jahr, war die Hauptstadt der Vereinigten Staaten – die Fallon weder damals noch heute vereinigt erschienen – noch immer Kriegsgebiet. Lager der Raider, Gruppen der dunklen Übernatürlichen und jene, die dem Kult der Purity Warriors anhingen, kämpften um Macht und um Land. Sie kämpften nicht nur gegeneinander, sondern auch gegen alle, die versuchten, zu reglementieren oder zu regieren.
So sehr Fallon sich Frieden wünschte, Wiederaufbau und Wachstum, begriff sie doch die Notwendigkeit, die Pflicht, zu kämpfen, um zu beschützen und zu verteidigen. Mehr als einmal hatte sie gesehen, wie ihr Vater bewaffnet die Farm verließ, um einem Nachbarn beizustehen oder das Dorf zu verteidigen. Mehr als einmal hatte sie seine Augen gesehen, wenn er nach Hause zurückgekommen war, und gewusst, dass es zu Blutvergießen und Todesfällen gekommen war.
Wie ihre Brüder war auch sie darin ausgebildet worden zu kämpfen, sich selbst und andere zu verteidigen. Selbst in der Hitze des Sommers, während auf der Farm die Ernte reifte, Bäume und Sträucher schwer an ihren Früchten trugen und die Wälder voller Wild waren, wüteten jenseits der Felder und Hügel ihres Zuhauses bittere Schlachten.
Und sie wusste, ihre Kindheit näherte sich mit jedem Glockenschlag, jedem Vorrücken des Zeigers dem Ende.
Sie war die Eine.
An Tagen, an denen ihre Brüder sie piesackten – weshalb musste sie sich bloß mit Brüdern herumärgern? –, wenn ihre Mutter nichts begriff und ihr Vater verdammt viel von ihr verlangte, wünschte sie, dieser Countdown möge schneller gehen.
Dann wieder begehrte sie auf und fragte sich, warum sie keine Wahl haben sollte? Sie wollte jagen und fischen, auf ihrem Pferd ausreiten, mit ihren Hunden im Wald herumtoben. Sogar mit ihren Brüdern.
In solchen Momenten fühlte sie sich unglücklich, weil von ihr verlangt wurde, etwas zu werden, worauf anscheinend weder sie noch ihre Eltern Einfluss nehmen konnten. Und der Gedanke, ihre Familie, ihr Zuhause verlassen zu müssen, machte sie unendlich traurig.
Sie wurde groß und stark, und das Licht in ihr brannte hell. Doch der Gedanke an ihren dreizehnten Geburtstag erfüllte sie mit Schrecken.
Sie regte sich darüber auf – wie über alles andere, was in ihrer und der Welt draußen unfair war –, während sie ihrer Mutter bei der Zubereitung des Abendessens half.
»Heute Nacht gibt es Sturm, ich spüre es.« Lana drückte an ihrem karamellfarbenen Haar herum, das sie vor dem Kochen hochgebunden hatte. »Aber es ist ein perfekter Abend, um draußen zu essen. Gieß schon mal das Wasser von den Kartoffeln ab, die ich gekocht habe.«
Fallon schmollte über den Herd gebeugt. »Warum musst immer du kochen?«
Lana schüttelte sacht eine Schüssel, in der frisch aus dem Garten geerntete Paprikastücke eingelegt waren. »Dein Dad grillt heute Abend«, erinnerte sie Fallon.
»Anfangs hast du alles gemacht.« Ohne diesen Hinweis zu akzeptieren, gab Fallon die Kartoffeln in ein Sieb im Spülbecken. »Warum machen Dad oder Colin oder Travis nicht alles?«
»Sie helfen, genau wie du. Und Ethan lernt auch schon. Aber um auf deine Frage zurückzukommen: Ich koche gerne. Ich bereite gern Essen zu, vor allem für meine Familie.«
»Und wenn ich das nicht gern tue?« Fallon wirbelte herum, ein groß gewachsenes, schlaksiges Mädchen mit momentan sturmgrauen Augen und trotzigem Blick. »Was, wenn ich einfach nicht gern koche? Warum muss ich Dinge tun, die ich nicht tun will?«
»Weil wir das alle müssen. Zu deinem Glück ist nächste Woche jemand anderes dran, und deine Zeit als Küchenhilfe ist vorbei, dann bist du zum Putzen eingeteilt. Du musst die Kartoffeln für den Grillrost noch würzen. Die Kräuter habe ich schon gehackt.«
»Okay, gut.« Sie kannte die Routine – Olivenöl, Kräuter, Salz, Pfeffer.
Wie sie auch wusste, dass sie das Öl und die Gewürze nur hatten, weil ihre Mutter und eine Hexe von einer benachbarten Farm ein Stückchen Ackerland ausgesucht und mit einem Zauber belegt hatten, um es in ein tropisches Fleckchen Erde zu verwandeln. Sie hatten Olivenbäume gepflanzt, Pfeffer- und Kaffeesträucher, Bananen. Feigen, Datteln.
Ihr Dad hatte gemeinsam mit anderen Olivenpressen und Trockenvorrichtungen für die Früchte gebaut.
Alle arbeiteten zusammen, und alle profitierten davon. Sie wusste das.
Und trotzdem.
»Willst du die nicht schon mal rausbringen und deinem Dad sagen, er soll mit dem Hühnchen anfangen?«
Immer noch schlecht gelaunt, stapfte Fallon aus dem Haus. Lana beobachtete ihre Tochter, und ihre sommerblauen Augen verdunkelten sich. Da zieht mehr als ein Sturm auf, dachte sie.
Sie aßen an dem großen Tisch im Freien, den Simon gebaut hatte, mit farbenfrohen Tellern, leuchtend blauen Servietten und Wildblumen in kleinen Töpfen.
Lana war es wichtig, immer einen hübsch gedeckten Tisch zu haben. Ethan durfte die Kerzen mit seinem Atem entzünden, weil ihn das immer zum Lachen brachte. Fallon ließ sich neben Ethan auf ihren Stuhl plumpsen. Ihren jüngsten Bruder empfand sie als nicht so nervig wie die beiden anderen, Colin und Travis.
Aber er war ja auch erst sechs. Er würde sicher noch schlimmer werden.
Simon, dessen braunes Haar von der Sonne meliert war, nahm Platz und lächelte Lana zu. »Sieht super aus, Baby.«
Lana erhob ihr Glas mit selbst gemachtem Wein. »Ein Lob dem Grillmeister. Wir danken«, fügte sie mit einem Blick auf ihre Tochter hinzu, »für die Nahrung, die wir mit unserer Hände Arbeit angebaut haben. Wir hoffen auf den Tag, an dem niemand mehr hungern muss.«
»Ich habe jetzt Hunger!«, meldete sich Colin zu Wort.
»Dann sei dankbar, dass Essen auf dem Tisch steht.« Lana legte ihm eine Hähnchenkeule auf den Teller.
»Ich habe Dad beim Grillen geholfen«, erklärte er, während er sich Kartoffeln, Gemüse und einen Maiskolben nahm. »Also sollte ich nicht abspülen müssen.«
»Daraus wird nichts, mein Sohn.« Simon füllte Travis’ Teller, Lana den von Ethan.
Colin fuchtelte mit seiner Keule herum, ehe er hineinbiss. Er hatte die braunen Augen seines Vaters, die manchmal golden oder grün schimmerten, und Haare etwas dunkler als die seiner Mutter, die sich in der Sommersonne aufhellten. Wie gewöhnlich stand es in Büscheln hoch, die sich nicht zähmen ließen.
»Ich habe den Mais geerntet.«
Travis, der bereits am Mampfen war, rammte ihm einen Ellbogen in die Seite. »Wir haben den Mais geerntet.«
»Irrelement.«
»Irrelevant«, korrigierte Simon. »Das ist es aber keineswegs.«
»Ich habe den meisten Mais geerntet. Das müsste zählen.«
»Anstatt euch übers Geschirrspülen Gedanken zu machen – denn das werdet ihr auf jeden Fall tun –, solltet ihr vielleicht besser den Mais essen«, schlug Lana vor und half Ethan, seinen Kolben mit Butter zu bestreichen.
»In einer freien Gesellschaft hat jeder eine Stimme.«
»Schade nur, dass du in keiner lebst.« Simon versetzte Colin einen Knuff in die Rippen. Er reagierte mit einem breiten Grinsen.
»Der Mais ist gut!« Obwohl Ethan einige Milchzähne verloren hatte, nagte er den Kolben begeistert ab. Er hatte die blauen Augen seiner Mutter, ihr hübsches blondes Haar und war einfach ein kleiner Sonnyboy.
»Vielleicht werde ich mal Präsident.« Colin, der sich nie beirren ließ, drängte sich nach vorn. »Ich werde der Präsident der Swift Familienfarm & Co. KG. Und dann der des Dorfes. Ich werde es Colinville nennen und dann nie mehr abspülen.«
»Keiner würde dich wählen.« Travis, der Colin fast so ähnlich sah wie ein Zwillingsbruder, kicherte.
»Ich wähle dich, Colin!«
»Was ist, wenn ich auch als Präsident kandidiere?«, wollte Travis von Ethan wissen.
»Dann würde ich euch beide wählen. Und Fallon.«
»Lasst mich da raus«, murrte Fallon und stocherte in ihrem Essen herum.
»Man kann nur für eine Person stimmen«, erklärte Travis.
»Warum?«
»Darum.«
»›Darum‹, das ist doof.«
»Diese ganze Unterhaltung ist doof!« Fallon schnipste mit den Fingern. »Du kannst nicht Präsident werden, denn selbst wenn es eine funktionierende Regierung gäbe, wärst du dafür nicht alt und vor allem nicht schlau genug.«
»Ich bin so schlau wie du«, konterte Colin, »und ich werde ja noch älter. Ich kann Präsident werden, wenn ich will. Ich kann alles werden, was ich will.«
»In deinen Träumen«, fügte Travis grinsend hinzu.
Das brachte ihm einen Tritt unter dem Tisch ein, den er erwiderte.
»Ein Präsident ist ein Führer, und ein Führer führt an.«
Als Fallon aufsprang, wollte Simon etwas sagen, um die Lage zu beruhigen, doch er bemerkte Lanas Blick.
»Du hast keine Ahnung, was es heißt, führen zu müssen!«
»Und du hast keine Ahnung von nichts!«, schoss Colin zurück.
»Ich weiß, dass ein Führer keine Orte nach sich selbst benennt, so wie ich auch weiß, dass er für Menschen Verantwortung trägt, sicherstellt, dass sie Essen und Unterkunft haben, entscheiden muss, wer in den Krieg zieht, wer lebt und wer stirbt. Und ich weiß, dass ein Führer kämpfen, vielleicht sogar töten muss!«
Zornesrote Lichtschimmer tanzten um sie herum, während sich ihre Wut Bahn brach. »Ein Führer ist jemand, von dem alle Antworten erwarten, selbst wenn es gar keine gibt. Und dem jeder die Schuld zuschiebt, wenn etwas schiefgeht. Ein Führer ist einer, der die Drecksarbeit tun muss, und wenn es nur das verdammte Geschirr ist.«
Sie wandte sich ab, stürmte ins Haus, den wütenden roten Schimmer hinter sich herziehend, und knallte die Tür zu.
»Wieso benimmt sie sich so bescheuert?«, fragte Colin. »Wieso wird sie so gemein?«
Ethan wandte sich mit Tränen in den Augen seiner Mutter zu. »Ist Fallon wütend auf uns?«
»Nein, Baby, sie ist einfach nur zornig. Wir müssen ihr ein wenig Zeit für sich geben, okay?« Sie blickte zu Simon. »Sie braucht etwas Raum für sich. Sie wird sich bestimmt entschuldigen, Colin.«
Er zuckte lediglich mit den Schultern. »Ich kann Präsident werden, wenn ich will. Sie ist nicht die Herrin der Welt.«
Lanas Herz schmerzte ein bisschen. »Habe ich eigentlich schon gesagt, dass ich als Nachspeise Pfirsichkuchen gemacht habe?« Sie wusste, Obstkuchen würde die Laune ihrer Jungs in jedem Fall aufbessern. »Das heißt, für jeden, der seinen Teller leer isst.«
»Ich habe da eine Idee, was wir nach dem Essen machen könnten.« Simon sah Lana an, und diese nickte zustimmend. »Wir könnten Basketball spielen.«
Seit er neben der Scheune ein halbes Spielfeld angelegt hatte, war Basketball ein Lieblingszeitvertreib seiner Jungen geworden.
»Ich will mit dir zusammenspielen, Daddy!«
Simon blinzelte Ethan zu und grinste. »Wir fegen sie vom Spielfeld, Champion.«
»Nie und nimmer.« Auch Colin wandte sich wieder seinem Essen zu. »Travis und ich, wir ziehen euch ab.«
Travis sah zu seiner Mutter und tauschte einen langen Blick mit ihr aus.
Er weiß Bescheid, dachte Lana. Und Colin wusste es ebenfalls, auch wenn er sich gerade über Fallon ärgerte.
Ihre Schwester war nicht die Herrin der Welt, aber sie trug deren Gewicht auf ihren Schultern.
* * *
Fallons Wut zerschmolz in einer Tränenflut von Selbstmitleid. Sie warf sich auf ihr Bett, das ihr Vater nach der Vorlage aus einer alten Zeitschrift für sie gebaut hatte. Irgendwann hörten die Tränen auf; dafür kamen nun Kopfschmerzen und Übellaunigkeit.
Es war nicht fair. Nichts war fair. Und Colin hatte damit angefangen. Er fing immer an mit seinen großartigen, blöden Ideen. Wahrscheinlich, weil er über keinerlei Magie verfügte. Oder weil er eifersüchtig war.
Sollte er doch ihre Magie haben, dann konnte er mit irgendeinem Fremden weggehen und zum Retter der ganzen doofen Welt werden.
Sie wollte einfach nur normal sein. Wie die Mädchen im Dorf oder auf den anderen Farmen. Wie alle anderen.
Sie hörte die Rufe, das Gelächter durch ihr offenes Fenster, versuchte, es zu ignorieren. Doch dann stand sie auf und schaute hinaus.
Der Himmel war intensiv blau an diesem langen Spätsommertag, aber wie ihre Mutter fühlte auch sie einen Sturm heraufziehen.
Sie sah ihren Vater, der Ethan auf seinen Schultern trug, auf die Scheune zugehen. Die älteren Jungen rannten bereits mit ihren Basketballschuhen, die ihr Vater für sie ergattert hatte, um die asphaltierte Kurve.
Sie wollte nicht lächeln, als ihr Vater Colin den Ball abnahm, ihn für Ethan hochhielt und dann zum Korb schritt, damit der ihn einwerfen konnte.
Sie wollte nicht lächeln.
Die älteren Jungen sahen Dad ähnlich, Ethan eher Mom.
Und sie sah aus wie der Mann auf der Rückseite eines Buches.
Das allein war oft schmerzlicher, als was sie meinte aushalten zu können.
Nach einem sanften Klopfen an ihrer Tür trat ihre Mutter ein. »Ich dachte, du hast vielleicht Hunger. Du hast ja das Abendessen kaum angerührt.«
Scham schob sich vor das Beleidigtsein. Fallon schüttelte lediglich den Kopf.
»Dann vielleicht später.« Lana stellte den Teller auf die Kommode, die Simon gebaut hatte. »Du weißt, wie du es aufwärmen kannst, wenn du so weit bist.«
Wieder schüttelte Fallon den Kopf, doch dieses Mal flossen dabei Tränen. Lana ging einfach zu ihr und schloss sie in ihre Arme.
»Es tut mir leid.«
»Ich weiß.«
»Ich habe alles vermurkst.«
»Nein, hast du nicht.«
»Wollte ich aber.«
Lana küsste Fallon auf die Wange. »Ich weiß, hast du aber nicht. Du wirst dich bei deinen Brüdern entschuldigen, aber wie du hörst, geht es ihnen gut. Nichts ist vermurkst.«
»Ich mag sie nicht, und dich und Dad auch nicht.«
Lana strich über Fallons langen schwarzen Pferdeschwanz, lehnte sich dann zurück und blickte in die ihr so bekannten grauen Augen.
»Ich habe dir von der Nacht erzählt, in der du geboren wurdest. Das war immer eine deiner Lieblingsgeschichten.« Während sie sprach, führte sie Fallon zum Bett und setzte sich mit ihr darauf. »Aber ich habe dir noch nie von der Nacht erzählt, in der du empfangen wurdest.«
»Ich …« Ihre Wangen begannen zu glühen. Sie wusste, was empfangen bedeutete und wie es geschah. »Das ist – das ist komisch.«
»Du bist beinahe dreizehn, und selbst wenn wir nicht schon über all das gesprochen hätten – du lebst auf einer Farm. Du weißt, woher Babys kommen und wie sie dorthin gelangen.«
»Aber es ist komisch, wenn es die eigene Mom ist.«
»Ein bisschen«, räumte Lana ein, »und deshalb bringe ich es dir schonend bei. Wir wohnten in Chelsea. Das ist eine Gegend in New York. Ich liebte sie. Auf der anderen Seite der Straße war eine nette kleine Bäckerei, und an der Ecke ein toller Delikatessenladen. Hübsche Geschäfte in der Nachbarschaft, wunderbare alte Gebäude. Max hatte ein Loft – ich zog zu ihm. Das liebte ich auch. Große Fenster zur Straße hinaus. Du konntest die Welt vorbeirauschen sehen. Regale voller Bücher. Die Küche war nicht halb so groß wie unsere hier, aber sie war komplett und modern eingerichtet. Wir hatten oft Dinnerpartys mit Freunden.
Ich arbeitete in einem guten Restaurant und hatte Pläne, eines Tages ein eigenes aufzumachen.«
»Du bist die beste Köchin.«
»Momentan gibt es nicht wirklich viel Konkurrenz.« Lana legte einen Arm um Fallons Taille. »Ich kam von der Arbeit nach Hause, und wir tranken etwas Wein, einen wirklich guten Tropfen, und liebten uns. Und danach, nur Minuten danach, brach einfach etwas in mir auf. So ein Licht, so eine Pracht, so ein … Ich kann dieses Gefühl nicht erklären, bis heute nicht. Es hat mir auf die wunderbarste Art und Weise den Atem geraubt. Und Max spürte das auch. Wir machten uns ein bisschen lustig darüber. Er holte eine Kerze. Damals war meine Gabe noch so klein, dass mir sogar eine Kerze anzuzünden nur auf gut Glück gelang, und es klappte erst nach einigen Versuchen.«
»Wirklich? Aber du …«
»Ich habe mich verändert, Fallon. Ich habe mich in jener Nacht geöffnet. Ich entzündete die Kerze mit einem bloßen Gedanken. Es stieg in mir auf, diese neue Kraft. Und in Max auch, in uns allen, die Magie in sich hatten. Aber was ich in mir hatte, das warst du. Dieser Moment, dieses Aufbrechen, diese Pracht, dieses Licht, das warst du. Das wurde mir erst Wochen später klar, aber das warst du. Du bist in jener Nacht in mir entstanden. Ich fand heraus – und einiges hast du mir gezeigt, da warst du noch in mir –, dass du nicht nur für mich, für Max und Simon ganz besonders bist, sondern für alle.«
»Ich will nicht weggehen.« Fallon vergrub das Gesicht an Lanas Schulter. »Ich will nicht die Eine sein.«
»Dann sag nein. Es ist deine Entscheidung, Fallon. Niemand kann dich zwingen, und ich würde nie zulassen, dass dich jemand zwingt. Auch dein Vater würde das nie zulassen.«
Das wusste sie. Sie hatten ihr immer gesagt, es werde ihre Entscheidung sein. Aber … »Ihr wärt nicht von mir enttäuscht? Ihr würdet euch nicht schämen?«
»Nein.« Lana zog Fallon an sich und hielt sie fest. »Nein, niemals.« Wie viele Nächte hatte sie innerlich gehadert und sich damit gequält, was von diesem Kind verlangt werden würde? Diesem Kind. Ihrem Kind. »Du bist mein Herz«, tröstete sie Fallon. »Ich bin jeden Tag stolz auf dich. Ich bin stolz auf dich, auf deinen Verstand, dein Herz, dein Licht. Oh Gott, es brennt so hell. Und ich würde dieses Licht ohne Zögern von dir nehmen, um dir diese Entscheidung abzunehmen. Den Zwang, sie treffen zu müssen.«
»Er starb, um mich zu retten. Mein leiblicher Vater.«
»Nicht nur wegen dem, was du vielleicht einmal sein wirst. Sondern vor allem, weil er dich liebte. Fallon, du und ich, wir sind die glücklichsten Frauen. Wir werden von zwei bewundernswerten, zwei mutigen Männern geliebt. Wie immer du dich entscheidest, sie und ich, wir werden dich lieben.«
Fallon hielt sich an ihr fest, fühlte sich getröstet und erleichtert. Spürte ihre Mutter … und wich sorgsam zurück. »Da ist noch mehr. Ich fühle es. Es gibt Dinge, die du mir noch nicht erzählt hast.«
»Ich habe dir von New Hope erzählt, und …«
»Wer ist Eric?«
Lana zuckte zurück. »Tu das nicht. Du kennst die Regel, sich nicht in die Gedanken eines anderen Menschen hineindrängen zu dürfen.«
»Das habe ich nicht gemacht. Ich schwöre es. Ich habe es eben erst gesehen. Gespürt. Da ist noch mehr«, erwiderte Fallon, und nun zitterte ihre Stimme. »Etwas, das du mir verschweigst, weil du Angst hast. Du hast Angst um mich, ich spüre es. Aber wenn du mir nicht alles sagst, woher soll ich dann wissen, was ich zu tun habe?«
Lana stand auf, ging zum Fenster. Sie schaute hinaus zu ihren Jungen, ihrem Mann, den beiden Hunden Harper und Lee, die in der Sonne dösten. Und zu den beiden jungen Hunden, die um die Jungen herumliefen. Auf die Farm, das Zuhause, das sie so schätzte. Auf das Leben, das sie aufgebaut hatte. Immer drängt sich die Finsternis ins Licht, dachte sie mit Bitterkeit.
Die Magie verlangte immer einen Preis.
Aus Angst hatte sie manches von ihrem Kind, vom hellsten aller Lichter, ferngehalten. Weil sie wollte, dass ihre Familie zusammen war, zu Hause. Sicher.
»Ich habe Dinge von dir ferngehalten, weil ich letztendlich wollte, dass du Nein sagst. Ich habe dir von dem Überfall erzählt, als wir in dem Haus in den Bergen wohnten.«
»Zwei, die dabei waren, haben die Seite gewechselt. Sie waren dunkle Übernatürliche, aber das wusstet ihr nicht, bis sie versuchten, euch zu töten. Mich zu töten. Du und Max und die anderen kämpften, und ihr dachtet, ihr hättet sie zerstört.«
»Ja, es war aber nicht so.«
»Sie haben euch in New Hope wieder angegriffen. Sie kamen meinetwegen, und um dich, um mich zu retten, hat Max sich geopfert. Du bist weggelaufen, wie er es dir gesagt hatte. Du bist weggegangen, weil sie wiedergekommen wären, und du musstest mich beschützen. Du warst eine lange Zeit allein, und sie jagten dich. Und dann fandest du die Farm und Dad.«
Fallon atmete tief. »War dieser Eric einer von ihnen? Einer der Dunklen?«
»Ja. Er und die Frau, mit der er zusammen war, die ihm meiner Meinung nach half, sich vom Licht abzuwenden. Sie wollten mich töten, oder eigentlich ging es um dich. Sie haben Max umgebracht. Eric ist Max’ Bruder.«
»Sein Bruder?« Fallon wurde steif vor Schreck. Brüder, dachte sie entsetzt, waren, selbst wenn sie noch so nervig waren, Brüder. Sie waren Familie. »Mein Onkel. Mein Blut.«
»Eric hat sich entschieden, dieses Blut zu verraten, seinen eigenen Bruder zu ermorden. Er hat sich für die dunkle Seite entschieden. Die Finsternis.«
»Er hat sich entschieden«, murmelte Fallon. Und straffte nach einem weiteren tiefen Atemzug die Schultern. »Du musst mir alles sagen. Du darfst nichts auslassen. Wirst du es mir erzählen?«
»Ja.« Lana presste die Finger auf ihre Lider. Beim Blick in diese ihr so vertrauten grauen Augen wusste sie bereits, welche Entscheidung ihr Kind treffen würde. »Ja, ich werde dir alles erzählen.«
Kapitel 2
Fallon entschuldigte sich. Colin tat es mit einem Achselzucken ab, doch sie wusste aus Erfahrung, dass er nachtragend war, und machte sich auf Vergeltung gefasst. Da es bis zu ihrem Geburtstag – und ihrer Entscheidung – nur noch einige Wochen hin waren, machte sie sich lieber Gedanken über die Rache ihres Bruders.
Das war normal, das war Familie.
Außerdem war ihr die Berechnung in seinem Blick lieber als die Sorge, die sie häufig bei ihrer Mutter und ihrem Vater registrierte.
Sie half, Heu zu machen und Weizen zu mähen, Obst und Gemüse zu ernten. Tägliche Aufgaben erleichterten es ihr, innerlich stabil zu bleiben. Sie klagte nicht über die Küchenarbeit – oder murrte zumindest nur in ihrem Kopf darüber. Das Ende des Sommers und das Herannahen des Herbstes bedeutete, stundenlang Marmeladen und Gelees zu machen, Früchte und Gemüse für den kommenden Winter zu konservieren.
Einen Winter, den sie fürchtete.
Wann immer sie konnte, floh sie, nutzte ihre freie Zeit, um auf ihrem geliebten Pferd Grace über Felder und durch Wälder zu reiten. Sie hatte es nach der Piratenkönigin benannt, die sie lange bewundert hatte.
Oft ritt sie zum Bach, nur um dort zu sitzen und nachzudenken – ihre ausgeworfene Angel war dabei eher Nebensache. Wenn sie einen Fisch zum Essen oder Tauschen mit nach Hause brachte, umso besser. Doch diese Zeit der Einsamkeit nährte ihre junge, bange Seele.
Ab und an übte sie sich dort auch ein wenig in Magie – rief die Schmetterlinge, brachte Fische zum Springen, drehte mit den Fingern kleine Lufttrichter.
An einem heißen Tag, an dem die Sonne stach und kaum Wind zu spüren war, saß sie an ihrem Lieblingsplatz. Da sie lesen wollte, hing ihre Angel von einem Zauber gehalten über dem Bach.
Sie konnte die Fische dazu bringen, den Köder zu schlucken, doch solche Kräfte – das hatte man ihr extra beigebracht – durften nur benutzt werden, um wirklichen Hunger zu stillen.
Ab und zu hörte sie Vögel zwitschern, und im Wald war gelegentlich ein Rascheln zu vernehmen. Wäre sie nicht so sehr in ihr Buch vertieft gewesen, hätte sie versucht, die Geräusche zu identifizieren. Reh, Kaninchen, Eichhörnchen, Fuchs, Bär – nur selten traf sie hier auf einen Menschen.
Doch sie genoss es, sich in eine Geschichte entführen zu lassen – über einen Jungen mit einer Gabe und einem inneren Leuchten, der in einem alten, schauderhaften Hotel gefangen war.
Deshalb beachtete sie auch das Tropfgeräusch des Wassers nicht, selbst dann nicht, als es sich wiederholte.
Doch die glucksende Stimme ließ sie plötzlich aufhorchen.
Ihr bereits wegen der Geschichte heftig pochendes Herz tat einen harten, dumpfen Schlag, als sie hörte, dass diese dünne Stimme ihren Namen flüsterte, und sah, dass das Wasser im Bach sich kräuselte.
Vorsichtig legte sie das Buch beiseite und stand auf, eine Hand an dem Messer, das sie am Gürtel trug.
»Was ist das für ein Zauber?«, murmelte sie.
War es ein Zeichen? War es etwas Dunkles, das gekommen war, um sie zu rufen?
Wieder war ihr Name zu vernehmen, und das Wasser schien zu beben. Am Ufer umhertanzende Schmetterlinge schwärmten davon, eine Wolke so gelb wie Dotterblumen.
Und die Luft wirkte still wie ein Grab.
Nun, sie war kein kleiner Junge wie der in dem Buch, erinnerte sie sich und trat näher ans Wasser.
»Ich bin Fallon Swift«, rief sie über das Hämmern in ihren Ohren hinweg. »Wer bist du? Was willst du?«
»Ich habe keinen Namen. Ich bin alle Namen.«
»Was willst du?«
Nur ein Fingerbreit Wasser stieg aus dem sich kräuselnden Bach auf. Sie brauchte bloß eine Sekunde, um zu erkennen, welcher Finger es war und was er bedeutete. Aber es war eine Sekunde zu spät.
Sie trafen sie von hinten, drei gegen eine. Fallon schlug mit dem Gesicht auf das Wasser auf, kam wieder hoch und hörte das ausgelassene Lachen ihrer Brüder. Sie strich sich die nassen Haare aus Gesicht und Augen und stand auf.
»Das konntet ihr nur zu dritt, und aus dem Hinterhalt.«
»›Wer bist du?‹«, wiederholte Colin mit bebender Stimme. »›Was willst du?‹ Ha, du hättest dein Gesicht sehen sollen!«
»Nett zu sehen, wie ihr eine Entschuldigung annehmt.«
»Du hast es verdient. Jetzt sind wir quitt.«
Vielleicht hatte sie es verdient, und sie musste zugeben, dass er den rechten Augenblick abgepasst hatte. Auch das Zusammenwirken mit seinen Brüdern und die Kreativität dieses Tricks waren bewundernswert.
Aber.
Sie überlegte ihre Optionen, die Demütigung im Falle eines Scheiterns, und entschloss sich, das Risiko einzugehen.
Sie hatte geübt.
Während ihre Brüder lachten und ihren Siegestanz aufführten, sprach sie von Geist zu Geist mit dem Pferd. Grace tat einen Schritt nach vorn und beförderte Colin mit einem Stoß ihres Kopfes ins Wasser.
»Hey!« Er war kleiner als Fallon und musste strampeln, bis seine Füße Boden fanden. »Das ist nicht fair!«
»Ist drei gegen eine auch nicht.«
Außer sich vor Lachen, sprang Ethan ins Wasser. »Ich will auch schwimmen!«
»Was soll’s.« Travis kickte die Schuhe von sich und landete mit einer Arschbombe im Bach.
Während die Jungen einander bespritzten und untertauchten, legte sich Fallon im Wasser auf den Rücken und verband sich in Gedanken mit Travis.
Das war dein Werk.
Jawohl.
Ich habe mich entschuldigt.
Ja, aber er brauchte das. Und es hat Spaß gemacht.
Er drehte den Kopf, lächelte ihr zu.
Und, es ist ein heißer Tag.
Der Mittelfinger war unanständig.
Aber witzig.
Sie konnte sich selbst ein Grinsen nicht verkneifen. Aber witzig. Ich brauche ein paar Minuten mit Colin allein.
Mein Gott, ist doch bloß Wasser!
Nicht deswegen. Zum Ausgleich. Ich brauche nur ein paar Minuten.
Sein Blick fokussierte sich auf sie. Er sah und wusste Bescheid, wie gewöhnlich. Dann wandte er sich ab und nickte nur.
Sie watete aus dem Wasser, kletterte aus dem Bachbett. Nachdem sie sich mit den Händen über den Körper gewischt hatte, um sich etwas abzutrocknen, verstaute sie ihr Buch und die Angel.
»Wir müssen zurück!«, rief sie laut.