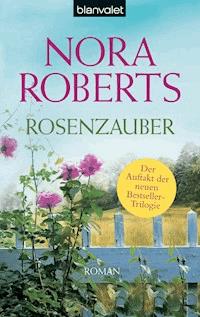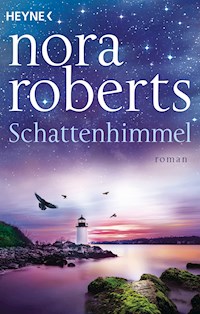
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Schatten-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Eine neue Ära bricht an
Die erste Schlacht ist bereits geschlagen, doch der große Kampf um Gut und Böse steht noch bevor: Fallon führt ihre Armee nach Washington D.C., um die schwarze Magie aus der Welt zu verbannen. Sie ist die Auserwählte, die nach der Apokalypse die Welt wiederaufbauen und ihre Bewohner vereinen soll. Aber die junge Frau wird auch von ihren eigenen Verwandten bedroht, die sie und ihre Familie vernichten wollen. Ihre große Mission fällt Fallon jedoch mittlerweile leichter als die Deutung ihrer Gefühle für Duncan, dessen Schicksal unvermeidlich mit ihrem verwoben ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 671
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Das Buch
Fallon Swift ist zu einer jungen Frau, talentierten Kämpferin und erfolgreichen Anführerin herangewachsen. Ihr Alltag ist der Kampf, denn die Welt ist nach dem Ausbruch der Pandemie voll von dunkelmagischen, gewalttätigen Menschen. Sie haben sich zu Gangs zusammengeschlossen, die Magiebegabte, die nicht auf ihrer Seite stehen, gefangen nehmen, foltern und hinrichten. Auch die Regierung, oder zumindest das, was von ihr noch übrig ist, steht ihnen an Grausamkeit nicht nach und führt menschenverachtende Experimente an den Magischen durch. Fallon kann zum Glück auf die Unterstützung von Familie und Freunden zählen, als sie ein gewagtes Manöver plant, um eine der größten Festungen der Feinde anzugreifen. Mit ihrer Mutter Lana als Heilerin und ihrem Lehrmeister Mallick als Rückendeckung führt sie die Truppen, ausgebildet von ihrem Bruder Colin, in den Kampf um Washington D. C. Und auch wenn sie ihre Gefühlen für Duncan verwirren, weiß sie, sie kann sich auf ihn verlassen. Tonia, Duncans Zwillingsschwester, steht ihr ebenfalls zur Seite. Alle drei sind die Nachfahren von mächtigen magischen Wesen und Tonia und Duncan wissen, dass sie Fallon bei ihrem Kampf gegen die Dunkelheit beistehen müssen, denn Fallons Cousine Petra ist skrupellos und trachtet Fallon seit Jahren nach dem Leben …
Die Autorin
Nora Roberts wurde 1950 in Maryland geboren. Ihren ersten Roman veröffentlichte sie 1981. Inzwischen zählt sie zu den meistgelesenen Autorinnen der Welt. Ihre Bücher haben eine weltweite Gesamtauflage von 500 Millionen Exemplaren überschritten. Mehr als 195 Titel waren auf der New-York-Times-Bestsellerliste, und ihre Bücher erobern auch in Deutschland immer wieder die Bestsellerlisten. Nora Roberts hat zwei erwachsene Söhne und lebt mit ihrem Ehemann in Maryland.
Mehr Informationen über die Autorin und ihr Werk finden Sie hier.
Besuchen Sie die Autorin auf www.noraroberts.com
Nora Roberts
Schattenhimmel
Roman
Die Originalausgabe THE RISE OF MAGICKS (Chronicles of The One, Book 3) erschien 2019 bei St. Martin’s Press, New York Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Vollständige deutsche Erstausgabe 09/2020 Copyright © 2019 by Nora Roberts Published by Arrangement with Eleanor Wilder Copyright © 2020 der deutschsprachigen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Für Bruce, unser Zuhause und die Familie, die wir zusammen aufgebaut haben
Inhalt
ERSTER TEIL
Freiheit
ZWEITER TEIL
Bestimmung
DRITTER TEIL
Schlacht und Blut
VIERTER TEIL
Glaube
FÜNFTER TEIL
Licht für Leben
Erster Teil
FREIHEIT
Einst saß die Freiheit auf den Höhn, Ob ihrem Haupt der Sterne Glut, Zu ihren Füßen das Getön Des Donners und der Flut.
Prolog
Auf den Schild, einen von sieben, die vor aller Zeit geschmiedet worden waren, um die Finsternis zurückzuhalten, fiel ein einziger Tropfen Blut.
Dadurch verlor der Schild an Kraft, und die Finsternis wartete mit der Geduld einer Spinne, ließ die Jahrzehnte verstreichen, während sich unter dem Gras und der Erde die Wunde ausbreitete.
Und am letzten Tag des Jahres, das sein letztes werden sollte, zerbrach ein guter Mann in aller Unschuld den Schild. Die Finsternis belohnte ihn dafür mit einer tödlichen Infektion, die vom Mann auf die Frau überging, von den Eltern auf die Kinder, von einem Fremden zum nächsten.
Die sterbende Welt wankte, und ihr gesamtes Gefüge – Regierungen, Technologien, Gesetze, Kommunikations- und Transportwesen – zerfiel wie Ziegel zu Staub.
Die Welt endete mit Blut und Schmerz, mit Furcht und Schrecken. Eine Kassiererin, die einem Kunden Wechselgeld gab, eine Mutter, die ihr Kind stillte, Geschäftsleute, die per Handschlag einen Handel besiegelten – solche und zahllose andere harmlose Kontakte verbreiteten den Tod über die Welt gleich einer Giftwolke.
Und Milliarden starben.
Man nannte es das Verderben – denn das war es –, eine rasend schnell sich verbreitende mörderische Krankheit, für die es keine Heilung gab, die gleichermaßen und ohne Ansehen Schurken wie Unschuldige, Staatsmänner wie Anarchisten, die Privilegierten und die Mittellosen dahinraffte.
Während Milliarden umkamen, mussten jene, die überlebten – die Immunen –, um jeden neuen Tag kämpfen; Nahrung finden, jeglichen Schutz, den sie ergattern konnten, verteidigen und versuchen, der entfesselten, ungehemmten Gewalt zu entkommen oder sie zu meiden. Denn nicht wenige brannten nieder, plünderten, vergewaltigten, töteten aus schierer Lust – selbst in ihrer schlimmsten Stunde.
Doch durch die giftige Wolke, die die Welt umhüllte, funkelte Licht. Kräfte, die lange geruht hatten, erwachten. Einige leuchteten hell, andere verbanden sich mit der Dunkelheit, je nach getroffener Wahl.
Magie begann sich zu regen.
Manche hießen die Wunder willkommen, manche fürchteten sie. Und einige waren voller Hass.
Das Andersartige hat in manchen Herzen stets Hass geschürt. Jene, die die Übernatürlichen genannt wurden, sahen sich der Furcht und der Hetze derer ausgesetzt, von denen sie gejagt wurden. Regierungen, die verzweifelt ihre Macht zu erhalten suchten, sammelten sie in Lagern, kerkerten sie ein und missbrauchten sie für Experimente.
Magische verbargen sich oder kämpften gegen jene, die einen zornigen, verbitterten Gott anriefen, in seinem Namen folterten und zerstörten – und sich dabei an ihre Bigotterie klammerten wie an eine Geliebte.
Und sie verbargen sich vor denen und bekämpften jene, die sich der Dunkelheit verschrieben hatten.
In einer sturmgepeitschten Nacht tat ein Kind seinen ersten Atemzug, dessen Licht die Welt retten sollte. Es war ein Mädchen, aus Liebe und unter vielen Opfern geboren, aus Kraft trotz großen Kummers.
Mit ihrem ersten Lebensschrei – unter den Tränen ihrer Mutter und in den starken Händen des Mannes, der sie hielt –, tat die Kriegerin, die Führerin, die Eine ihren ersten Schritt ihrer Bestimmung entgegen.
Magien begannen ihr Werk.
In den folgenden Jahren wüteten Kriege unter den Menschen, zwischen Finsternis und Licht, zwischen denen, die um Überleben und Wiederaufbau kämpften, und jenen, die zerstören und über die Trümmer zu herrschen suchten.
Das Kind wuchs heran, und seine Kräfte entfalteten sich. Während seiner Ausbildung, die einherging mit Fehlern, Rückschlägen und Siegen, tat es seine nächsten Schritte. Und schließlich griff eine junge Frau voller Vertrauen in sich und ihre Bestimmung in das Feuer und nahm das Schwert und den Schild auf. Und wurde zu der Einen.
Magien begannen sich zu erheben.
Kapitel 1
Ein Sturm wütete. Er toste um sie herum mit wildem, windgepeitschtem Regen, knisternden Blitzschlägen, brüllendem Donnerrollen. Eine Zornesflut, die es zu unterdrücken galt, tobte in ihr, das wusste sie.
Sie würde heute Nacht den Tod bringen, mit ihrem Schwert, mit ihrer Kraft, mit ihren Befehlen. Jeder vergossene Tropfen Blut würde an ihren Händen kleben – dies war die Last der Führung, die es zu akzeptieren galt.
Dabei war sie noch keine zwanzig Jahre alt.
Fallon Swift berührte die Manschette an ihrem Handgelenk. Sie hatte sie geschnitzt aus einem Baum, den sie in einem Wutanfall vernichtet hatte, um sich immer daran zu erinnern, nie wieder etwas aus Zorn zu zerstören.
Darauf stand: Solas don Saol.
Licht für Leben.
Sie würde heute Nacht den Tod bringen, dachte sie noch einmal, doch sie würde dadurch anderen helfen zu leben.
Durch den Sturm betrachtete sie das Anwesen. Mallick, ihr Lehrer, hatte sie an ihrem vierzehnten Geburtstag zu einem ähnlichen gebracht. Doch während jenes verlassen gewesen war, lediglich der Gestank schwarzer Magie, die verkohlten Überreste der Toten und die ersterbenden Schreie der Gefolterten dort übrig geblieben waren, befanden sich in diesem hier mehr als sechshundert Menschen – zweihundertachtzig Mann Personal und dreihundertzweiunddreißig Gefangene.
Siebenundvierzig dieser Gefangenen waren ihren Informationen zufolge noch keine zwölf Jahre alt.
Sie hatte jeden Quadratzentimeter dieses Sammellagers – jedes Zimmer, jeden Korridor, jede Kamera, die komplette Alarmanlage – in ihrem Kopf. Sie hatte genaue Karten angefertigt und die Rettung monatelang geplant.
In den drei Jahren, seit sie begonnen hatte, ihre Armee aufzubauen und sie und ihre Familie ihr Zuhause verlassen hatten, um nach New Hope zu gehen, würde dies der größte Rettungsversuch ihrer Truppe sein.
Falls sie scheiterte …
Eine Hand legte sich auf ihre Schulter und beruhigte sie wie schon so oft. Sie wandte den Kopf und blickte ihren Vater an.
»Wir haben es im Griff«, sagte Simon zu ihr.
Sie seufzte. »Die Überwachungskameras verzaubern«, murmelte sie und übermittelte die Worte von Geist zu Geist an die Elfen, damit sie die Order weitergaben.
Diejenigen, die an den Bildschirmen saßen, würden nun nur mehr die Bäume, den Regen, den sumpfigen Boden sehen.
»Setzt die Alarmanlagen außer Kraft.«
Der Sturm tobte, während sie und andere Hexen den Zauber gewissenhaft ausführten.
Als das Alles-Klar durch die Reihen ging, ignorierte sie den stechenden Schmerz und gab den Befehl. »Bogenschützen, los.«
Die Wachen auf den Türmen mussten rasch und geräuschlos ausgeschaltet werden. Sie spürte, wie Tonia, die Anführerin der Bogenschützen, Freundin, Blut von ihrem Blut, einen Pfeil an die Sehne legte und schoss.
Mit einem konzentrierten Blick aus grauen Augen beobachtete sie, wie in den vier Türmen an den Ecken der Gefängnismauern Männer getroffen zu Boden gingen.
Sie rückte vor, deaktivierte mithilfe magischer Kraft die Elektrotore. Auf ihr Zeichen hin strömten Truppen durch die Öffnung, Elfen erklommen die Wände und Zäune, Gestaltwandler kämpften sich mit Zähnen und Klauen voran, Feen glitten auf lautlosen Schwingen vor.
Perfektes Timing, dachte sie, gedanklich mit Flynn, dem Elfenkommandeur, und Tonia sprechend. Sie würden die drei Türen gleichzeitig durchbrechen, und jeder Teamleiter würde seinen Truppen deren Aufgaben zuweisen – Zerstörung der Kommunikationskanäle, Ausschaltung der Sicherheitsanlagen, Übernahme des Waffenarsenals, Sicherung des Labors. Und vor allem ging es um den Schutz aller Gefangenen.
Nach einem letzten Blick auf ihren Vater, dem sie vollkommen vertraute und dessen Gesicht voller Mut und Entschlossenheit war, gab sie den Befehl.
Sie zog ihr Schwert, sprengte die Schlösser der Haupttüren, stürmte hinein, sprengte die zweiten Türen auf.
Irgendwo tauchte in ihren Gedanken das Gefängnis von Hatteras auf, die Visionen, die sie dort mit vierzehn Jahren gehabt hatte. So viel Ähnlichkeit.
Doch hier lebten Soldaten, griffen nach ihren Waffen. Gerade als Gewehrfeuer laut wurde, schlug sie zu, entflammte Waffen, die Hände verbrannten, mit Blasen überzogen, sodass Männer vor Schmerzen aufschrien. Sie schwang ihr Schwert, schwang ihren Schild, kämpfte sich voran.
Hinter den Stahltüren wurden Rufe, Stöhnen, Flehen laut, und sie spürte die Furcht, die schreckliche Hoffnung, die Qual und Verwirrung der Eingekerkerten.
Davon überwältigt streckte sie einen Soldaten nieder, der zu seinem Funkgerät stürzte, zerschlug es mit ihrem Schwert, jagte einen Schockblitz durch das gesamte System.
Funken sprühten, Bildschirme wurden schwarz.
Stiefel schepperten auf metallenen Treppen, und Tod, noch mehr Tod, kam ihnen entgegen, während Pfeile die Luft durchschnitten. Eine Kugel schlug in Fallons Schild, sie schickte das Geschoss postwendend zu dem Schützen zurück und drehte sich der eisernen Tür zu, die jemand innerhalb des Gefängnisses hatte sichern können.
Sie sprengte die Tür auf, setzte zwei Feinde dahinter außer Gefecht und tötete einen dritten mit dem Schwert, während sie über die rauchenden Metallteile sprang und auf die nach unten führende Treppe zueilte.
Kriegsgeschrei folgte ihr. Ihre Truppen schwärmten aus, drangen überall ein – in die Kaserne, in Büros, einen Speisesaal, eine Küche, die Krankenstation.
Sie selbst stürmte mit ihren Leuten zu dem Labor mit seiner Schreckenskammer. Dort, noch eine Eisentür. Sie wollte eben mit ihrer Kraft ausholen, hielt dann jedoch im letzten Moment inne, da sie plötzlich etwas Dunkles spürte.
Magie, schwarz und tödlich.
Mit erhobener Hand stoppte sie ihre Begleiter, zwang sich zu Geduld und forschte nach. Stand da in voller Größe, in ihren von Elfen gefertigten Stiefeln, einer Lederweste und mit kurzem schwarzem Haar, der Blick durch ihre Kraft verschwommen.
»Tretet zurück«, befahl sie, schulterte ihren Schild, steckte das Schwert in die Scheide und legte die Hände an die Tür, die Schlösser, den Rahmen, das dicke Metall.
»Eine versteckte Sprengladung«, murmelte sie. »Wenn wir sie eindrücken, explodiert sie. Geht zurück.«
»Fallon.«
»Trete zurück«, sagte sie zu ihrem Vater. »Ich könnte sie abstellen, aber das würde zu lange dauern.« Sie hielt Schwert und Schild wieder vor sich. »In drei, zwei …«
Sie forcierte ihre Kraft, Licht gegen Finsternis.
Die Tür brach auf, spuckte Feuer, versprühte gezackte, flammende Metallteile. Splitter krachten auf ihren Schild, zischten vorüber und bohrten sich in die Wand hinter ihr, doch sie warf sich mitten in den Tumult.
Und sah den Mann, nackt, mit glasigen Augen, ausdrucksloser Miene, auf einen Untersuchungstisch gefesselt. Ein zweiter in einem Laborkittel zuckte zurück und kletterte so schnell er konnte die hintere Wand hinauf.
Sie schleuderte Kraft an die Decke, sodass der im Kittel zu Boden ging; gleichzeitig wich Simon dem Skalpell eines Dritten aus und erledigte ihn dann mit einem raschen Stich.
»Sucht nach weiteren«, ordnete Fallon an. »Konfisziert sämtliche Unterlagen. Zwei sichern diesen Teil ab, der Rest verteilt sich und stellt sicher, dass die Etage frei ist.«
Sie ging zu dem Mann auf dem Tisch. »Kannst du sprechen?«
Sie hörte seine Gedanken, bekam mit, wie er um Worte rang.
Sie haben mich gefoltert. Ich kann mich nicht bewegen. Hilf mir. Werdet ihr mir helfen?
»Wir sind hier, um zu helfen.« Sie steckte das Schwert ein und beobachtete seine Miene. Auf ihn konzentriert hielt sie die gedankliche Verbindung mit ihm.
»Hier drüben ist eine Frau«, rief Simon. »Unter Drogen, aufgeschnitten, aber sie atmet.«
Sie haben uns verletzt, wehgetan. Helft uns.
»Ja.« Fallon legte eine Hand auf eine der Fesseln, und sie öffnete sich. »Wie lange seid ihr schon hier?«
Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Bitte. Bitte.
Sie ging um den Tisch herum und befreite den Mann von der zweiten Fessel. »Hast du dich für die Finsternis entschieden, bevor oder nachdem du hierherkamst?«, fragte sie stumm.
Er bäumte sich auf, mit Häme im Blick, und versuchte, sie mit einem Blitz zu treffen. Sie schmetterte ihn mit ihrem Schild zurück und durchbohrte den Mann mit seiner eigenen Waffe.
»Das werden wir nun wohl nie mehr erfahren«, murmelte sie.
»Lieber Gott. Fallon.« Simon stand da, das Gewehr im Anschlag, die Frau hing schlaff über seiner Schulter.
»Ich musste auf Nummer sicher gehen. Kannst du einen Arzt für sie besorgen?«
»Ja.«
»Wir machen die restlichen Räume klar.«
Nachdem das getan war, stand fest, dass sie dreiundvierzig Gefangene transportieren mussten. Die restlichen würden sie begraben. Sanitäter rückten an, um die Verwundeten beider Seiten zu behandeln, und Fallon begann mit der mühsamen Überprüfung der in Zellen eingesperrten Gefangenen.
Einige, das wusste sie, waren womöglich so wie die im Labor. Andere waren vielleicht geistig gebrochen, und konnten deshalb ebenfalls gefährlich werden.
»Mach mal Pause«, sagte Simon zu ihr und drückte ihr eine Tasse Kaffee in die Hand.
»Bei einigen steht noch nicht alles fest.« Sie nahm einen Schluck und sah ihrem Vater ins Gesicht. Er hatte das Blut abgewischt, und seine braunen Augen waren klar. Vor langer Zeit war er schon einmal Soldat gewesen. Und nun war er es wieder.
»Sie müssen in eines der Behandlungszentren gebracht werden, bevor sie gehen können. Warum fühlt sich das nur immer so an, als würden wir sie gefangen halten?«
»Das sollte es nicht, weil es gar nicht unsere Intention ist. Einige werden nie mehr klar im Kopf sein, Fallon, und trotzdem lassen wir sie gehen, solange sie nicht eine reale Gefahr darstellen. Aber jetzt sag mir, woher du wusstest, dass der Kerl auf dem Labortisch ein Schurke war.«
»Zuerst einmal war er nicht so mächtig, wie er glaubte, und das habe ich bemerkt. Aber der Zauber an der Tür, das war ganz klar Hexerei. Der andere Magische im Labor war ein Elf. Ein übler Elf«, sagte sie mit einem angedeuteten Grinsen. »Elfen sind gut darin, Schlösser zu überwinden, aber sie können sie nicht verzaubern. Dann habe ich beim Lösen der ersten Fessel seinen Puls gefühlt, und der schlug heftig. Wenn er eine paralysierende Droge intus gehabt hätte, wäre das nicht der Fall gewesen.«
»Aber du hast die zweite auch noch gelöst.«
»Das hätte er auch selbst machen können.« Sie zuckte die Achseln. »Ich hätte ihn gerne befragt, aber … na ja.« Sie leerte ihre Tasse und pries im Geiste ihre Mutter und die anderen Hexen, die in New Hope eine tropische Zone geschaffen hatten, sodass sie Kaffee anbauen konnten. »Weißt du über die Frau Bescheid, die sie vom Tisch geworfen haben?«
»Eine Fee. Sie wird nie mehr fliegen können – sie haben ihr den größten Teil des linken Flügels abgetrennt – aber sie lebt. Deine Mom hat sie in der mobilen Praxis.«
»Gut. Die Fee hatte das Glück, dass sie sie einfach auf den Boden warfen, anstatt sie zu töten. Sobald wir mit unseren verletzten Gefangenen fertig sind, brauche ich dich für die Befragungen. Ich weiß, dass dir das schwerfällt«, fügte sie hinzu. »Es sind Soldaten, und die meisten von ihnen befolgen einfach nur Befehle.«
»Es sind Soldaten«, stimmte er zu, »aber sie blieben bei der Folterung ihrer Gefangenen und der Unterbringung von Kindern in Zellen untätig oder unterstützten das sogar. Nein, Kind, das fällt mir nicht schwer.«
»Ich könnte es ohne dich machen, weil ich es machen muss, aber ich weiß nicht, wie ich das ohne dich schaffen sollte.«
Er drückte ihr einen Kuss auf die Stirn. »Das musst du auch nie herausfinden.«
Fallon sprach mit magischen Kindern – blutsverwandt oder adoptiert –, die ihren nichtmagischen Eltern weggenommen worden waren, brachte zwei wieder zusammen, bei denen ein Elternteil in einer anderen Zelle gefangen gehalten worden war.
Sie sprach mit jenen, die jahrelang eingesperrt gewesen waren, und solchen, die man erst vor Tagen eingeliefert hatte.
Sie überprüfte jede einzelne Person anhand der sehr genauen, vom – nun verschiedenen – Gefängniskommandanten persönlich geführten Unterlagen, sah sich die entsetzlichen Aufzeichnungen über die im Labor durchgeführten Experimente an.
Die beiden Dunklen Übernatürlichen – der Hexer und der Elf –, die in dem Labor gearbeitet hatten, hatten ihre wahre Natur verborgen; deshalb hatte sie nichts über Magische in der Belegschaft in Erfahrung bringen können.
Informationen haben eben auch ihre Grenzen, dachte Fallon, während sie den Hexer als verstorben und den Elf als Kriegsgefangenen deklarierte.
Der Sturm legte sich, die Dämmerung brach an, und sie machte einen letzten Rundgang durch das Gebäude. Reinigungsteams waren bereits damit beschäftigt, Blutflecken von Böden, Wänden und Treppen zu entfernen. Das Versorgungsteam hatte alles eingesammelt, was wertvoll genug war, um es mitzunehmen – Lebensmittel, Geräte, Fahrzeuge, Waffen, Kleidung, Schuhe, medizinische Güter. Alles würde erfasst und dort ausgegeben werden, wo es am nötigsten gebraucht wurde, oder bis zu einer späteren Benutzung eingelagert werden.
Gräber wurden ausgehoben. Zu viele Gräber, dachte Fallon, als sie hinausging und über den matschigen Boden schritt. Doch heute gruben sie keines für einen von ihnen, und das machte den Tag zu einem guten Tag.
Flynn kam aus dem Wald geglitten, an seiner Seite sein Wolf Lupa.
»Sieben Gefangene müssen noch weiter behandelt werden«, sagte er. »Deine Mom hilft, sie nach Cedarsville zu transportieren. Dort ist die nächste Klinik, in der ihre Verletzungen behandelt werden können. Die anderen sind unterwegs ins Sammellager nach Hatteras.«
»Gut.«
Flynn, dachte sie, er ist schnell – ein Elf eben –, effizient und verlässlich wie der Fels, mit dem er verschmelzen konnte. Als Teenager hatte er ihre Mutter und ihren leiblichen Vater getroffen und sich ihnen angeschlossen.
Nun war er ein Mann und einer ihrer Truppenführer.
»Wir brauchen hier ein rotierendes Einsatzkommando«, fuhr sie fort. »Hatteras ist schon fast voll, also werden wir diese Anlage hier nutzen.«
Sie zählte einige Namen für das Einsatzkommando auf, darunter auch den ihres Bruders Colin.
»Ich kümmere mich darum«, erklärte Flynn. »Aber Colin wurde bei dem Einsatz verwundet, deshalb …«
»Was?« Sie wirbelte zu Flynn herum und packte ihn heftig am Arm. »Was höre ich da gerade?«
»Du bist die Eine, aber die Mutter der Einen ist ausgesprochen ängstlich; wenn sie also sagt, ich soll es für mich behalten, dann tue ich das. Es geht ihm gut«, fügte Flynn rasch hinzu. »Er hat eine Kugel in die Schulter abbekommen, aber sie ist entfernt, und die Wunde schon fast wieder verheilt. Denkst du, deine Mom würde mit verwundeten Feinden mitfahren, wenn ihr Sohn nicht okay wäre?«
»Nein, aber …«
»Sie wollte nicht, dass du dich aufregst, und dein Bruder auch nicht – der ist übrigens mehr wütend als verwundet. Dein Dad hat ihn bereits in die mobile Praxis gesteckt, die nach New Hope zurückfährt.«
»Okay, gut.« Dennoch fuhr sie sich frustriert durch das kurze Haar. »Verdammt.«
»Wir haben dreihundertzweiunddreißig Personen befreit und niemanden verloren.« Flynn stand da, groß und schlank, und blickte mit seinen intensiv grünen Augen auf das Gebäude zurück. »Niemand wird in diesem Drecksloch mehr gefoltert werden. Freu dich über deinen Sieg, Fallon, und mach dich auf den Heimweg. Wir sind hier sicher.«
Sie nickte und ging in den Wald, sog den Geruch der feuchten Erde ein. Hier, in dieser sumpfigen Gegend des früheren Virginia, nahe der Grenze zu Carolina, summten und brummten Insekten, und der Essigbaum wuchs in dichten Reihen.
Sie ging weiter, bis sie im schimmernden Kreis der Morgensonne stand, und rief dann Laoch.
Er glitt aus den Lüften herab und stand groß und weiß vor ihr, die Silberschwingen ausgebreitet, das Silberhorn glänzte.
Da sie trotz des Sieges todmüde war, presste sie für einen Augenblick das Gesicht an seinen starken Hals. In diesem Moment war sie nicht mehr als ein Mädchen, mit schmerzenden Prellungen, die grauen Augen geschlossen, das Blut der Getöteten auf dem Hemd, ihrer Hose, ihren Stiefeln.
Dann schwang sie sich in den goldenen Ledersattel. Sie ritt ihr Alicorn ohne Zügel.
»Baile«, murmelte sie ihm zu. Nach Hause.
Und Laoch stieg mit ihr in den blauen Morgenhimmel auf.
Als sie bei dem großen Haus zwischen der Kaserne von New Hope und der Farm ankam, auf der Eddie und Fred mit ihren Kindern lebten, saß ihr Vater wartend auf der Terrasse, die Füße auf dem Geländer und einen Becher Kaffee in der Hand.
Er war frisch geduscht, bemerkte sie, das dichte braune Haar noch feucht. Er stand auf, kam ihr entgegen und legte eine Hand an Laochs Hals.
»Geh hinein und sieh ihn dir an. Er schläft, aber dir wird es dann besser gehen. Ich kümmere mich um Laoch, und dann steht für uns beide ein warmes Frühstück in der Röhre.«
»Du wusstest, dass er verwundet wurde.«
»Ich wusste, dass er verwundet wurde, und ich wusste, dass er okay war.« Simon legte eine Pause ein, bis sie sich beruhigt hatte. »Deine Mom meinte, wir sollten es dir erst sagen, wenn du fertig bist. Daran ist nicht zu rütteln, das weißt du …«
»Schon in Ordnung. Ich sehe ihn mir an, und dann dusche ich. Danach Frühstück, das wäre in Ordnung. Was ist mit Travis und Ethan?«
»Travis arbeitet in der Kaserne mit neuen Rekruten. Ethan ist drüben bei Eddie und Fred und hilft mit dem Vieh.«
»Okay, alles gut.«
Nun, da sie wusste, wo ihre anderen Brüder waren, wollte sie nach Colin sehen.
Sie ging hinein und auf die Treppe zu. Dieses Haus wird wohl nie ein echtes Heim werden, dachte sie dabei. Die Farm, auf der sie geboren wurde, wo sie aufgewachsen war, würde immer ihr Zuhause bleiben. Dieser Ort hier, ebenso wie die Hütte im Wald, wo Mallick sie ausgebildet hatte, diente lediglich einem Zweck.
Sie ging zu Colins Zimmer. Der lag mit ziemlich schäbigen Boxershorts bekleidet auf seinem Bett und schnarchte heldenhaft.
Fallon ging zu ihm und legte leicht – sehr leicht – eine Hand auf seine rechte Schulter. Steif, schmerzend, konstatierte sie, aber eine saubere Wunde, die gut heilte.
Ihre Mutter verfügte über große Fähigkeiten, erinnerte sie sich. Dennoch nahm sie sich noch eine Minute und berührte sein Haar – blond, jedoch dunkler als das ihrer Mutter, und zu einem kurzen, dicken Kriegerzopf geflochten.
Er hatte den Körper eines Kriegers – muskulös und zäh, mit dem Tattoo einer geringelten Schlange auf dem linken Schulterblatt. (Gestochen mit sechzehn und ohne Erlaubnis der Eltern.)
Sie verweilte noch einen Moment im Chaos seines Zimmers – er sammelte nach wie vor, was immer an kleinen Schätzen ihm wertvoll erschien. Seltsame Münzen, Steine, Glasstücke, Drähte, alte Flaschen. Und offenbar hatte er nie gelernt, auch nur ein Kleidungsstück einmal aufzuhängen oder zusammenzulegen.
Von ihren drei Brüdern verfügte er als Einziger nicht über magische Fähigkeiten. Und als Einziger schien er ein geborener Soldat zu sein.
Sie ließ ihn schlafen und ging wieder hinunter ins Erdgeschoss.
Anders als bei Colin war ihr Zimmer sehr ordentlich. An der Wand hingen Landkarten – von Hand gezeichnet oder gedruckt, alte und neue. In der Truhe am Fuß des Betts verwahrte sie Bücher – Romane, Biografien, Geschichtswerke, Literatur über Wissenschaft und Zauberei. Auf dem Schreibtisch lagen Akten über Truppen, Zivilisten, Ausbildung, Standorte, Gefängnisse, Lebensmittellager, Sanitätsartikel, Manöver, Zauber, Dienstpläne und Schichtwechsel.
Auf dem Nachttisch stand eine weiße Kerze, daneben lag eine Kristallkugel – Geschenke des Mannes, der sie ausgebildet hatte.
Sie zog sich aus, steckte ihre Kleidung in den Wäschekorb und trat mit einem tiefen Seufzer in die Dusche, um sich vom Blut, Schweiß, Schmutz und Gestank der Schlacht zu reinigen.
Danach schlüpfte sie in eine an den Knien abgetragene Jeans, die ihr kaum mehr bis an die Knöchel reichte, und ein T-Shirt. Sie zog ihr zweites Paar Stiefel an, denn die in der Schlacht getragenen musste sie erst noch putzen.
Schließlich legte sie noch ihr Schwert an und ging dann nach oben, um mit ihrem Vater zu frühstücken.
»Deine Mutter ist zurück«, sagte er, während er angewärmte Teller aus der Röhre holte. »Sie macht noch einen Besuch in der Klinik, ist aber wieder hier.«
»Ich gehe nach dem Frühstück zu ihr.« Sie nahm sich ein Glas Fruchtsaft, da sie etwas Kaltes wollte.
»Du brauchst Schlaf, Baby. Du bist seit mehr als vierundzwanzig Stunden auf den Beinen.«
Rührei, knuspriger Bacon. Sie aß, als sei sie halb verhungert. »Du auch«, sagte sie.
»Ich habe auf dem Rückweg etwas geschlafen – und auf der Terrasse auch ein wenig, bevor du ankamst.«
Sie nahm sich noch einmal von dem Rührei. »Ich habe nicht einen Kratzer abbekommen. Keinen einzigen. Soldaten, die ich anführte, schon. Colin ist verletzt. Und mir fehlt absolut nichts.«
»Du hast früher schon einiges abbekommen.« Er legte eine Hand auf ihre. »Und du wirst auch wieder verletzt werden.«
»Ich muss mich um die Verwundeten kümmern, sollte mich bei ihnen sehen lassen. Und bei den Geretteten. Dann gehe ich schlafen.«
»Ich begleite dich.«
Sie blickte zur Decke und dachte an den Soldaten, der oben schlief. »Du solltest bei Colin bleiben.«
»Ich hole Ethan, der soll sich zu ihm setzen. Deine Mom sagte, er wird wahrscheinlich bis zum Nachmittag schlafen.«
»Okay. Gib mir einen Eindruck von den Gefangenen«, sagte sie mit einem Seufzer.
»Unterschiedlich. Einige Hartgesottene, die voller Hass sind und sich vor Magischen fürchten. Die sind nun mal, wie sie sind. Aber von den jüngeren können wir womöglich einigen etwas beibringen.«
»Sie müssen die Laboraufzeichnungen sehen. Sie müssen sehen, wie Menschen unter Drogen gesetzt, festgezurrt, gefoltert und für Experimente missbraucht wurden, nur weil sie anders sind.«
Obwohl ihr das, was sie in dem Gefängnis gesehen hatte, den Magen umdrehte, aß sie weiter. Sie musste zu Kräften kommen, um funktionieren zu können.
»Das sollte sie etwas lehren.«
Die Verbitterung in ihrem Ton war nicht zu überhören, er tätschelte noch einmal ihre Hand. »Du hast recht. Aber gib ihnen noch ein paar Tage Zeit. Viele von ihnen rechnen damit, von uns gefoltert oder hingerichtet zu werden. Wir zeigen ihnen, dass wir unsere Gefangenen human und anständig behandeln.«
»Und dann zeigen wir ihnen den Beweis für das Gegenteil«, fuhr sie fort. »Gut. Aber einige werden sich nie ändern, nicht wahr?«
»Nein.«
Sie stand auf, nahm seinen und ihren Teller zum Abwaschen mit zur Spüle. »Es ist zwecklos zu fragen weshalb, aber ich komme immer wieder darauf zurück. Vor zwanzig Jahren endete die Welt, die du kanntest, die Mom kannte. Milliarden kamen durch das Verderben auf schreckliche Weise um. Wir sind die Übriggebliebenen, Dad, und wir bringen uns gegenseitig um.«
Sie sah ihn an, diesen guten Mann, der mitgeholfen hatte, sie auf die Welt zu bringen, der sie geliebt, mit ihr gekämpft hatte. Ein Soldat, der Farmer geworden war, und nun ein Farmer, der wieder das Leben eines Soldaten führte.
Er hatte keine magischen Fähigkeiten, und dennoch verkörperte er alles, wofür das Licht stand.
»Du hast nicht gehasst oder dich gefürchtet«, sagte sie. »Du hast zuerst dein Heim und dann dein ganzes Leben einer Fremden geöffnet, einer Hexe, und einer Verfolgten. Du hättest sie abweisen können, mit mir in ihr, aber das hast du nicht getan. Warum nicht?«
So viele Antworten, dachte Simon. Er entschied sich für eine. »Sie war ein Wunder, so wie du, in ihr. Und die Welt brauchte Wunder.«
Sie lächelte ihm zu. »Sie wird sie bekommen, ob sie es will oder nicht.«
Sie ritt mit ihm in den Ort, auf ihrem Pferd Grace, um ihr etwas Aufmerksamkeit zu schenken und sie zu bewegen. Die sanften Hügel waren jetzt im Sommer üppig grün und voller Wildblumen. Fallon roch frisch umgegrabene und bepflanzte Erde, hörte die Rufe, das Klirren von Metall aus der Kaserne, wo Rekruten trainierten.
Ein Rudel Rehe weidete an einem steilen, dicht mit Bäumen bestandenem Hang. Der Himmel über ihnen strahlte nach dem Sturm in einem weichen, hoffnungsfrohen Blau.
Auf der gewundenen Straße nach New Hope waren keine liegen gebliebenen Autos mehr zu sehen – man hatte sie alle mühsam zu einer entlegenen Werkstatt geschleppt, wo sie repariert oder in Einzelteile zerlegt wurden.
Häuser, dachte Fallon. Die meisten waren inzwischen in gutem Zustand und bewohnt. Diejenigen, die nicht gerettet werden konnten, waren – wie die Fahrzeuge – zur weiteren Verarbeitung abgetragen worden: Holz, Rohre, Fliesen, Kabel, alles, was noch brauchbar war. Auf den Wiesen und Weiden grasten Rinder, Ziegen, Schafe, einige Lamas und Pferde hinter sorgfältig instand gehaltenen Zäunen.
An einer Biegung der Straße war der Zauber der Tropen zu spüren, die zu schaffen ihre Mutter mitgeholfen hatte. Dort stand ein Hain mit Zitrusgewächsen, Olivenbäumen, Palmen, Kaffee- und Pfeffersträuchern und anderen Kräutern und Gewürzen. Menschen, die dort arbeiteten, winkten zu ihnen herüber.
»Ein Wunder«, sagte Simon nur.
Sie passierten die Sicherheitsschleuse und ritten nach New Hope hinein. Auf dem Höhepunkt des Verderbens hatte es hier nichts als Tod und Geister gegeben. Nun lebten mehr als zweitausend Menschen im Ort, und ein Erinnerungsbaum gemahnte an die Toten. Der Gemeinschaftsgarten und die Treibhäuser waren zweimal Ziel eines schlimmen Überfalls gewesen; nun wuchs und gedieh hier alles bestens. Die Gemeinschaftsküche, die ihre Mutter vor Fallons Geburt eingerichtet hatte, bereitete täglich Mahlzeiten zu.
Die Max Fallon Magick Academy, benannt nach ihrem leiblichen Vater, die Schulen von New Hope, das Rathaus, die für Tausch und Handel geöffneten Geschäfte, die Privathäuser an der Hauptstraße, die Klinik, die Bücherei, das Leben, das durch Schweiß, Entschlossenheit und Opfer wieder zurückgekommen war.
War nicht all das, fragte sie sich, ebenso ein Wunder?
»Du vermisst die Farm«, sagte sie, während sie die Pferde zu den Pferdestangen und den Trögen führten.
»Ich gehe bestimmt wieder dorthin zurück.«
»Du vermisst die Farm«, wiederholte sie. »Du hast sie meinetwegen verlassen, deshalb freue ich mich jedes Mal, wenn ich nach New Hope komme, dass du sie für einen guten Ort mit guten Leuten verlassen hast.«
Sie stieg ab, streichelte Grace und band die Zügel um die Stange.
Dann ging sie mit Simon zur vormaligen Grundschule, die nun die Klinik von New Hope beherbergte.
Vieles hatte sich über die Jahre verändert – Fallon war durch die Kristallkugel zurückgegangen, um zu sehen, wie alles angefangen hatte. Im Eingangsbereich standen Stühle für die, die auf ihre Behandlung warten mussten. In einer Ecke gab es Bücher und Spielsachen, die in aufgegebenen Häusern eingesammelt worden waren.
Einige Kleinkinder spielten mit Bauklötzen – eines davon flatterte erfreut mit seinen Flügeln. Eine schwangere Frau saß da und strickte, auf einem anderen Stuhl lümmelte offensichtlich gelangweilt ein Teenager. In einem Sessel kauerte gebückt, mit röchelndem Atem, ein alter Mann.
Während sie auf das Büro zugingen, eilte Hannah Parsoni – die Tochter der Bürgermeisterin und Schwester von Duncan und Tonia – mit einem Klemmbrett in der Hand und einem Stethoskop um den Hals den rechten Flur hinunter.
Ihre üppige blonde Mähne war zu einem langen Zopf geflochten. Die dunkelbraunen, warmen Augen begannen vor Freude zu leuchten, als sie die beiden erkannte. »Ich hatte gehofft, euch zu sehen. Aber im Moment haben wir viel zu tun!«, setzte sie hinzu. »Deshalb habe ich kaum Zeit für euch. Rachel lässt mich mit den angemeldeten und den spontan kommenden Patienten arbeiten, und ich habe auch bei der ersten Untersuchung der Verwundeten geholfen. Wir haben niemanden verloren. Einige der Leute, die ihr befreit habt …«
Eine Welle des Mitgefühls ging von ihr aus, die so stark war, dass Fallons Haut zu kribbeln begann.
»Einige werden eine längere Behandlung und Therapie brauchen, aber niemand ist mehr in einem kritischen Zustand. Lana – sie ist ein Wunder. Wie geht es Colin?«
»Er schläft«, antwortete Simon.
»Kein Fieber, keine Infektion«, fügte Fallon hinzu.
»Sagt es auf jeden Fall eurer Mom. Sie weiß es zwar, aber es würde ihr helfen, es zu hören.«
In der ihr eigenen Art, Fürsorge anzubieten, berührte Hannah sie beide. »Ihr seht beide ganz schön müde aus.«
»Vielleicht sollte ich ein wenig …«
Fallon wollte eine Hand ans Gesicht führen, doch Hannah ergriff sie. »Einen Zauber? Tu das lieber nicht. Die anderen können die Anstrengung in deinem Gesicht ruhig sehen. Sie sollten wissen, was es einem abverlangt, was die Freiheit kostet. Dass du auch einen Preis dafür zahlst.«
Sie drückte Fallons Hand und ging dann weiter. »Hey, Mr. Barker, gehen wir rein, damit wir Sie anschauen können.«
Der alte Mann keuchte, röchelte. »Ich kann auf die Frau Doktor warten.«
»Wollen Sie nicht schon mal mit ins Untersuchungszimmer kommen? Ich kann dann alles für Rachel herrichten.«
Trösten und den anderen annehmen anstatt beleidigt zu sein, dachte Fallon. Das war Hannah – Hannah, die schon fast von Kindheit an gelernt und eine Ausbildung absolviert hatte, um Ärztin zu werden, und jahrelang als Rettungssanitäterin gearbeitet hatte. Geduld, erkannte Fallon, war Hannahs eigene Form von Magie.
Sie sah das Mädchen im Büro an einem Computer arbeiten – etwas, das sie selbst noch nicht sehr gut beherrschte. April, erinnerte sie sich. Eine Fee, ungefähr in ihrem Alter. Verwundet bei dem Überfall im Gemeinschaftsgarten vor zwei Jahren.
Ein Angriff, den Fallons eigene Verwandtschaft angeführt hatte, ihre Cousine, die Tochter des Bruders ihres leiblichen Vaters und dessen Frau. Dunkle Übernatürliche, die nichts mehr wünschten als ihren Tod.
Das Mädchen blickte auf und begann zu lächeln. »Hey, hallo. Sucht ihr Lana?«
»Ich wollte nach den Verwundeten sehen – nach allen, die dazu bereit sind.«
»Wir haben die befreiten Gefangenen behandelt und durchgecheckt und in der Aula der Schule untergebracht. Die Truppen, die behandelt und durchgecheckt wurden, haben wir in die Kaserne zurückgeschickt. Die restlichen sind im Krankensaal. Jonah und Carol machen Rundgänge, und Ray überwacht die, die wir bereits entlassen haben. Heute Morgen waren wir alle im Einsatz. Und jetzt?« Sie zeigte ihr strahlendes Feenlächeln. »Rachel und Lana entbinden gerade ein Baby!«
»Ein Baby?«
»Eine der Gefangenen …«
»Lissandra Ye, Wolf-Gestaltwandlerin«, ergänzte Fallon – sie hatte sämtliche Berichte gelesen. »Aber sie sollte doch erst in acht Wochen so weit sein.«
»Sie bekam in der mobilen Praxis Wehen, auf dem Weg hierher, die nicht gestoppt werden konnten.« April presste die Lippen aufeinander, denn sie war etwas in Sorge. »Sie haben so eine Art Neugeborenenintensivstation eingerichtet, so gut es eben geht. Aber ich habe bemerkt, dass Rachel sich Sorgen macht, auch wenn Jonah sagte, er sehe keinen Tod.
Das würde er doch sehen, nicht wahr?«, hakte April nach, um sich zu vergewissern. »Das würde Jonah wissen.«
Fallon nickte und ging hinaus.
»Der Tod ist nicht die einzig mögliche Konsequenz.« Sie sprach leise mit Simon. »Lissandra Ye war vierzehn Monate lang in diesem Gefängnis. Sie wurde dort vergewaltigt, und sogar nachdem sie schwanger wurde, machten sie weiter Experimente mit ihr.«
»Du musst deiner Mutter und Rachel vertrauen.«
»Das tue ich.«
Sie ging einen anderen Korridor hinunter. Klassenräume, zu Untersuchungs-, Behandlungs-, und Sprechzimmern umfunktioniert, andere zu Lagern für Medikamente.
Geburtswehen und Entbindung. Sie legte eine Hand an die Tür, spürte die Kraft dahinter. Die Kraft ihrer Mutter. Hörte Rachels beruhigende Stimme und das Stöhnen der Frau, die in den Wehen lag.
»Das tue ich«, wiederholte sie und ging weiter zu der weitläufigen Cafeteria, die nun als Abteilung für Patienten diente, die kontinuierlich behandelt oder beobachtet werden mussten.
Vorhänge – erbeutet oder selbst gefertigt – trennten die Betten voneinander; ihre Buntheit und ihre Muster erzeugten eine beinahe fröhliche Atmosphäre. Die Monitore piepten. Nicht genug, nicht annähernd genug für so viele Patienten. Deshalb wurden sie je nach Bedarf durchgewechselt, wie Fallon wusste.
Sie sah Jonah, er hängte gerade einen frischen Infusionsbeutel auf und sah so erschöpft aus, wie sie sich selbst fühlte.
»Fang du auf Jonahs Seite an«, schlug Simon vor, »und ich auf der von Carol.«
Also ging sie zu Jonah und der Fremden, die mit geschlossenen, von dunklen Ringen umgebenen Augen im Bett lag. Ihre Haut war aschfahl, das tiefschwarze Haar brutal kurz geschoren.
»Wie geht es ihr?«, fragte sie Jonah.
Er rieb sich die müden Augen. »Dehydriert, unterernährt – das ist bei allen so. Verbrennungen – alte und neue – auf etwa dreißig Prozent des Körpers. Man hat ihr die Finger gebrochen und dann nichts weiter gemacht. Deine Mutter hat daran gearbeitet, und wir denken, sie wird ihre Hände wieder gebrauchen können. Laut ihren Unterlagen war sie über sieben Jahre lang da drinnen, länger als die meisten anderen Insassen.«
Fallon warf einen Blick auf das Krankenblatt. Naomi Rodriguez, dreiundvierzig Jahre alt. Hexe.
»Den Unterlagen zufolge hat sie sich um einen Elf gekümmert.«
»Dimitri«, sagte Jonah. »Er kennt seinen Nachnamen nicht oder kann sich nicht daran erinnern. Er ist zwölf. Es geht ihm gut, so weit man das von irgendeinem von ihnen sagen kann. Er war schließlich einverstanden, mit einigen der Frauen zu gehen, die wir entlassen konnten.«
»Okay. Ich möchte …«
Sie brach ab, als die Frau die Augen öffnete und sie anstarrte. Augen, die fast so schwarz waren wie die Ringe darum herum.
»Du bist die Eine.«
»Fallon Swift.«
Die Frau ergriff Fallons Hand. Keine physischen Schmerzen, bemerkte sie – darum hatten sich die Mediziner gekümmert. Doch die seelischen Qualen konnten sie nicht lindern.
»Mein Junge.«
»Dimitri. Es geht ihm gut. Ich werde ihn bald besuchen.«
»Wir bringen ihn zu Ihnen«, fügte Jonah hinzu. »Sobald wir können. Er ist jetzt in Sicherheit, so wie Sie auch.«
»Sie haben ihm eine Waffe an den Kopf gehalten, deshalb musste ich mit ihnen gehen. Sie sagten, sie würden ihn gehen lassen, wenn ich es täte, aber das war gelogen. Alles gelogen. Sie haben mich und meinen Jungen mit Drogen vollgepumpt. Er war doch nur ein Kind. Ich durfte ihn nicht sehen, aber ich konnte ihn fühlen, hören. Sie hielten uns unter Drogen, sodass wir unsere Kraft nicht finden konnten. Manchmal waren wir stunden- oder tagelang mit verbundenen Augen geknebelt und gefesselt. Sie brachten uns zu diesem Helfershelfer und seinen Teufeln, die uns folterten. Manche schienen sich zu schämen, aber sie haben uns trotzdem hingebracht. Und sie wussten, was die uns antaten.«
Sie schloss die Augen wieder. Tränen quollen unter den Lidern hervor, rannen über ihre Wangen. »Ich habe meinen Glauben verloren.«
»Sie müssen sich nicht schämen.«
»Ich wollte töten; anfangs überlebte ich nur, weil ich mir vorstellte, sie alle umzubringen. Dann wollte ich bloß mehr sterben, einfach alles beenden.«
»Sie müssen sich dafür nicht schämen«, wiederholte Fallon, und die gepeinigten Augen öffneten sich wieder.
»Aber du hörst mir zu, obwohl ich sagte, ich habe keinen Glauben mehr.«
Fallon beugte sich zu ihr. »Siehst du mich? Siehst du das Licht in mir?«
»Es ist wie die Sonne.«
»Ich sehe dich, Naomi. Und ich sehe das Licht in dir.« Da Naomi den Kopf schüttelte, legte Fallon ihr eine Hand auf die Wange und ließ etwas von diesem Licht in sie fließen. »Sie haben dein Licht abgeschwächt, aber ich sehe es. Ich sehe das Licht, das strahlte, das einen ängstlichen Jungen aufnahm, einen kleinen, verwirrten, bekümmerten Jungen, und ihm ein Zuhause gab. Ich sehe das Licht, das bereit war, sich für diesen Jungen zu opfern. Ich sehe dich, Naomi.«
Fallon richtete sich auf. »Ruh dich nun aus und werde gesund. Wir bringen Dimitri zu dir.«
»Ich werde mit dir kämpfen.«
»Wenn du wieder gesund bist«, erwiderte Fallon und ging zum nächsten Bett.
Es dauerte fast zwei Stunden. Sie scherzte mit einem Soldaten, der behauptete, erschossen worden zu sein, und dann habe man ihn getreten und sei auf ihn getrampelt, als wäre das völlig normal und alltäglich. Sie tröstete die Verzweifelten, besänftigte die Verwirrten.
Bevor sie ging, sah sie den knochendürren, dunkelhäutigen Jungen an Naomis Bett sitzen. Stockend, mit ungeübter, eingerosteter Stimme, las er ihr aus einem der Kinderbücher aus dem Wartezimmer vor.
Fallon ging hinaus, um Luft zu schnappen, sah, dass ihr Vater es ihr gleichgetan hatte und gerade eben ihre Mutter küsste.
»Geht nach Hause, da habt ihr doch ein ganzes Haus für euch.«
Lana blickte mit glockenblumenblauen Augen zu ihr und grinste. »Da ist ja mein Mädchen.« Sie ging auf Fallon zu und umarmte sie fest. »Du bist so müde.«
»Da bin ich nicht allein.«
»Nein, bist du nicht.« Sie ließ sie los. »Wir haben niemanden verloren. Dank der Göttin.«
»Auch das Frühgeborene nicht?«
»Auch das nicht. Es war hart, aber schließlich brachte ich das Baby dazu, sich zu drehen. Rachel wollte einen Kaiserschnitt vermeiden, es sei denn, er wäre in Steißlage geblieben.«
»Er.«
»Brennan. Etwa vier Pfund schwer und vierzig Zentimeter groß. Rachel ist noch bei ihm, aber sie ist zufrieden mit ihm, und mit der Mutter auch – sie ist zäh.«
»Wie du. Geh jetzt nach Hause, schau nach Colin, und dann leg dich schlafen.«
»Mache ich. Wir werden uns hier gegenseitig ablösen. Gehen wir alle nach Hause.«
»Ich muss noch mit den Leuten in der Aula reden, dann komme ich auch.«
Mit einem Nicken strich Lana durch Fallons Haar. »Du wirst merken, dass einige von ihnen mehr Zeit brauchen, um sich zu akklimatisieren. Katie ist mit der Unterbringung beschäftigt – es sind so viele, und viele von ihnen sollte man noch nicht allein lassen.«
»Wir haben Freiwillige, die einige aufnehmen werden«, erklärte Simon. »Die Stabileren können die Quartiere nehmen, die wir vor der Rettungsaktion vorbereitet haben. Aber einige werden einfach nur gehen wollen.«
»Das sollten sie nicht tun, jedenfalls noch nicht, aber …«
»Ich rede mit ihnen«, versicherte ihr Fallon und führte ihre Mutter zu den Pferden. »Möchtest du dich nach Hause beamen?«
»Reiten wäre eigentlich ganz gut.« Lana wartete, bis Simon aufsaß, und schwang sich dann hinter ihn, als ob sie – die vormalige Großstädterin aus New York – schon ihr Leben lang geritten wäre. »Komm bald nach Hause«, sagte sie, schmiegte sich an Simon und legte die Arme um ihn.
Das ist Liebe, dachte Fallon, als sie davonritten. Vielleicht war das das größte Wunder. Sie zu fühlen, sie zu geben, sie zu kennen.
Dann schwang sie sich auf Grace und ritt zur Schule, in der Hoffnung, die Gefolterten, die Erschöpften, die Niedergeschlagenen überzeugen zu können, wieder an das Leben zu glauben.
Kapitel 2
Als Fallon zu Hause ankam, sah sie Ethan aus dem Stall kommen, und wie gewöhnlich waren die Hunde Scout und Jem bei ihm. Dass er in letzter Zeit so stark gewachsen war, schockierte sie noch immer ein wenig. Sie erinnerte sich noch sehr gut an den Tag seiner Geburt, zu Hause, in demselben großen Bett, in dem auch sie, Colin und Travis das Licht der Welt erblickt hatten.
Sein erster Schrei hatte in ihren Ohren wie ein Lachen geklungen. Als sie ihn das erste Mal halten durfte, hatte er sie mit diesem eindringlichen, intensiven Blick eines Neugeborenen angesehen, und sie hätte schwören können, dass er sie angrinste.
Mit diesem ersten lachenden Hallo hatte das Baby der Familie seine sonnige Natur offenbart und tat dies seither jeden Tag. Nur dass er nun, Fallon gestand es sich mit einigem Widerstreben ein, kein Baby mehr war.
Obwohl nach wie vor ein wenig schmächtig gebaut, hatte Ethan einige Muskeln bekommen. Er hatte das karamellfarbene Haar ihrer Mutter und wunderschöne blaue Augen, doch bei der Größe geriet er wohl nach ihrem Vater, denn er schien in kürzester Zeit gleich einige Zentimeter in die Höhe geschossen zu sein.
Beim Absteigen bemerkte sie, dass er nach Stall roch – er hatte zweifellos ausgemistet.
»Wie geht es Colin?«
»Mom sagt gut. Er hat die ganze Zeit geschlafen, während Mom und Dad weg waren. Und er schläft wahrscheinlich immer noch.« Er musterte sie, nahm Graces Zügel, und die Hunde sprangen hoch und verlangten Aufmerksamkeit. »Du solltest auch schlafen.«
»Mache ich. Was ist mit Travis?«
»Er kam für ein paar Minuten nach Hause, nur um bei uns reinzuschauen. Er springt für Colin beim Rekrutentraining ein, deshalb musste er gleich wieder zurück.«
Ihr mittlerer Bruder mochte noch immer einen Hang zu Streichen haben, aber Travis stand stets zuverlässig seinen Mann und setzte sich ein.
»Grace freut sich, dass du mit ihr geritten bist«, sagte Ethan und brachte es fertig, die Hunde und das Pferd gleichzeitig zu tätscheln. Ethan hatte eine starke Verbindung zu Tieren – er spürte, wie sie dachten, was sie fühlten, was sie brauchten. Das war seine Gabe. »Sie hätte jetzt gern eine Karotte.«
»Ach ja?«
Fallon stellte sich den Garten vor, die Karottenbeete, die orangenen Spieße in der Erde, die grünen Büschel darüber. Sie suchte eine aus, formte die Worte in ihren Gedanken, streckte eine Hand aus.
Und hielt eine frische Karotte darin. Ethan neben ihr lachte.
»Die ist aber schön!«
»Ich arbeite noch immer daran.« Fallon wischte an ihrer Jeans die Erde von der Karotte ab und gab sie ihrer treuen Stute.
»Ich kümmere mich um sie«, sagte Ethan. »Geh du schlafen. Von Mom soll ich dir sagen, dass noch Nudeln da sind, falls du Hunger hast. Die beiden sind auch todmüde.«
»Okay. Danke, Ethan.«
Er führte Grace weg, blieb dann aber noch einmal stehen. »Als Eddie zurückkam – ich war gerade drüben auf der Farm, um Fred zu helfen –, sagte er, es war abscheulich, was sie den Leuten angetan haben, die ihr gerettet habt. Genau so hat er es genannt.«
»Das stimmt. Abscheulich, das ist genau das richtige Wort dafür.«
»Er sagte, sie hatten dort auch kleine Kinder eingesperrt.«
»So war es. Jetzt sind sie in Sicherheit, niemand wird ihnen mehr etwas antun.«
Seine wunderschönen blauen Augen, die denen ihrer Mutter so glichen, trübten sich ein. »Es hat nie irgendeinen Sinn, weißt du? Böse zu sein macht einfach keinen Sinn.«
Ethan, dachte sie auf dem Weg zum Haus, würde sich immer dafür entscheiden, freundlich zu sein. Zu wissen, dass er tagtäglich für den Krieg trainierte, widerstrebte ihr.
Sie warf einen Blick auf die Nudeln, beschloss, dass sie mehr müde als hungrig war, ging geradewegs nach unten.
Und fand Colin, der im Familienzimmer auf sie wartete. Offenbar war er hungrig aufgewacht, denn auf dem Tisch standen eine leere Schüssel, ein Teller und ein Glas.
Ein gutes Zeichen, dachte sie, wie auch seine Farbe und der klare Blick seiner braunen Augen.
»Wie geht es deiner Schulter?«
Er zuckte mit der heilen und hob den anderen Arm in der Schlinge. »Geht schon. Mom sagt, ich muss noch den ganzen Tag lang dieses blöde Ding da tragen, und morgen vielleicht auch noch, also versuche ich, keine ruckartigen Bewegungen zu machen. Aber es nervt.«
»Wenn du nicht aufpasst, bekommst du Probleme mit ihr.«
»Ich weiß.« Er mochte ein furchtloser Soldat sein, aber er war nicht so dumm, sich mit ihrer Mutter anzulegen. »Eine irre Schlacht, was?«
Sie ließ ihn reden. Sie wusste, er brauchte das ebenso wie es auch die meisten Männer und Frauen gebraucht hatten, die sie in der Klinik aufgesucht hatte.
»Im Grunde haben wir eine Säuberungsaktion durchgeführt, weißt du das? Mann, wir waren ihnen verdammt auf den Fersen, Fallon. Das war, als du unten in der Folterkammer warst. Eddie sagte jedenfalls, dass du da unten warst.«
Er lief beim Reden hin und her – eine nervöse Angewohnheit, die sie durchaus auch von sich selbst kannte.
»Einige der Feen arbeiteten also an den Zellenschlössern, weil wir alles unter Kontrolle hatten, richtig? Einige von ihnen, die total unter Drogen standen, konnte man hören, wie sie um Hilfe riefen. Und Kinder, die weinten. Oh Gott.«
Hier legte er eine Pause ein. »Wirklich, Kinder. Das ist einfach nicht zu fassen. Jedenfalls, dieser Typ fällt hin, hält die Hände hoch. Ich neutralisiere keinen, der sich ergibt, also gehe ich zu ihm, um ihm die Waffen abzunehmen – er legte sie schließlich nieder, verdammt. Und, glaub es oder nicht, Fallon, einer von seinen eigenen Leuten knallt ihn ab und trifft mich am Arm, bevor ich ihn ausradieren konnte.«
Ein Soldat durch und durch, und einer, der eine starke Gemeinschaft von Kriegern – und Kriegerinnen – gebildet hatte. Kein Wunder, dass Colins Abscheu mit Wut einherging.
»Der Typ hat seinen eigenen Mann erschossen. Seinen eigenen, unbewaffneten Mann. Wer zum Teufel tut denn so etwas?«
»Ein total überzeugter Anhänger«, erwiderte sie nur. »So einen wahren Gläubigen darf man nicht unterschätzen.«
»Also, was immer dieser Mistkerl glaubte, ich glaube, dass er jetzt in der Hölle schmort. Er erschoss einen eigenen Mann, der die Hände hochhielt.« Er zuckte noch einmal mit der heilen Schulter. »Wir sind sie zum Glück los. Hast du mit Clarence gesprochen?«
»Ja. Es geht ihm gut.«
»Gut. Gut. Ich habe gesehen, wie er zu Boden ging, konnte aber nicht zu ihm.«
»Die meisten unserer Verwundeten wurden versorgt und dann entlassen. Die anderen müssen noch etwas länger in der Klinik bleiben, aber sie werden alle wieder.«
»Ja, das hat Mom auch gesagt. Ich glaube, ich gehe mal ins Dorf, nachsehen, wie es ihnen allen so geht.«
»Gib Ethan Bescheid, damit er es Mom und Dad sagen kann, falls ich noch schlafe.«
»Klar.« Er räumte seinen Teller, die Schüssel und das Glas auf. Dann sah er ihr in die Augen, von Krieger zu Kriegerin.
»Es war eine gute Mission. Dreihundertzweiunddreißig Gefangene befreit.«
»Dreihundertdreiunddreißig. Eine hat gerade ein Baby bekommen.«
»Ach, echt?« Er grinste. »Tolle Sache. Bis später.«
Sie ging in ihr Zimmer, er nach oben. Er ist zum Farmer erzogen worden, dachte sie, und er liebt Basketball, gibt gern ein wenig an und mag kleine Schätze. Einmal hatte er behauptet, Präsident zu werden. Das wird er nicht, dachte Fallon, während sie sich auszog. Er war ein Soldat und würde immer einer bleiben. Und zwar ein verdammt guter.
Sie zog ein zu großes T-Shirt an, das sie vor Jahren einmal erbeutet hatte und zusammen mit Jungen-Boxershorts zum Schlafen hernahm. Es war schon unzählige Male gewaschen worden, deshalb war das Bild des Mannes mit der Gitarre darauf schon fast verblichen. Ihr Dad nannte den Mann The Boss und sagte, er sei – oder war, wer wusste das schon? – eine Art Rock-Troubadour gewesen.
Sie hatte kein musikalisches Talent, aber sie wusste, was es hieß, der Boss zu sein.
Und so schlüpfte sie in ihr Bett und dankte den Göttern, dass niemand, den sie liebte oder befehligte, umgekommen war. Und als die Stimmen, die Geschichten, die Albträume derer, die zu retten sie geholfen hatte, zusammen mit ihren Ängsten, ihrer Dankbarkeit und ihren Tränen in ihrem Kopf widerhallten, befahl sie sich, das alles abzuschalten.
Und zu schlafen.
Sie erwachte bei Mondlicht und herbstlicher Kühle in der Luft. Nebel kroch über den Boden, dünner Rauch, der sich durch den Steinkreis wand. Frost, schneidend wie Diamanten, glitzerte am hohen Gras des Felds.
Der Wald dahinter krachte und stöhnte im Wind.
»Na gut.« Neben ihr blickte Duncan über das Feld, über den Wald hinweg und musterte sie dann mit einem scharfen Blick aus dunkelgrünen Augen. »Das kommt unerwartet. Hast du mich mit reingezogen?«
»Ich weiß es nicht.«
Sie hatte ihn fast zwei Jahre lang nicht gesehen, und auch damals nur kurz, als er sich nach New Hope gebeamt und Bericht erstattet hatte. Sie wusste, dass er an Weihnachten zurückkommen würde, um seine Familie zu besuchen, weil Tonia es erwähnt hatte.
Er hatte New Hope vor Jahren im Herbst verlassen, nach der Schlacht im Gemeinschaftsgarten, bei der er einen Freund verlor, der wie ein Bruder für ihn gewesen war. Und bei der sie den Bruder ihres leiblichen Vaters, den Mörder, niederschlug – und Simon Swift ihn tötete.
Er war weggegangen, um bei der Ausbildung von Truppen zu helfen, mit Mallick, ihrem Lehrer, zu arbeiten, an einem Stützpunkt weit genug weg, um ihnen beiden Zeit und Raum zu geben.
»Na gut«, sagte er noch einmal. »Da wir nun schon mal hier sind.« Er hatte die Hand auf das Heft seines Schwerts gelegt und suchte erneut den Wald, die Schatten, die Nacht ab. »Ich hörte, die Rettungsaktion war ein Volltreffer. Großartig«, fügte er hinzu und blickte sie erneut an. »Wir hätten euch helfen können.«
»Wir waren genug Leute dafür. Aber es kommen noch weitere. Du …«
Er trug das Haar nun länger als früher, bemerkte sie, oder er hatte sich einfach nicht darum gekümmert, es zu schneiden. Locken fielen über den Kragen seiner Jacke. Auch rasiert war er nicht, sein Gesicht – seine kantigen Züge – bedeckte ein Dreitagebart.
Sie wünschte, das hätte ihm nicht so gut gestanden. Sie wünschte, sie würde nicht dieses … Verlangen nach ihm spüren.
»Ich?«, hakte er nach.
»Ich bin durcheinander. Ich mag das nicht.« Sie hörte den Ärger in ihrem Ton, doch es war ihr gleichgültig. »Vielleicht hast du mich ja mit reingezogen.«
»Kann ich dir nicht sagen. Absichtlich war es so oder so nicht. Für mich war Sommer, Abend. Ich war in meinem Quartier und dachte daran, einen langen Tag mit einem Bierchen abzuschließen. Wir haben in unserem Stützpunkt eine hübsche kleine Brauerei. Und du?«
Sie befahl sich, Ruhe zu bewahren, und antwortete auf die gleiche Weise. »Sommer, der Tag nach der Rettung. Ich war gerade nach Hause gekommen. Ich schlief. Es könnte inzwischen Abend sein.«
»Okay, dann sind wir wahrscheinlich beide in der selben Zeit. Aber hier ist nicht Sommer. MacLeod-Land, das Land der Verwandtschaft meiner Mutter. Der erste Schild, der, den mein Großvater zerbrach.«
»Die Finsternis zerbrach den Schild. Der Junge, der Mann, zu dem er wurde, war ein Werkzeug, unschuldig. Er war unschuldig.«
Ihr Ton veränderte sich, wurde tiefer, denn eine Vision überkam sie. Sie veränderte sich, glühte geradezu. Er hatte das schon einmal gesehen. »Es geht los«, murmelte er.
»Du bist von ihm, Duncan von den MacLeods. Ich bin von ihm, denn wir sind von den Tuatha de Danann. So wie unser Blut und der Flecken des Blutes von dem, was wartet, den Schild für die Magie öffnete, für die lichtvolle wie auch für die dunkle, so wird Blut ihn wieder schließen.«
»Wessen Blut?«
»Unseres.«
»Also, dann tun wir es.« Er zog sein Messer aus der Scheide am Gürtel und schickte sich an, seine Handfläche zu ritzen.
»Noch nicht!« Sie ergriff seinen Arm, und er spürte die Kraft in ihr, durch ihn, strömen. »Du riskierst sonst, alles zu öffnen, riskierst das Ende von allem. Hungersnot und Flut, verbrannte Erde und die Asche der Welt. Es kommt noch so vieles mehr. Magien erheben sich, lichtvolle und dunkle, dunkle und lichtvolle. Sturm tost, Schwerter klirren.«
Nun legte sie eine Hand auf sein Herz, und was er fühlte, war fast zu viel. Jeder Muskel seines Körpers bebte, als ihr Blick aus von Visionen getrübten Augen den seinen traf. »Ich bin bei dir, in der Schlacht, im Bett, im Leben, im Tod. Aber nicht diese Nacht.
Hörst du die Krähen?«
Er blickte auf, sah sie kreisen. »Ja. Ich höre sie.«
»Sie warten, es wartet, wir warten. Doch die Zeit kommt.«
»Kann nicht bald genug kommen«, murmelte er.
Sie lächelte ihm zu, und etwas in diesem Blick war schlau und verführerisch und voller Kraft.
»Du denkst an mich.«
»Ich denke an vieles.« Gott, sie machte ihm den Mund wässrig. »Vielleicht solltest du wieder zu dir kommen.«
»Du denkst an mich«, wiederholte sie, ließ die Hände seine Brust hinauf gleiten und schloss sie hinter seinem Nacken. »Und an das.«
Ihr Körper schmolz an seinen, ihr Mund strich über seinen, einmal, zweimal. Neckend, verlockend. Ein wildes Lachen quoll aus ihrem Hals. Alles tat ihm weh, überall und gleichzeitig, und er wollte, begehrte sie, mehr als er ertragen konnte.
»Zum Teufel damit. Mit allem.«
Nun, als er seine Lippen auf die ihm angebotenen presste, kam etwas wie Triumph aus ihrer Kehle.
Sie schmeckte nach der Wildnis und erweckte in ihm eine tiefe Sehnsucht. Nach Wildheit und Freiheit, dem Unbekannten – und doch stets Bekannten. Verzweifelt bewegten sich seine Hände über ihren Körper – endlich –, während er den Kuss vertiefte, heftiger wurde.
Krähen kreisten über ihnen, die Steine trieben durch den Nebel, der Wind rauschte wie wilde Musik über Wald und Feld.
Heftig an sie gepresst, mit wild hämmerndem Herzen, hätte er sie auf den von Frost überzogenen Boden gezerrt, sie am Einstieg in das Verderben genommen.
Doch mit einem plötzlichen Aufbranden entrüsteter Kraft stieß sie ihn von sich, ließ ihn fast die Balance verlieren.
Schnaubend starrte er sie an, sah, dass sich die Visionen verflüchtigt hatten. Sein Gegenüber war nun eine ausgesprochen wütende Frau.
»Was zum Teufel ist los mit dir?«, fuhr sie ihn an. »Du glaubst wohl, wir sind hierhergekommen, damit du auf mich losgehen kannst und …«
»Ich weiß nicht, warum in aller Welt wir hier sind, aber du wirst das nicht mir anhängen. Du hast damit angefangen, Schwester. Du hast mich angemacht.«
»Ich …«
Er beobachtete, wie ihr Zorn zu Verwirrung wurde, und dann – zumindest eine kleine Befriedigung – zu Entsetzen und Scham.
»Ich war nicht ich selbst.«
»Quatsch. Du bist immer du selbst, Visionen hin oder her.« Und er war noch immer so verdammt aufgedreht, so begierig, dass er sich beherrschen musste, um nicht zu zittern. »Die Masche mit den Visionen zieht bei mir nicht.«
»Tut mir leid.« Sie sagte es steif, aber sie sagte es. »Ich weiß nicht, warum …«
»Schon wieder Quatsch. Wir wissen beide warum. Früher oder später werden wir das zu Ende bringen und sehen, ob es das ist oder nicht. In der Zwischenzeit …«
»Ich bin keine Aufreißerin.«
»Keine was?«
Noch immer war so viel heiße Erregung in ihr, merkte sie. So viel Lust – sie war nicht so halsstarrig, sich das nicht einzugestehen – und so viel Verlegenheit. »So nennt Colin Mädchen, die Jungs anmachen und sie dann im Regen stehen lassen. So bin ich aber nicht.«
»Nein, so eine bist du nicht.« Etwas gefasster richtete er den Blick wieder auf sie. »Wir fühlen, was wir fühlen, du und ich. Einer der Gründe, warum ich wegging, war, weil ich noch nicht bereit bin, es zu fühlen. Ich vermute, bei dir ist es genauso.«
»Für mich wäre es leichter, du würdest wütend bleiben.«
»Und für mich wäre es leichter, wenn ich dich haben könnte. Pech für uns beide.« Er blickte zum Himmel, verfolgte die kreisenden Krähen. »Wir waren hier schon einmal, du und ich.«
»Ja. Und wir werden wieder herkommen. Was wir dann tun, was wir in der Zwischenzeit tun … und danach? Es ist alles so bedeutungsvoll. Da kann ich nicht an … Sex denken.«
»Jeder denkt an Sex«, erwiderte er abwesend. »Ich habe dir gesagt, ich würde nach New Hope zurückkommen. Ich habe dir außerdem gesagt, ich würde deinetwegen kommen, und das werde ich.«
Er zog sein Schwert, entflammte es, schoss Feuer auf die Krähen. Als sie verbrannten und niederfielen, wandte er sich wieder ihr zu. »Du denkst auch an mich.«
Sie erwachte, das Licht des Sommerabends schien sanft durch ihre Fenster. Seufzend wälzte sie sich aus dem Bett und zog sich an, um zu ihrer Familie zu gehen.
Duncan kam mit demselben unsanften Ruck in sein Quartier zurück.
»Miststück!«
Er ließ sich auf seine Schlafstelle sinken, um Atem zu schöpfen. Das war anders als das Beamen, dachte er. Letzteres brachte das Blut zwar ebenfalls – wenn auch nur leicht – in Wallung, doch dies – das Kommen wie das Gehen – fühlte sich an wie aus einer Kanone geschossen zu werden.
Er hatte absolut nichts dafür übrig.
Er brauchte ein Bier und vielleicht ein schönen, langen Spaziergang. Er musste Fallon wieder in die Finger kriegen. Nein, nein, er wollte sie berühren, in seinen Armen halten – das war etwas ganz anderes als bloßes Begehren.
Er hatte fast zwei Jahre lang keinen direkten Kontakt mit ihr gehabt, erinnerte er sich, stand auf und ging im Schlafzimmer des Hauses auf und ab, das er sich mit Mallick teilte. Und er hätte das auch noch länger vermieden, wenn sie ihn nicht angemacht hätte.
Aber es war nicht ihr Fehler – nicht ganz zumindest. Er war nicht so dumm, das nicht zu sehen. Sie hatten sich da in etwas verstrickt – das Beste war wohl, es einfach dabei zu belassen.