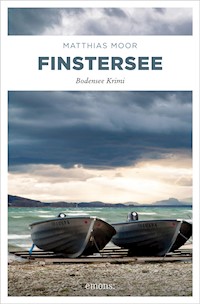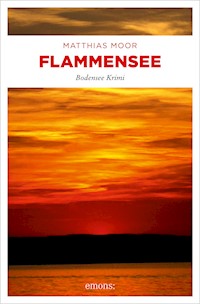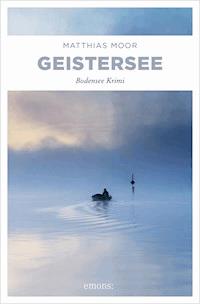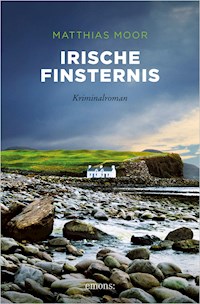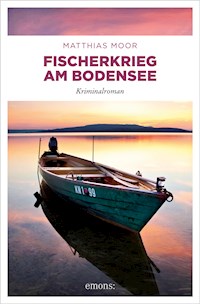Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Martin Schwarz
- Sprache: Deutsch
Ein ergreifender Kriminalroman, der ein Stück Geschichte am Bodensee lebendig werden lässt. Im Hegau wird an der Schweizer Grenze bei Waldarbeiten ein Skelett entdeckt. Jahrzehntelang lag es unter der Erde, die Polizei steht vor einem Rätsel. Bis sich eine ältere Dame bei Privatdetektiv Martin Schwarz meldet und behauptet, der Tote sei ihr verschollener Vater. Der jüdische Lehrer wollte während der Zeit des Nationalsozialismus aus Deutschland fliehen. Schwarz soll herausfinden, was damals geschah, und stößt dabei auf verstörende Ereignisse, deren lange Schatten bis in die Gegenwart reichen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 505
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Sammlungen
Ähnliche
Matthias Moor, Jahrgang 1969, lebt seit über dreißig Jahren am Bodensee. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder, arbeitet als Gymnasiallehrer und Autor und liebt den Bodensee mit seinen vielgestaltigen Landschaften. Wenn mal nichts anliegt, fährt er am liebsten mit seinem Boot zum Angeln auf den See hinaus.
Besuchen Sie den Autor auf www.matthias-moor.de.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2023 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: lookphotos/age fotostock
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Carlos Westerkamp
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-98707-030-3
Bodensee Krimi
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Dieser Roman wurde vermittelt durch die Literaturagentur Beate Riess, Freiburg.
All den Menschen gewidmet,
Der Roman spielt teilweise zur Zeit des Nationalsozialismus und hat diesen zum Thema. Die Unmenschlichkeit des nationalsozialistischen Regimes drückt sich auch in seiner »vergifteten« Sprache aus. Deshalb werden von der NS
Prolog
Elvira war vierzehn. Sie warf die Schultasche in die Ecke, doch ihre Mutter zuckte nicht einmal. Wie abwesend saß sie hinter dem Küchentisch. Elvira erschrak, auch wenn sie nicht zum ersten Mal so dasaß: graugesichtig und mit einem leeren, trostlosen Blick. Die Mutter starrte auf ihre Kaffeetasse, seit dem Frühstück musste sie so verloren dasitzen. Unfähig, sich zu regen, unfähig, sich von dem zu lösen, das sie quälte. Da wusste Elvira, dass die dunkle Zeit wieder begonnen hatte.
Wo bist du, Mama?, fragte sie sich, wie sie sich das immer fragte, wenn eine solche Phase anbrach. Mittlerweile hatte sie eine dunkle Ahnung, durch welch grausame Gefilde ihr Geist schweifte, doch Genaues wusste sie nicht.
Graugesichtig, trostlos, leer: Elvira war überzeugt, dass ihre Mutter schon auf diese Weise in die Welt geblickt hatte, als sie Elvira stillte. Natürlich konnte sie daran keine Erinnerungen haben, dennoch war die Vorstellung Wirklichkeit: Sie trank an der Brust ihrer Mutter, doch die nahm sie gar nicht wahr, fühlte ihr Kind nicht, sondern starrte in ein alles verschlingendes Nichts.
Sie liebt dich nicht, das spürte Elvira schon als Baby, noch bevor sie es denken konnte, und auch wenn sie tief in ihrem Inneren wusste, dass das nicht stimmte, ließ sie das Gefühl nie los.
Du bist schuld, dachte sie, ohne zu wissen, woran. Und die Scham war wie ein Magnet, der alle Kräfte aus ihr saugen wollte, dem sie mit aller Macht widerstehen musste.
Über ihren Vater wusste sie nicht viel. Er war vor ihrer Geburt gestorben. An einer schlimmen Krankheit, hatte die Mutter ihr erzählt, mehr nicht, doch Elvira ahnte, dass das nicht stimmte.
Die Mutter musste ihn sehr geliebt haben, wohl mehr, als sie ihre Tochter liebte. Auch ihre Großeltern waren tot. Sie beide waren allein auf der Welt, und wenn die dunkle Zeit anbrach, gab es niemanden außer Elvira.
Sie betrachtete die erstarrte Mutter, ging zu ihr in die Küche, wollte tief Luft holen, doch der Gedanke an die nächsten Wochen schnürte ihr die Kehle zu. Sie setzte sich ihr gegenüber, die Mutter schien keine Notiz davon zu nehmen.
Es gab andere Phasen, wo es schon im Treppenhaus nach einem leckeren Mittagessen roch, in denen die Mutter sie mit einem herzlichen Lachen empfing. In denen die Mutter fröhlich und gesprächig war, wie es ihrer Natur entsprach. Früher war Elvira dann in ihre Arme gelaufen und hatte sie fest an sich gedrückt, aus Freude und weil sie so hoffte, die Mutter im Leben halten zu können. Sie gingen in den Zoo oder einkaufen und fuhren am Wochenende ans Meer. Elvira hoffte dann, dass die dunkle Zeit, in der die Mutter zu einem Gespenst wurde, endgültig vergangen wäre.
Doch sie kehrte immer wieder, immer wieder. Immer wieder. Elvira spürte, wenn das Lachen der Mutter bloß gespielt, sie in ihren Gedanken ganz woanders war. Da wusste sie, dass sie bald selbst die Tür aufschließen und das Essen kochen musste.
Mittlerweile hoffte Elvira nur noch darauf, dass die guten Phasen möglichst lang anhielten und die schlechten nur Wochen und nicht Monate dauerten. Dass ihre Mutter überhaupt noch lebte, wenn sie nach Hause kam.
»Warum bist du so traurig? Was ist los?«, fragte sie, während die Mutter reglos auf die Kaffeetasse starrte. Sie fragte das zum hunderteintausendsten Mal, ohne eine Antwort zu erwarten. Ihre Stimme klang, als wäre sie vor langer Zeit auf Tonband aufgenommen worden.
»Es ist wegen deines Vaters«, antwortete sie mit brüchiger Stimme. Überrascht, erschrocken, mit großen Augen sah Elvira sie an.
Da begann die Mutter zu erzählen. Sie würde ihr das, sagte sie, nur ein einziges Mal erzählen.
Danach war Elviras Brust erfüllt von Trauer, Schmerz und einer unermesslichen Wut, die sie wie ein Raubtier zerreißen wollte.
***
Elvira war seit zwei Monaten achtzehn und kam zu Besuch aus Tel Aviv, wo sie studierte, als sie ihre Mutter tot im Bett fand. Sie hat gewartet, bis ich achtzehn geworden und ausgezogen bin, war ihr erster Gedanke. Sie war bestürzt, traurig, doch nicht verzweifelt oder überrascht. Sie hatte schon lange damit gerechnet, es war zu erwarten gewesen.
Die Sorge um Elvira hatte sie im Leben gehalten, hatte sie vom Selbstmord abgehalten. Vielleicht mehr die Sorge, dachte sie, als die Liebe. Wäre ihre Mutter damals nicht mit ihr schwanger gewesen, wer weiß, vielleicht wären ihre Eltern heute beide noch da.
Elvira hatte sich früh von ihrer Mutter lösen müssen, um zu überleben, um von ihrer Trauer und ihrem Schmerz nicht mit hinabgezogen, nicht davon verschlungen zu werden. Sie hatte früh gelernt, sich andere Menschen zu suchen, auf die sie zählen konnte, Freundinnen und einige Lehrer. Sie lernte, das Trauma der Mutter zu akzeptieren und zu verstehen, auch um sie nicht hassen zu müssen.
Sie hasste ihre Mutter nicht, doch die Trauer, der Schmerz und die Wut würden sie zeitlebens begleiten, würden immer ein Teil von ihr sein. Sie waren das Vermächtnis ihrer Mutter, zusammen mit dem fröhlichen Lachen, mit dem sie in den guten Tagen die Wohnungstür geöffnet hatte.
Diese Geister ihrer Mutter würde sie nie wieder los.
1
Martin Schwarz saß mit einem Bierchen in seinem Lieblingssessel vor dem Fenster und blickte hinaus auf den Überlinger See. Wo an klaren Tagen die Schweizer Alpen zu sehen waren, hatte sich an diesem Abend ein Sommergewitter zusammengebraut, eine gigantische, alles verschlingende Wolkenfront, die allmählich näher rückte und bald lospoltern würde. Doch noch war es ruhig, abgesehen von einem dumpfen Grollen in der Ferne, als bebten leise die Berge.
Seit der Kindheit mochte Martin diesen Anblick, wenn es plötzlich düster wurde, als wäre blaue Stunde, und die Welt den Atem anhielt. Man wusste, dass Schlimmes drohte, aber auch, dass man selbst in Sicherheit war.
Die Front hatte fast alle Farben verschwinden lassen, alles war in ein dunkles Blaugrau getaucht, mit einem schwachen violetten Schimmer und nur wenigen, sich kaum voneinander abhebenden Schattierungen. Da waren die schweren Wolken, die jeden Moment auf den See hinabzustürzen schienen, das stille, glatte Wasser, das bald aufgepeitscht sein würde, und die Insel Mainau, die wie ein Zauberberg daraus hervorstieg. Und die reglose alte Weide am Ufer vor ihrem Haus. Als Kind hatte er sie für einen Riesen gehalten, der nachts zum Leben erwachte, die dürren Zweige wie Haar schüttelte und das Haus vor Geistern schützte.
Martin lächelte. Er liebte es, diese Märchenwelt aus seinen Kindertagen, die von Rittern, Feen und in den Tiefen des Bodensees schlummernden Ungeheuern bevölkert war, für seine sechsjährige Tochter Kim zu neuem Leben zu erwecken. Auch deshalb, zur Inspiration, saß er abends gern hier am Fenster mit seinem Feierabendbier. Zumal er für heute Abend noch keine Geschichte hatte. Und diese Geschichten für Kim gerade wichtiger waren denn je. Wie wäre es also, wenn im Mainau-Schloss ein böser Hexenmeister wohnte, der der Welt das Licht rauben und es in sein Schloss sperren würde? Alle Tage wären dann wie Nächte, bestünden aus Schiefer, Basalt und Granit, und jede Freude wäre verschwunden.
Martin atmete tief ein und trank noch einen Schluck. Kim machte ihm gerade Sorgen. Seit fast anderthalb Jahren lebte er von seiner Frau Elsa getrennt. Sie bemühten sich, das Leben für Kim so angenehm wie möglich zu gestalten, dennoch litt sie. Was ja auch verständlich war: Kim wünschte sich, dass ihre Eltern wieder zusammenkommen würden, dass sie nicht zwei Zuhause hätte, sondern eins, dass sie nicht jede Woche zwischen Konstanz und Waldshut pendeln müsste, dass ihre Welt und ihr Herz nicht mehr zerrissen wären.
Seit ein paar Monaten hatte Elsa einen neuen Partner, und Martin hatte den Eindruck, dass Kim ihn nicht sonderlich mochte. Jedenfalls fuhr sie nicht mehr so gern am Wochenende zu ihrer Mutter und freute sich nur darauf, wenn der Neue auf Reisen war. Kim wollte nicht darüber sprechen, und Martin respektierte das. Er konnte auch nicht verhehlen, dass ihn Kims Antipathie erleichterte. Denn die Angst, dass Kim zur Mutter ziehen könnte, ließ ihn manchmal schlecht schlafen.
Martin hatte diesen Per Stenhoven noch nicht kennengelernt, ihn aber gegoogelt. Der Mittfünfziger war ein renommierter Psychiater, Professor an der altehrwürdigen ETH und Leiter einer schlossähnlichen Privatklinik in Zürich, in der Mitglieder der globalen Oberschicht, die an traurigen Herzen litten, therapiert wurden. Dazu war dieser Per noch gut aussehend, durchtrainiert, in diversen gemeinnützigen Vereinigungen ehrenamtlich engagiert und vernetzt bis in hohe Kreise der Schweizer Politik. Ein wahrer Musterknabe, allem Anschein nach. Und auch beruflich passte es perfekt: Elsa hatte eine psychoanalytische Praxis in Waldshut, da konnten sie abends bei einem Glas Rotwein über die Störungen ihrer Patienten fachsimpeln.
Tja, dieser Per war eine andere Liga als er: ein Ex-KSK-Soldat, der vor über zehn Jahren traumatisiert aus Afghanistan zurückgekehrt war und sich dann, nach einigen alkoholumnebelten Jahren, mühsam aus einem Sumpf aus Schuldgefühlen, Selbstmitleid und Lebensmüdigkeit herausgekämpft und eine kleine Detektei gegründet hatte, die zwar nicht schlecht lief, aber auch nicht allzu viel abwarf. Ein Haus mit großem Seegrundstück wie das, in dem er lebte, würde er sich selbst in zwanzig Leben als Privatdetektiv nicht leisten können, und auch das war ein Grund, weshalb er immer noch bei seiner Mutter wohnte. Nicht zuletzt daran war seine Ehe gescheitert.
Martin seufzte und trank noch einen Schluck. Dass er die schweren Jahre überlebt hatte, verdankte er in erster Linie Elsa, und das würde er ihr nie vergessen. Bei seinem ersten großen Fall war er seiner ehemaligen Mitschülerin auf einem Klassentreffen wiederbegegnet, sie verliebten sich sofort ineinander und verbrachten eine wilde Nacht in seiner Trinkerhöhle. Ihre Liebe, ihre Achtung und ihr Vertrauen gaben ihm in dieser harten Zeit die Kraft, wieder aufzustehen; als er noch am Boden lag und sich gerade aufzuraffen begann, hatte sie den Mann in ihm gesehen, der er sein könnte, und daran geglaubt, dass er so werden würde. Durch Elsas Vertrauen hatte er seinen inneren Kompass wiedergefunden, wobei dieser nie so präzise anzeigte, wohin es im Leben gehen sollte: Die Nadel sprang oft und zitterte und drehte sich auch mal um hundertachtzig Grad. Anders als bei Per Stenhoven, schätzte Martin, bei dem hatte sie wohl schon steil nach Norden gezeigt, als er das Licht der Welt erblickte.
Jetzt waren Elsa und er also getrennt. Dabei ging es Martin nicht so schlecht wie Kim. Er mochte Elsa nach wie vor, doch er liebte sie nicht mehr; der Schmerz, den er die ersten Monate nach der Trennung verspürt hatte, war verwunden. Elsa und er hatten sich geeinigt, dass Kim unter der Woche bei ihm und seiner Mutter lebte. Die mit seiner Tochter verbrachte Zeit war für ihn wie ein Geschenk: die Spaziergänge am See entlang zur Insel Mainau, die Brettspielenachmittage, die Radtouren, das Baden und Angeln von ihrem Grundstück aus, wenn sie selbst gefangene Aale über offenem Feuer brieten … Müsste er sich für nur eine Sache im Leben entscheiden, fiele ihm das nicht schwer: Er wollte Kim ein guter Vater sein. Insofern gab sein Kompass ihm jetzt doch eine klare Richtung vor.
Und dann war da noch die Sache mit Alexandra Kaltenbacher. Martin lächelte, als er sie vor seinem geistigen Auge sah. Die dreißigjährige Journalistin hatte er bei seinem letzten Fall kennengelernt. Sie begannen eine Affäre, begehrten und mochten sich, er liebte und vermisste sie – wohl wissend, dass daraus nichts werden würde: Alexandra war über zwanzig Jahre jünger als er, sie lebte in München, war weltoffen, gern unterwegs, skeptisch gegenüber festen Beziehungen und kein einfacher Charakter. Gut, das war er auch nicht. Das wollte er auch gar nicht sein, zumindest meistens.
Obwohl sie beide wussten, dass aus ihrer Beziehung nichts werden würde (oder vielleicht gerade deshalb?), und obwohl sie beide so taten, als wären sie gar nicht richtig zusammen, hielten sie ständig Kontakt, schrieben sich täglich Nachrichten, schickten sich Bilder und besuchten sich regelmäßig. Und fielen dann, wenn Kim endlich schlief, wie ausgehungerte Tiere übereinander her.
Wobei er sich manchmal fragte, was sie an ihm fand. Sein Körper wurde alt, die Haut faltig, das Bindegewebe schwächer, und obwohl er sich felsenfest vorgenommen hatte, seinen Bauchspeck abzutrainieren, war es ihm bisher nur ansatzweise gelungen, er klebte an ihm wie ein Fluch. Und die Muskeln wuchsen auch nicht so, wie er sich das erhofft hatte. Na ja, da waren die paar Hantelübungen an zwei, drei Tagen in der Woche halt zu wenig. Da müsste er wohl Stereoide fressen. Oder hieß es »Steroide«? Doch wie kam man an so was ran?
Vier Mal war Alex inzwischen schon bei ihm in Konstanz gewesen. »Was für ’ne Bonzenhütte«, hatte sie beim ersten Mal mit ungläubigem Blick und abschätzigem Grinsen gemeint. Alex war ziemlich links, doch die Bonzenhütte mit Seegrundstück schien ihr dann doch ziemlich gut zu gefallen.
Und Kim und Alex mochten sich. Kim imponierte die nach außen hin selbstbewusste, eloquente und eigenwillige junge Frau mit der wilden Löwen-Rastamähne, den Piercings und den Lederklamotten. Nur Martins Mutter beobachtete die neue Liaison mit Argusaugen. »Was willst du mit dem ausgeflippten jungen Ding?«, hatte sie nach Alexandras erstem Besuch abfällig gemeint. »Bekämpfst du so deine Midlife-Crisis? Diese Frau ist doch viel zu flatterhaft für dich.« Außerdem sorgte sie sich wegen der Nachbarn, weil dieses junge Ding auch mitten im Winter frühmorgens splitterfasernackt in den See hüpfte und dabei lustvoll schrie. Wobei denen das gefiel, zumindest dem alten Witwer Beck von nebenan. Schon ein paarmal hatte Martin schmunzelnd bemerkt, wie er ergriffen aus dem Fenster blickte, wenn Alex badete.
Auch Elsa hatte seine Mutter von Anfang an mit Skepsis betrachtet. Weil sie Elsa durchschaut hatte oder sie eifersüchtig war, wie Elsa und Alex das vermuteten? Nun ja. Jedenfalls waren nach seiner Rückkehr aus Afghanistan die Mutter und das Haus zwei der Anker gewesen, die ihn im Leben hielten, und er brauchte seine Mutter jetzt wegen Kim. Und ausziehen wollte er auch nicht. Weil er das Haus am See liebte. Weil es sein Zuhause und seine Heimat war.
Mittlerweile war das Blaugrau draußen einem dunklen Grau gewichen, der Zauberer bannte das letzte Licht ins Mainau-Schloss. Das Grollen war lauter und klarer geworden, und auf einmal krachte es derart, dass Martin erschrocken zusammenzuckte. Drüben in Meersburg brannten die Lichter, flackernde orangefarbene Punkte, wie Irrlichter in einem Moor oder kleine Lagerfeuer. Vielleicht rasteten dort die Helden, die das Licht befreien wollten.
Martin lächelte und trank einen weiteren Schluck Helles. Schön mild und süßlich, richtig süffig schmeckte es. Kim war unten und kochte mit seiner Mutter eine kräftige Rindfleischsuppe, der würzige Duft erfüllte das Haus. Rindfleischsuppe war eines von Kims Lieblingsgerichten, weshalb es das auch mitten im Sommer gab. Auch er liebte diese Suppe. Die Markknochen lustvoll schmatzend auszusaugen, war für ihn früher eine große Sache gewesen, auf die er sich schon mal einen ganzen Schulvormittag lang gefreut hatte.
Das Leben, dachte Martin, war gerade nicht allzu schlecht. Und Kims Kummer, hoffte er, würde sich mit der Zeit auch legen.
Da klingelte das Telefon.
Jemand rief auf seiner Geschäftsnummer an.
»Detektei Martin Schwarz, ja bitte?«
»Guten Tag«, sprach eine Frau mit fester Stimme und einem Akzent, den Martin nicht zuordnen konnte. »Mein Name ist Elvira Wolff. Ich bin die Tochter des Hegau-Skeletts.«
Martin war verwirrt – und elektrisiert. Von dem rätselhaften Toten, der vor gut einer Woche bei Waldarbeiten auf einer Anhöhe in einem Wald nahe der Schweizer Grenze gefunden worden war, hatte er in der Südzeitung gelesen.
»Woher wissen Sie das?«, fragte er. »Ich meine, nach meinem Kenntnisstand ist noch gar nicht klar, um wen es sich handelt. Und wann der Tote gestorben ist.«
»Doch, ich weiß das. Und ich habe einen Auftrag für Sie.«
Vor Verblüffung war Martin kurz still. Dann: »Und der wäre?«
»Sie sollen den Mörder meines Vaters finden.«
Sprachlos schüttelte Martin den Kopf. Die Dame klang sehr entschieden. Doch warum der Mann gestorben war, ob es sich überhaupt um ein Verbrechen handelte, war laut Südzeitung völlig ungewiss. Da keine Textilreste oder Schmuckstücke bei dem Toten gefunden worden waren, konnte die Rechtsmedizin auch nicht genau feststellen, wie lange der Tote schon unter der Erde lag. Sicher mehrere Jahrzehnte, hieß es. Jedenfalls war er in etwa fünfzig Zentimetern Tiefe vergraben worden. Da ein Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden konnte – vielleicht hatte jemand ein Mordopfer verschwinden lassen wollen –, hatte die Konstanzer Staatsanwaltschaft ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Die DNA des Mannes war bereits mit der von zahlreichen Vermissten abgeglichen worden, bisher jedoch ohne Ergebnis.
»Ich fürchte, ich kann noch nicht ganz folgen«, sagte Martin nach einer Pause.
»Hm«, meinte die Frau. Es klang ein wenig unwirsch. »Haben Sie ein paar Minuten Zeit? Dann erklär ich Ihnen das.«
Draußen blitzte es, für einen Augenblick war die Welt taghell, um gleich darauf wieder in tiefe Dunkelheit zu versinken.
2
Als eine ältere Frau das libanesische Restaurant in der Nähe des Konstanzer Hauptbahnhofs betrat, wusste Martin Schwarz sofort, dass es sich um Elvira Wolff handelte. Die rüstige, putzmuntere Person passte perfekt zu der energischen Stimme, mit der er vor ein paar Tagen am Telefon gesprochen und die sich ihm als »Tochter des Hegau-Skeletts« vorgestellt hatte. Sie war klein und schlank, fast schon zierlich, und flößte ihm dennoch sofort Respekt ein. Eine kleine Gewalt, dachte Martin und schmunzelte. So nannte sein Freund Frank Zwille Martins Mutter.
»Guten Abend«, sagte sie mit einem weichen Akzent.
Martin Schwarz stand auf und erwiderte den Gruß. »Es freut mich außerordentlich, Sie kennenzulernen«, sagte er ehrfürchtig und feierlich, als stünde eine Nobelpreisträgerin vor ihm.
»Jetzt setzen Sie sich schon«, meinte Elvira Wolff und grinste. »Noch nie eine echte Jüdin gesehen?«
Martin schluckte. Sie hatte es erfasst. Er hatte noch nie mit einer echten Jüdin gesprochen, oder einem Juden, zumindest nicht wissentlich. Er hatte keine jüdischen Menschen im Bekanntenkreis, kannte nur welche aus dem Fernsehen. Juden waren für ihn fremde Wesen mit einer furchtbaren Vergangenheit, für die Deutschland hauptverantwortlich war.
Wobei, so stimmte das nicht, es war viel schlimmer. Wenn jemand »Jude« sagte, dachte Martin an einen arabisch aussehenden Mann um die fünfzig mit fleischiger Nase und wulstigen Lippen. Oder an einen orthodoxen Juden mit schwarzem Hut, Nickelbrille und Schläfenlocken. Oder an einen verschlagen dreinblickenden Bankier mit Zylinder oder einen hyperintellektuellen amerikanischen Ostküsten-Literaten mit fein ziselierten, kühlen Gesichtszügen. Juden konnten gut mit Geld umgehen, waren hochgebildet und jahrtausendelang verfolgt worden und machten jetzt mit unerbittlicher Härte den Palästinensern ihr Land streitig.
Verdammt, dachte Martin beschämt, und diese Ansammlung von Karikaturen hatte er trotz eines siebenjährigen Geschichtsstudiums im Kopf. Oder genau deswegen? Jedenfalls waren ihm diese Gedankenbilder abgrundtief peinlich, und er würde diese Phantasien nie ehrlich zugeben, sondern entsetzt dreinblicken und den Kopf schütteln, wenn jemand so etwas öffentlich bekennen würde. Aber im Prinzip war sein gedanklicher Prototyp eines jüdischen Menschen nicht weit von den finstersten antisemitischen Klischees entfernt. Weil er sich im Studium zu intensiv damit beschäftigt hatte? Oder weil selbst ein Geschichtsstudium nichts gegen das Beharrungsvermögen rassistischer Stereotype ausrichten konnte?
Martin erschauerte. War er ein Antisemit?
Auf jeden Fall war ihm all das schrecklich peinlich. Deshalb fühlte er sich auch so unbeholfen und gehemmt. Als er mit Elvira Wolff telefoniert und sie ihn gefragt hatte, in welchem Restaurant in der Nähe des Bahnhofs sie sich treffen könnten, hatte er den Libanesen vorgeschlagen. Und im nächsten Moment voller Entsetzen gedacht, dass eine Jüdin aus Israel das vielleicht als Affront empfinden könnte. Schließlich waren Israel und der Libanon alles andere als beste Freunde. Wie konnte er nur so verflucht unsensibel sein?
Aber die Sorge war unbegründet gewesen. Ein Libanese? Klasse, hatte Elvira Wolff gemeint, da schmeckt’s fast so wie daheim.
Tja.
»Ein großes Hefeweizen«, sagte die Wolff, als die Kellnerin kam und ihnen die Karte reichte. Martin bestellte auch eins.
Eine Weile studierte sie die Speisen. Martin beobachtete sie. Elvira Wolff hatte markante Gesichtszüge und hohe Wangenknochen. Ihre leicht toupierten Haare waren silbern, die braunen Augen sprühten vor Energie. Sie hat keine jüdische Nase, dachte Martin und schämte sich für den Gedanken.
»Was schmeckt hier denn?«, fragte sie. Ihr Blick war zugleich voller Entschiedenheit, Neugierde und Humor.
»Nun ja.« Martin war sich unsicher. Die Frau war schlank und sah kerngesund aus. Sie aß sicher viel Gemüse. »Also, das Taboulé und die Falafel sind klasse.«
»Hm, und was nehmen Sie?«
»Äh, den Grillteller. Mit Lamm, Rind und Hühnchen. Dazu gibt es Nudelreis. Den mag ich besonders gern.«
»Klingt gut. Gibt’s den auch für zwei?«
»Klar. Ist aber viel.«
Elvira Wolff hob die Brauen. »Wir kriegen den schon klein.«
Martin lächelte. »Ich habe ihn bisher immer geschafft.«
Die Biere kamen. »Na dann«, sagte sie und hob ihr Glas, »auf erfolgreiche Ermittlungen.«
Martin trank einen großen Schluck. Das Weizen war herrlich kühl. »Und Sie glauben also, dass der Tote aus dem Hegau Ihr Vater ist.«
Elvira Wolff nickte entschieden. »Ich bin mir sicher.«
Schon am Telefon hatte sie Martin die Geschichte ihrer Eltern erzählt. Sie hatten sich vor den Deportationen der Nazis versteckt und im Untergrund in Berlin gelebt. Ihre Mutter war 1943 in die Schweiz geflohen, da war sie mit Elvira schwanger gewesen. Im Hegau war sie nachts über die Grenze gegangen, zusammen mit dem Fluchthelfer Franz Haffner. Ihr Vater wollte im Februar 1944 folgen, verschwand aber spurlos. Wie auch Haffner, der ihn ebenso in die Schweiz führen wollte.
»Gab es schon einen Abgleich mit Ihrer DNA?«
»Ist seit gestern in Arbeit. Ich bin dafür extra nach Freiburg gefahren, um die Sache zu beschleunigen. Aber ich bin nicht die Einzige, die sich diesbezüglich bei der Freiburger Rechtsmedizin gemeldet hat. Mehrere hundert Angehörige von Vermissten wollen dort einen DNA-Abgleich. Man sagte mir, ich müsse etwas Geduld haben, es könnte vielleicht acht Tage dauern.«
»Warum warten Sie nicht, bis Sie Gewissheit haben?«
Elvira zuckte mit den Achseln. »Es passt einfach zu gut. Mein Gefühl sagt mir, dass er es ist. Und ich möchte nicht mehr warten, Herr Schwarz. Ich warte schon mein ganzes Leben lang. Meine Mutter ist wartend gestorben. Ich muss wissen, was mit meinem Vater passiert ist. Und ich weiß nicht, wie lange ich noch habe. Schließlich werde ich bald achtzig.«
»Oha«, meinte Martin. »Das sieht man Ihnen aber nicht an.«
»Ach ja?« Elvira Wolff hob die Brauen. »Wie sieht denn Ihrer Meinung nach eine Achtzigjährige aus? So als hätte sie schon ein Weilchen im Grab gelegen? Schimmert das Skelett schon durch?«
Martin schluckte. War das jetzt ironisch? Er hatte ihr doch ein Kompliment machen wollen! War das zu gönnerhaft rübergekommen?
»Ist die Polizei an dem Fall dran?«, lenkte er ab.
Ihr Blick verfinsterte sich. »Theoretisch ja. Die zuständigen Kommissare machen keinen allzu motivierten Eindruck. Die tun nichts, bis feststeht, dass es sich bei dem Toten um meinen Vater handelt. Und selbst dann werden sie nur widerwillig an die Sache rangehen. Sie ermitteln gerade in einem anderen Mord, und ich zweifle, ob sie für einen achtzig Jahre alten Fall die nötige Lust und Energie aufbringen. Zumal ein toter Jude ja politisch heikel ist. Und dann noch aus der Nazizeit! Jedenfalls liegen ihre Prioritäten ganz klar auf dem anderen Fall, und das kann ich ihnen auch nicht verdenken. Nirgendwo auf der Welt hat die Polizei die Ressourcen, die sie bräuchte.«
»Wie heißen die Kommissare?«
»Lothar Steck und Malena Henke.«
Martin grinste. Bei seinem letzten Fall um die verschwundene Berufsfischerin von der Insel Reichenau hatte er mit den beiden bereits zu tun gehabt. Da hatte er mit seinem Team maßgeblich zur Aufklärung beigetragen. Steck und Henke würden nicht begeistert sein, wenn sie erfuhren, dass sie wieder parallel ermitteln würden.
»Wissen die beiden, dass Sie mich beauftragt haben?«
Elvira Wolff nickte. »Ich habe auch den Polizeipräsidenten darüber informiert. Die sollen ruhig ein bisschen Druck spüren. Konkurrenz belebt das Geschäft.«
Na, das kann ja heiter werden, dachte Martin. Doch der Fall interessierte ihn. Zunächst wollte er sich aber noch ein besseres Bild von der Frau machen.
»Und Sie sind bei Ihrer Mutter Frieda in Jerusalem aufgewachsen?«, fragte er.
»So ist es. Nach der Flucht in die Schweiz ist meine Mutter nach Palästina emigriert. Heimlich, versteht sich. Damals war Palästina ja noch britisches Mandatsgebiet, und aus Rücksicht auf die Araber wollten die Briten keine Juden mehr ins Land lassen. Obwohl sie genau wussten, was die Deutschen mit den Juden anstellten. Stellen Sie sich das mal vor! Na ja, jedenfalls bin ich dort auf die Welt gekommen. Nach Deutschland wollte meine Mutter nie mehr zurück. Die Deutschen hatten ihre Eltern und – davon war sie überzeugt – ihren Verlobten ermordet, neben weiteren sechs Millionen europäischen Juden. Sie hat nie mit mir Deutsch geredet, obwohl sie es viel besser als Hebräisch sprach. Sie wollte diese Sprache nicht mehr verwenden und auch nicht, dass ich sie lernte.«
»Ihr Deutsch ist ausgezeichnet.«
»Stellen Sie sich vor: Ich habe sogar ein Jahr in Westberlin studiert.«
»Nein!«, sagte Martin, ehrlich überrascht. »Und warum?«
»Damit ich euch Monster besser verstehen kann.«
Martin fiel die Kinnlade runter.
Elvira Wolff lachte laut auf. »Keine Angst, ich werde Sie nicht gleich aufessen. Zumindest nicht heute.« Sie seufzte. »Weiß man so genau, warum man tut, was man tut? Vielleicht liegt es an meinem Vater. Oder daran, dass meine Mutter lange versucht hat, ihre Herkunft zu verleugnen. Tabus sind anziehend, vor allem, wenn die eigene Mutter sie setzt. Meine Eltern waren ja Deutsche, so wie meine Großeltern, Onkel und Tanten, die auch alle von den Nazis ermordet worden sind. Tja, und dann habe ich in der Schule Tucholsky und Heine gelesen. Deutschsprachige Juden. Das hat mich angesprochen und eine Sehnsucht nach der deutsch-jüdischen Kultur geweckt. Ich habe Geschichte studiert und mich intensiv mit Deutschland und dem Holocaust beschäftigt. Das Thema hat mich nie losgelassen. Ich habe vierzig Jahre an einer Schule in Jerusalem Geschichte unterrichtet.«
Martin lächelte. »Meine Mutter ist auch Lehrerin. Ich glaube, Sie würden sich verstehen. Ich habe übrigens auch Geschichte studiert.«
Er staunte über diese außergewöhnliche, stolze Frau. Und er mochte sie. Ihre Offenheit, ihr schwarzer Humor und diese Mischung aus Härte und Herzlichkeit imponierten ihm. Aber so ein bisschen hatte er auch Angst vor ihr.
»Warum ist es Ihnen so wichtig, den Mörder Ihres Vaters zu finden?«
Elvira Wolff verengte die Augen zu Schlitzen. »Es geht um Rache.«
Martin stutzte. Wieder war er sich nicht sicher, ob das ironisch gemeint war.
Sie schmunzelte. Lachte sie ihn aus? Wollte sie ihn provozieren? Dennoch hatte er den Eindruck, dass die Frau ihn mochte, trotz seiner Unsicherheit. Oder vielleicht sogar deswegen.
»Wissen Sie, wie sehr meine Mutter gelitten hat? Wie quälend es für sie gewesen ist, nicht zu wissen, was mit ihrem Verlobten geschah, dem sie ihr Leben verdankte und den sie über alles geliebt hat? Wurde er auf der Flucht getötet? Nach Auschwitz oder Sobibor deportiert? Wo, wenn überhaupt, liegt er begraben? Nach außen hin war sie eine fröhliche, selbstbewusste Frau, aber unter der Oberfläche lagen Schmerz, Wut, Trauer und Depression. Unsere Familie ist von den Deutschen fast vollständig vernichtet worden. All die Wut, Trauer und Schmerzen haben sich auf mich übertragen. Auch ich habe unter der Ungewissheit gelitten, was mit meinem Vater geschehen ist. Sie quält mich bis heute. Und so etwas hört nie auf. Zumindest nicht nach zwei, drei oder vier Generationen. Außerdem denke ich, dass auch Charlotte Förster, die Tochter des Fluchthelfers, erfahren muss, was aus ihrem Vater geworden ist. Sie muss ähnlich gelitten haben wie ich. Und ihr Vater hat meiner Mutter damals das Leben gerettet. Ohne ihn gäbe es weder mich noch meine Familie. Ich fühle mich ihr verpflichtet.«
Martin nickte. All das konnte er verstehen.
Sie fuhr fort: »Aber das sind noch nicht die wichtigsten Gründe. Mir geht es vor allem um Gerechtigkeit: Völkermord bleibt Völkermord, und der verjährt nicht. Die Nachfahren der Opfer werden noch für Generationen die Schmerzen der Shoah tragen müssen. Warum soll es da den Nachfahren der Täter besser gehen? Nach der jüdischen Tradition bestraft Gott einen Menschen für böse Taten auf zehn Generationen, während er einen für gute Taten auf hundert Generationen belohnt. Auch wenn wir die Täter nicht mehr bestrafen können, weil sie tot sind, müssen wir nach ihnen suchen. Wir Juden und Sie als Deutsche. So wie in der Shoah-Gedenkstätte Yad Vashem immer noch Tag für Tag nach den Opfern der Shoah gesucht wird. Es fehlen noch über eine Million Namen, aber jede Woche werden neue ermittelt. Und genauso müssen wir nach den Tätern suchen. Damit deren Kinder, Enkel und Urenkel wissen, was ihre Vorfahren getan haben.«
»Um die Shoah im Gedächtnis zu behalten?«
Elvira Wolff nickte. »Wie die Opfer haben die Täter Kinder, Enkel und Urenkel. Jeder Mensch ist geprägt von den Handlungen, Haltungen und Erfahrungen seiner Vorfahren, davon bin ich felsenfest überzeugt. Unsere Urgroßeltern, Großeltern, Eltern, alle vergangenen Generationen leben in uns weiter, mit ihren Hoffnungen und Ängsten, ihrer Schuld und ihren Lügen und Verbrechen, sie sind ein Teil von uns. Und wenn wir von ihnen und über sie etwas lernen wollen, müssen wir möglichst viel darüber wissen. Und uns mit ihren Leben auseinandersetzen. Nur so können wir es vielleicht in der Gegenwart besser machen.«
Martin nickte ehrfürchtig. Das leuchtete ihm ein. »Und warum engagieren Sie keinen jüdischen Privatdetektiv?«
Elvira Wolff zwinkerte ihm zu. »Ich bin Pädagogin.«
»Ich bin also Teil eines pädagogischen Projekts?«
»Nun ja, nach dem, was ich über Sie gelesen habe, sollen Sie nicht schlecht in Ihrem Beruf sein. Und ich will wirklich unbedingt wissen, was damals passiert ist.«
Der Grillteller kam. Eine Weile aßen sie schweigend.
»Schmeckt hervorragend«, meinte sie dann. »Fast wie zu Hause. Das Gericht und das Restaurant haben Sie gut ausgesucht.«
Martin lächelte. »Wie haben Sie eigentlich vom Hegau-Skelett erfahren?«
»Die Tochter von Franz Haffner hat mich angerufen. Sie hat darüber in der Zeitung gelesen und sich gleich gedacht, dass der Tote im Wald mein Vater sein könnte. Meine Mutter und sie hatten nach dem Krieg noch ein paar Jahre Kontakt.«
Martin stutzte. »Wäre es nicht auch möglich, dass …«
»Franz Haffners Skelett dort oben liegt?«
Martin nickte.
Elvira schüttelte den Kopf. »Franz Haffner war über eins fünfundachtzig, der Tote ist aber nur knapp eins siebzig. Wie mein Vater.«
»Alles klar.«
»Haben Sie schon einen Plan, wie Sie vorgehen wollen?«
»Darüber muss ich noch nachdenken. Aber ein paar Ideen habe ich schon. Wenn es so ist, wie Sie vermuten, ist Ihr Vater bei der Flucht in die Schweiz getötet worden. Das heißt, der Tatort muss in der Nähe des Fundorts des Skeletts liegen. Vielleicht war der Fundort auch der Tatort. Wobei die Polizei das unmittelbare Umfeld abgesucht und nichts gefunden hat. Keine Kugeln oder Patronenhülsen.«
Elvira nickte. »Jedenfalls liegen die Überreste meines Vaters keine hundert Meter von der Schweizer Grenze entfernt.«
»Möglicherweise wurde Ihr Vater von einem Grenzpolizisten verfolgt, und als er glaubte, ihn nicht mehr vor der Grenze stellen zu können, hat er ihn erschossen. In dem Fall müssten wirklich irgendwo Kugeln und Patronenhülsen im Erdreich liegen. Vielleicht haben der oder die Täter eine Stelle gesucht, wo sie die Leiche im Wald leicht begraben können. Wobei sich mir die Frage stellt, warum Grenzpolizisten die Leiche im Wald vergraben sollten. Und wenn unsere Theorie stimmt, müsste auch Haffners Leiche irgendwo da oben liegen. Jedenfalls werde ich mit meinem Team die weitere Umgebung des Fundorts mit Metalldetektoren absuchen, ein Freund von mir kann Geräte besorgen. Allzu große Hoffnungen mache ich mir nicht, aber ein Versuch ist es wert. Ich will sowieso dorthin, um mir einen Eindruck von der Gegend zu verschaffen.«
Elvira Wolff nickte. »Sehr gut, ja, das leuchtet mir ein. Ich war übrigens gestern mit einem Polizisten an dem Ort. Ich habe darum gebeten, dass man mir die Stelle zeigt. Die Suchmaßnahmen sind abgeschlossen, das Gelände ist nicht mehr abgesperrt.«
Ihre Stimme klang auf einmal leise und brüchig. Es musste ergreifend für sie gewesen sein, den Ort zu besuchen, an dem vermutlich ihr Vater getötet worden war, nur wenige Schritte von der Schweiz entfernt.
»Könnten Sie mir den Fundort geografisch beschreiben?«
Sie holte ihr Portemonnaie aus der Tasche und nahm einen Zettel heraus. »Hier, das sind die GPS-Daten. Ich habe den Ort auf meinem Handy eingespeichert. Habe mir schon gedacht, dass Sie dorthin möchten. Die Stelle ist in der Nähe des Dorfes Büßlingen. Dort können Sie parken und in den Wald laufen.«
»Danke, das hilft mir sehr.«
Elvira Wolff nickte wieder. »Es würde mich freuen, wenn Sie mich auf dem Laufenden hielten. Ich wohne in einer Ferienwohnung in Allmannsdorf. Im Hechtgang. Meine Mobilnummer haben Sie ja.«
»Und wie lange bleiben Sie in Deutschland?«
»Bis Sie den Mörder meines Vaters und Franz Haffners gefunden haben«, sagte die Dame entschieden. »Eher gehe ich hier nicht weg.«
Nachdem Elvira Wolff aufgebrochen war, blieb Martin noch ein Weilchen sitzen. Er war aufgewühlt, durch den Wind, freute und schämte sich. So konnte er noch nicht ins Bett. Und Kim schlief heute Nacht eh bei der Oma.
Er fingerte sein Handy aus der Tasche. Zwille zog vielleicht noch durch die Konstanzer Kneipen. Wenn Martins Welt- und Selbstbild erschüttert war, half nichts so sehr wie die Warmherzigkeit, Offenheit und gedankliche Klarheit des Radikalmarxisten Frank Zwille.
»Hi, Schatz«, sagte Zwille. So nannte er Martin immer, seit er sich von Elsa getrennt hatte. Martin gefiel das nicht, aber da konnte man nichts machen.
Stimmengemurmel im Hintergrund. Zwille hockte eindeutig in einer Kneipe. Wie jeden Abend. Sehr gut.
»Zwille, ich brauch deinen Rat.«
Zwille kicherte. »Du hast grad mit der Jüdin gegessen, gell?«
Martin hatte ihm von ihrem Anruf und ihrem Treffen erzählt.
»Yupp. Und zwar beim Libanesen.«
»Und jetzt bist du in deinem Deutschsein zutiefst erschüttert.«
Martin seufzte schwer. »Du sagst es!«
»Ich bin im ›Salzfass‹. Ist ja nur ein paar Schritte entfernt. Soll ich dir schon mal ein Bier bestellen?«
»O ja. Ein großes. Und einen Schnaps.«
3
Wenig später betrat Martin das »Salzfass«, eine urige Kneipe mit niedrigen Decken mitten in der Konstanzer Altstadt. Zwille hockte am Tresen wie ein dunkler Fels in der Brandung. An ihm würde Martin sich erst einmal festhalten. Ohne ein Wort zu sagen, kippte Martin den Schnaps herunter.
»Oha«, meinte Zwille mit hochgezogenen Augenbrauen, »die Alte hat dir ja ganz schön zugesetzt.«
Der schwarzhaarige Zwille trug wie immer seine Lederkluft, einen Fünftagebart und drei große goldene Creolenohrringe an jedem Ohr. Er sah aus wie ein Räuberhauptmann oder ein Pirat. Vor fünfhundert Jahren wäre Zwille bestimmt eins davon gewesen. Oder Anführer im Bauernkrieg. Doch, das wäre Zwilles Ding gewesen: Mit einer Horde bäurischer Hungerhaken Schlösser brandschatzen, Adlige aufknüpfen und ein wildes Leben im Dienste der Gerechtigkeit führen. Martin sah es vor sich, wie Zwille nach einer Mordbrennerei an einem prasselnden Lagerfeuer saß und mit verwegenem Blick in eine Hammelkeule biss.
Nun ja, ein wildes Leben führte Zwille auch jetzt, als ultralinker und polyamouröser Punkrocker. Schon ein krasser Typ, sein alter Schulfreund. Aber vor allem ein feiner Mensch. Jedenfalls hatte er ihm mit dem Schnaps gerade das Leben gerettet.
»Tut gut, der Ouzo.«
»Das war ein Arak«, korrigierte Zwille. »Ist grad richtig hip bei Israels Jugend. Passt zum Thema, hab ich mir gedacht.«
Martin trank nachdenklich einen Schluck Bier. »Sag mal, Zwille, ganz ehrlich: Wenn du das Wort ›Jude‹ hörst, woran denkst du dann spontan?«
Zwille warf die Stirn in Falten. »Ganz ehrlich? An einen muskulösen Hintern, eine stark behaarte, durchtrainierte Brust, feurige schwarze Augen, die ›Fick mich‹ rufen, und einen haselnussbraunen beschnittenen Schwanz.«
»Psst!«, zischte Martin und sah sich entsetzt um. Er spürte, wie er knallrot wurde. »So kann man doch nicht übers Judentum reden! Mir ist das ernst!«
»Mir auch. Was siehst denn du? Einen bleichen orthodoxen Juden mit Pickeln und Schläfenlocken? Ferdinand Marian als ›Jud Süß‹? Nazipropagandabilder?«
Martin räusperte sich.
»Ich denke halt an Jaron. Ist ein neuer Lover von mir. Er kommt übrigens gleich.«
Zwille grinste, als er Martins erschrockenes Gesicht sah. »Ich dachte mir, eine jüdische Perspektive kann das Gespräch befruchten. Jaron ist Soziologiedozent aus Tel Aviv und macht ein Forschungssemester an der Uni Konstanz, an meinem alten Lehrstuhl. Da habe ich dieses Jahr mal wieder einen Lehrauftrag, so haben wir uns kennengelernt. Jaron ist aber in Deutschland aufgewachsen und hat eine deutsch-jüdische Mutter.«
Genau Zwilles Typ, dachte Martin, als Jaron wenig später die Kneipe betrat. Er war so Ende dreißig und sah aus wie ein Araber: groß, breite Schultern, Fünftagebart, volle Lippen, und sein Blick hatte zugleich etwas Leidenschaftliches und Melancholisches. O Gott, wie ein Araber, dachte Martin: Durfte man so was denken?
Die beiden küssten sich.
Martin sah weg.
Zwille: »Mein Freund Martin ist Detektiv und ermittelt gerade im Auftrag einer Jüdin. Es geht um einen mutmaßlichen Judenmord in der Nazizeit. Martin kennt keine Juden, und das Gespräch mit der Frau hat einen weiteren tief sitzenden Schuldkomplex in ihm freigelegt. Den wollen wir jetzt bearbeiten. Er braucht einen frischen Blick auf jüdisches Leben.«
Martin merkte, dass er wieder rot wurde. Er hasste Zwilles Sarkasmus. »Wieso denn einen weiteren?«, fragte er frostig.
»Na, deine latente Homophobie und die damit verbundene Scham.«
Martin verdrehte die Augen. Aber so war Zwille halt, er kam immer schonungslos zum Punkt.
Jaron lächelte Martin an. »Kennst du die heilige jüdische Dreifaltigkeit?«
Schon wieder war Martin verwirrt. Wurde das jetzt ein Theologieseminar? »Äh«, brachte er heraus. Ihm schwirrten Begriffe wie Chanukka, Schabbat, Tempelberg und Thora im Kopf herum.
Jaron erlöste ihn: »Antisemitismus, Shoah und Nahostkonflikt.«
»Was?«
»Die Dreifaltigkeit beherrscht das Denken der Deutschen gegenüber Juden. Im Prinzip gibt es in dieser Hinsicht drei Typen Deutsche. Der erste hasst Juden und macht auch keinen Hehl daraus. Er hat antisemitische Stereotype verinnerlicht und glaubt an eine jüdische Weltverschwörung. Diesen Typ gibt es vor allem bei der extremen politischen Linken wie der Rechten. Er sieht in Juden geldgierige und brutal auf ihren Vorteil bedachte Wesen, die vor nichts zurückschrecken, um ihre Interessen durchzusetzen. Ihr Lieblingsthema: die grausame Politik Israels gegenüber Palästina. Und: wie das Judentum mit dem Holocaust die Welt in Geiselhaft nimmt. Außerdem: Die Wall Street als Instrument der jüdischen Welteroberung.«
Okay, dachte Martin erleichtert. Zu dem Typ gehörte er nicht.
»Typ zwei empfindet ehrliche Scham wegen der Shoah. Er sieht in uns Juden arme Opfer und fasst uns nur mit Samthandschuhen an. Er steckt voller Schuldgefühle, am liebsten würde er ständig vor uns auf die Knie fallen und uns um Verzeihung bitten. Allerdings erwartet er dann auch, dass wir ihm verzeihen, am liebsten jeden Tag, und er ist stinksauer, wenn nicht. Wenn Typ zwei an einen Juden denkt, ploppen in seinem Hirn Bilder von Viehwaggons, Verbrennungsöfen, SS-Männern und Nazikarikaturen auf. Er hat viel über die Shoah gelesen oder zumindest einen Haufen Dokus darüber geguckt und glaubt, wir Juden seien tieftraurige, schutzbedürftige, vom Völkermord noch immer traumatisierte Wesen aus Porzellan, voller Risse und Sprünge, zu denen man sehr, sehr lieb sein muss, damit sie nicht auseinanderbrechen. Der Typ ist eher links und hundertzwanzigprozentig proisraelisch und sieht alle Schuld am Nahostkonflikt bei den Palästinensern. Das ist dann zum Beispiel ein Lehrer, der im Unterricht den Staat Israel feiert und eine jüdische Schülerin voller ehrlichem Mitgefühl fragt, ob sie nicht ein Referat über die Opfergeschichte ihrer Familie halten mag. Oder ein Professor, der in eine Seelenkrise stürzt, wenn irgendwo ein propalästinensischer Aktivist öffentlich auftritt. Entweder geht er dahin und isst ihn auf, oder er verklagt die Veranstalter, weil sie das Existenzrecht des Staates Israels in Frage stellen.«
Touché, dachte Martin. »Das bin eher ich«, gab er zu.
»Und Zwille auch«, stellte Jaron fest.
»Ach komm«, meinte Zwille leicht empört. »Meinst du, ich schlafe mit dir, weil ich meine Schuld gegenüber dem jüdischen Volk abtragen will?«
Jaron hob die Brauen und grinste. »Na ja, nicht nur. Aber schon auch. Ich schätze mal, du bist mächtig stolz, einen jüdischen Lover zu haben. Macht dich ja zu einem weltoffenen Typen, der souverän über der deutschen Geschichte steht und mit sich im Reinen ist. Und, hey, so eine Art Persilschein ist es ebenso.«
»Wie bitte?«, entfuhr es Zwille.
Das gibt’s nicht, er wird rot, dachte Martin und lachte.
»Na ja«, fuhr Jaron fort, »wenn ich mit dir schlafe, heißt das ja auch, dass du ein guter, geläuterter, prosemitischer Deutscher sein musst. Unser Sex spricht dich von allen Sünden frei. Er adelt dich sozusagen.«
»Ts«, machte Zwille. Er war sichtlich getroffen und um eine Antwort verlegen, was ihm sonst nie passierte.
Martin sah sich um. Sie hatten inzwischen einige Zuhörer. Ihr Thema schien einen Nerv der »Salzfass«-Trinker zu treffen.
Zwille fiel wieder etwas ein. Natürlich scherte er sich nicht ums Publikum, im Gegenteil. Das Private war ja immer auch politisch und gehörte öffentlich ausdiskutiert. »Und was genau bedeutet es dann für dich, einen Deutschen zu vögeln? Ist das auch eine Egodusche? Beweist du dir damit, dass du dich von den langen Schatten der Shoah befreit und ent-opfert hast? Oder ist es besonders prickelnd, einem Sprössling des Tätervolks einen zu blasen?«
Martin schloss die Augen. Mann, konnte Zwille peinlich sein!
»Na ja«, meinte Jaron und blinzelte. Jetzt musste er nachdenken.
»Und Typ drei?«, fragte Martin, auch um den beiden einen Weg aus ihrer heiklen interkulturellen Beziehungsexegese zu weisen. »Was kennzeichnet den?«
»Ist mit Typ zwei verwandt«, sagte Jaron. »Er empfindet wie Typ zwei große Scham wegen der Shoah. Aber er versucht, diese unbewusst abzuwehren, weil es sein Ego kränkt. Für ihn steht die Grausamkeit der Shoah außer Frage, zugleich ist aber der Nahostkonflikt ein großes Thema. Die Juden sind aus seiner Sicht eindeutig die Täter. Dabei setzt er die Juden mit der israelischen Regierung gleich. Warum, fragt Typ drei sich und andere, geht das militärisch überlegene Israel so brutal mit den Palästinensern um? Warum besetzt es palästinensisches Gebiet, baut jüdische Siedlungen ins geraubte Land und gräbt den Palästinensern das Wasser ab? Und insgeheim argwöhnt er: Es gibt sie doch, diese angeborene jüdische Grausamkeit. Denn eigentlich müssten die Juden doch gerade angesichts ihrer schlimmen Geschichte menschlich und fair mit den Palästinensern umgehen. Zeigt sich da nicht ein schlimmer zionistischer Rassismus? Und dann wird schnell das Existenzrecht Israels in Frage gestellt. Das würde Typ drei natürlich nie offen tun, höchstens im vertrauten Kreis nach fünf Bier. Und, wie gesagt, dass viele Juden die Politik der israelischen Regierung kritisieren, nimmt er nicht zur Kenntnis.«
»Und welcher Typ ist am wenigsten schlimm?«
»Die nehmen sich nichts«, meinte Jaron.
»Was?« Überrascht sah Martin ihn an. Auch Zwille wirkte irritiert.
»Und wisst ihr was?«, verkündete Jaron. »Mittlerweile scheiß ich auf die Shoah.«
Kurz war es still, als hätte ein mächtiger Donner das »Salzfass« erschüttert.
»Ach komm!«, sagte Zwille empört. »Das meinst du nicht ernst!«
Klar, analysierte Martin, Typ zwei trifft so ein Statement ins Mark.
Jaron holte tief Luft. »Weißt du, wie beschissen es ist, immer als bedürftiges Opfer oder als übler Täter gesehen zu werden? Die jüdische Dreifaltigkeit klebt auf unseren Rücken wie ein Klumpen aus Blei. Als hätten wir hässliche Buckel. Und ihr habt sie uns aufgepflanzt.«
Nur wir?, fragte sich Martin, blieb aber lieber still.
»Trotzdem«, beharrte Zwille mit erhobenem Zeigefinger, »das geht zu weit. Du willst, dass wir uns nicht mehr an die Shoah erinnern? Dass das Thema aus dem Schulunterricht gestrichen wird?«
Jaron seufzte schwer. »Nein, natürlich nicht. Aber ich kenne viele Juden in Deutschland, die vom Opfersein die Schnauze voll haben. Und gerade die jungen Juden kotzen inzwischen, wenn sie auf die Shoah oder den Nahostkonflikt angesprochen werden. Zumal die meisten deutschen Juden heute aus der ehemaligen Sowjetunion stammen und gar keine Opfergeschichte haben. Manche ihrer Vorfahren haben in der Roten Armee gekämpft und die Deutschen besiegt. Die wollen raus aus dieser Rolle, die ihnen von den Deutschen zugeschrieben worden ist. Sie wollen einfach nur normale junge Leute sein.«
»Aber unsere Beziehung ist nicht normal«, meinte Zwille. »Also ich meine jetzt die zwischen Deutschen und Juden. Das Nichtnormale ist das Normale. Dem können wir uns nicht entziehen.«
Beide hatten irgendwie recht, fand Martin. Außerdem, musste er sich eingestehen, war er vielleicht auch ein bisschen Typ drei.
»Aber ist es denn falsch, sich für den Nahostkonflikt zu interessieren?«, fragte Martin vorsichtig.
Jaron wiegte den Kopf. »Mich wundert halt, dass der so prominent in Deutschland diskutiert wird. Ich meine, warum regen sich die Deutschen nicht genauso inbrünstig über den Kaschmirkonflikt auf?«
Kaschmirkonflikt, dachte Martin, was war das noch mal genau? Irgendwas mit Indien und Pakistan. Musste er nachher mal im Internet gucken.
»Meine These ist«, sagte Jaron, »dass der Nahostkonflikt der deutschen Schuldabwehr dient. Es geht auch ein bisschen um die Palästinenser, aber vor allem darum, die eigene Schuld unbewusst zu relativieren.«
»Hm«, meinte Martin. Das führte jetzt tief hinab in die Abgründe einer Tätervolkpsyche. Zu tief für diese Uhrzeit, nach all dem Alkohol.
Ihm schwirrte der Kopf. Und weiter fragen wollte er auch nicht. Wegen der heiligen jüdischen Dreifaltigkeit und weil er zu einem Fünftel oder Viertel eventuell auch Typ drei war.
»Ich glaube, das muss ich alles mal ein bisschen ordnen«, meinte Martin. »Ich lauf jetzt heim.«
»Dann ordne mal schön«, frotzelte Zwille. Und zu Jaron gewandt: »Wir beide müssen auch einiges ordnen, und zwar dringend. Bei mir oder bei dir?«
4
Berlin, 26. August 1942
Horst Winter schwieg, als Frieda sein Büro betrat. Er trug das Goldene Parteiabzeichen der NSDAP, sie den Judenstern auf ihrer Arbeitsjacke. Seit einem Jahr war sie als Zwangsarbeiterin in Winters Geschützfabrik beschäftigt und lackierte Metallteile. Frieda konnte sich auf den wortkargen Winter mit den kalten Habichtsaugen keinen Reim machen. Er war Karrierist und hatte beste Verbindungen in der Partei, seine Firma konnte sich im Krieg vor Aufträgen kaum retten, zugleich setzte er sich für »seine« Juden ein. Ja, so nannte er sie: »seine Juden«. Sogar einige Sechzigjährige hatte er eingestellt und sorgte dafür, dass sie bleiben konnten.
Winter lächelte, als Frieda unsicher vor ihm stand, so als würde er ihre Angst genießen.
»Setzen Sie sich«, sagte er. Es klang freundlich und zugleich unterkühlt.
Sie nahm Platz. »Ja bitte?«
Er holte tief Luft und blickte besorgt. »Die Lage für Juden spitzt sich zu, Frau Wolff. Ich mache mir Sorgen.«
Sie zuckte mit den Schultern. Warum sagte er das? Wer wusste das besser als sie? Gleich im April 1933 waren die Fenster des Bekleidungsgeschäfts ihres Vaters vollgeschmiert worden. Monat für Monat war es seitdem mit dem alteingesessenen Herrenausstatter bergab gegangen. Immer weniger Kunden kamen, bald blieben auch die Stammkunden weg. Wer bei Juden einkaufte, wurde öffentlich gebrandmarkt, als wären sie Verbrecher. Auf offener Straße hatten Hitlerjungen ihren Vater bespuckt und ihre Familie Judenbrut genannt. Selbst christliche Freunde ließen ihre Kinder nicht mehr mit Frieda spielen. »Die Leute reden, das versteht ihr doch«, sagten sie, und das schlechte Gewissen wegen ihrer Feigheit stand ihnen ins Gesicht geschrieben. Das Leben in Potsdam wurde für sie zu einem Spießrutenlauf.
Deshalb hatte Frieda ihre Ausbildung als Schneiderin in Charlottenburg begonnen, in der anonymen Großstadt sollte es für Juden einfacher sein. Ihr Vater musste sein Geschäft verkaufen, ein arischer Konkurrent zahlte so viel, dass ihre Eltern ein paar Jahre gerade so überleben können würden. Doch emigrieren wollten sie nicht. Selbst als im November 1938 die Synagogen brannten und Juden in Konzentrationslager deportiert wurden, meinte ihr Vater immer noch mit trotziger Zuversicht, dass es bald wieder besser werden würde.
Doch das wurde es nicht. Immer neue Schikanen erschwerten ihr Leben und machten jeden Tag zu einer Demütigung. Bald mussten Juden einen zweiten Vornamen tragen – die Frauen Sara, die Männer Israel –, weshalb sie jetzt Frieda Sara Wolff hieß. Schulen und Universitäten wurden für sie geschlossen. Es gab einen Judenbann für bestimmte Berliner Straßen und Plätze – zudem für Kinos, Theater und Restaurants. Und seit Kriegsbeginn galt eine Ausgangssperre ab acht Uhr abends. Außerdem mussten sie Radio, Telefon und Familiensilber abgeben. Und seit letztem Sommer waren alle arbeitsfähigen Juden zur Zwangsarbeit verpflichtet. Sie wurden also nicht mehr nur ausgeraubt und entrechtet, sondern auch versklavt.
Was also, fragte Frieda sich, sollte sich da noch zuspitzen? Wollte Winter sie fortschicken?
Trotzig sah sie ihren Chef an. Ihr Herz schlug schneller. Seine Habichtsaugen ruhten auf ihr wie auf einem Kaninchen, das er gleich packen würde. Unwillkürlich krallte sie ihre Finger in die Sitzfläche des Stuhls.
Wollte er mit ihr schlafen? Ging es darum? Sie war nicht verheiratet, er wusste das. Und nicht hässlich. Wenn auch ihre dunkelbraunen Augen, ihre etwas zu große und nach unten gebogene Nase, die schwarzen Haare und ihr südländischer Teint sie bei Ariern mit Rasseninstinkt verdächtig machten. »Judennase« hatten Klassenkameraden ihr hinterhergerufen. Sie war ein leichtes, ein leicht unter Druck zu setzendes Opfer. Freiwild für hungrige Männer, die es mit der Rassenlehre nicht so genau nahmen. Wobei Winter immer korrekt und anständig gewirkt hatte. Würde er sie anrühren, würde sie laut schreien und sich wehren. Ihn schlagen, beißen, kratzen und zwischen die Beine treten, was auch immer nötig wäre.
Sie spannte ihre Muskeln an.
»Was wollen Sie mir sagen?«, fragte Frieda mit zitternder Stimme und starrte auf das Goldene Parteiabzeichen.
Er bemerkte ihre Anspannung. »Vielleicht kann ich Sie schon bald nicht mehr beschützen. Deutsche Truppen rücken immer weiter in Russland vor. Hitler hat seine Kriegsziele fast erreicht, niemand scheint ihn stoppen zu können. Sein Selbstbewusstsein ist ins Unermessliche gewachsen. Er sieht sich als Erlöser, Frau Wolff. Und als solcher will er nicht nur ein Kolonialreich im Osten, sondern auch die Juden vernichten. Er hasst Ihre Rasse … ich meine Ihr Volk … abgrundtief.«
»So weit wird er nicht gehen«, sagte sie bestimmt und fragte sich, worauf sich ihre Gewissheit eigentlich gründete.
»Da wäre ich mir nicht so sicher. Der Mann ist besessen. Es gibt furchtbare Berichte aus dem Osten. SS-Einheiten und Polizeibataillone folgen dort der vorrückenden Wehrmacht. Sie durchkämmen Dörfer und Städte hinter der Front nach Juden. Und erschießen alle, die sie finden. Es wird von Massenerschießungen mit vielen tausend Toten und anonymen Massengräbern berichtet.«
Frieda schluckte. Diese Berichte, diese Gerüchte waren ihr bekannt. Hitler hatte bereits 1939 von der »Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa« gesprochen, sie hatte die Rede im Radio gehört und es nicht fassen können. Mit ihrem Freund Leo hatte sie lang darüber diskutiert. Es konnte nicht sein, waren sie sich einig gewesen, warum sollte Hitler das tun? Er brauchte sie doch als Sklavenarbeiter in den Rüstungsfabriken, jetzt, wo die deutschen Männer im Feld standen. Deshalb ließ er die Juden auch nicht mehr ausreisen. Und er brauchte einen Feind, auf den sich der Hass konzentrieren konnte, der hinter allem Bösen steckte. Bis er den Krieg gewonnen hätte, dann würden die Diffamierungen und Verfolgungen aufhören.
Wieder und immer wieder hatten sie sich das einander eingeredet, um die Zweifel zu vertreiben.
Doch sie waren geblieben.
»Was wollen Sie von mir?« Ihre Stimme klang hart und feindselig.
Verwundert sah Winter sie an. Und verstand plötzlich, was sie fürchtete. Er lächelte entschuldigend. »Nicht, was Sie denken, Frau Wolff. Ich will Ihnen nur sagen, dass ich Sie vielleicht nicht mehr lange schützen kann. Was tun Sie dann?«
Forschend blickte sie ihn an. Sie fragte sich, was ihn trieb. Die Nazis und ihre Aufrüstungspolitik hatten ihn reich gemacht. Schämte er sich für das, was die Deutschen in der Welt anrichteten? Schützte er seine Zwangsarbeiter-Juden, um Buße zu tun? Um vor sich zu rechtfertigen, dass er sich am Krieg eine goldene Nase verdiente? Konnte er so nachts besser schlafen?
»Wenn die SS mit Lastwagen vor der Fabrik steht und Sie holen will, ist es zu spät. Das sollten Sie bedenken, Frau Wolff. Versuchen Sie, ins Ausland zu gehen.«
»Habe ich versucht«, sagte sie bitter. »Ich hatte schon ein Visum für Großbritannien. Doch dann begann der Krieg.«
Auch Leo hatte ein Visum für Großbritannien gehabt. Sie hatten sich ihre Zukunft, ihr gemeinsames Leben schon in bunten Farben ausgemalt. Die Sonne schien, der Atlantik brandete an die Küste, es roch nach Salz und Freiheit. England wäre nur ein Zwischenstopp gewesen. Von da wären sie weiter nach Palästina gereist.
Winter nickte und senkte den Blick.
Friedas Augen verengten sich. »Muss ich gehen? Schicken Sie mich fort?«
Winter schüttelte den Kopf. »Ich werde Sie behalten, solange es mir möglich ist. Aber darauf sollten Sie sich nicht verlassen. Sie sollten verschwinden, solange Sie können.«
»Wohin denn?« Ihr Lachen war kalt. Verloren blickte Frieda vor sich hin.
Winter seufzte. Darauf hatte auch er keine Antwort. »Ich gebe Ihnen Bescheid, wenn ich Sie nicht mehr schützen kann. Versprochen.« Er zögerte. »Und da habe ich noch etwas.«
Winter griff in seine Anzugtasche und holte eine kleine Schachtel heraus. Er öffnete sie und stellte sie vor Frieda. Darin befanden sich das Abzeichen der NS-Frauenschaft und das Goldene Parteiabzeichen in kleiner Ausführung, so wie er selbst eines trug. Fragend sah Frieda ihn an.
»Oft ist der Schein wichtiger als das Sein«, sagte er. »Die Leute sehen, was sie sehen wollen. Und dieses Abzeichen macht eine Arierin aus Ihnen. Und vielleicht kennen Sie jemanden, dem Sie das andere Abzeichen geben können.«
5
Berlin, 24. Oktober 1942
»Ihr dürft auf keinen Fall dahin!«, rief Frieda und sah ihre Mutter fassungslos an. Sie hatte die gleichen großen, dunklen, sanften Augen wie Frieda. In der Hand hielt die Mutter ein Schreiben, das die Jüdische Gemeinde im Auftrag der Gestapo verfasst hatte. Dort stand, dass Friedas Eltern in den Osten umgesiedelt würden. Dass die Gestapo sie heute im Lauf des Tages abholen werde und dass sie sich bereithalten sollten.
»Wann habt ihr das Schreiben bekommen?«, fragte Frieda.
»Vor zwei Tagen«, sagte die Mutter.
Das war merkwürdig, normalerweise gab die Gestapo den Juden zwei Wochen Vorlauf. Seit einem Jahr liefen die Transporte in den Osten. In der Levetzowstraße, in der einst prächtigen Synagoge, war ein Sammellager eingerichtet worden. Dorthin wurden die Berliner Juden gebracht, sie schliefen auf Strohsäcken und auf ein paar wenigen Matratzen, bis eintausend Leute beisammen waren. Dann wurden sie in Lkws zum Bahnhof Grunewald gebracht und in Güterwaggons in den Osten gefahren. In Güterwaggons! Die Gestapo hatte die Jüdische Gemeinde gezwungen, das Lager mit Verpflegung, Medikamenten, Schlafgelegenheiten und Wäsche zu versorgen. Juden kochten in einer Großküche Essen, besorgten Decken und betreuten die Alten und Kranken. Es war so schlau wie perfide von der Gestapo, die Jüdische Gemeinde in die Organisation der Deportation einzuspannen. Die jüdischen Helfer sahen darin die Chance, anderen zu helfen. Und sich selbst für eine Weile der Deportation zu entziehen.
Friedas Vater saß am Esstisch und starrte auf alte Fotos, die er vor sich auf dem Küchentisch ausgebreitet hatte. Fotos von ihnen aus einer anderen, glücklichen Zeit, als sie eine angesehene Potsdamer Familie gewesen waren. Ihr Vater liebte das Fotografieren, so wie er sein Leben geliebt hatte, bevor die Nazis an die Macht gekommen waren. Jedes Foto war für ihn das Dokument eines erfüllten Moments, alle zusammen ergaben das Mosaik eines gelungenen Lebens.
»Ihr dürft auf keinen Fall gehen!«, sagte Frieda.
»Was sollen wir denn tun?«, fragte die Mutter verzweifelt. »Im Untergrund leben? Von Tag zu Tag eine neue Bleibe suchen? Vater ist nicht mehr gut zu Fuß, er kann nicht rennen. Und er kann sich nicht verstellen. Er kann nicht vor einem SS-Mann strammstehen und den Hitlergruß machen.«
Ja, es würde schwierig werden, dachte Frieda, und sie musste an die Warnung von Horst Winter denken. Was bedeutete es, wenn sie die Juden in den Osten brachten? Es hieß, dass es in Polen riesige Arbeitslager der Rüstungsindustrie gab. Dass Juden dort Kriegsgerät für den Russlandfeldzug produzierten. Doch wenn es wirklich Arbeitslager waren: Warum schickten die Nazis einen über sechzigjährigen, gebrechlichen Mann dorthin und nicht sie?
»Wir gehen«, sagte der Vater plötzlich. »Die tun uns nichts. Wir sind angesehene deutsche Bürger. Ich bin Weltkriegsveteran mit Eisernem Kreuz, ich habe für dieses Land gekämpft und es nach dem Krieg mit aus dem Schlamassel gezogen.«
Es klang wütend und trotzig, als wäre Frieda schuld daran, dass die Nazis dies vergessen hatten. Als müsste er das nur laut genug sagen, dann würden sie die Juden schon in Ruhe lassen.
Er sah seine Frau an. »Wir haben schon ganz anderes gestemmt. Wir gehen in den Osten und fangen noch einmal von vorn an. Dort kommen schließlich unsere Vorfahren her, und wenn der Krieg vorbei ist, machen wir wieder einen Herrenausstatter auf. Gute Kleidung braucht man immer und überall.«
Frieda sah, wie die Augen ihrer Mutter für einen Moment leer und trostlos wurden. Wie Glaube und Hoffnung für einen Augenblick keine Kraft mehr besaßen. Dann hatte sie sich wieder im Griff.
»Vor einer Woche«, sagte sie und senkte dabei den Blick, »kam ein Offizier der Luftwaffe zu uns. Er hatte einen Makler dabei, und der teilte uns mit, dass der Mann sich fürs Vaterland verdient gemacht habe und unser Haus ›übernehmen‹ werde.«
Daher weht der Wind, dachte Frieda, deshalb deportieren sie euch so schnell. Sie wollen die Eltern verschwinden lassen, um rasch an das Haus zu kommen.
»Wir haben hier nichts mehr, Frieda«, sagte ihre Mutter mit tonloser Stimme.
Das große Haus nah am Templiner See war für sie alle eine Oase des Glücks gewesen. Nach dem Verkauf des Geschäfts hatten sie im Garten Obst und Gemüse angebaut und Hühner gezüchtet. Und Leo hatte sie hier bei einem Spaziergang kennengelernt. Wie sie arbeitete er in einer Fabrik in Berlin.
Leo! Wenn sie nur an ihn dachte, schlug ihr Herz schneller, und alle Traurigkeit verschwand für einen Moment. Mit ihm war sie im letzten Jahr jeden Samstag und Sonntag am Templiner See und am Wannsee entlangspaziert. Dort konnten sie ein bisschen die Wirklichkeit vergessen. Im Herbst gingen sie durch buntes Laub, im Winter durch Eis und Schnee, und als die Kirschen blühten, küssten sie sich zum ersten Mal. Dabei standen sie mit den Füßen im kalten Seewasser. Eine Romanze im Angesicht des Schreckens.
Frieda schüttelte den Kopf. »Ihr dürft nicht warten, bis euch die Gestapo holt. Ihr müsst verschwinden! Leo und ich helfen euch. Leo hat sehr gute Kontakte zur Jüdischen Gemeinde, wir finden eine Wohnung für euch. Es gibt Gerüchte, dass im Osten schlimme Dinge passieren. Dass die Nazis dort Juden töten, zu Tausenden.«
»Dummes Gerede«, sagte der Vater. Doch so, wie er klang, glaubte er sich selbst nicht so ganz. Warum wollte er in den Osten gehen?, fragte sich Frieda. Weil er nicht glaubte, nicht glauben wollte, dass die Deutschen ihm etwas antun würden. Er wusste von den Konzentrationslagern, auch dass dort Juden gefoltert wurden, aber dass es Massenerschießungen gab? Niemals. Und vielleicht spielte auch eine trotzige Hoffnungslosigkeit eine Rolle. Felsenfest hatte er an die deutsche Kultur geglaubt, dass die Jahrhunderte der Diskriminierung endlich vorbei wären, dass die rechtliche Gleichstellung Schritt für Schritt zu echter Gleichberechtigung führen würde, doch er hatte sich getäuscht. Und diese herbe Enttäuschung, zusammen mit den alltäglichen Demütigungen, wollte er nicht länger ertragen. Da wollte er lieber sterben, als wie ein Entrechteter, wie ein Aussätziger zu leben. Und dann war da noch die Scham, dass er das Geschäft, das schon sein Vater geführt hatte, verkaufen musste, auch wenn er gar nichts dafürkonnte.
Frieda redete und bettelte. Es gelang ihr dennoch nicht, die Eltern umzustimmen.
Als sie ging, kam ihre Mutter noch mit an die Tür.
»Hier«, sagte sie leise und gab Frieda ein Päckchen mit Briefen. Die Hände der Mutter zitterten leicht. Es waren Friedas Briefe, die sie der Mutter nach Hause geschrieben hatte, seit sie zur Ausbildung nach Berlin gezogen war. Im ersten Moment wusste Frieda nicht, was das sollte, und sah die Mutter verwundert an. Dann verstand sie, und sofort schossen ihr Tränen in die Augen. Ihrer Mutter war klar, dass sie sich nie mehr wiedersehen würden. Deshalb gab sie ihr die Briefe zurück, diese Zeichen von Friedas Liebe. Als Erinnerung. Sie wollte die Briefe retten, damit Frieda ihre Mutter nicht vergaß. Und auch Fotografien waren dabei, solche, von denen der Vater mehrere Abzüge hergestellt hatte, die er entbehren konnte, die er nicht jeden Tag ansehen musste, um in diesen finsteren Zeiten Kraft und Hoffnung zu schöpfen.