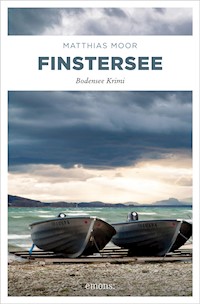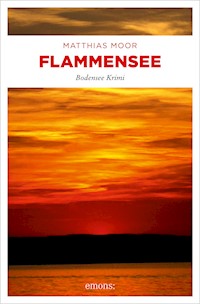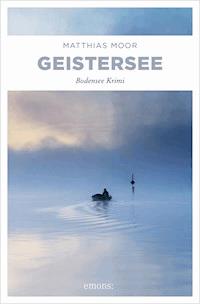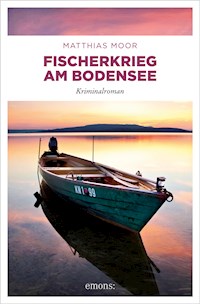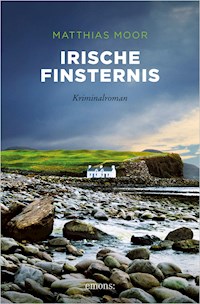
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Sehnsuchtsorte
- Sprache: Deutsch
Spurensuche an den Cliffs of Kerry Marc Wegener ist am Boden zerstört, als seine Verlobte kurz vor der Hochzeit unter ungeklärten Umständen ums Leben kommt. Als er auf einem Foto von ihr im Hintergrund seine alte Jugendliebe Jane entdeckt, reist er in deren Heimat Irland in der Hoffnung, dass sie Antworten für ihn hat. Doch Jane scheint spurlos verschwunden. Marc forscht weiter. Was er herausfindet, lässt die Grenzen zwischen Gut und Böse verschwimmen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 457
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Matthias Moor, Jahrgang 1969, lebt seit über zwanzig Jahren am Bodensee. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder und arbeitet als Gymnasiallehrer und freier Journalist in Konstanz. Irland ist neben dem Bodensee seine Seelenheimat. Wenn mal nichts anliegt, geht er am liebsten zum Angeln.www.matthias-moor.de
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2021 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: mauritius images/Vince Bevan/Alamy
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer
Karte: dedesigned elisabeth deger
Lektorat: Lothar Strüh
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-729-3
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Dieser Roman wurde vermittelt durch die Literaturagentur Beate Riess, Freiburg.
Well you know I have a love
A love for everyone I know
And you know I have a drive
To live, I won’t let go
But can you see its opposition
Comes rising up sometimes?
That its dreadful imposition
Comes blacking in my mind
And then I see a darkness
And then I see a darkness
And then I see a darkness
And then I see a darkness
Did you know how much I love you?
Is a hope that somehow you
Can save me from this darkness?
Will Oldham, »I See a Darkness«
Prolog
Lough Currane, Irland
Sie wusste nicht, was sie geweckt hatte, aber irgendetwas stimmte nicht, ihr Herz schlug viel zu schnell. War es ein böser Traum? Sie konnte sich an nichts erinnern.
Reglos lag sie in dem Bett des ausrangierten Wohnwagens. Irgendetwas sagte ihr, dass sie sich nicht bewegen durfte. Seit gestern waren sie hier mutterseelenallein gewesen, an diesem bezaubernden Ort. Doch wo blieb Sinéad? Am Abend war sie zum Einkaufen gefahren. Sie hätte schon längst wieder da sein müssen.
Plötzlich ein Geräusch … Das Rascheln von Blättern auf der anderen Seite der dünnen Wand …
Sie hielt den Atem an. Ihr Herz schlug so schnell, dass sie Angst hatte, man könne es draußen hören. Ein Tier, es könnte ein Tier sein. Am Nachmittag hatte sie einen Nerz am Seeufer beobachtet.
Da war es wieder!
Als würde jemand auf trockenes Laub treten.
Mit einem Ruck drehte sie sich um. Es dauerte einen Moment, bis sie fokussieren konnte, aber für den Bruchteil einer Sekunde sah sie es: Das Gesicht in dem kleinen schmutzigen Fenster, es hatte hineingeblickt und sie angestarrt!
Einen Wimpernschlag später war es verschwunden. Ein eiskalter Schauer lief ihr den Rücken herunter: Es war das Gesicht einer Frau, weiß wie ein Geist aus dem Totenreich. Sie trug einen strengen Pagenschnitt, der Pony ging bis knapp über die Augenbrauen. In ihrem Ausdruck lag etwas Kaltes. Erbarmungsloses. Nein, das war nicht Sinéad.
Der Puls hämmerte in ihren Schläfen. Der Wohnwagen ließ sich nicht abschließen, jeder konnte ihn jederzeit betreten. Sie hatte auch keine Waffe. Und nur Sinéad wusste, wo sie war. Es gab kein Haus weit und breit, abgesehen von dem verlassenen Gemäuer gegenüber.
Langsam setzte sie sich auf. Lauschte nach dem Rascheln, aber jetzt war es still. Sie schlüpfte in ihre Schuhe und nahm die Taschenlampe. Ihr Herz pochte, die Hände zitterten, aber sie musste wissen, wer da draußen war.
Es quietschte, als sie die Tür öffnete. Der schwache Lichtstrahl der Taschenlampe suchte den Vorplatz ab, dann leuchtete sie hinüber zu dem alten Haus. Vielleicht hatte sich die Frau darin versteckt?
Sie trat hinaus.
Die Luft war kühl.
»Hallo?«, rief sie in die Nacht. »Sinéad?«
Nichts. Hatte sie geträumt? Die dunklen Fensteröffnungen des Hauses gegenüber kamen ihr wie Riesenaugen vor. Stand die Frau dort im Schatten und spähte durch die zerbrochenen Scheiben? Jedenfalls war sie ganz in der Nähe, das spürte sie. Sie hatte Gänsehaut.
Schnell wieder rein, rief ihr Instinkt.
Als sie sich umdrehte, nahm sie aus den Augenwinkeln eine Bewegung wahr.
Die Frau stand direkt neben dem Wohnwagen, sie musste sich dahinter versteckt haben. Der Lichtstrahl der Taschenlampe heftete sich an das Gesicht der Frau, sodass sie kurz blinzelte. Sie sah aus wie Sinéad und dann wieder nicht. Ihre Haare waren fuchsrot und lagen perfekt, als wäre es eine Perücke.
Sie lächelte. Es war kein gutes Lächeln. Es strahlte Verachtung aus, Verachtung und eine kalte Lust. So hatte Sinéad nie gelächelt, so hatte Sinéad sie nie angesehen!
Du musst hier weg, rief eine Stimme. Sie fuhr herum, wollte zurück in den Wagen, da traf sie ein harter Schlag im Nacken. Als sie kraftlos zu Boden sank, spürte sie noch einen Stich im Arm. Kurz darauf wurde ihr schwarz vor Augen …
Als sie erwachte, lag sie wieder im Bett des Wohnwagens. Aber etwas war anders, sie fühlte sich wie benommen, ganz schwer und ruhig, als wäre sie in Watte gepackt. Als wäre alles gar nicht so schlimm. Ihre Gedanken liefen wie in Zeitlupe ab.
Die Frau stand im Halbdunkel am Fußende des Bettes und durchsuchte mit einer Taschenlampe ihren Rucksack. Jetzt, wo sie sie beobachten konnte, gab es keinen Zweifel: Es war Sinéad. Sie war schön, auch in dieser Verkleidung. Eine kühle, strenge Schönheit. Sinéad hatte sie gerettet, dank ihr hatte sie wieder Lebensmut. Mit Sinéad war alles so leicht. Ihr konnte sie vertrauen. Sinéad würde ihr nichts tun.
»Du bist ja schon wieder wach?« Sinéad tat überrascht und sprach, als wäre sie ein kleines, dummes Kind. Ihre Stimme klang weit, weit entfernt. Doch sie hatte keine Angst mehr, zumindest war die auch weit weg. Ihre Lider wurden schwer, sodass sie für einen Moment die Augen schloss.
»Was hast du mir gegeben?« Ihre Stimme war ein Lallen, die Zunge so schwer wie ein Stück Blei.
»Du wirst gleich wieder schlafen«, antwortete Sinéad. »Lange, lange schlafen.«
Sie wollte sich aufrichten, doch sie war gefesselt. Das merkte sie erst jetzt. Arme und Beine waren mit Tüchern aneinandergebunden.
Da war die Angst auf einmal wieder da.
Kroch schnell an sie heran.
Flüsterte ihr etwas zu.
Schlüpfte wie kalter Nebel in ihre Poren.
Du wirst diese Nacht nicht überleben.
Sinéad wird dich töten, und sie hat dich die ganze Zeit belogen.
»Was hab ich dir getan?«, fragte sie.
Da lachte Sinéad. Mit einer Spritze in der Hand stieg sie aufs Bett und setzte sich auf ihren Bauch. Sie wollte sich wehren, aber ihre Glieder waren ja gefesselt und außerdem so unendlich schwer.
»Das wird dir guttun«, sagte Sinéad. Sie wehrte sich nicht. Der Einstich schmerzte in ihrer Armbeuge. »Du wirst einen schönen, einen wunderschönen Tod haben.«
Sinéads Gesicht war jetzt direkt über ihrem. Sie sah selbst so aus, als hätte sie Drogen genommen, es war ein Ausdruck absoluter Erfüllung. Sinéad fuhr mit ihren Händen durch ihre langen Haare. Auf die war sie immer stolz gewesen.
»Sie sind so schön und weich. Genau wie ihre. Erinnerst du dich noch an sie? Und genauso rot. Wie Feuer. Wie …«
Sinéad beugte sich zu ihr.
Flüsterte ihr etwas ins Ohr.
Sagte den Namen.
Da riss sie die Augen auf.
Auf einmal war ihr alles klar.
Die Erkenntnis stach in ihr Herz wie ein glühendes Schwert.
Kurz bevor die Droge ihr alle Sinne raubte, verstand sie, warum sie sterben musste.
Einmal noch wachte sie auf. Sie nahm alles nur verschwommen wahr, aber Sinéad schien weg zu sein. Es war der Geruch, der sie aufgeweckt hatte, sie kannte ihn von früher. Es roch nach Gas. Sie müsste die Fenster öffnen, aber sie konnte sich überhaupt nicht bewegen, als wäre sie gelähmt. Außerdem war sie so schrecklich müde. Wahrscheinlich gehörte der Geruch zu ihrem Traum. Auf ihrem Bett und dem Tisch brannten Teelichter. Schön sah das aus, wunderschön. Also machte sie die Augen wieder zu. Innerhalb von Sekunden fiel sie in einen schweren Schlaf.
Als der Wohnwagen in Flammen aufging, legte sich ein Lächeln auf Sinéads Gesicht. Das war besser als jeder Rausch. Als würde sich ein warmes, orangefarbenes Licht in ihrem Körper ausbreiten, das pure Glück. Nichts tat mehr weh, nichts drängte, sie war wie entrückt, als würde sie schweben. Es würde sie nicht heilen, aber am Leben halten. Lange.
Sie steckte sich eine Zigarette an, schloss die Augen und sog den Rauch tief in ihre Lungen. Die beste Zigarette meines Lebens, dachte sie.
Da hörte sie die Schreie, voller Schmerz und Verzweiflung, und zuckte zusammen. Lag auch Reue darin? Hatte sie verstanden, warum sie starb?
Sie öffnete die Augen. Die Flammen loderten in die Nacht, aber das warme Licht in ihr war erloschen, und die Schreie wollten nicht aufhören.
Als sie endlich verstummt waren, warf sie die Kippe mit zitternden Händen in eine Pfütze und machte sich auf den Weg durch den Wald.
Sie war noch nicht fertig.
Sie hatte noch einen langen, gefährlichen Weg vor sich.
1
Frierend stehe ich draußen an Deck, bald kommen wir in Dublin an. Die See ist rau, und die Fähre schwankt so stark, dass ich mich an der Reling festhalten muss. Der eisige Wind wirft mir einen Schauer Gischt ins Gesicht, die Küste Irlands sieht aus wie eine schwarze Wand. Darüber türmen sich noch schwärzere Wolken, und dazwischen scheint ein schmaler Streifen aus goldenem Licht. Es ist kein tiefes, warmes, sattes Gold, nur ein ganz schwaches, kühles, als hätte die Sonne gerade andere Sorgen.
Nicht mal hier oben bin ich allein. Ein paar Meter von mir entfernt würgt sich ein junger Mann die Seele aus dem Leib, als hätte er einen Aal verschluckt. Dabei lehnt er sich weit über die Reling, jeden Moment könnte er vornüberkippen und in der Irischen See verschwinden. Der arme Kerl ist keine dreißig und so dürr, dass ihn die nächste Bö vom Deck fegen könnte. Dem geht es noch dreckiger als mir, und das will was heißen.
»Brauchst du Hilfe?«, frage ich und lege meine Hand auf seine Schulter, aber er schüttelt nur abwehrend den Kopf.
Ein gezwungenes Lächeln. »Danke, Kumpel, mir geht’s gleich wieder gut.«
Danach sieht es nicht aus, und schon geht das Gewürge wieder los. Wie ein toter Fisch hängt er kurz darauf über der Reling. Besser, ich halte ihn fest.
Da fangen seine Schultern wieder an zu zucken. Es dauert eine Weile, bis er sich selbst festhalten kann. »Zu viele Pints gegen den Sturm«, sagt er.
Oder gegen das Leben, denke ich, damit kenne ich mich aus. Innerhalb eines Jahres bin ich zu einem Trinker geworden, den nur der Gedanke durch den Tag trägt, am Abend die erste Flasche aufzumachen und alles vergessen zu können. Immerhin scheint jetzt alles draußen zu sein. Mein neuer Freund riecht nach Erbrochenem und Bier und saugt die salzige Luft in seine durchgewalkten Lungen. Atmet ein, atmet aus.
»Back among the living«, meint er mit einem zuversichtlichen Lächeln. Sein Gesicht ist grau, mit einem Stich Grün. Und genauso nass von der Gischt wie meins.
»Fucking freezing«, stellt er fest. »Lass uns reingehen.«
Ich stütze ihn auf dem Weg zur Tür. Er wirkt gebrechlich und kurzatmig, eher wie siebzig als wie dreißig, und schwankt noch stärker als die Fähre. So wie er aussieht, hat er nicht nur ein Alkoholproblem. Hasch, Speed, Koks, wahrscheinlich nimmt er alles, was er in die Finger kriegt. Keine gute Prognose. Wir zwei sind sicher ein prächtiger Anblick.
Ich öffne die Decktür. Ein Schwall warmer, verbrauchter Luft dringt aus dem Schiffsinneren.
Der junge Ire schlüpft hinein. »Danke«, sagt er dann. »Du hast mir das Leben gerettet. Wirklich. Ich stehe tief in deiner Schuld. Wie wär’s mit einem Hot Whiskey und einem Pint unten an der Bar?«
Ich schüttle den Kopf, obwohl ich eigentlich einen Drink bräuchte. »Ich bleibe hier.«
Verwundert sieht er mich an, betrachtet zum ersten Mal so richtig seinen Retter, und ich kann hören, was er denkt: Fuck, der ist ja noch fertiger als ich.
»Warum?«, fragt er. »Was zur Hölle willst du hier draußen? Sterben?«
Nicht mehr, denke ich. Und sage: »Nachdenken.«
Und er: »Alles klar.« Dann ist er fort.
Nein, sterben will ich nicht mehr, im Moment zumindest nicht, aber bis vor ein paar Tagen wollte ich genau das. Seit über einem Jahr ist Anna jetzt tot. Sie und unsere kleine Tochter, die noch in ihrem Bauch war. Mia, wir hatten sie Mia genannt.
Seitdem habe ich fast nichts mehr gegessen und vor allem von Alkohol und Nikotin gelebt. Und von Valium, wenn das andere nicht mehr half. Ich bestehe nur noch aus Haut und Knochen, bin aber noch da. Es ist gar nicht so leicht, sich totzusaufen, habe ich festgestellt. Nur mein Hirn hätte ich schon ruiniert. Meint zumindest mein Freund Philipp, der einzige Mensch, der mich halbwegs kennt. Der mich nie im Stich gelassen oder aufgegeben hat. Der abends vorbeikam und mich dazu zwang, ein paar Bissen herunterzuwürgen. Stürz dich in die Arbeit, halt dich an der Arbeit fest, hat er mir gesagt, so haben wir es doch immer gemacht, rede dir ein, dass sie dein Leben ist, mach dich zu ihrem Sklaven, dann stehst du das durch!
Wenn das nur so einfach wäre. Mir hat die Kraft dazu gefehlt. Oder: Ich wollte sie gar nicht mehr haben.
Aber dann war auf einmal alles anders. Ich wollte doch wieder leben. Auf einmal hatte ich wieder Energie. Und kündigte meine Stelle und meine Wohnung. Ich sei völlig verrückt, meinte Philipp. »Für nichts, für absolut nichts lässt du alles zurück?«
Ich fragte: »Was alles?«
Da war er still.
Das Nichts ist ein Foto, ein gottverdammtes Foto. Deshalb stehe ich hier, auf dieser schwankenden Fähre in der Irischen See, und vielleicht kann es mich retten. Deshalb bin ich gestern Abend sofort losgefahren, nach dem Anruf des Detektivs, von Frankfurt nonstop nach Calais und in einem Tempo, als wäre der Teufel hinter mir her. Aber mich hat keiner verfolgt, zumindest habe ich niemanden bemerkt, ich hatte einfach nur Angst, dass ich wieder umdrehe, wenn ich stehen bleibe. Denn wer weiß, was mich erwartet. Wen ich finde, wenn ich sie finde. Lass die Vergangenheit ruhen, weck die Geister nicht auf, meinte Philipp. Und sah mich ernst an mit diesem von einer schlecht operierten Hasenscharte leicht entstellten Gesicht.
Noch immer könnte ich umkehren, einfach im Hafen von der Fähre runterfahren und mit der nächsten zurück. Aber wohin? Frankfurt wäre mein Ende, Afrika auch. Ich kann nicht mehr so leben wie vor Anna.
Ein neuer Schauer kalter Gischt wirft mich zurück an Deck. Dublin ist näher gekommen, doch der Lichtstreifen am Horizont verschwunden. Ein zerrissener Schleier aus Regen hat sich zwischen Irland und die Fähre geschoben. Und schon fängt es an zu schütten.
Das Leben ist einfach wunderbar, denke ich.
Ich setze mich auf eine Bank so halbwegs im Trockenen und hole mit klammen Fingern das Foto heraus, um mich zum tausendsten Mal zu vergewissern. Mein Gesicht ist immer noch nass, und meine Lippen schmecken nach Salz. Das Foto ist eines der letzten, die es von Anna gibt, ich habe es ein paar Tage vor ihrem Tod gemacht.
Es war der erste warme Tag des Jahres. Endlich, dachte ich, in ein paar Wochen wollten wir heiraten, da sollten die Apfelbäume blühen. Wir hatten beide frei, waren wieder glücklich, machten ein Picknick am Main, saßen im Gras auf dem breiten Uferstreifen mit Blick auf die Frankfurter Skyline. Die Sonne schien schon warm, der Boden war noch kalt. Anna kniete auf einer Picknickdecke, ein Glas Saft in der rechten Hand, die linke auf ihrem Bauch. Seit sie schwanger war, hatte sie immer eine Hand auf ihrem Bauch. Sie sah umwerfend aus, wie das blühende Leben, keine Spur mehr von Traurigkeit oder Zweifeln. Ihr langes Haar glänzt, sie trägt eine hellblaue Bluse, der oberste Knopf ist geöffnet, an einer Kette hängt ein Stück rote Koralle. Das habe ich ihr nach unserem ersten Urlaub geschenkt. Anna sieht mich an, und ihr Lächeln ist wie ein Sog, in dem ich verschwinden will.
Aber das ist es nicht, was mich hergebracht hat. Es ist die Frau hinter Anna, die mir erst vor einer Woche aufgefallen ist, obwohl ich mir dieses Foto wie all die anderen schon Hunderte Male angeschaut habe. Sie sitzt vielleicht zehn Meter hinter Anna und blickt direkt in die Kamera.
Direkt in meine Augen.
Meine Hände zittern, nicht nur wegen der Kälte. Die Bräune Afrikas ist schon lange weg, es sind bleiche, alte Hände mit hervorstehenden bläulichen Adern und blättriger Nagelhaut. Sie sehen so aus, wie ich mich fühle, viel älter, als ich bin. Aber es sind meine, sie sind wirklich da, genau wie diese Fähre und dieses Meer aus Anthrazit und die schweren Wolken, genau wie diese Frau auf dem Foto.
Sie ist es, ohne jeden Zweifel! Warum sollte mich eine wildfremde Frau so anstarren? Mit diesem Blick? Es ist Jane, auch wenn ihre Haare kurz und hellblond sind, meine erste große Liebe, die ich vor über fünfundzwanzig Jahren das letzte Mal gesehen habe. Jane auf einem Foto zusammen mit Anna, meiner zweiten großen Liebe. Zwei Frauen aus zwei Zeiten, den wichtigsten in meinem Leben. Und die erste große Frage ist: Was wollte Jane in Frankfurt, auf derselben Wiese wie Anna und ich, und das wenige Tage vor Annas Tod?
2
Trotz des Regens sind Dublins Straßen voller Menschen. Den Wagen habe ich in einem Parkhaus in der Innenstadt geparkt. Ich treibe in einem bunten Strom aus Regenanzügen, so einen hätte ich Trottel auch einpacken sollen. Ein kalter Wind weht die von Kaimauern eingezwängte Liffey hinab, als ich über die Millennium Bridge laufe. Fucking freezing, hätte mein Freund von der Fähre gesagt. Ich muss den Schirm mit beiden Händen festhalten, damit wenigstens mein Kopf trocken bleibt, der Regen kommt von überall. Es ist Ebbe, aus dem Fluss steigt ein modriger Geruch nach Schlick und Tang, der sich mit dem der Autoabgase mischt. Die haben sich auch ins Rot der eckigen Ziegelbauten entlang der Uferstraße gefressen, sodass sie aussehen, als hätte sich ein Grauschleier auf sie gelegt. Es braucht wohl viel Sonne, um das Rot wieder zum Leben zu erwecken. Fleischige Seetangblätter hängen wie Wucherungen von den Kaimauern herab, zwei blaue Plastikflaschen treiben zwischen weißen Möwen auf dem schmutzig grauen Wasser. Die Schreie der Vögel klingen drohend und kalt.
Ich schaue in die Gesichter der Leute und suche nach Jane, als wäre es nicht unwahrscheinlich, dass sie mir hier einfach so über den Weg läuft. Ich weiß nicht mehr, was mein erster Gedanke war, als ich sie auf dem Foto erkannte. Es war eine Explosion von Gedanken. Dass sie es ist und dass es Unsinn ist, dass sie es ist. Wir hatten ein Vierteljahrhundert keinen Kontakt, warum sollte sie plötzlich etwas von mir wollen?
Aber vielleicht war es Zufall, vielleicht war sie beruflich in Frankfurt, hat sich an diesem herrlichen Frühlingstag in die Sonne gesetzt und mich erkannt. Oder sie hat mich gar nicht erkannt und nur gedacht: Wow, was für ein glückliches Paar! Oder sie wollte mich finden. Hat mich verfolgt, weil sie unsere Trennung nie verwunden hatte. Und deshalb will sie sich rächen und bringt meine schwangere Verlobte um.
So ein Quatsch, dachte ich dann und sah noch mal hin. Sah eine Frau, deren Schönheit mir unter die Haut ging. Sah das Bedingungslose in ihrem Blick, der mich damals schon magisch angezogen hatte. Erinnerte mich, wie wir schwitzend und nackt nach einer Nacht voller Sex in diesem winzigen Wohnwagen am Lough Currane gelegen und geraucht hatten, während draußen die Vögel zwitscherten.
»Du bist ein kranker Romantiker, das warst du schon immer«, meinte Philipp, als ich ihm von diesen Gedanken erzählte. »Du stellst dir vor, dass Jane Annas Mörderin ist, und zugleich willst du mit ihr vögeln und dich in sie verlieben. Du bist völlig verrückt, aber ich gebe zu, es gibt weniger originelle Wege, um sich zu zerstören.«
Zumindest damit hat er wohl recht.
Der Pub, in dem ich mich mit dem Detektiv verabredet habe, ist direkt gegenüber von der Christ Church Cathedral. Blumenbüsche wachsen aus Ampeln über der Tür und ranken die Fenster herab. Die erdbeerroten, himmelblauen, orangen und rosafarbenen Blüten blühen so prächtig vor dem satten Grün der Blätter, als wollten sie der wintergrauen Stadt einen Vorwurf machen. Aber wahrscheinlich sind sie gar nicht echt, sie blühen einfach zu perfekt.
Als ich die Tür öffne, schlagen mir warme Luft und Folkklänge entgegen. Eine Combo mit Harfe, Geige und Querflöte sitzt um einen Tisch und spielt. Rhythmisch, schnell, mehr fröhlich als traurig, dazu Geplauder, Gelächter, es riecht nach Guinness und Pommes. Tut gut. Und ich brauche einen Drink, dringend. Das Licht ist gedimmt, nur über der Bar aus dunklem Holz werden Dutzende Whiskeyflaschen hell angestrahlt. Ein Firmament aus silbrigem Glas, dunklem Grün und glänzendem Bernstein.
Brian Ferguson begrüßt mich mit einem jovialen Lächeln. Ich erkenne ihn sofort. Am Telefon meinte er nur, ich solle nach einem Fleischberg mit kahlem Gipfel Ausschau halten.
Jetzt stehen geschätzte vier Zentner auf knapp zwei Metern vor mir und schütteln meine Hand. Seine ist groß wie eine Schaufel und ziemlich verschwitzt. Ich mag den Mann sofort. Ein offenes Gesicht mit einem warmen Lachen, fleischigen Lippen und smarten Augen. Er trägt ein Seidenhemd und eine teuer aussehende Anzughose aus grün glänzendem Stoff. Wir sitzen in einer ruhigen Ecke mit Blick auf die Band und die Bar. Auf dem Tisch liegt ein großes iPhone. Detektivarbeit scheint sich in Irland zu lohnen.
»Sie sehen aus, als könnten Sie einen Hot Whiskey gebrauchen. Oder besser gleich einen doppelten?«
Ich nicke. »Und noch ein Pint Guinness dazu.«
Brian grinst und gibt dem Barmann ein Zeichen. »Ihr Deutschen seid noch schlimmer als wir.«
Meine Hose ist patschnass, ich bin völlig durchgefroren. Vor Brian steht ein riesiger Teller mit einem Supersize-Rumpsteak und einer Wagenladung Pommes.
»Willkommen im zauberhaften irischen Frühling«, meint Brian trocken und nimmt wieder Platz. »War bestimmt eine reizende Überfahrt. Ich schätze mal, zwei Drittel der Passagiere haben die Fische gefüttert?«
»Mindestens! Deshalb bin ich an Deck geflüchtet. Aber da hat sich auch einer die Seele aus dem Leib gewürgt. Wäre beinahe über Bord gegangen. Keine dreißig und ein schwerer Trinker.«
»Tja, die irische Krankheit. Im alten Irland tranken die Leute, weil sie entweder arbeitslos waren oder ein Leben lang an einem öden Job festhingen. Im neuen Irland trinken sie, weil sie an den vielen Möglichkeiten verzweifeln. Oder scheitern. Und da ist kein Glaube mehr, der dich sanft an den weichen Busen drückt wie eine alles verzeihende Mutter.«
»Und Sie? Sind Sie neues oder altes Irland?«
Brian lacht. »Beides. Ich liebe traditionelle Pubs und Folk Music, aber zurück ins bigotte, korrupte, alte Irland will ich nicht. Das wurde in den letzten Jahrhunderten von drei grausamen Herrinnen regiert: der britischen Krone, der Armut und der katholischen Kirche. Gott sei Dank haben wir uns von allen so ziemlich befreit.«
»Und wer regiert Irland jetzt?«
»Gute Frage! Der freie Wille? Oder die freie Marktwirtschaft. Finden Sie es heraus. Wissen Sie übrigens, dass die dicksten Dorsche der Irischen See direkt unterhalb der Fährlinie gefangen werden? Aus offensichtlichen Gründen?«
»Ach so? Dann nehme ich wohl lieber kein Fish & Chips!«
Brian grinst süffisant. »Steak ist hier eh besser. Ich komme zweimal im Monat zum Essen her. Allerdings sind die Portionen für Touristen kleiner. Die Riesensteaks macht der Wirt speziell für mich.«
Ich schüttle den Kopf. »Danke, ich nehme gar nichts. Mein Magen muss sich erst noch akklimatisieren.«
Und hier kommen die Drinks. Vor mir steht das erste Stout seit einer Ewigkeit, schwarz wie meine Träume, schwarz wie meine Seele. Und die fingerbreite Schicht weißen Schaums ist wie der letzte Rest Hoffnung, der mich aus Mitleid noch nicht verlassen hat. Mit dem ersten Schluck leere ich es zur Hälfte. Ahhh! Bittersüß und betörend, wie eine wilde letzte Liebesnacht.
Dann nehme ich den Hot Whiskey. Brian nippt an seinem und mustert mich, wie ich die Hände an dem Glas wärme. Einen Mann, der aussieht, als hätte ihn die Hölle ausgespuckt.
»Und Sie wollen also Ihre Jugendliebe wiederfinden?«
»So ist es. Ich bin ziemlich gespannt, was Sie herausgefunden haben. Im Internet habe ich ein paar Jane Flynns gefunden, aber meine war nicht dabei. Ihre Agentur meinte, Sie wären der Beste, wenn es darum geht, jemanden zu finden.«
Brian lächelt. »Schön, dass die das meinen. Aber wie gesagt, viel habe ich leider noch nicht. Ich hätte Ihnen das auch einfach schicken können.«
Ich schüttle den Kopf. »Ich wollte Sie sehen, wenn Sie es mir erzählen. Außerdem musste ich einfach weg. Zu Hause ist mir die Decke auf den Kopf gefallen. Schlimmer noch: Ich war dabei durchzudrehen.«
»Das kenne ich. Ich flieg immer nach Griechenland, wenn so eine Phase im Anmarsch ist. Dort lass ich mir dann die Sonne auf die Wampe brutzeln und trinke Cocktails, bis die Welt wieder im Lot ist. Na ja. Wegen dieser Jane Flynn: Allzu gute Neuigkeiten habe ich nicht.«
»Ist sie tot?«
»Ich weiß es nicht.« Brian seufzt. »So einen Fall hatte ich noch nie. Ich bin tatsächlich ziemlich gut darin, Verschwundene zu finden, doch diese Jane Flynn scheint sich in Luft aufgelöst zu haben.«
»Aber Sie haben eine Spur?«
Er schiebt mir ein Polizeifoto hin. Bestürzt starre ich es an. Es ist Jane, eindeutig. Ihre rotblonden Haare, die Sommersprossen und diese unglaublichen Augen: Ihre Iris war hellgrün mit goldenen, gelben, grauen, blauen und braunen Sprenkeln, ein verwirrendes Mosaik, man konnte sich darin verlieren. Das Foto muss ein paar Jahre nach unserem Sommer aufgenommen worden sein. Aber sie hat sich verändert, mein Gott. Ihre Züge wirken hart und feindselig. Ich weiß nicht, ob ich diese Frau mag. Ich würde mich jedenfalls nicht Hals über Kopf in sie verlieben.
»Ist das die Jane, die Sie suchen?«
Ich nicke. »Von wann ist das Bild?«
»Mai 1996. Da war sie gerade zwanzig. Dreiundzwanzig Jahre ist das jetzt her. Sie wurde in London festgenommen wegen eines Diebstahldelikts. Sie wollte ein paar Flaschen Wodka aus einem Supermarkt stehlen, wurde aber vom Ladendetektiv gestellt. Die Polizei hat dann Heroin bei ihr gefunden.«
»Sie war ein Junkie?« Ich merke, wie ich noch blasser werde.
Brian nickt und sieht mich mitfühlend an. »Sie hatte damals keinen festen Wohnsitz. Zumindest war sie nirgendwo gemeldet. Angeblich wohnte sie bei einer Freundin in East London. Die war auch polizeibekannt, eine drogenabhängige Prostituierte. Keine Ahnung, ob Jane ebenfalls als Prostituierte gearbeitet hat.«
»Oh mein Gott.«
»Tut mir leid.«
»Haben Sie noch mehr?«
»Jane hat zwei Jahre zuvor die Schule ohne Abschluss verlassen. Ein ehemaliger Lehrer von ihr hat mir erzählt, dass sie eine sehr eigenwillige Schülerin gewesen ist. Irgendetwas, meinte er, muss sich Ende des Jahres 1993 ereignet haben. Er kann sich noch genau erinnern, wie glücklich sie nach den Sommerferien gewirkt hat.«
Brian bricht ab. Ich sehe wohl ziemlich desolat aus.
»Machen Sie weiter. Bitte.«
»Er vermutete, dass sie sich in jemanden verliebt hatte.«
»Das war ich. Ich war damals gerade neunzehn.«
Brian schaut in seine Unterlagen. »Nach Weihnachten war sie dann wie ausgewechselt. Missmutig, starke Stimmungsschwankungen, aggressiv. Der Mann meinte wörtlich: ›So viel Zorn und Bitterkeit habe ich noch nie in einer jungen Frau gesehen.‹«
»Da haben wir uns getrennt. Ich meine, da habe ich mit ihr Schluss gemacht.«
»Jedenfalls kam der Lehrer danach nicht mehr an sie heran. Die Eltern wohl genauso wenig. Kurz darauf ist sie verschwunden. Die Polizei suchte nach ihr, aber ohne Erfolg.«
Brian macht eine Pause. »Gut zwei Jahre später taucht sie dann in London auf. Als kleinkriminelle Heroinabhängige.«
»Und dann verliert sich ihre Spur?«
»Noch nicht ganz. Zwei Jahre später war sie für einige Monate in einer Entzugsklinik in Cork. Allerdings hat sie die Therapie wieder abgebrochen. Seitdem scheint Jane Flynn vom Erdboden verschluckt worden zu sein. Einfach weg, unauffindbar. Jedenfalls ist sie in keinem europäischen Land gemeldet, auch nicht in den USA, Kanada, Australien und Neuseeland. Sie taucht nirgendwo auf.«
»Kann es sein, dass sie geheiratet hat?«
»Das habe ich natürlich als Erstes überprüft. Fehlanzeige.«
»Und was heißt das?«
Brian zuckt mit den Schultern. »Ehrliche Antwort? Rechnen Sie mit dem Schlimmsten. Frauen ohne festen Wohnsitz leben gefährlich. Und Prostituierte umso mehr, falls sie eine gewesen ist. Was glauben Sie, wie viele Menschen jedes Jahr verschwinden und niemals wieder auftauchen?«
»Und wenn sie nicht tot ist?«
»Das weiß der Himmel. Womöglich treibt sie sich irgendwo unter falschem Namen herum. Als Obdachlose, vielleicht in einer Fixerkolonie am Rand einer Großstadt. Sie ist jetzt Anfang vierzig. Wer so lange auf der Straße lebt, ist meist ein Wrack. Sie sind Arzt, Sie wissen, was das heißt. Offen gesagt, würde ich mir keine großen Hoffnungen machen. Selbst wenn sie noch am Leben ist, dürfte es ziemlich schwer sein, sie zu finden. Und wen auch immer Sie finden, es wird aller Wahrscheinlichkeit nach weder ein glücklicher noch ein gesunder Mensch sein.«
Für einen Moment bin ich still. Ich leere den Rest vom Whiskey in einem Schluck. Ich hatte also recht. Jane gibt mir die Schuld an ihrem kaputten Leben, und deshalb ist sie nach Frankfurt gekommen und hat Anna umgebracht. Auf diesem Polizeifoto sah sie so ganz anders aus, als ich sie in Erinnerung hatte, hart und feindselig, voller Hass. Aber dann: Die Frau auf dem Foto in Frankfurt, die sah überhaupt nicht aus wie ein Psychowrack auf Rachetrip. Das war der magische Blick der jungen Jane.
Ich hätte doch wieder umdrehen sollen.
»Und Janes Eltern?«, frage ich.
»Sind beide tot. Starben vor ein paar Jahren.«
»Und ihre Freundin damals in London? Die Prostituierte?«
»Ist vor zehn Jahren an Aids gestorben.«
»Dieser Lehrer: Meinen Sie, er wäre bereit, mit mir zu sprechen?«
Brian lächelt matt. »Habe mir schon gedacht, dass Sie nicht lockerlassen. Ist ein sehr feiner Mann. Patrick McGrath. Er lebt hier in Dublin, in Howth.«
»Sie haben seine Adresse?«
Brian gibt mir einen Schnellhefter. »Hier finden Sie alles, was ich Ihnen in Kurzform berichtet habe.« Er zögert einen Moment. »Und ich habe noch etwas für Sie. Es gibt da eine Kate MacMahon, eine Krankenschwester aus Cork. War nicht so leicht, sie aufzuspüren. Sie ist mittlerweile im Ruhestand und hat Jane betreut, als sie in der Entzugsklinik war. Eine ziemlich taffe Frau mit Haaren auf den Zähnen. Sie ist bereit, mit Ihnen zu sprechen. Sie hat sich damals wohl gut mit Jane verstanden. Aber sie verlangt ein saftiges Honorar: tausendfünfhundert Euro für eine Audienz. Kann sein, dass sie einfach nur abkassieren will. Ich dachte mir, wir besprechen das erst, bevor ich Ihr Konto plündere. Wenn Sie wollen, rede ich mit ihr. Oder Sie machen das selbst. Die Adresse finden Sie im Schnellhefter.«
»Danke, Mr. Ferguson. Gute Arbeit.«
»Brian, wenn Sie mögen.«
Ich reiche ihm die Hand und lächle. »Marc.«
»Ich hätte gern gute Neuigkeiten für dich gehabt. Die große Liebe nach so langer Zeit wiedersehen, wow, das hört sich aufregend an! Aber wenn ich dir einen Rat geben darf: Lass die Finger von der Sache. Ich glaube nicht, dass die Geschichte gut ausgeht.«
»Danke. Ich weiß deine Offenheit zu schätzen, Brian. Du sagst das Gleiche wie mein bester Freund. Aber ich will, dass du weitermachst. Suche in Südamerika, in Sibirien, von mir aus in der Antarktis. Checke Kliniken, Sozialämter, Psychiatrien, was weiß ich.«
Brian nickt. »Okay. Du bist der Boss. Aber das kann dauern. Und wird teuer.«
»Ich informiere dich, bevor ich pleite bin.«
Brian lacht. »Wie du willst. Du bist der Klient, und ich liebe große, gute Steaks. Was hast du jetzt vor?«
»Ich bleibe ein Weilchen in Irland. Ich werde mit dem Lehrer und der Krankenschwester reden. Und dann gibt es ein paar Orte, die ich wiedersehen will.«
3
Immerhin, der Regen hat aufgehört, auch der Wind ist schwächer geworden. Es ist erst Nachmittag, doch so dunkel, als wäre schon Abend. Die Straßenlaternen brennen, und von dem warmen Licht glänzen das nasse Kopfsteinpflaster und die Ziegel der Häuser in den Gassen von Temple Bar. Die Portale mancher Pubs sind so kunstvoll, prächtig und farbenfroh wie buddhistische Schreine. Man will einfach rein, und ich hätte auch schon wieder Durst, gehe aber weiter, treibe mit der Menge. Es wimmelt nur so von Sprachen und Menschen, alten und jungen, alle auf der Jagd nach ein bisschen Glück.
»Hey, Marc«, sagte Jane damals bei unserem letzten Telefonat. »In vier Wochen ist Weihnachten, dann sehen wir uns.«
Ihre Stimme sollte fröhlich klingen, aber da war noch etwas anderes. Hatte sie mir in den letzten Wochen etwas angemerkt?
»Jane, ich werde nicht kommen«, sagte ich mit pochendem Herzen.
»Ach so?« Sie klang verwundert, aber nicht erschrocken.
»Ich habe ziemlich lange nachgedacht. Ich glaube, dass es besser ist, wenn wir uns trennen.«
Dann begann ich zu erzählen, was ich mir zurechtgelegt hatte, ich weiß nicht mehr genau, was. Dass eine Fernbeziehung schwierig wäre, dass wir ja beide bald studieren würden und viel um die Ohren hätten, dass es zu früh wäre, sich schon festzulegen, irgend so etwas, jedenfalls war es nicht die Wahrheit.
Danach schwieg sie. Dieses Schweigen kann ich immer noch hören. So klingt es, wenn Hoffnung stirbt. Und ich starb auch ein wenig, bis ihre Antwort kam.
Doch sie wirkte ganz ruhig und gefasst. »Okay«, sagte sie langsam und nachdenklich, aber nicht verzweifelt. »Vielleicht hast du recht. Vielleicht ist es wirklich zu früh. Wir sollten unsere Zeit so in Erinnerung behalten, wie sie war, und das nicht kaputtmachen.«
Sie brach ab. Auch ich sagte nichts. Ich glaubte ihr kein Wort. Erst dachte ich, sie wollte noch etwas sagen. Dann, dass sie weinte. Und vielleicht dachte sie das Gleiche von mir.
»Ich wünsch dir alles Gute«, sagte ich nach einer kleinen Ewigkeit des Schweigens.
»Ja, das wünsch ich dir auch. Werde ein guter Arzt, Marc.«
Dann legte sie auf. Sie hatte nicht geweint, sie klang gefasst. Ich war erleichtert, dass sie es so leichtnahm, und auch enttäuscht. Doch die große Leere und der große Schmerz, die kamen erst später. Keine Ahnung, ob ich sie überhaupt bewusst wahrgenommen habe.
Ich zünde mir eine Zigarette an, eine Purple Silk Cut, im Pub habe ich mir drei Schachteln gekauft, so aus einer Laune heraus. Das waren Janes Lieblingszigaretten. Meistens rauchte sie Selbstgedrehte, weil Filterzigaretten zu teuer waren, aber zu besonderen Anlässen gab es eine Silk Cut. Auch ich habe sie damals in Irland geraucht. Sie schmecken mir immer noch. Und das Nikotin tut so verdammt gut. Legt sich wie Samt auf meine wunden Nerven.
Warum habe ich sie verlassen? Die Wahrheit ist: Ich bin weggerannt. Ich habe gezweifelt, an ihr wie an mir. Ich bin einer von den vielen mit einer zu schweren Kindheit. Der überlebt hat, aber spürt, dass er nicht wie die meisten ist. Stark, doch nicht wirklich gesund, mit einer Wunde, die nie ganz verheilt ist, nie ganz verheilen wird, die jederzeit wieder aufbrechen und mich töten kann. Ein Kind von Eltern, die besser keines bekommen hätten. Ich trage ein Zeichen, und alle, die so eins tragen, erkennen einander. Jane hatte es auch. Ich konnte es an ihren Augen sehen. Hinter ihrer Lebensfreude, ihrer Leidenschaft lag etwas Krankes, Todgeweihtes.
Im Kern war es das, weshalb ich weglief: Zwei Gezeichnete wie wir können nicht zusammen sein. Obwohl wir uns anzogen wie Magnete. Wer gerade so und mit viel Mühe die Balance hält, wird sie verlieren bei jemandem, der genauso ist. Dabei hatte ich genau so jemanden gesucht, der mich vielleicht versteht. Und jetzt? Will ich diese Frau wiederfinden, um jeden Preis. Weil die Wunde verheilt ist? Nein. Weiß ich, warum? Vergiss es!
Inzwischen bin ich in der College Road. Ich nehme mein Smartphone und wähle die Nummer von Patrick McGrath, Janes ehemaligem Lehrer. Eine ältere Frau hebt ab und reicht mich weiter. Die Stimme des Mannes ist freundlich und klar. Er weiß gleich, worum es geht, und würde sich freuen, meine Bekanntschaft zu machen. Und er hätte am frühen Abend Zeit, später müssten sie ins Theater.
Immerhin, denke ich. Er wird sich denken können, wer ich bin, und will mich trotzdem treffen. Aber vielleicht will er auch nur den Scheißkerl sehen, der das Leben seiner Schülerin ruiniert hat.
Ich nehme einen tiefen Zug. Vor mir spiegelt sich die stattliche Fassade des Trinity College in einer großen Pfütze. Schwere Säulen, hellgraue Steine, korinthische Kapitelle und Kassettenfenster mit weißen Rahmen. Hier wollten wir studieren, so hatten wir uns das zusammengeträumt: Jane vielleicht Sprachen und ich Medizin. Wir hätten ein kleines Zimmer und würden beide nach der Uni jobben, um es zu finanzieren. Spätabends kämen wir erschöpft nach Hause und hätten trotzdem wie jede Nacht wilden Sex. Dann würden wir Arm in Arm in einem viel zu schmalen Bett einschlafen, und wenn im Winter die Kälte durch die brüchigen Fensterrahmen kröche, würden wir uns unter der Decke noch enger aneinanderschmiegen. Wir würden es schaffen, würden uns nie mehr loslassen, wären für immer geborgen und hätten endlich ein Zuhause.
Da fährt ein Auto durch die Pfütze, meine Hose ist patschnass und der Traum fort. Auf der anderen Straßenseite steht ein Mann und starrt mich an. Mir stockt der Atem. Sein Gesicht kann ich in der Dämmerung kaum erkennen, aber es ist seine Figur, klein und schmächtig. Michael, er ist also gekommen, verfolgt mich noch immer. Warum sollte er auch aufhören? Das wird er nie. Der Mann, der mich mit jeder Faser seines Körpers hasst, weil Anna ihn für mich verlassen hat und nicht zu ihm zurückgekehrt ist. Nie mehr zu ihm zurückkehren kann.
»Michael!«, rufe ich hinüber, aber der Straßenlärm verschluckt den Schrei. Da versperrt ein vorüberfahrender Bus die Sicht, und als er vorbei ist, ist Michael fort.
»Wegen dir ist sie tot«, meinte er nach der Beerdigung. Ein Satz wie ein Messer, und es steckt immer noch in mir drin. Annas Mutter wurde weiß wie eine Wand. Und dann sagte er noch: »Ich werde dich nie in Ruhe lassen.«
Michael ist ein Getriebener. Wie ich. Er jagt mich, und ich jage einen Geist. Will er mich töten? Vielleicht nicht. Das hätte er schon lange tun können. Aber verhindern, dass ich vergesse. Er will, dass ich es selbst tue.
Ich laufe los. Schiebe mich zwischen den Passanten hindurch, manche rufen mir wütend nach. Ich renne, bis ich aus der Puste bin. Seit einem Jahr habe ich außer Trinken keinen Sport getrieben.
Ich stehe in der Grafton Street. Es wird nicht aufhören. Ich habe mir eingebildet, ihn abschütteln zu können, aber er wird für immer mein Schatten sein. Dann, zwischen all den vorbeiströmenden Menschen, den Straßenmusikern und erleuchteten Schaufenstern, bleibt mein Blick an einer jungen Bettlerin hängen. Zusammengekauert sitzt sie da, mit erstarrter Miene, dunklen Augenrändern und einem leeren Blick, als wäre ihr Geist längst zu einem besseren Ort geflogen und hätte den Körper als leere Hülle hier zurückgelassen.
4
Ich bin das Kind eines Kampfes, so erbittert, wie ihn zwei Menschen nur führen können. Als ich fünf war, zog meine Mutter mit mir zu einer Freundin und reichte die Scheidung ein. Für meinen Vater war das der erste Gipfel des Verrats.
Lächle bloß nicht, wenn er Fotos von dir macht, impfte mir die Mutter ein. Er zeigt sie dann dem Richter, um zu beweisen, dass es dir bei ihm besser geht. Dann nimmt der Richter dich mir weg. Dann musst du für immer zu ihm. Am besten lachst du überhaupt nicht, wenn du bei ihm bist.
Also schaute ich todernst, wenn mein Vater mich fotografierte. Lächle, rief er, wenn ich es nicht tat. Verkniff es mir, obwohl ich eigentlich gern gelächelt hätte. Und wenn er mich mit traurigen Augen ansah, war das jedes Mal wie ein Stich ins Herz. Und wenn ich mal nachgab, wenn ich doch lächelte, was ich ja eigentlich wollte, kam es mir so vor, als hätte ich meine Mutter verraten. Fühlte ich mich schlecht, weil ich mich gut gefühlt hatte. Und fürchtete, jetzt für immer bei ihm bleiben zu müssen.
Einmal kehrten wir zu meinem Vater zurück. Ich hatte mehr Angst, als dass ich mich freute. Nach zwei Wochen dämmerte mir, dass es nicht gut gehen würde. Merkte, dass die Mutter ihr Lächeln nur spielte. Wie der Vater immer stiller und grimmiger wurde. Wie wir beim Essen am Tisch saßen und nur noch schwiegen. Wie sich die Atmosphäre langsam auflud wie vor einem schweren Gewitter. Dann alles wie gehabt: Geschrei, Vorwürfe, Obszönitäten; das Schlagen von Türen, zertrümmerte Gegenstände; Tränen und Alkohol in verschlossenen Zimmern; kurze Reue und eine Versöhnung, an die niemand mehr glaubte.
Und ich? Durchschaute das Spiel schon längst. Saß im Zimmer und blickte starr vor mich hin. Wartete, dass die Schalen sich um mich herum schlossen, wie bei einer Muschel. Waren sie zu, bekam ich von der Welt praktisch nichts mehr mit. Das hatte ich gelernt, um mich zu schützen. Aber es funktionierte nicht immer.
Kurz darauf waren wir wieder in der kleinen Wohnung bei der Freundin meiner Mutter. Sie beantragte jetzt eine eigene. Aber für eine alleinerziehende Frau, die in Scheidung lebte, war das damals nicht so leicht. Und mein Vater erhöhte den Druck. Kaufte mir teures Spielzeug und nahm mich mit auf Reisen, die sich meine Mutter nicht leisten konnte. So will er dich zu sich locken, meinte meine Mutter, oder er entführt dich und kehrt nie mehr zurück.
Mein Vater nahm mich in teure Restaurants mit, doch die Köstlichkeiten hatten ihren Preis. Es ging nicht nur darum, mir die große Welt zu zeigen und die Mutter zu quälen. Irgendwann kam immer das ernste Gespräch. Nicht jedes Mal, aber ich wusste: Es würde kommen.
Thema Nummer eins: Mutter und die Männer.
»Hat sie einen Freund? Kommt er oft zu Besuch? Wie heißt er denn?«
»Sie hat doch keinen.«
»Sie hatte schon einen, als wir verheiratet waren. Der kam, wenn ich bei der Arbeit war.«
Schweigen.
»Ist er wenigstens nett? Macht er dir Geschenke?«
Kopfschütteln.
»Er schläft bei ihr im Bett, hab ich recht?«
Seine Stimme wurde heiser, wenn er diese Frage stellte.
Und wenn ich schwieg: »Dass du zu deinem Vater niemals ehrlich sein kannst.«
Thema Nummer zwei: Mutters Grausamkeit. »Schau hier die Spieluhr, die habe ich schon als Kind gehabt. Die Mama hat sie mit einem Fußtritt kaputt gemacht, aus reiner Bosheit, weil sie wusste, wie gern ich sie hatte.«
Ich: Schweigen.
Er: »Die Mama will mich quälen, deshalb tut sie das. Deshalb will sie dich mir wegnehmen. Sie erträgt es nicht, wenn jemand gut zu ihr ist.«
Dazu ein Blick, als würde er gleich zusammenbrechen, ein einziger Vorwurf.
Aber es war noch nicht vorbei. Es war nie vorbei.
Die Fahrt zurück zur Mutter war am schlimmsten. Die grausamste aller Fragen kam immer dann. Die eine, um die sich alles drehte und die in meinen Eingeweiden wühlte wie ein Messer.
»Willst du nicht bei mir wohnen? Du wirst es gut bei mir haben. Und die Mama kannst du besuchen, sooft du willst.«
Und wenn ich Nein sagte: ein Blick, als hätte ich ihn in einen Abgrund gestoßen, als hätte ich ihn umgebracht.
Wenn ich dann verwirrt, zermürbt, erschöpft und kreidebleich bei meiner Mutter saß, war ich noch immer nicht erlöst. Sie wollte wissen, was er über sie erzählt hatte.
»Nichts«, sagte ich.
»Das glaub ich nicht. Er will uns auseinanderbringen. Der Papa kann sehr böse sein. Ich habe Angst, dass du mich irgendwann verlässt.«
Dann eine Umarmung, die sich wie ein Zangengriff anfühlte, als hätte mich ein riesiger Hummer mit seinen Scheren gepackt. Unter den Augen hatte sie dunkle Sorgenringe.
Der Richter konnte sich nicht entscheiden, als hätte damals niemand gewusst, was so ein Kampf mit den Beteiligten macht. Die Mutter war immer öfter angetrunken, und das nicht nur, wenn ich vom Vater kam. Das sei ganz schlimm, meinte er, als ich mich ihm anvertraute, und er setzte ein sehr besorgtes Gesicht auf. »Du musst da raus!«
Ein anderes Mal entdeckte ich in seinem Nachttisch Schachteln mit Valium, die Schublade war voll davon. Das sei Medizin gegen Husten, behauptete er. Eine schlimme Droge, erklärte die Mutter. »Sie verändert das Gehirn und kann sehr gefährlich werden: Man weiß nicht mehr, was man tut, und wird verrückt.«
Als ich ihm das, vor Sorge zerfressen, beim nächsten Mal erzählte, meinte er, nie Valium im Haus gehabt zu haben. Wir sahen beide nach. In der Nachttischschublade waren nur Taschentücher und Hustenpastillen.
»Aber ich habe die Tabletten doch gesehen«, beharrte ich.
Besorgtes Kopfschütteln. »Hat die Mama dir eingeredet. Du kennst das doch. So hat sie das schon immer gemacht: erzählt ihre Lügen so oft, bis du sie glaubst.«
Als ich schon zwölf war, erhielt meine Mutter das Sorgerecht. Der Kampf war beendet, so schien es zumindest. Aber so war es nicht. Oft blieb die Mutter über Nacht weg oder kam erst in den frühen Morgenstunden zurück. Morgens begegnete ich manchmal einem fremden Mann im Bad. Hatte Vater mit seinen Anschuldigungen doch recht gehabt?
Einmal entdeckte ich ihn nachts vor unserer Wohnung, versteckt hinter Büschen. Und die Mutter stand vor Angst zitternd hinter den Gardinen und starrte hinaus.
Immer öfter rief sie morgens bei der Arbeit an und meldete sich krank. Immer öfter ließ sie die Flasche mit Gin über Nacht auf dem Wohnzimmertisch stehen. Und mein Vater stürzte sich in die Arbeit, scheffelte Geld und blies Trübsal. Versank in Selbstmitleid, fraß Tabletten und trank zu viel. Und nährte seinen Hass auf meine Mutter.
Wer war schuld an all dem Leid? Der Vater sagte: Sie. Eine Hexe, eine Schlange, ein Biest voller Bosheit und Hass, die alle hintergehe und unsere Beziehung zerstöre, indem sie immer wieder Lügen erzähle und meine Erinnerungen manipuliere. Aber eben auch: Ich. Weil ich der Mutter nur zu bereitwillig glaube. Mich ihrem Einfluss nicht entziehen könne. Zu weich sei ich, zu schwach, fremdbestimmt.
Die Mutter sagte: Er. Ein kranker, von Eifersucht und Minderwertigkeitsgefühlen getriebener Mann, vor dem sie Tag und Nacht Angst habe, der sie bis in ihre Träume verfolge. Der weder lieben noch vertrauen könne, andere abhängig mache und manipuliere, auch mich. Warum ich ihn nur nicht durchschauen würde?
Wer hat also recht?
Die Frage war eine Qual.
Sie machte mich krank.
Und wer hatte Schuld?
Vor allem: Ich. Letzten Endes immer ich.
Dann traf ich Jane. Und auf einmal spielten diese Fragen keine Rolle mehr. In jenem Sommer entschied ich mich, sie mir nicht mehr zu stellen, ihnen keine Bedeutung beizumessen, sie abzuhaken und zu vergessen. Sie mit all den Erinnerungen in ein Verlies zu sperren und den Schlüssel wegzuwerfen. Wegzugehen und meine Eltern nie mehr wiederzusehen.
Doch es war nicht vorbei.
So etwas ist nie vorbei.
5
Es regnet nur leicht, und der Wind hat sich ausgetobt, als ich in dem Hafenstädtchen Howth nördlich von Dublin ankomme. Doch die Wolken hängen noch tief über den Häusern, als wollten sie die jeden Moment verschlucken. Auf dem Weg hatte ich noch ein Pint, damit meine Hände mit dem Zittern aufhören. Was sie dann erst nach einem doppelten Whiskey taten. Michael ist nicht wieder aufgetaucht, jedenfalls hat mich niemand verfolgt.
Ich parke direkt am Fischereihafen. Ein roter Trawler liegt an der Kaimauer, vor mir türmen sich Berge aus hellgrünen Netzen. Aus den Maschen kriecht der faulige Geruch von verwesendem Fisch. In dem Trawler kämpft eine Silbermöwe mit einem großen Krebs, er hat die Scheren aufgestellt, doch plötzlich dreht der Vogel ihn mit einer blitzschnellen Bewegung auf den Rücken und hackt mit zwei Schnabelhieben die Scheren vom Körper.
Im ruhigen Hafenbecken wirkt das Wasser wie ein schwarzer Teich. Direkt unter der Oberfläche weiden große Meeräschen Algen von der Kaimauer. Ihre schlanken silbernen Körper gleiten sanft wie Raumschiffe durch eine schwerelose Welt. Wäre vielleicht möglich, eine mit einer kleinen weißen Fliege zu überlisten. Seit ich nach Frankfurt zurückgegangen bin, habe ich nicht mehr geangelt, dabei ist das meine große Leidenschaft, seit ich denken kann. Wie auch Philipps, schon als Jugendliche haben wir unzählige Stunden zusammen am Wasser verbracht. Nichts schweißt so sehr zusammen wie eine gemeinsame Passion.
»Nimm die Angelruten mit«, hat er vor meiner Abreise gemeint. Widerwillig habe ich sie in den Kofferraum gepackt, und jetzt hätte ich fast wieder Lust.
Neben dem Fischereihafen liegt ein viel größerer, in dem die Gewinner des neuen Irlands ihre Motoryachten und Segelboote parken. Seit der Wirtschaftskrise dürften einige den Besitzer gewechselt haben.
Die zweistöckigen Häuser an der Hafenmeile haben die Farben von Flieder und Hyazinthen. Restaurants, kleine Läden und Pubs sind darin, Howth lebt wohl von Tagestouristen aus Dublin, nur sind bei dem Mistwetter kaum welche da. Ein Pub mit rosenroter Straßenfront heißt »Fisherman’s« und ruft nach mir wie eine nackte Sirene.
Patrick McGrath wohnt in einem alten Haus aus hellgrauem Stein. Heute würde sich das ein Lehrer in einer solchen Gegend wohl nicht mehr leisten können. Efeu wächst die Hauswände hoch, die kleinen Fenster haben makellos weiße Rahmen, auf den Simsen stehen Tontöpfe mit feuerroten Tulpen. Alles hat hier seinen Platz, wird gepflegt und geliebt und sieht so verdammt nach Heimat aus, dass es wehtut. So ein Haus war schon immer mein Traum. Nichts Großes, einfach etwas Festes, in das man gern jeden Tag zurückkehrt. In dem man abends ein Glas Rotwein trinkt und denkt: Hier gehöre ich hin. So etwas habe ich nie gehabt. Meine Heimat waren die Camps in Afrika, wo ich wusste, dass ich nach ein paar Monaten weiterziehen würde.
Eine ältere Dame öffnet die blau lackierte Holztür und sieht mich freundlich an. »Der Deutsche!«, meint sie lächelnd. »Willkommen!«
Ein schmaler Flur, dunkle Holzdielen, niedrige Decke, alles ist eng, stilvoll und gemütlich. An den weinroten Wänden Aquarelle, Szenen aus Howth und Dublin und vom Hafen Dún Laoghaire. Frau McGrath nimmt mir die Jacke ab und führt mich ins Wohnzimmer, das wie ein kleiner Salon wirkt. Im Kamin brennt ein Feuer. Bis zum Boden reichende Fenster öffnen den Blick auf den kleinen Garten: ein gepflegtes Stück Rasen, Rabatten mit Fuchsien und Farnen und dahinter eine hohe Hecke aus Kirschlorbeer. Genau so ein Haus habe ich in Frankfurt für Anna und mich gesucht. Aber das Einzige, was uns die Makler anboten, waren triste Reihenhäuser in trostlosen Retortenstädten. Mit Supermarkt, U-Bahn-Station und Kindergarten um die Ecke, aber ohne Charakter und Geschichte. Auch Anna hat nie eines gefallen.
Patrick McGrath ist aufgestanden und kommt mir entgegen. Der kleine, hagere Mann mit dem schlohweißen Haar wirkt gebrechlich. Er muss schon weit über siebzig sein. Als er mir die Hand gibt, spüre ich, wie sie zittert.
Er merkt mir an, wie bewegt ich bin, und lächelt. »Nehmen Sie Platz«, sagt er in fast akzentfreiem Deutsch. »Schön, jemanden aus Deutschland hier zu haben.«
»Danke. Wo um alles in der Welt haben Sie so gut Deutsch gelernt?«
»Haha! Sie schmeicheln mir! Es war mal gut, aber inzwischen ist es ziemlich eingerostet. Mir fehlt die Praxis.«
Ich sitze in einem samtbezogenen Ohrensessel. Auf dem Boden ein gewalkter Teppich. Der Raum ist in Braun- und Grüntönen gehalten. Vor den Wänden stehen Bücherregale bis unter die Decke. Kurz darauf stellt seine Frau ein Silbertablett mit Teeservice auf den Beistelltisch. Es duftet nach Earl Grey, auf einer Etagere liegen Shortbread Fingers und Muffins. Manche Iren sind englischer als Engländer.
Wir plaudern ein wenig. Patrick McGrath hat über vierzig Jahre Deutsch und Englisch an einer Gesamtschule in Dublin unterrichtet. Das Haus hat er in den Siebzigern für zwanzigtausend Pfund gekauft. Viel Geld damals für einen jungen Lehrer, heute dürfte es das Fünfzigfache wert sein. McGrath hat ein paar Semester in München studiert und dort auch einige Jahre als Fremdsprachenlehrer gearbeitet.
»Und Sie sind also Jane Flynns verflossene Liebe.«
»Sie wissen Bescheid?«
McGrath lacht. »Der Detektiv hat erzählt, dass ein Deutscher Jane Flynn sucht. Da habe ich eins und eins zusammengezählt.«
»Sie haben ein gutes Gedächtnis.«
»Wie ein Elefant, meint meine Frau. Mein Körper altert schneller als mein Geist. Besser so als andersherum.«
»Sie wussten schon damals von mir?«
»Genaues hat Jane nicht erzählt. Sie war eine verschwiegene kleine Person. Aber dass sie bis über beide Ohren verliebt war, konnte sie nicht verbergen. Sie strahlte nur so vor Glück. Und sie war auf einmal hochmotiviert in Deutsch. Davor hatte sie mit der Sprache nicht viel anfangen können.«
»Erstaunlich, dass Sie sich noch so genau erinnern.«
»Jane war etwas Besonderes.«
»Inwiefern?«
Verwundert schaut er mich an. »Wissen Sie das nicht?«
»Doch. Aber mich würde interessieren, wie Sie das beschreiben.«
Seine Hand zittert, als er die filigrane Teetasse zum Mund führt. Wahrscheinlich Parkinson. Die Finger sehen arthritisch aus. »Schwierig, das in Worte zu fassen. Sie war dem Leben so zugewandt. Sie hat sich ohne Vorbehalte und Hintergedanken auf die Welt eingelassen. Nein: in sie hineingestürzt. Aber so ein Leben ist gefährlich. Enttäuschung und Schmerz erfassten sie genauso vehement wie Glück.«
McGraths Worte schneiden in mein Herz. Wir sind beide still. Eine Standuhr tickt die Sekunden weg. Auf dem Kaminsims stehen Fotos seiner Kinder, ein Sohn und eine Tochter. Bilder aus der Schulzeit, die beiden mit Doktorhut und Diplom in der Hand und mit ihren Familien. McGrath scheint sechsfacher Großvater zu sein. Alle sehen so glücklich aus. Ich denke an Anna und Mia. So ein Leben wie Patrick McGrath hätte ich auch führen können.
»Sie wissen, was mit Jane später passiert ist?«, frage ich.
»Nein. Aber es würde mich sehr interessieren.«
Ich erzähle knapp, was Brian bisher herausgefunden hat.
»Das ist sehr traurig. Wenn auch nicht ganz hoffnungslos.«
»Meinen Sie?«
»Man kann Jane tief verletzen. Aber sie ist auch zäh. Eine Kämpferin.«
»Ich habe oft an diese acht Wochen gedacht. Sie gehören zum Schönsten, was ich erlebt habe. Und jetzt? Stelle ich fest, dass Janes Leben eine verhängnisvolle Abzweigung genommen hat. Und dass ich wahrscheinlich dafür verantwortlich bin.«
»Glauben Sie wirklich, Sie waren das allein? Schätzen Sie Jane so ein? Missverstehen Sie mich nicht, aber ich fürchte, da überschätzen Sie Ihre Bedeutung doch etwas.«
»Sie haben doch gerade selbst gesagt, wie hart sie Enttäuschungen treffen konnten.«
McGrath holt tief Luft, so als müsse er weit ausholen. Er sieht mich an wie ein gütiger Vater. »Janes Charakter ist sehr irisch, voller Sehnsucht, voller Fernweh, voller Aufmüpfigkeit. Eine romantische Seele. Aber das passte nicht ins Irland der späten achtziger Jahre. Ihr Freiheitsdrang, diese Wildheit, das hat ihr ständige Probleme bereitet, mit den Eltern, dem Pfarrer, den Lehrern. Sie war zuerst in einer katholischen Mädchenschule, aber dort flog sie raus. Wussten Sie das?«
»Ich weiß nur, dass sie die katholische Kirche gehasst hat.«
»In der Tat. Sie hielt die Kirche für verdorben und verlogen. Und das lange bevor die ganzen Skandale aufgedeckt wurden. Offenbar hat eine Ordensschwester aus der Schule sie einmal unsittlich berührt, und Jane hielt bei so etwas natürlich nicht den Mund. Obwohl die Eltern und die Schulleitung inständig darum baten. Das hat sie nur noch wütender und unerbittlicher gemacht. Und sie hat ja recht gehabt. Aber das führte dazu, dass sie die Schule verlassen musste. Eine übergriffige lesbische Schwester, das wollte damals niemand glauben. Jane wurde als Lügnerin hingestellt, der Schwester passierte nichts.«
McGraths Stirn hat sich in Falten gelegt. »Vor einigen Jahren hat die irische Regierung Untersuchungskommissionen zu Gewalt an Kindern durch die katholische Kirche eingesetzt. Es kam heraus, dass sie allgegenwärtig war. Tausende, Zehntausende Kinder sind in Kirchen, Heimen und Schulen auf vielfältige Weise missbraucht worden. Und die Verantwortlichen in Kirche und Politik wussten davon. Es wurde vertuscht, allzu dreiste Pädosexuelle wurden versetzt, das Leid der Kinder hat man wissentlich in Kauf genommen. Die katholische Kirche hat sich an den Menschen dieses Landes schwer versündigt. Ihre Glaubwürdigkeit hat sie verloren. Soll sie zur Hölle fahren! Dort gehört sie hin.«
»Sie klingen genau wie Jane.«