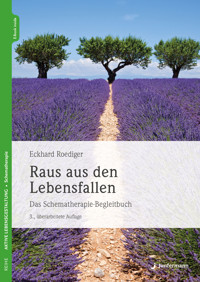72,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schattauer
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Alles andere als Schema F. Anwendungsbezogen: Beispiele aus der Praxis mit genauen Anleitungen Einzigartig: Systematische Erläuterung der schematherapeutischen Grundlagen Lösungsorientiert: Detaillierte Empfehlungen für den Umgang mit schwierigen Therapiesituationen insb. zur empathischen Konfrontation Das Standardwerk zur Schematherapie besticht durch eine detaillierte, praxisnahe Schilderung aller Techniken sowie eine anschauliche Erklärung der zugrunde liegenden Konzepte. Die komplett überarbeitete 4. Auflage bleibt diesem Ansatz treu – mit folgenden wichtigen Ergänzungen und Aktualisierungen: Darstellung der neurobiologischen Grundlagen des Schematherapiekonzeptes Aktualisierter Überblick über die Modelle mit Bezug zum DSM-5 bzw. ICD-11 Engere Verknüpfung der Schematherapie mit der Verhaltensanalyse (SORK) Vereinfachte, systematisierte Darstellung der erlebnisaktivierenden Techniken Nutzung kontextueller (ACT-)Prozesse zum Aufbau des Erwachsenenmodus Spezifische Hinweise für andere Settings (online, Paare, Gruppen) Mit diesem Buch bleiben keine Fragen offen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1114
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Eckhard Roediger | Matias Valente
Schematherapie
Kontextuell – prozessbasiert – interpersonal
4. Auflage
Schattauer
Impressum
Dr. med. Eckhard Roediger
Frauenlobstr. 64
60487 Frankfurt am Main
Deutschland
Dr. Matias Valente
Im Loh 118
74523 Schwäbisch Hall
Besonderer Hinweis:
Die in diesem Buch beschriebenen Methoden sollen psychotherapeutischen Rat und medizinische Behandlung nicht ersetzen. Die vorgestellten Informationen und Anleitungen sind sorgfältig recherchiert und nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Dennoch übernehmen Autor und Verlag keinerlei Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Anwendung oder Verwertung der Angaben in diesem Buch entstehen. Die Informationen sind für Interessierte zur Weiterbildung gedacht.
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe zum Zeitpunkt des Erwerbs.
Schattauer
www.schattauer.de
Rotebühlstr. 77, 70178 Stuttgart
Fragen zur Produktsicherheit: [email protected]
© 2025 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte inklusive der Nutzung des Werkes für Text und
Data Mining i. S.v. § 44b UrhG vorbehalten
Gestaltungskonzept: Farnschläder & Mahlstedt, Hamburg
Cover: Bettina Herrmann, Stuttgart
unter Verwendung einer Abbildung von © shutterstock/igor gratzer
Gesetzt von Eberl & Koesel Studio, Kempten
Grafiken S. 40 und S. 175: © Christine Lackner, Ittlingen
Gedruckt und gebunden von CPI – Clausen & Bosse, Leck
Lektorat: Marion Drachsel
Projektmanagement: Dr. Nadja Urbani
ISBN 978-3-608-40189-9
E-Book ISBN 978-3-608-12340-1
PDF-E-Book ISBN 978-3-608-20688-3
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar..
Inhalt
Geleitwort
Vorwort
Einleitung
Die Einordnung der Schematherapie in die psychotherapeutische Landschaft
Schematherapie als integrative Methode
Der Beitrag der Schematherapie zu einer Prozessbasierten Therapie
Beziehungsgestaltung in der Schematherapie
1 Theoretische Grundlagen
Einführung
1.1 Stimulus
1.2 Organismus
1.2.1 Das Persönlichkeitskonstrukt
1.2.2 Die Rolle der frühen Beziehungserfahrungen
1.2.3 Gedächtnissysteme und Informationsspeicherung
1.2.4 Die Bedeutung der sprachlichen Verarbeitung
1.2.5 Predictive Coding
1.2.6 Das Netzwerkmodell
1.2.7 Das Attraktorenmodell und die Konsistenztheorie von Klaus Grawe
1.2.8 Das Schemakonstrukt
1.2.9 Der kontextuelle Charakter von Schemata
1.3 Das Reaktionsdreieck
1.3.1 Das emotionale Toleranzfenster
1.3.2 Zur Neurobiologie von Achtsamkeit und Meditation
1.3.3 Basisemotionen
1.3.4 Selbstreflexive Emotionen
1.3.5 Außengerichtete Emotionen
1.3.6 Emotionale Grundbedürfnisse
1.3.7 Grundbedürfnisse, komplexe Bedürfnisse und Emotionen im Überblick
1.3.8 Kognitive Prozesse
1.3.9 Behaviorale Prozesse
1.3.10 Selbstregulation durch Selbstreflexion und Selbstinstruktion
1.3.11 Wie tief gehen Verhaltensveränderungsprozesse?
1.3.12 Biologisch angelegte Reaktionstendenzen
1.3.13 Das Reaktionsdreieck im interpersonalen Geschehen: ein dimensionales Verständnis
1.4 Die interpersonale Perspektive als Kontingenz-Variable
1.4.1 Das »Still face-Experiment« von Edward Tronick
1.4.2 Die Biologie frühkindlicher Erfahrungen
1.4.3 Die Polyvagal-Theorie
1.4.4 Mentalisierung und Selbstentwicklung
1.4.5 Das soziale Gehirn
1.5 Zusammenfassung
2 Psychotherapie im Wandel – Die »3. Welle der Verhaltenstherapie«
2.1 Historischer Hintergrund
2.2 Von der Symptombehebung zur Gesundheitsförderung
2.3 Vom Syndrom zur Dimension
2.4 Achtsamkeit und Akzeptanz: Eine Frage der Haltung?
2.5 Prozessorientiertes Vorgehen in der Psychotherapie
2.5.1 Der funktionale Kontextualismus
2.5.2 Die Bezugsrahmentheorie (Relational Frame Theory)
2.5.3 Die Rolle unserer Lebensgeschichte im ACT‑Therapierational
2.5.4 Die sechs Prozessdimensionen im Überblick
2.5.5 Akzeptanz- und Commitment-Therapie in der Schematherapie: Fertigkeiten des Erwachsenenmodus
2.6 Auf dem Weg zur allgemeinen integrativen Psychotherapie: prozessbasierter Ansatz
2.6.1 Das Erweiterte Evolutionäre Meta-Modell von Prozessen
2.6.2 Ideografische statt nomothetische Diagnostik: Die individuellen Störungsprozesse
2.6.3 Veränderungsprozesse: Evidenzbasierte Interventionen und Mediatoren von Veränderung
2.6.4 Veränderungsprozesse und Erwachsenenmodus
2.6.5 Prozessbasierte Beziehungsgestaltung
2.7 Zusammenfassung
3 Modelle in der Schematherapie
3.1 Historischer Hintergrund und Einleitung
3.1.1 Das Schemamodell
3.1.2 Die Einführung des Modusmodells
3.1.3 Die »wissenschaftliche Ära« und das taxonomische Modusmodell
3.2 Das ursprüngliche Schemamodell von Jeffrey Young
3.2.1 Schemabewältigung
3.2.2 Schemabewältigungsstile
3.2.3 Schemata als Erweiterung der kognitiven Therapie
3.3 Das Modusmodell als Taxonomie
3.3.1 Die Kindmodi
3.3.2 Die maladaptiven Bewältigungsmodi
3.3.3 Die dysfunktionalen Elternmodi (»innere Bewerter oder Kritiker«)
3.3.4 Der Modus des gesunden Erwachsenen
3.4 Der Zusammenhang zwischen Schema- und Modusmodell
3.4.1 Das Schemamodell
3.4.2 Das Modusmodell
3.4.3 Der Zusammenhang von Schemata, Schemabewältigung und nach außen gezeigtem Bewältigungsmodus
3.4.4 Gleiche Erscheinung, unterschiedliche Schemata
3.5 Neue Entwicklungen in der Schematherapie
3.5.1 Neue frühe maladaptive Schemata
3.5.2 Adaptive Schemata
3.5.3 Unsere Kritik an dem taxonomischen Modusmodell
3.6 Auf dem Weg zu einer Prozessbasierten Schematherapie
3.6.1 Ein kontextueller Umgang mit Schemata
3.6.2 Ein kontextueller Umgang mit Modi
3.7 Unser Konzept des Erwachsenenmodus
3.7.1 Die Aufgaben des Erwachsenenmodus in drei Schritten
3.7.2 Der Erwachsenenmodus in der schematherapeutischen Fallkonzeption
3.8 Das dimensionale Modusmodell
3.8.1 Die drei Dimensionen des Modusmodells
3.8.2 Die drei prototypischen Modusdynamiken
3.8.3 Von den Modusdynamiken zur dimensionalen Fallkonzeption mit der Modus-Landkarte
3.8.4 Die Integration des taxonomischen und des dimensionalen Modusmodells
4 Therapieplanung und Therapieprozess
4.1 Therapieziele
4.2 Die Therapiephasen im Überblick
4.2.1 Phase 1: Diagnostik, Stabilisierung und Beziehungsaufbau
4.2.2 Phase 2: Erlebnisaktivierung, Neubewertung und Ressourcenaktivierung
4.2.3 Phase 3: Problembewältigung und Selbstregulation im Alltag fördern
4.2.4 Phase 4: Verselbstständigung, Ablösung und Beendigung
4.3 Diagnostik
4.3.1 Anamneseerhebung
4.3.2 Diagnostische Imagination
4.3.3 Modusdiagnostik auf mehreren Stühlen
4.3.4 Fragebögen
Parenting-Fragebogen
Versionen des Young Schema Questionnaire (YSQ)
Kompensationsfragebogen (Young Compensation Inventory, YCI)
Fragebogen zu positiven Schemata (Young Positive Schema Questionnaire, YPSQ)
Die Qualität der Fragebögen
Auswertung
4.4 Fallkonzeptionen
4.4.1 Fragebogenbasierte Fallkonzeption mit Fokus auf Schemata
4.4.2 Prozessbasierte Fallkonzeption mit Fokus auf Modi
4.4.3 Verschiedene Fallkonzeptionen – Szenisches Verstehen
4.4.4 Schematherapeutische Verhaltensanalyse
4.4.5 Deskriptiv-taxonomische Modusskizze
4.4.6 Dimensionale Modus-Landkarte
4.5 Emotionsaktivierende Techniken
4.5.1 Grundlagen imaginativen Arbeitens
4.5.2 Stühle-Dialoge
4.6 Verhaltensaktivierung
4.6.1 Schema-Modus-Memo
4.6.2 BEATE-Schritte
4.6.3 Selbstregulation fördern durch innere Dialoge
4.6.4 Die Bedeutung von Verhaltensexperimenten für die Schemamodifikation
4.6.5 Verhaltensaktivierende Hausaufgaben
4.6.6 Verschiedene Schematagebücher
4.6.7 Weitere Übungen zur Verhaltensänderung
4.6.8 Impact-Techniken
4.6.9 Übergang von der Veränderungs- zur Akzeptanzphase
4.7 Gestaltung der einzelnen Therapiesitzungen
5 Das Beziehungsfeld und Techniken der Beziehungsgestaltung
5.1 Die vier Positionen im therapeutischen Feld
5.2 Die Positionen im Detail
5.2.1 Die konfrontierende, schemaaktivierende Position
5.2.2 Die imaginative, schemaaktivierte Position
5.2.3 Die unterstützende, wahrnehmende Position
5.2.4 Die klärende, kontextuelle Beobachterposition und Reflexionsebene
5.3 Die Bewegung zwischen den Positionen
5.4 Techniken der Beziehungsgestaltung und der Steuerung des Therapieprozesses
5.4.1 Konfrontierende, schemaaktivierende Interventionen
5.4.2 Erlebnisvertiefende Interventionen
5.4.3 Bindungs- und akzeptanzfördernde, unterstützende Interventionen
5.4.4 Interventionen, die den Bezug zum Hier-und-Jetzt stärken
Present Moment Awareness
Die Verwendung von Apps zum Fertigkeitentraining
5.4.5 Stabilisierungstechniken in der Übersicht, Meditation
Stabilisierungsübungen
Meditation als »Sicherer Ort«
5.4.6 Reflexionsfördernde und kontextschaffende Interventionen
5.4.7 Ressourcenaktivierende Interventionen
5.4.8 Verhaltensvorbereitende Interventionen
5.5 Die Positionen im Therapieprozess
5.5.1 Die internalisierenden Menschen
5.5.2 Die externalisierenden Menschen
5.6 Motivationale Klärung
5.7 Unsere eigenen Schemata
5.8 Fallen in der Beziehungsgestaltung (Circe und Odysseus)
6 Die komplexen Interventionen
6.1 Imagery Rescripting (ImRs)
6.1.1 Vorbereitung von Imaginationen
6.1.2 Diagnostische Imagination
Schritt 1 (wenn angezeigt): Imaginative Stabilisierung im Sicheren Ort
Schritt 2: Die Ausgangssituation vorstellen
Schritt 3: Übergang auf die Gefühlsebene
6.1.3 Wiedererleben und Exposition
Schritt 4: Wechsel in eine Jugend- oder Kindheitsszene (Float-Back)
Ausstieg: Rückkehr in den Alltag, ggf. über den Sicheren Ort (nur bei einer diagnostischen Imagination)
Die Wahl passender Erinnerungsbilder
Besondere Aspekte der diagnostischen Imagination
6.1.4 Imaginative Überschreibung (Rescripting)
Schritt 5: Fokussierte kurze emotionale Exposition und Bezug zum unerfüllten Bedürfnis
Skript 1: Intervention durch die therapierende Person
Schritt 6 (wenn indiziert): Konfrontation einer Bezugsperson
Schritt 7: Tröstung und Validierung des Kindes
Schritt 8: Auflösung über ein positives Bild
Skript 2: Intervention durch die erwachsene Person
Schritt 5b: Emotionale Neubewertung und Perspektivwechsel
Schritt 6b (wenn indiziert): Konfrontation von Bezugspersonen durch die erwachsene Person (Rescripting – Teil 1)
Schritt 7b: Versorgung des Kindes (Rescripting – Teil 2)
Schritt 8b: Wiedererleben aus der Sicht des Kindes
Schritt 9: Wechsel in die Ausgangssituation und deren Veränderung (Float‑Forward)
Schritt 10: Kognitive Verankerung und Regelextraktion
Schritt 11: Anhören der Audioaufnahmen als Hausaufgabe
6.1.5 Umgang mit Schwierigkeiten bei der Überschreibung
6.1.6 Imaginationsübungen mit Traumatisierten
6.2 Andere Imaginationsübungen
6.2.1 Kurze imaginative Vertiefung
6.2.2 Imagination »Sicherer Ort«
6.2.3 Imagination »Kind auf der Straße«
6.2.4 Imagination »Best Day«
6.2.5 Imagination »Honeymoon«
6.2.6 Imagination »Ermächtigung«
6.2.7 Imagination »Galerie« bzw. »Museum der Ressourcen«
6.2.8 Imaginatives Probehandeln
6.2.9 Imagination eines Verlustes
6.2.10 Imagination »80. Geburtstag«
6.3 Stühle-Dialoge mit internalisierenden Menschen
6.3.1 Befragung eines Bewältigungsmodus bzw. Symptoms
6.3.2 Umgehen des Bewältigungsmodus – Bewerterstimmen erkennen und heraussetzen
6.3.3 Dialog zwischen Bewerter und Kindmodi
6.3.4 Perspektivwechsel und Ressourcenaktivierung
6.3.5 Einüben funktionalen Verhaltens
6.4 Stühle-Dialoge bei externalisierenden Menschen
6.4.1 Unterbrechen der Interaktion
6.4.2 Empathieübung
6.4.3 Die verletzbare Seite unterstützen
6.4.4 Einüben einer funktionalen Kommunikation
6.5 Andere Stühle-Dialoge
6.5.1 Zwei-Stühle-Dialog als Rollenmodell
6.5.2 Historisches Rollenspiel
6.5.3 Rollenspiele mit Realsituationen
6.5.4 Imaginative Rollenspiele zum konstruktiven Umgang mit Ärger
6.5.5 Imaginatives Rollenspiel zum Umgang mit Trauer
6.5.6 Umgang mit emotionaler Vermeidung – Arbeit im Resonanzraum
7 Strategien für schwierige Therapiesituationen
7.1 Die Freundlich-Abhängigen
7.1.1 Ablösungsphase und Therapiebeendigung bei abhängigen Menschen
7.1.2 Umgang mit Unterordnenden oder Verliebten
7.2 Die Distanziert-Zurückgezogenen
7.3 Essstörungen, Somatisierung oder komorbide somatische Erkrankungen
7.4 Die Suizidalen und Selbstschädigenden
7.4.1 Suizidalität
7.4.2 Selbstschädigendes Verhalten
7.5 Die komplex Traumatisierten
7.5.1 Die Beziehungsgestaltung
7.5.2 Spezielle Aspekte zur Traumaexposition
7.5.3 Integrationsphase
7.5.4 Dissoziative Identitätsstörung (DIS)
7.6 Die Selbstberuhiger
7.7 Die Passiv-Aggressiven
7.7.1 Versteckter Ärger auf uns
7.7.2 Blockaden durch andere Motive
7.8 Die offen Anklagend-Aggressiven
7.8.1 Ärger auf Dritte
7.8.2 Umgang mit Ärger auf die Therapeutinnen bzw. Therapeuten
7.8.3 Umgang mit berechtigter Kritik
7.9 Die Narzisstisch-Überheblichen
7.9.1 Differenziertes Störungsverständnis
7.9.2 Spezielle Interventionen
7.9.3 Verdeckter, vulnerabler Narzissmus
7.9.4 Umgang mit primären Narzissten
8 Spezielle Aspekte
8.1 Empirische Absicherung und Stand der Forschung
8.2 Online arbeiten
8.3 Einbeziehung der Partnerperson
8.3.1 Warum die Partnerperson einbeziehen?
8.3.2 Schritte der Einbeziehung
8.3.3 Elemente einer interpersonalen Perspektive
8.3.4 Verbindende Gespräche (connection dialogue)
8.3.5 Weitere Aspekte
8.4 Moduszirkel in der therapeutischen Beziehung
8.4.1 Das Moduszirkel-Memo in der Therapiebeziehung
8.4.2 Imaginative Selbsterfahrung
8.4.3 Der Umgang mit dysfunktionalen Moduszirkeln
8.4.4 Videobasierte Supervision
8.4.5 Anregungen zur Selbstfürsorge
8.5 Fortbildungsmöglichkeiten
Literatur
Sachverzeichnis
Geleitwort
Die Entwicklung immer neuer Verfahren und Techniken der Psychotherapie, die in der Tendenz zur gegenseitigen Abgrenzung zu dogmatischen Konstrukten geworden sind, hat den Blick getrübt für das Wesentliche: den psychotherapeutischen Prozess. Klaus Grawe hatte dies als einer der ersten Psychotherapieforscher erkannt und eine »neue«, »Allgemeine« Psychotherapie gefordert, die auf empirisch nachgewiesenen Wirkfaktoren beruht. Auch wenn sein Entwurf vorwiegend im deutschsprachigen Raum bekannt wurde, so ist die Grundidee in den letzten Jahren auch in der internationalen Psychotherapieforschung in das Zentrum des Interesses gerückt worden. Nicht zuletzt durch den Befund, dass die Entwicklung neuer Psychotherapieverfahren nicht zu einem Zuwachs an Wirksamkeit geführt hat, ist die Erkenntnis gewachsen, dass der Fortschritt vor allem durch eine bessere Abstimmung vorhandener Methoden an die individuellen Probleme der Patienten und Patientinnen erzielt werden kann.
Diese Grundidee wurde von Stefan Hofmann und Steve Hayes in dem Prozessbasierten Therapieansatz aufgegriffen und vordergründig in einer Integration von kognitiver Verhaltenstherapie und Akzeptanz- und Commitment-Therapie umgesetzt. Sie wenden sich gegen die holzschnittartige Anwendung von Therapiepaketen für spezifische Diagnosen und postulieren eine konsequente Personalisierung von Diagnostik und Behandlung. Dabei greifen sie die Netzwerk-Theorie als systemisches Gegenstück zum medizinischen Krankheitsmodell auf, das psychische Probleme nicht durch ein latentes Krankheitskonstrukt erklärt, sondern als dynamische Netzwerke individueller, sich wechselseitig beeinflussender psychologischer Prozesse. Ausgangspunkt ist ein individuelles, gemeinsam erarbeitetes hypothetisches Netzwerkmodell der Störung wie auch der adaptiven Ressourcen. Die Digitalisierung hat es möglich gemacht, diesen hypothetischen Entwurf durch Smartphone-basiertes EMA auch empirisch zu überprüfen. Durch Abstimmung der therapeutischen Interventionen auf dieses Netzwerk wird eine weitere Verfeinerung der Therapieplanung ermöglicht, indem eine Passung von Wirkfaktoren und individuellen Veränderungsprozessen angestrebt wird.
Diese Grundidee einer Konzentration auf Störungs- und Veränderungsprozesse findet sich auch in der Schematherapie. Die Prozessorientierung ist zum einen in dem Moduskonzept gegeben, das die Aktivierung stabiler, maladaptiver und adaptiver früher Schemata im Hier-und-Jetzt beinhaltet. Zum anderen hat Young in die Schematherapie, ursprünglich verwurzelt in der kognitiven Therapie von Beck, auch psychodynamische Grundprinzipien und erlebnisorientierte, insbesondere gestalttherapeutische Techniken integriert, die auf die Veränderung individueller Schema-Modi als zentralem Wirkfaktor gerichtet sind. So stellt Schematherapie ein Musterbeispiel für Prozessorientierte Therapie dar, indem nicht nur die flexible Anwendung von wirkungsvollen Techniken und Behandlungsprinzipien, sondern auch die Berücksichtigung interaktioneller Prozesse in der therapeutischen Beziehung fundamentale Bedeutung haben.
Das Konzept des vorliegenden Buches stellt in verschiedener Hinsicht eine Weiterentwicklung von Schematherapie vor, indem eine breitere Einbettung in moderne psychologische Theorien und empirische Ergebnisse vorgenommen wird als bisher. Dreh- und Angelpunkt der Personalisierung ist die Fallkonzeption, die in der Schematherapie einen großen Raum einnimmt. Dabei wird in dem vorliegenden Buch die funktionale Bedingungsanalyse nach dem SORKC-Modell, neben dem Modusmodell, wieder ein wichtigerer Ausgangspunkt für eine Individualisierung und Fokussierung der Behandlungsplanung. Im Gegensatz jedoch zur traditionellen Verhaltenstherapie, die bis heute das erste, von Kanfer (Kanfer & Saslow 1965) vorgelegte SORKC-Modell als ein lineares, behavioristisches Konzept verfolgt, beziehen sich Roediger und Valente auf das modernere Selbstregulations-Modell (Kanfer & Karoly 1972), das ganz im Sinn des Netzwerkmodells systemische Wechselwirkungen berücksichtigt. Die hierin enthaltene sogenannte Organismus-Variable, ursprünglich auf biologische Prozesse bezogen, wird zu einer umfassenden Dimension, die auch alle zeitstabilen psychologischen Faktoren wie motivationale und Gedächtnisprozesse, Emotionsregulationsstrategien und »Persönlichkeit« enthält.
Das Spektrum der vorgestellten Techniken ist sehr breit und reicht von kognitiv-behavioralen Ansätzen über die Akzeptanz- und Commitment-Therapie bis zu psychodynamischen Vorgehensweisen. Gemeinsamer Ausgangspunkt aller Techniken ist die Wahrnehmung von aktivierten Schemata, die in einem strukturierten Ablauf (BEATE-Schema) eingeübt wird und die zu behavioralen Techniken wie Verhaltensaktivierung und Verhaltensexperimenten überleitet. Besonders hervorzuheben sind jedoch, gewissermaßen als ein Alleinstellungsmerkmal von Schematherapie, die erlebnisaktivierenden Techniken, insbesondere imaginative Verfahren und Stuhldialoge. Mittlerweile gibt es eine wachsende Zahl von Studien, welche die Wirksamkeit dieser Ansätze belegen und die im Sinne Grawes auf die große Bedeutung von Emotionsaktivierung als Grundprinzip der Problemaktualisierung in der Psychotherapie hinweisen.
Breiten Raum nimmt in dem vorliegenden Buch auch eine Neukonzeptualisierung der Beziehungsgestaltung in der Schematherapie ein, die sich aufgrund des Interesses von Young traditionell auf das transaktionsanalytische bzw. psychoanalytische Konzept der Nachbeelterung konzentrierte. Zwar behalten die Autoren in ihrem Konzept der vier Positionen im therapeutischen Beziehungsfeld die Nachbeelterung bei, interpretieren sie jedoch stärker als wertschätzende Unterstützung und ergänzen sie durch die Perspektiven der Konfrontation, Beobachtung und Erlebnisaktivierung (Imagination). Ein interessanter Ansatz ist hierbei das gezielte Wechseln zwischen diesen Perspektiven innerhalb einer Sitzung, um eine größere Flexibilität in der Beziehungsgestaltung zu erzielen, ein Ansatz, der an den »hexaflex dance« von Steve Hayes erinnert. Weiterhin beschreiben die Autoren eine Vielzahl von Techniken, die eine hilfreiche Sammlung von Tools für die Beziehungsgestaltung darstellen. Somit unterstreicht dieses Kapitel die Prozessperspektive nicht nur in der Analyse von Störungsprozessen oder dem Aktivieren von Veränderungsprozessen, sondern auch in der wirksamen Steuerung von Interaktionsprozessen.
Die Schematherapie ist durch ihre Integrationsfähigkeit zu einer der wichtigsten psychotherapeutischen Konzeptionen geworden, die helfen wird, die einseitige Orientierung an dogmatischen Schulen zu überwinden. Das vorliegende Buch wird durch die starke Orientierung an wissenschaftlichen Konzepten und praxisnahe Vermittlung von evaluierten Grundprinzipien einen wesentlichen Anteil daran haben, dass die Weiterentwicklung der Schematherapie nicht nur im wissenschaftlichen Kontext bleibt, sondern in die psychotherapeutische Praxis einfließen kann. Patientinnen und Patienten ist zu wünschen, dass das hier vorgestellte Konzept eine große Verbreitung findet und zur Verbesserung der Versorgung und Förderung der seelischen Gesundheit beiträgt.
Herbst/Winter 2024
Prof. Ulrich Stangier, Frankfurt a. Main
Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser, vielen Dank für Ihr Interesse an der inzwischen 4. Auflage dieses Buches. Wir freuen uns sehr! Sie werden es bemerkt haben: Wir sind inzwischen ein Autoren-Team geworden. Zum einen konnten wir nur gemeinsam die sehr komplex gewordenen Entwicklungen überblicken. Zum anderen arbeiten wir seit fast 20 Jahren zusammen und unsere Sicht- und Arbeitsweisen stimmen sehr stark überein. Obwohl die moderne Verhaltenstherapie (VT) unser therapeutisches »Zuhause« ist, haben wir in unseren Werdegängen beide die tiefenpsychologische und analytische Psychotherapie kennengelernt. Das fließt in unser Verständnis der Schematherapie ein. Innerhalb der VT teilen wir das Interesse an akzeptanzbasierten Therapien wie der Akzeptanz- und Commitment-Therapie (ACT), an der Dialektisch-Behavioralen Therapie (DBT) sowie der Traumatherapie. Wir haben uns bemüht, unser Wissen und unsere Erfahrung in ein homogenes, integratives und umfassendes therapeutisches Vorgehen zu verschmelzen. Es ist der Geist dieses Buches, Schematherapie (ST) nicht als ein »stand alone treatment«, sondern als ein für die Arbeit mit Persönlichkeitsstörungen entwickeltes und mit anderen Methoden sehr gut kombinierbares psychotherapeutisches Vorgehen darzustellen, das sowohl spezifische Techniken als auch eine besondere Form der Beziehungsgestaltung in die sich weiterentwickelnde Psychotherapie einbringen kann. Daher haben wir uns für einen neuen Untertitel entschieden: Kontextuell bedeutet, dass wir die Schematheorie kongruent zur 3. Welle der Verhaltenstherapie und insbesondere zur Akzeptanz- und Commitment-Therapie weiterentwickeln. Prozessorientiert bezieht sich historisch auf Klaus Grawes(1) Suche nach allgemeinen Wirkfaktoren, die heute in der Prozessbasierten Psychotherapie von Hofmann, Stangier und Hayes eine Renaissance erfährt. Interpersonal weist auf das essenziell interaktionelle Verständnis der Schematherapie bezüglich der Entstehung und Bewältigung von zwischenmenschlichen Interaktionsproblemen hin, welche das zentrale Problem bei Persönlichkeitsstörungen darstellen.
Der Anspruch des Buches bleibt unverändert: Wir wollen (1) eine fundierte Darstellung der für unser therapeutisches Vorgehen relevanten Grundlagen, eine Einbettung in bestehende neurobiologische, psychologische und soziale Konzepte im Sinne eines bio-psycho-sozialen Modells mit einem starken Fokus auf soziale Interaktionsprozesse bis hin zur Einbeziehung der Partnerpersonen, (2) eine umfassende und differenzierte Darstellung des Schemamodells, nun erweitert durch einen dimensionalen Blick, und (3) eine sehr detaillierte Darstellung des Therapieablaufs, insbesondere der erlebnisaktivierenden Techniken, geben. Dabei haben wir uns bemüht, das Standardvorgehen einerseits zu systematisieren und in zusammenfassenden Anleitungen übersichtlich zu halten, aber auch vielfältige Optionen für besondere Zielgruppen und schwierige Therapiesituationen anzubieten – also eine gute Mischung aus Struktur und Details.
Neu sind der verstärkte Bezug zur Verhaltensanalyse (SORC-Schema) sowie die systematisierte Darstellung der Beziehungsgestaltung und der entsprechenden Interventionen, um die gewünschten Prozesse steuern zu können. Das so entstandene Beziehungsfeld ist gewissermaßen die Bühne, auf der die Therapie stattfindet. Wir versuchen konsequent – ähnlich wie in der Gestalt- oder in der systemischen Therapie –, die konventionellen Interaktionsmuster zu unterbrechen und neue Erlebnisse herbeizuführen.
Wir bieten eine Fülle an Details und Querverbindungen an. Um das Buch dennoch übersichtlich und benutzerfreundlich zu halten, stehen die Kapitel für sich und können unabhängig voneinander gelesen werden. Verweise stellen die Bezüge zwischen den Kapiteln her. Die ersten drei Kapitel beschäftigen sich mit der Theorie: Kapitel 1 fasst die für uns relevanten neurobiologischen, lerntheoretisch-psychologischen und interpersonalen Konzepte zusammen. In Kapitel 2 finden Sie die Grundlagen der kontextuellen und Prozessbasierten Therapie und im Kapitel 3 die Modelle der Schematherapie bis hin zu unserer integrativ-kontextuell-dimensionalen Perspektive des Schema- und Moduskonzeptes. Im zweiten Teil des Buches beschreiben wir die praktische Anwendung: in Kapitel 4 die Therapie als Ganzes, in Kapitel 5 die Beziehungsgestaltung im therapeutischen Feld, in Kapitel 6 die erlebnisaktivierenden Techniken (Imagination und Stühle-Dialoge) und in Kapitel 7 die Anpassungen an besondere Problemstellungen. Den Abschluss bilden Hinweise zu Studien und spezielle Settings (Online, Paare, Supervision) und auf Fortbildungsmöglichkeiten.
Das Buch hat jetzt eine konsequent Gender-neutrale Sprache. Wir haben verstanden (und es ist ein wichtiges Axiom unseres therapeutischen Verständnisses), dass das Denken und Sprechen nicht nur unsere Bewusstseinsinhalte ausdrückt, sondern auch unser Bewusstsein formt. Und es ist an der Zeit, tradierte Rollenungerechtigkeiten zu überwinden und zu einer wirklichen Gleichberechtigung zu finden. Das fordert den Preis, die Sprache bewusst einzusetzen. Wir sind aber nicht bereit, sie zu deformieren. Daher haben wir keine Binnenzeichen verwendet und auch keine substantivierten Verben. Stattdessen verwenden wir geschlechterneutrale Umschreibungen, manchmal beide Geschlechter und wechseln stellenweise zwischen der männlichen und weiblichen Form ab. Das ist unser Kompromiss, für den wir auf Verständnis hoffen.
Bleibt uns noch, all denen zu danken, die zum Entstehen (und hoffentlich auch Gelingen) des Buches beigetragen haben. Das sind vor allem die von uns behandelten Menschen, die sich uns anvertrauen und uns tiefe Einblicke in ihr Erleben und damit ein intimes Verständnis dafür geben, wie unsere Arbeit auf sie wirkt. Es sind auch die Menschen, die an unseren Kursen und der Supervision teilnehmen und uns mit ihren kritischen Fragen auf Lücken in unserem Verständnis hinweisen. Wissenschaftlich fundierte Arbeit lebt von kritischen Fragen! Natürlich sind es auch unsere Familien, die über ein Jahr lang die »Dreiecksbeziehung« zwischen ihnen und dem Laptop tolerieren mussten. Wir danken auch unseren Korrekturleserinnen Claudia Stromberg und Gesa Janssen-Schauer und natürlich Dr. Nadja Urbani und Marion Drachsel für die geduldige Unterstützung von Verlagsseite. Ganz besonders auch für die Bereitschaft, farbige Abbildungen zu drucken, ohne die das »Zwei-Beine«-Modell mit den entsprechenden Farben nicht sinnenfällig darstellbar ist. Verlage machen ja so etwas nicht gerne! Das ist aus unserer Sicht ein großer Gewinn! Und natürlich danken wir alle Jeffrey Young, dass er dieses lebendige und zentrale Konzept konsequent und mutig entwickelt hat und vor allem dafür, dass er es nicht »festschreibt«, sondern für Weiterentwicklungen offen ist; zudem Heinrich Berbalk, der die Schematherapie 2004 nach Deutschland brachte und in der Verhaltenstherapie verankerte. Das wollen wir nicht vergessen!
Ich, Eckhard Roediger, möchte – wie in den vorherigen Auflagen – den Menschen besonders danken, die mich wesentlich zu meiner psychotherapeutischen Entwicklung inspiriert haben. Das sind vor allem der inzwischen leider verstorbene Therapeut Bryn Jones, dem ich das Verständnis der körperlichen Prozesse verdanke, sowie Markus Pawelzik, der mich erst zur Verhaltenstherapie und dann zu einer Zeit zur Schematherapie »brachte«, als diese in Deutschland kaum jemand kannte. Erst das gab mir die Möglichkeit, die Entwicklung der Schematherapie in Deutschland maßgeblich mitzugestalten. Außerdem fühle ich mich meinem psychologischen Mentor Ralf Schneider verbunden, der mich in die zentralen psychologischen Konzepte einführte und mir auch als Leitungsperson ein Vorbild wurde, sowie Klaus Grawe, der bei einer Fortbildung in der salus Klinik 1998 den Gedanken einer »allgemeinen Psychotherapie« tief in meine Seele pflanzte, dem dieses Buch verpflichtet ist.
Ich, Matias Valente, möchte an erster Stelle meinen Mentoren Alfred »Freddy« Ehret und Joachim Romeis herzlich danken, denn ohne sie und ihre geduldig-liebevolle Anleitung in den ersten Jahren meines psychotherapeutischen Werdegangs am Zentrum für Psychiatrie Weinsberg hätte ich weder die Schematherapie noch die Akzeptanz- und Commitment-Therapie kennengelernt. Unser damaliger Chefarzt Prof. Dr. Friedebert Kröger motivierte und unterstützte uns sehr bei der Implementierung der damals kaum bekannten Schematherapie in der Klinik, wofür ich ihm noch heute sehr verbunden bin. Während Mentoren im Laufe unserer (beruflichen) Entwicklung sinnbildlich eine elterliche Funktion übernehmen, finden wir manchmal auch symbolische Geschwister auf diesem Entwicklungsweg. Von Beginn an war für mich Yvonne Reusch, mit der ich gemeinsam seit über zehn Jahren das Institut für Schematherapie Stuttgart leiten darf, diese Schwester. Für ihre Unterstützung, die gelegentlich notwendige empathisch-konfrontative Kritik, vor allem jedoch für ihre bedingungslose Freundschaft gilt ihr ein ganz herzlicher Dank. Abschließend möchte ich besonders Eckhard Roediger meinen Dank aussprechen, der mich seit zwanzig Jahren auf meiner »Schematherapie-Reise« kontinuierlich anleitet und begleitet und mir die Möglichkeit gab, dieses Werk mit ihm mitzugestalten.
Nun wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Lesen sowie viel Erfolg und Zufriedenheit bei der Anwendung.
Frankfurt am Main und Schwäbisch Hall im Herbst 2024
Eckhard Roediger und Matias Valente
Einleitung
Die Einordnung der Schematherapie in die psychotherapeutische Landschaft
Innerhalb der großen Verfahren in der Psychotherapie wird die Schematherapie in Deutschland der Verhaltenstherapie zugerechnet. Sie kann dort auch als Teil eines verhaltenstherapeutischen Gesamtbehandlungsplan mit den gesetzlichen und privaten Krankenkassen(1) abgerechnet werden (Köhler & Grünwald 2011). Die Einbettung der Schematherapie in die Kognitive Verhaltenstherapie findet ihren Ausdruck auch darin, dass sie als Methode der Verhaltenstherapie in die aktuellen Auflagen praktisch aller wichtigen Lehrbücher und Manuale Einzug gehalten hat und zunehmend wertschätzend rezipiert wird (z. B. Fiedler 2010, S. 341 ff.). International wird Schematherapie eher als eine eigene Methode wahrgenommen. Sie bildet unseres Erachtens konzeptuell und thematisch eine Brücke zwischen den großen »Therapieschulen«. Wir haben den Begriff in Anführungszeichen gesetzt, da sich inzwischen starke Bemühungen abzeichnen, die Schulenorientierung zu überwinden. Das war bereits das Anliegen Klaus Grawes(2) in den 1990er-Jahren, dessen Ansatz sich dieses Buch immer verpflichtet gefühlt hat. Auf der praktischen Anwendungsebene ist inzwischen eine deutliche Annäherung zu beobachten. So erlaubt beispielsweise der strukturelle Ansatz im Sinne Rudolfs (2020) eine recht aktive Therapeutenrolle, während die Bedeutung der frühen Erfahrungen aus der Bindungsforschung mittlerweile Teil des Störungsverständnisses in der Verhaltenstherapie ist (und zwar nicht nur bei Traumafolgestörungen). Ebenso haben Imaginationstechniken (auf die bereits Beck verwies) inzwischen breiteren Einzug in die Verhaltenstherapie gefunden (Hackmann et al. 2011). Auch die zentrale Rolle der Therapeutinnen und Therapeuten (als »common factor« im Vergleich zu den angewandten Techniken; Wampold et al. 2018) wird gesehen und in der Ausbildung berücksichtigt.
Die Unterschiede zwischen den Methoden bestehen deutlicher auf der Ebene der (festgeschriebenen) Konzepte als auf der Ebenen des (flexibleren) konkreten Tuns.
Wie psychodynamische Theorien geht auch die Schematherapie von der Bedeutung früher Beziehungserfahrungen aus, die ihren Niederschlag in Schemata finden. Der Diskurs über die Konzeptualisierung des kindlichen Erlebens und der therapeutische Umgang damit braucht aber eine konsistente Begriffsbildung (Epistemologie) und exakte Prozessbeschreibungen, die an bestehende, wissenschaftlich bereits fundierte Konzepte »anschlussfähig« sind (Gauggel 2006, S. 135): zum einen, damit ein wissenschaftlich-kritischer Diskurs möglich und das Vorgehen lehrbar ist, zum anderen, um die Konzepte z. B. in Studien empirisch überprüfbar zu machen. Daher beziehen wir uns in der Konzeptualisierung stark auf das SORC-Schema und verzichten weitgehend auf eine schematherapeutische Terminologie, sondern benutzen eingeführte Begriffe (und setzen die Schematherapie-Termini in Klammern; siehe Tuschen-Caffier & Hoyer 2014). Auch leiten wir die Interventionen aus den zuvor dargestellten Grundlagen ab und beschreiben sie sehr detailliert, um das Vorgehen transparent, nachvollzieh- und empirisch überprüfbar zu machen.
Schematherapie bildet eine Brücke zwischen den Therapieschulen. Sie versteht sich als Beitrag für den Bereich der Interaktions- bzw. Persönlichkeitsstörungen und erweitert das Technikrepertoire und das therapeutische Interaktionsverhalten.
Pawelzik (2013b) definiert die Kernprobleme von Menschen mit Persönlichkeitsstörungen wie folgt:
anhaltende innere Anspannung
undifferenzierte negative emotionale Selbstzustände
Neigung zu impulsivem bzw. inkonsequentem Handeln
mangelnde Selbstberuhigungs- und Selbstregulationsfähigkeit
sich und andere nicht verstehen können (Mentalisierungsdefizite)
anhaltendes negatives Beziehungserleben
Für all diese Problembereiche bietet die Schematherapie Antworten bzw. Lösungen. Das wird der Gegenstand dieses Buches sein. Da das Störungsmodell störungsübergreifend-unspezifisch ist, kann es auf alle Interaktionsstörungen angewendet werden, was in dieser Breite (außerhalb der psychodynamischen Therapien) bei keiner anderen Methode der Fall ist. Das gilt zum einen für konkrete Persönlichkeitsstörungen, für die inzwischen eine gewisse Evidenz nachgewiesen ist (siehe Kap. 8), zum anderen aber auch für alle Störungsbilder, bei denen die vordergründige Symptomatik durch maladaptive Interaktionsmuster mitbedingt oder aufrechterhalten wird. Das ist bei vielen chronischen bzw. rezidivierenden Störungen der Fall. Auch dazu gibt es erste Evidenzen (siehe Kap. 8).
Die Schematherapie ist kein störungsspezifischer Ansatz, sondern bietet ein strukturiertes Vorgehen für alle Persönlichkeitsstörungen bzw. Persönlichkeitsstrukturen, die Achse-I-Symptome aufrechterhalten.
Bei der Antragstellung(1) im Rahmen einer Richtlinienpsychotherapie(1) ergänzt die schematherapeutische Fallkonzeption die auf die aktuelle Symptomatik bezogene horizontale Verhaltensanalyse(1) und die daraus abgeleiteten störungsbezogenen Maßnahmen, kann sie aber nicht ersetzen. Entsprechend können schematherapeutische Elemente mit störungsspezifischen Techniken bei der Behandlung chronifizierter Symptomatiken integriert werden. Beispiele geben das »Praxisbuch Verhaltenstherapie« von Gerhard Zarbock (2008), die Bücher »Störungsspezifische Schematherapie« (Reusch & Valente 2015), »Selbstregulation und Impulskontrolle durch Schematherapie aufbauen« (Valente & Reusch 2017) sowie »Emotionale Regulation bei psychischen Störungen« von Stromberg & Zickenheiner (2021). Dabei wird im Rahmen der Makro- bzw. vertikalen Verhaltensanalyse(1) die Behandlung der inneren Struktur der Patienten unter schematherapeutischen Gesichtspunkten dargestellt (Köhler & Grünwald 2011).
Schematherapie als integrative Methode
Die Entwicklung der Psychotherapie im Allgemeinen und der Verhaltenstherapie im Besonderen vollzieht sich in einer Polarität zwischen Abgrenzung und Integration. Die Abgrenzung ist notwendig, um neue und innovative Elemente differenziert in ihrer Besonderheit darzustellen. Dadurch wird das Besondere einer Methode für die Allgemeinheit wahrnehmbar. Erstarrt eine Methode in der Abgrenzung, läuft sie Gefahr, über die Zeit marginalisiert zu werden und in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden; insbesondere nach dem Ableben der Pioniere, die die Methode einst begründeten und meist charismatisch vertraten. Langfristig überleben daher nur die Elemente einer spezifischen Methode, die den Anschluss an den sich weiterentwickelnden Strom der Psychotherapie halten und in das allgemeine Repertoire integriert werden.
Schematherapie war vom Anbeginn an integrativ (Young 2011).
Auf der konzeptuellen Ebene versucht die Schematherapie, eine große Anzahl vorhandener therapeutischer Techniken in ein konsistentes Theoriemodell zu integrieren, »damit die Fülle relevanter Erkenntnisse […] in ein griffiges, handhabbares Konzept eingeordnet und so eine (handlungsleitende) Ordnung und Übersicht hergestellt wird« (Caspar 2010, S. 16). Schematherapie versteht sich daher sensu Young(1) nicht als eklektizistisch, sondern als »assimilative Integration(1)« (Messer 2001), da ihr »eine zusammenhängende Theorie zugrunde liegt« (Young et al. 2005, S. 83). Um Bezüge oder auch Anleihen zu anderen Ansätzen transparent zu machen, werden in diesem Buch immer wieder diese Konzepte und Autoren zitiert. Das Ziel ist, auf der Basis der verhaltenstherapeutischen Grundlagen weitere Techniken und Haltungen im Sinne eines kontextuellen Metamodells (Wampold et al. 2018) konzeptuell zu integrieren, um möglichst alle bewährten therapeutischen Möglichkeiten zu nutzen. In dieser 4. Auflage werden wir sowohl die neueren Entwicklungen innerhalb der 3. Welle der Verhaltenstherapie mit dem Schematherapiemodell verschmelzen als auch den Körper in der Therapie berücksichtigen, indem wir Elemente des sogenannten Somatic Experiencing(1) (Levine 2011) zur Vertiefung des emotionalen Erlebens verwenden. Es ist uns wichtig, zu betonen, dass diese Weiterentwicklungen explizit im Sinne des Begründers der Schematherapie Jeffrey Young(2) sind. Um das zu verdeutlichen, haben wir an vielen Stellen seitengenaue Verweise eingefügt. Entsprechend seiner grundsätzlich wissenschaftlichen Orientierung sagte Young(3) wiederholt, dass das Modell nicht festgeschrieben, sondern immer wieder überprüft werden muss. So bestätigte er explizit in dem Abschlussinterview des ersten »Schematherapie Online Summit 2020«, dass er unseren Ansatz der kontextuellen Schematherapie als legitime und erwünschte Weiterentwicklung begrüßt. Dafür sind wir ihm dankbar und das ist für uns keinesfalls selbstverständlich, verhalten sich doch andere Menschen, die neue Therapiemethoden begründen, häufig weniger freilassend und deutlich kontrollorientierter.
Die kontextuelle und prozessbasierte Schematherapie trägt den Geist der Schematherapie einen Schritt weiter. Das soll auch das neue Titelbild ausdrücken.
Der Beitrag der Schematherapie zu einer Prozessbasierten Therapie
Grawes(3) Idee einer »allgemeinen Psychotherapie(1)« ((4)Grawe et al. 1994) erscheint ganz aktuell in einem neuen Gewand in dem Ansatz einer Prozessbasierten Psychotherapie (Hayes & Hofmann 2018). Stangier (2019) formuliert dessen wesentliche Elemente so:
Abkehr von psychiatrischen Störungsmodellen, störungsspezifischen Manualen und Therapieschulen (»protocols for syndroms game«; Hofmann et al. 2021)
Hinwendung zu transdiagnostischen Therapiekonzepten, die auf überprüften Veränderungsprozessen basieren
Rückkehr zur individualisierten Therapieplanung auf Grundlage einer idiografischen funktionalen Analyse der Faktoren, die problematisches Verhalten und Erleben aufrechterhalten
Diesem Ansatz wollen wir bei der Darstellung der Schematherapie in diesem Buch folgen. Wir versuchen, für den Bereich der Interaktions- bzw. Persönlichkeitsstörungen mit folgenden in der Schematherapie entwickelten Prozessen beizutragen:
detaillierte Darstellung umfassender intrapsychischer Verarbeitungsprozesse (z. B. beim Imagery Rescripting)
Systematisierung von Interaktionsprozessen als Common Factor
detaillierte Darstellung emotionsfokussierter Veränderungsprozesse vor dem Hintergrund eines kontextuellen Schema- und Modusverständnisses
Doch was soll der spezifische Beitrag der Schematherapie sein? Aus unserer Sicht liegt die Expertise der Schematherapie auf folgenden Feldern:
Die Schematherapie wurde entwickelt, um die maladaptiven Interaktionsmuster von Menschen zu verstehen, konzeptuell zu erfassen und zu modifizieren. Damit erweitert sie das Repertoire der Verhaltenstherapie für den Bereich der Interaktions- bzw. Persönlichkeitsstörungen.
Mit dem neurobiologisch abgeleiteten Konstrukt des Schemas lassen sich die frühen Erfahrungen von Menschen fassen und in ihren Auswirkungen auf das heutige Leben einfach (und damit für uns in einer Behandlung anschaulich) schulenübergreifend konzeptualisieren.
Das in diesem Buch beschriebene Vorgehen führt zu einer dimensionalen Fallkonzeption, um Persönlichkeitsstörungen im Sinne des alternativen Modells des DSM‑5(1) einzuordnen.
Die sehr genau ausgearbeiteten erlebnisaktivierenden Techniken können im Rahmen dieser Fallkonzeption zielgerichtet eingesetzt werden, um die Prozesse zu aktivieren, die unsere Patientinnen und Patienten brauchen, im ihre interaktionellen Verhaltensexzesse und -defizite auszugleichen. Diese Techniken (z. B. Imaginationen und Stühle-Dialoge) können auch in psychodynamischen Therapien eingesetzt werden.
Die schematherapeutische Beziehungsgestaltung erzielt im Vergleich zu anderen Vorgehensweisen hohe Haltequoten und wird auch Menschen gerecht, die interaktionell als herausfordernd gelten. Das gibt uns in der Therapie Sicherheit und mindert die emotionale Belastung. Diese aktivere Beziehungsgestaltung kann auch in psychodynamischen Therapien eingesetzt werden.
Beziehungsgestaltung in der Schematherapie
(5)Grawe (2004) betont die Notwendigkeit der Aktivierung emotionaler Prozesse in der therapeutischen Beziehung. Er führt damit eine Entwicklung der Kognitiven Verhaltenstherapie weiter, die zunehmend auch auf »hot cognitions« fokussiert (Goldfried 2003). Die Schematherapie versucht in diesem Sinne, die negativen frühen Beziehungserfahrungen im Schutz der therapeutischen Beziehung durch einen spezifischen Einsatz von Techniken gezielt zu aktivieren, um sie mit den im Erwachsenenalter verfügbaren weiterentwickelten Ressourcen, unterstützt von einem anfangs sehr supportiven Therapeutenverhalten, zu modifizieren.
Dazu muss sich die verhaltenstherapeutische Arbeitsbeziehung abschnittsweise zu einer »Arbeit in der therapeutischen Beziehung« verändern.
In diesem Sinne fordert z. B. Laireiter (2009, S. 193), dass »Psychotherapeuten außer in der Anwendung therapeutischer Methoden […] vor allem im Aufbau, der Aufrechterhaltung und der Arbeit mit der therapeutischen Beziehung, nicht nur mit der Arbeitsbeziehung, sondern vor allem auch mit der sogenannten ›Schemabeziehung‹, d. h. mit den Beziehungsmustern, die Klienten und auch Therapeuten in die therapeutische Beziehung einbringen«, trainiert werden sollen, besonders wenn man davon ausgeht, dass das in der Therapie gezeigte Verhalten des Patienten repräsentativ ist für das außerhalb gezeigte (Wendisch 2000). Entsprechende Konzepte schematherapeutisch basierter Supervision und Selbstreflexion wurden inzwischen entwickelt (Neumann et al. 2013).
Auch unter einem weiteren Aspekt bildet die Schematherapie ein fortschrittliches Konzept: In der medizinethischen Diskussion werden zunehmend Transparenz und Partizipation für die Patienten und Patientinnen bei der medizinisch-therapeutischen Entscheidungsfindung gefordert. Die Schematherapie erfüllt diese modernen Forderungen nach einer partnerschaftlichen, kontraktualistischen (d. h. vertragsartigen) Beziehungsgestaltung bzw. dem shared decision making(1) (Beauchamp & Childress 2001). Alle Hintergründe und Vorgehensweisen werden erklärt und miteinander abgestimmt. In der Schematherapie-Fortbildung wird in der Supervision(1) mittels Videoanalysen anhand der von Young(4) entwickelten Competence-and-adherence-Skalen ausdrücklich das Therapeuten- und Therapeutinnenverhalten hinsichtlich des Eingehens auf die Bedürfnisse der behandelten Person, der Transparenz, der Abstimmung des Therapiefokus und der Art der Entscheidungsbildung trainiert und in der Zertifizierung beurteilt.
Es ist das Anliegen dieses Buches, die Beziehungsgestaltung und ihre differenzierte Handhabung in den emotionsaktivierenden Techniken detailliert darzustellen. Lassen Sie uns beginnen!
1 Theoretische Grundlagen(1)
Einführung
In diesem ersten Kapitel beschäftigen wir uns mit den tragenden Theoriesäulen schematherapeutischer Konzepte, insbesondere unseres prozessbasierten und kontextuellen Verständnisses von Psychotherapie im Allgemeinen sowie im Kontext der Schematherapie. Um diese Konzepte zu ordnen, orientieren wir uns am SORC-Modell(1) (ursprünglich 1988 eingeführt von Kanfer & Schefft). Diese Betrachtung des menschlichen Verhaltens stellt nicht nur das Herz der Verhaltenstherapie und der Lerntheorie dar, sondern in unseren Augen auch eine transdiagnostische, individuelle und dynamische Systematik wesentlicher Kernprozesse, mit denen komplexe Handlungen und Reaktionen erklärt werden können.
Meist wird das SORC-Schema(1) in linearer Form dargestellt (siehe Abb. 1-1). Schauen wir uns das Beispiel einer typischen SORC-Analyse(1) zum Verständnis impulsiven Verhaltens einer Patientin mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung(1) an:
Beispiel
Eine Patientin, nennen wir sie Frau Müller, unterhält sich mit ihrem Freund über die Arbeit und dieser erwähnt, dass es eine neue Kollegin im Büro gebe, die sehr nett sei (S). Vor dem Hintergrund unbeständiger Beziehungserfahrungen in der Kindheit und einer erhöhten emotionalen Reaktivität (O) denkt die Patientin: »Dieser Kerl wird bestimmt fremdgehen« (R kog.), fühlt kurz Angst, dann aber starke Wut (R emot.) mit starker psychovegetativer Aktivierung (R phys.). Sie springt auf und schreit ihn an: »Dann hau doch ab und geh gleich mit der Tussi in die Kiste!« (R mot.). Dadurch kommt es kurzfristig zu einer emotionalen Entlastung (Ȼ-), die Beziehung wird jedoch längerfristig stark belastet und ihr negatives Selbstbild verstärkt sich (C–).
Diese lineare Darstellung S → O → R → C suggeriert ein eher mechanistisch-reduktionistisches Verständnis von Verhaltenssteuerung.
Wie würde die Mikroanalyse(1) dieser impulsiven Reaktion unserer Patientin aussehen, wenn wir das SORC-Schema nicht als lineare Kette, sondern als dynamischen Rückkopplungskreis darstellen würden?
Beispiel (Fortsetzung)
Während die Patientin die ersten Worte über die neue Kollegin hört (S), fühlt sie vor dem Hintergrund der eigenen belastenden Kindheitserfahrungen (O) bereits erste körperliche Anzeichen von Angst/Misstrauen (R emot./phys.), wobei sie unbewusst auf bestimmte lerntheoretisch relevante Hinweisstimuli achtet (R mot. und S) und prüft, ob ihr Freund Interesse an der Kollegin hat. Sie hat nämlich bereits in früheren Beziehungen gelernt, auf gewisse Nuancen der Stimme zu achten (O), was alleine durch die Fokussierung der Aufmerksamkeit nach außen für eine kurze Angstreduktion sorgt (Ȼ–). Gleichzeitig denkt sie vor dem Hintergrund der Übungen in der Therapie und anderer positiver Beziehungserfahrungen (O), dass ihr Freund treu und verlässlich ist (R kog.) und sie liebt, was sie auch sehr freut (R emot./phys.), woraufhin sie erneut aufmerksam zuhört und interessiert nachfragt (R mot.), bis er erwähnt, wie nett die Kollegin sei (S). In dem Moment imaginiert sie, wie er mit ihr im Büro flirtet (S int.), was sowohl mit Traurigkeit und Schmerz in der Brust als auch mit Wut und Herzrasen einhergeht (R emot./phys.). Sie versucht zunächst, sich mit Selbstinstruktionen zu beruhigen, und sagt nichts (R kog., R mot.), was ebenfalls für einen Moment zu einer kurzen Reduktion der aversiven Emotionen führt (Ȼ–). Bei einem erneuten Kommentar von ihm, die Kollegin sei sehr gut in ihrem Job (S), nimmt jedoch die Tendenz zu Misstrauen und Wut überhand (R emot./phys.).
Wie schon Fred Kanfer(1) beschreibt, befinden wir uns anhaltend in derartigen Selbstregulationsschleifen, die man mikroanalytisch betrachten kann, bis hin zu einem impulsiven Verlassen des Raums und der Selbstverletzung mit einer Nagelschere im Bad (Kanfer et al. 2012).
Den Umgang mit diesen Schleifen und die wissenschaftlichen Hintergründe wollen wir in diesem Kapitel detailliert betrachten. Wer direkt zur daraus resultierenden Anwendungspraxis fortschreiten möchte, lese gerne in den folgenden Kapiteln weiter.
Unser Nervensystem funktioniert nicht wie eine lineare »Input-Output-Maschine«, sondern wie ein hochkomplexes und anpassungsfähiges System mit ständigen Feedback- und Feedforward-Schleifen, um eine möglichst effektive Anpassung an und Interaktion mit der Umwelt zu ermöglichen (Abb. 1-1).
Abb. 1-1: Der SORC-Kreis(1) (mod. nach Valente 2021).
SORCK, SORKC oder SORC? Sowohl im Sinne der pragmatischen Vereinfachung als auch in Anlehnung an Fred Kanfers Selbstregulationsformel entscheiden wir uns für die Variante »SORC«, denn wir stellen prinzipiell die unmittelbar wirkenden Verstärkermechanismen (C+, C–, Ȼ–, Ȼ+) in den Vordergrund. Die Verwendung des Begriffs »Kontingenz« ist in der Literatur uneinheitlich. Im englischsprachigen Raum spricht man beispielsweise über das »3 term contingency ABC-Model« ((1)Skinner 1953), wobei die Relation zwischen »antecedents« (Ereignisse vor dem Verhalten), »behaviour« (das Verhalten an sich) und »consequences« (Folgen) die sog. drei Elemente der Kontingenz darstellen. In der deutschsprachigen Literatur wird Kontingenz häufig als Regelmäßigkeit des Auftretens einer bestimmten Folge auf eine bestimmte Reaktion definiert, was unseres Erachtens in der O-Variable als vertikale Achse der funktionalen Analyse bereits gut abgebildet wird. Anders als von Kanfer(2) ursprünglich definiert, wird die Kontiguität zwischen Situation, Reaktion und Folge nicht immer als Gesamtphänomen dargestellt und betrachtet. Wenn wir wiederum über Kontingenzmanagement(1), beispielsweise im Sinne der Dialektisch-Behavioralen Therapie (DBT) ((1)Linehan 1996), sprechen, meinen wir jedoch auch die bewusste Beeinflussung der Bedingungen sowohl im Sinne von (diskriminativen) Stimuli als auch von Konsequenzen/Verstärkern.
Die Verwendung der vereinfachten Variante SORC ist für unsere Zwecke und unter Betrachtung der Gefahr von konzeptuellen Missverständnissen am einfachsten. Dies entspricht nicht nur Fred Kanfers Grundgedanken, sondern auch unserer kontextuellen 3. Welle-Haltung. Denn mit dem Begriff »Kontext« meinen wir sowohl externe Kontingenzen (unmittelbar vorausgehende und folgende Stimuli/Bedingungen) als auch innere Bedingungen einer Handlung. Das erklären wir ausführlich im Kapitel 2 im Rahmen der Einführung in das Erweiterte Evolutionäre Meta-Modell von Prozessen nach Hayes et al. (2020) (siehe Kap. 2.6.1).
Diese dynamische Darstellung der Verhaltenssteuerung ermöglicht ein tiefes und gleichzeitig geordnetes Verständnis als Grundlage therapeutischen Handelns. Dies gilt natürlich nicht nur für problematische Verhaltensweisen, denn die beteiligten kognitiven, emotionalen und verhaltenssteuernden Kernprozesse sind immer die gleichen, unabhängig davon, ob das Outcome dieser Prozesse dann als krankheitswertiges Symptom oder als adaptives Verhalten angesehen wird.
Wir möchten die Schematheorie in dieses übergeordnete Verständnis der Verhaltenstherapie einbetten. Konsequenterweise orientiert sich unsere Darstellung der wichtigsten Grundlagen an den Ebenen Stimulus, Organismus, Kognition, Emotion, sichtbares Verhalten und interpersonale Kontingenzen. Wir werden daher im Therapieprozess immer wieder die Elemente des SORC-Kreises abfragen, mit der O-Variable (d. h. dem Schemahintergrund) in Beziehung setzen und nach einer möglichst funktionalen Reaktion suchen.
Es ist aus unserer Sicht eines der wesentlichen Charakteristika der Methoden der »3. Welle der Verhaltenstherapie«, den Fokus stärker auf positive psychologische Prozesse anstatt auf pathologische Symptome zu lenken.
1.1 Stimulus(1)
Die systematische Beobachtung von Stimulus-Reaktion-Beziehungen(1) markiert Anfang des 20. Jahrhunderts die Geburtsstunde der Verhaltenstherapie. Inspiriert von den tierpsychologischen Experimenten des russischen Physiologen Iwan Pawlow überträgt der US-amerikanische Psychologieforscher John Watson(1) die Prinzipien der klassischen Konditionierung auf Menschen und begründet damit den Behaviorismus. Der historische Kontext spielt bei dieser Entwicklung eine entscheidende Rolle, denn auf der anderen Seite des Atlantischen Ozeans finden zur gleichen Zeit tiefenpsychologische Theorien und insbesondere die Psychoanalyse von Sigmund Freud sehr hohe akademische Akzeptanz. Als fast ideologischer Widerspruch lehnt der Behaviorismus zunächst die Beschäftigung mit intrapsychischen, nicht beobachtbaren Prozessen ab und konzentriert sich nur auf messbare, von außen objektivierbare Phänomene. So stehen von Anfang an Stimulus-Variablen und insbesondere die Suche nach replizierbaren Möglichkeiten, diese zu kontrollieren (Stimuluskontrolle), im Herzen klassischer behavioristischer Theorien. Und auch wenn Burrhus Skinners operante Konditionierung den Fokus vor allem auf die Folgen einer Handlung legt, spielen externale Stimuli sowohl im Sinne diskriminativer (Hinweis-)Reize als auch im Sinne verstärkender Bedingungen weiterhin eine wesentliche Rolle in seiner Lerntheorie.
Mit der kognitiven Wende der Verhaltenstherapie in den 1970er-Jahren verliert die Stimulus-Variable in der funktionalen Analyse den deterministischen Charakter und wird vielmehr als zu prozessierende Information verstanden, wobei der Fokus primär auf die kognitive Informationsverarbeitung gelegt wird. In weiteren Entwicklungen und insbesondere im Rahmen der 3. Welle der Verhaltenstherapie(1) werden Stimuli häufig im Sinne von äußeren Bedingungen, als »Kulisse« des Verhaltens oder als Kontext verstanden.
Lassen Sie uns diese unterschiedlichen Perspektiven genauer anschauen:
Stimuli als Außenreize. Diese Betrachtung entsteht im Kontext (neuro-)physiologischer Forschungstradition. Dabei werden Stimuli als Reize verstanden, die von außen auf einen Organismus einwirken und bei ihm eine Reaktion hervorrufen. Bei der Übertragung auf komplexere menschliche Reaktionen verliert sich in der Regel die eher deterministische und unidimensionale Kausalitätsbeziehung zwischen Stimulus und Reaktion, dem reagierenden Organismus wird jedoch implizit weiterhin eine tendenzielle Passivität unterstellt. Der Fokus liegt dabei auf der Wahl passender Stimuli, um Reaktionen hervorzurufen bzw. zu verstärken im Sinne der operanten Lerntheorie, wie etwa beim Training eines Hundes. Auch Begriffe wie »Trigger« und »Stressor« sind in ähnlichem Sinne in unserem alltäglichen Gebrauch.
Internale Stimuli. Die Anerkennung der Fähigkeit eines Organismus zur Selbststimulation lässt sich im lerntheoretischen Kontext auf Skinner(2) zurückführen. Damit werden Prozesse im Organismus deutlicher in den Vordergrund gestellt und als Auslöser einer Kette weiterer innerer Reaktionen sowie Handlungen verstanden, z. B. bei Symptomstörungen wie Angst- und Zwangsstörungen, somatoformen Störungen oder bei der Erklärung posttraumatischer Reaktionen, welche durch Intrusionen in Gang gesetzt werden, aber – und daher im Kontext dieses Buches besonders wichtig – auch bei der Entwicklung und Aufrechterhaltung von Persönlichkeitsstörungen(1). In der Regel konzeptualisieren wir dann im Rahmen der Verhaltensanalyse ein Zusammenspiel sowohl external-situativer als auch internaler Elemente als komplexes Gefüge der S-Variable.
Stimuli als zu verarbeitende Information. Mit der kognitiven Wende Ende der 1960er-Jahre wird der Fokus dezidiert auf die aktive Rolle des Organismus bei der Wahrnehmung, Selektion und dem Erwerb von Informationen aus der Umgebung im Sinne von Wissenserwerb (Niesser 1967) gelegt. Damit wird aktive Reaktion des Individuums, welche sich vor allem auf kognitive Verarbeitungsprozesse zurückführen lässt, wichtiger als der Stimulus selbst.
Stimuli als Anforderung an den Organismus. Diese Formulierung wird im Rahmen der Prozessbasierten Therapie (PBT)(1) von Svitak & Hofmann (2022) gewählt. Eine Anforderung ist kein kausaler Faktor für eine bestimmte Reaktion, denn der Organismus hat gewissermaßen Freiheitsgrade hinsichtlich möglicher Reaktionen, welche dann als Prozesse verstanden werden. Ohne diese Anforderungen würde der Organismus jedoch keine entsprechenden Prozesse in Gang setzen. Auch hier wird zwischen externalen und internalen Anforderungen unterschieden.
Stimuli als situative Bedingungen oder Kontext. Mit der 3. Welle der Verhaltenstherapie(2) und insbesondere im kontextuellen Verständnis der Akzeptanz- und Commitment-Therapie (ACT; Hayes et al. 2012) entsteht eine neue Sichtweise auf die Stimulus-Variable. Äußere Faktoren werden bei der Entstehung komplexen Verhaltens als situative Bedingungen und damit als Teil des Kontextes verstanden. Der Fokus wird noch stärker auf intrapsychische, motivationale Prozesse bei der Entstehung konkreter Entscheidungen und Handlungen gelegt. Im erweiterten Sinne besteht der Kontext der Entscheidung zu einer bestimmten Handlung nicht nur aus den unmittelbaren situativen Bedingungen und den erlernten (konditionierten) Reaktionen, sondern auch aus individuell aktivierten, reaktiven emotionalen und kognitiven (inneren) Prozessen (Harris 2019).
Welche Betrachtung der Situation oder Stimuli ist nun die Richtige? Lassen Sie uns mit einer Metapher antworten. Stellen Sie sich vor, wir sind Fotografen vor einer weiten Berglandschaft und haben eine Kamera mit einem sehr flexiblen Zoom-Objektiv und verschiedensten Brennweiten. Wir können sowohl die ganze Szene (Ultraweitwinkel) als auch kleinste Elemente in hoher Auflösung (Telezoom) und alles dazwischen ablichten. Wir schauen durch das Visier, zoomen fast spielerisch rein und raus, explorieren die Landschaft vor uns und die verschiedenen Betrachtungsmöglichkeiten, bevor wir uns für ein Motiv entscheiden. Die Fotografie eines einsamen Baumes im Tal und das darauffolgende Bild der großen Berge links und rechts mit dem kaum sichtbaren Baum in der Mitte ergänzen sich, geben einander Kontext und Bedeutung.
Das ist die Essenz einer kontextuellen Haltung: kein »entweder – oder«, sondern ein »sowohl als auch«. Das gilt auch für die Analyse der situativen Elemente eines Verhaltens. Verschiedene Perspektiven und Betrachtungsweisen führen zu mehr Flexibilität sowohl in der diagnostischen Konzeptualisierung als auch in der Wahl der Interventionen. Mikro- und Makroebene bilden eine Dimension, ebenfalls das Zusammenspiel zwischen Situation und Organismus.
1.2 Organismus(1)
Introspektion als ein Zugang zum Störungsverständnis wurde in den ersten behavioristischen Modellen zunächst kategorisch abgelehnt. So spricht (2)Watson (1913) über die »Black Box«(1), deren Inhalt seines Erachtens nicht wissenschaftlich zugänglich gemacht werden kann und entsprechend ignoriert werden solle. Das ist für unser heutiges Verständnis undenkbar. Würden Sie sich nicht für frühe Erfahrungen, Selbstbild, Grundüberzeugungen und emotionale Wahrnehmungs- und Regulationsmuster interessieren? Ein Wissen über wesentliche Organismus-Prozesse gibt uns neben der Analyse situativer Bedingungen den Rahmen, in dem Reaktionen verstanden werden können. Entsprechend ergänzten (6)Caspar & Grawe (1982) die horizontale Bedingungsanalyse durch die vertikale Verhaltensanalyse(2). Die O-Variablen beantworten im Wesentlichen die Frage: »Wie ergeben Frau Müllers Reaktionen in dieser spezifischen Situation motivational betrachtet Sinn?«
Anders formuliert: Die Organismus-Variable(1) im SORC-Denkmodell bringt jenseits diagnostischer Klassifikationen wieder die wertschätzende (ideografische) Betrachtung der Einzigartigkeit eines Individuums ins Bild.
Die Organismus-Variable im funktional-analytischen Sinne umfasst viele relevante Prozesse, mit denen wir uns auf den nächsten Seiten beschäftigen möchten. Aus schematheoretischer Sicht steht das Schemakonstrukt im Mittelpunkt der O-Variablen. Bevor wir in Kapitel 3 zu einer detaillierten Darstellung des Modells kommen, laden wir Sie zunächst ein, sich mit uns gemeinsam mit Persönlichkeitstheorie und Bindungsforschung, einem modernen Verständnis von Gedächtnis und Informationseinspeicherung sowie mit Situationsbewertungsmechanismen als neurobiologischem Hintergrund von Schemaentstehung und -aktivierung zu beschäftigen.
1.2.1 Das Persönlichkeitskonstrukt(1)
Im Kern der Organismus-Variable steht das theoretische Konstrukt der Persönlichkeit. Eine klassische Definition dazu wurde von (1)Eysenck (1967) formuliert:
Definition
»Persönlichkeit(1) ist die Gesamtsumme der aktuellen oder potenziellen Verhaltensmuster des Organismus, wie sie durch Anlage oder Umwelt determiniert sind. Diese Muster entwickeln sich durch die Interaktion von vier Hauptbereichen: dem kognitiven Bereich (Intelligenz), dem konativen Bereich (Charakter und Motive), dem affektiven Bereich (Temperament) und dem somatischen Bereich (Konstitution).«
Eine modernere Definition ist bei Fiedler (2012) nachzulesen:
Definition
»Persönlichkeit(2) und Persönlichkeitseigenschaften(1) eines Menschen sind Ausdruck der für ihn charakteristischen Verhaltensweisen und Interaktionsmuster, mit denen er gesellschaftlich-kulturellen Anforderungen und Erwartungen zu entsprechen und seine zwischenmenschlichen Beziehungen auf der Suche nach einer persönlichen Identität mit Sinn zu füllen versucht.«
In der Literatur finden sich zahlreiche Kontroversen hinsichtlich der transsituativen Konsistenz und der transtemporalen Stabilität von Persönlichkeitseigenschaften. Und in der Tat erleben wir bezüglich des Persönlichkeitskonstrukts und insbesondere im Hinblick auf das Konzept von Persönlichkeitsstörungen(2) einen Paradigmenwechsel. Die wesentliche Annahme des im 20. Jahrhundert dominierenden Eigenschaftenparadigmas(1) (trait paradigma) besteht darin, dass unsere Persönlichkeit aus stabilen, zum Teil konstitutionell angelegten Eigenschaften bestehe (Kuhl 2001), deren Entwicklung bis zu Beginn des Erwachsenenalters weitestgehend abgeschlossen sei. Den Systematiken im DSM-IV und in der ICD-10 liegt entsprechend ein taxonomisches Verständnis(1) von Persönlichkeitsstörungen(3) zugrunde.
Aktuelle Forschung belegt jedoch, dass die Stabilitätsrate von Persönlichkeitsstörungen(4) sehr gering (Skodol et al. 2005) und ein taxonomisches Verständnis unzureichend valide und reliabel sind. DSM-5(2) und ICD-11 verändern dieses Verständnis hin zu einem dimensionalen (und ideografischen) Verständnis von Persönlichkeitsstörungen.
Das »neue« dimensionale Verständnis der Persönlichkeitsstörungen(1) ist an sich nicht wirklich neu und hat eine sehr lange Tradition in der Persönlichkeitspsychologie. Forscher führten bereits in den 1930er- und 1940er-Jahren zahlreiche faktorenanalytische Studien durch, um die sehr lange Liste an Persönlichkeitseigenschaften auf wenige Faktoren zu reduzieren. So entstanden beispielsweise die 16 Persönlichkeitsfaktoren von Cattell (1946) und das bekannte zweidimensionale Temperamentkonzept(1)(1)von (2)Eysenck (1947). Eysenck(3) postuliert ein dimensionales Verständnis von Temperamentseigenschaften entlang der beiden Dimensionen Extraversion(1) und Neurotizismus(1): Die erste Dimension besteht aus der Polarität Introvertiert (verschlossen, schwer durchschaubar, mit intensivem Fantasie- und Gefühlsleben bei wenig Gefühlsausdruck) und Extrovertiert (zugänglich, freundlich, ablenkbar, mit starkem Gefühlsausdruck). Die zweite Dimension bewegt sich zwischen Instabilität(1) (labile Stimmungslage, Ängstlichkeit, Impulsivität) und Stabilität(1) (ruhig, zuverlässig, sorgfältig). So ergeben sich die folgenden vier Kombinationen:
introvertiert-labil(1) (das melancholische Temperament(1)) – schweigsam, ungesellig, zurückhaltend, pessimistisch, rigide-beeindruckt, ängstlich, launisch
extrovertiert-labil(1) (das cholerische Temperament(1)) – empfindlich, unruhig, aggressiv, reizbar, wechselhaft, impulsiv, optimistisch, aktiv
introvertiert-stabil(1) (das phlegmatische Temperament(1)) – passiv, sorgsam, nachdenklich, friedlich, beherrscht, zuverlässig, ausgeglichen, ruhig
extravertiert-stabil(1) (das sanguinische Temperament(1)) – gesellig, aus sich herausgehend, gesprächig, teilnehmend, lässig, lebhaft, sorglos, tonangebend
Das »neue« dimensionale Verständnis verlässt die Annahme einer zeitstabilen und statischen Persönlichkeit, löst sich von den pathologisierenden (in Klammern gesetzten) konventionellen Bezeichnungen, betont damit unser grundsätzliches Veränderungspotenzial hin zu einem höheren Funktionsniveaus (auch noch im Erwachsenenalter) und öffnet symbolisch die Tür für positiv-psychologische, ressourcenorientierte und prozessbasierte Perspektiven auch im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung und der Persönlichkeitsstörungsbehandlung. Dazu kann und will die Schematherapie einen Beitrag leisten.
Allgemein akzeptiert und auch die Basis für das dimensionale Verständnis von Persönlichkeitsstörungen(5) im DSM-5 ist das Fünf-Faktoren-Modell(1) oder »Big Five«(1) (Fiske 1949). Dieses Modell erweitert das Zwei-Faktoren-Modell(2) von (4)Eysenck (1947) mit den zusätzlichen Dimensionen Offenheit für Erfahrungen, Verträglichkeit und Rigidität/Gewissenhaftigkeit. Tabelle 1-1 zeigt diese Dimensionen, angelehnt an den Skalen und Facetten des »NEO-Personality Inventory«(1) von Costa und McCrae (1992).
Faktor
Hohe Ausprägung
Niedrige Ausprägung
Neurotizismus(2)
(negative Affektivität(1))
Ängstlichkeit, Reizbarkeit, Impulsivität, Verletzbarkeit
Emotionale Stabilität, Entspannung, Selbstsicherheit und Zufriedenheit
Extraversion(2)
(Enthemmung(1))
Geselligkeit, Aktivität, Herzlichkeit, Personenorientiertheit, Frohsinn
Zurückhaltung bei sozialen Interaktionen, Bevorzugen des Alleinseins, Ungeselligkeit
Offenheit für Erfahrungen(1)
(Distanziertheit(1))
Offenheit für Fantasie, Ästhetik, Gefühle, Handlungen, Ideen, Offenheit des Werte- und Normsystems
Neigung zu konventionellem Verhalten und zu konservativen Einstellungen
Verträglichkeit(1)
(Dissozialität(1))
Altruismus, Vertrauen, Freimütigkeit, Verständnis und Entgegenkommen, Bescheidenheit, Gutherzigkeit
Antagonistische und egozentrische Tendenzen, Misstrauen, kompetitive Tendenzen
Rigidität(1)/Gewissenhaftigkeit(1)
(Zwanghaftigkeit(1))
Kompetenz, Ordnungsliebe, Pflichtbewusstsein, Leistungsstreben, Selbstdisziplin, Besonnenheit
Tendenz zu Unordnung, Lustprinzip, Spontaneität, Ungenauigkeit
Tab. 1-1: Das Fünf-Faktoren-Modell(2) der Persönlichkeit(1).
1.2.2 Die Rolle der frühen Beziehungserfahrungen(1)
Wie werden wir die Person, die wir heute sind? Selbst wenn wir das Potenzial haben, uns bis ins spätere Erwachsenenalter zu verändern, scheinen unsere Beziehungserfahrungen in der Kindheit eine sehr prägende Rolle bei der Entwicklung unserer Persönlichkeit zu spielen. Sie geben uns eine Art »Bedienungsanleitung« für den Aufbau und die Gestaltung weiterer Beziehungen im Laufe unseres Lebens (internal working model(1); (1)Bowlby 1969).
Die Pioniere der Bindungsforschung(1) (Ainsworth et al. 1978; (2)Bowlby 1969) versuchten in den 1960er- und 1970er-Jahren eine Systematisierung von Bindungstypen(1) zu erstellen. Dafür führten sie Untersuchungen an Kindern mittels der Fremden Situation(1)(1) (Ainsworth et al. 1978) durch, in der die Kinder nach einem festen Ablauf vorübergehend von der Mutter getrennt und bis zu deren Rückkehr von einer Ersatzperson betreut wurden. So beschrieben sie folgende Bindungstypen (die Prozentangaben beziehen sich auf eine nicht-klinische Population):
Unsicher-vermeidend gebunden(1) (Typ A, ca. 25 %). Das Kind weint bei der Trennung nicht, ignoriert den Elternteil beim Wiedersehen und konzentriert sich die ganze Zeit auf sein Spielzeug, ohne dabei unter Stress zu geraten.
Sicher gebunden(1) (Typ B, ca. 60 %). Das Kind kann (ausgehend von der Mutter als sicherer Basis) den Raum erkunden und spielen, weint bei der Trennung, freut sich bei der Rückkehr, das heißt, es kann sich auf wechselnde Bezugspersonen einstellen.
Unsicher-ambivalent gebunden(1) (Typ C, ca. 15 %). Das Kind wirkt schon vor der Trennung angespannt und »auf der Hut«, erforscht die Umgebung wenig und hält sich während des ganzen Tests bis zur Trennung eng an den Elternteil, ohne jedoch in einen konkreten Kontakt zu gehen (»Beschattungssyndrom«). Es lässt sich auch von der fremden Person nicht beruhigen, sondern rennt zur Tür und hämmert dagegen, sobald die Mutter weg ist, und spielt kaum. Bei Wiederkehr der Mutter wechseln Anklammerung und Aggression ab.
Desorganisiert gebunden(1) (Typ D, 30 % von Typ A und Typ C). Die Anwesenheit des Elternteils destabilisiert das Kind eher, es zeigt ein zwiespältiges bzw. bizarr-ungerichtetes Verhalten von Anklammern und gleichzeitigem Weinen und Wegstoßen, von ziellosem Jammern bis hin zur dissoziativen Apathie. Es kann weder Nähe herstellen noch sich ablenken und findet keine stabile Verarbeitungsstrategie für die Trennung.
Die Benennungen und Inhalte der Bindungstypen bei Kleinkindern (erfasst mit der Fremden Situation) und Erwachsenen (kategorisiert mittels des »Adult Attachment Inventory«(1) [AAI]; George et al. 1985) variieren etwas (Tab. 1-2). So entspricht der desorganisierten Bindung bei Erwachsenen die Kategorie »unverarbeitetes Trauma«, die aber auch bei sicher Gebundenen auftreten kann. Gillath et al. (2016) sehen Parallelen zwischen Bindungstypen, dem resultierenden inneren Arbeitsmodell und dem Schema-Modus-Konzept(1), denn die Aktivierung der schemaverbundenen Erinnerungen führt zu starken emotionalen Aktivierungen, zu deren Moderation Bewältigungsmodi(1)eingesetzt werden (siehe Spalte 3 in Tab. 1-2).
Mikulincer & Shaver (2020) postulieren, dass feinfühlige und resonante Bezugspersonen eine gute Balance zwischen einem »sicheren Hafen« mit schutzgebender Bindung (safe haven(1)) und einer sicheren Basis (secure base(1)) als Grundlage anbieten, die Welt zu erforschen.
Sicher gebundene Menschen können zwischen Nähe und Distanz wechseln und haben eine sichere Basis, von der aus sie die Welt erforschen und sich frei in Richtung Komplexitätssteigerung entwickeln können.
Welche Relevanz haben diese Erkenntnisse für unsere Praxis? Viele Menschen, die zu uns in Behandlung kommen, wurden in der Kindheit vernachlässigt oder gar misshandelt und zeigen entsprechende Bindungsstile. Sroufe (2021) sieht in einem unsicheren Bindungsstil einen Faktor, der verschiedenste Störungen vom internalisierenden, externalisierenden oder Borderline-Typ mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,4 vorhersagen kann. Bei Menschen mit Borderline-Störungen wurden als gemeinsames Ergebnis in 13 Studien ein unsicher-verstrickter Bindungsstil und Hinweise auf ein unverarbeitetes Trauma gefunden (Agrawal et al. 2004), was zu den Ergebnissen der Langzeitstudie von Zanarini et al. (2003) passt, in der mehr als 90 % der Borderline-Patientinnen in der Kindheit einen sexuellen Missbrauch oder emotionale Vernachlässigung angaben.
Welche Bedeutung hat das für die therapeutische Beziehungsgestaltung(1)? Reagieren wir in einer Behandlung auf dysfunktionales Verhalten ausschließlich im Sinne des Kontingenzmanagements ((2)Linehan 1996) mit einer Unterbrechung der Beziehung (z. B. durch ein »Time-out«) oder im Sinne einer Konfrontation im Rahmen der Übertragungsfokussierten Therapie nach Kernberg (2020), können durch eine Re-Aktivierung früherer Erfahrungen Ängste und Anspannung ansteigen und im Sinne einer maladaptiven Beziehungschemie (bzw. im psychodynamischen Modell einer projektiven Identifikation) zu Beziehungsabbrüchen führen. Sofern diese Ängste Ausdruck der persistierenden Bindungsstörung sind, sollten sie gezielt Gegenstand einer spezifischen, bindungsorientierten Behandlung sein (Fonagy et al. 2022).
In der Schematherapie versuchen wir dem Rechnung zu tragen, indem wir auch bei der Konfrontation dysfunktionaler Verhaltensweisen immer die Bindung schützen. Jeffrey Young(5) spricht in diesem Sinne von empathischer Konfrontation(1).
1.2.3 Gedächtnissysteme(1) und Informationsspeicherung(1)
Wie werden Informationen wie etwa Beziehungserfahrungen gespeichert und später im Leben aktiviert? Gedächtnisprozesse sind dynamische und hochkomplexe Leistungen unseres Gehirns, die auch mit modernster bildgebender Technik nur teilweise erklärt werden können. Bevor wir ins Detail gehen, möchten wir um Verständnis dafür bitten, dass unsere Diktion in diesem Abschnitt des Buches etwas biologistisch ist. Wir werden verschiedenen Strukturen relativ spezifische Funktionen zuweisen, was reduktionistisch ist, denn wie die Analyse von Konnektomen (also gleichzeitig aktivierten Hirnregionen) und neuronalen Netzwerken zeigt, sind Aktivitäten häufig über das ganze Gehirn verteilt und in MRT-Abbildungen werden zum Teil kleine Unterschiede zwischen verschiedenen »regions of interest(1)« sehr deutlich sichtbar gemacht. So entstehen schnell lokalisatorische »Neuromythen(1)« (Hasler 2012). Dieser Gefahr sind wir uns bewusst. Dennoch versuchen wir, die komplexen Prozesse in eine gewisse Verständlichkeit zu bringen, denn wir möchten im Sinne des erweiterten bio-psycho-sozialen Modells(1) der Prozessbasierten Therapie (Hofmann et al. 2021) unsere Interventionen darauf aufbauen.
Für unsere Arbeit ist im Hinblick auf die Betrachtung der O-Variable das Langzeitgedächtnis(1)(1) mit seinen über lange Zeiträume abrufbaren Informationen von besonderer Bedeutung. Funktional werden vor allem zwei Ebenen unterschieden:
Das non-deklarative oder implizite Gedächtnis(1) schließt nonverbale Inhalte ohne bewusst abrufbare Repräsentanzen ein. Dazu gehören das prozedurale Gedächtnis (motorische und implizit-kognitive Fertigkeiten), die automatisierte assoziative Bahnung oder Priming, die klassische Konditionierung, die Stimulushabituation und die Stimulungssensibilisierung.
Das deklarative oder explizite Gedächtnis(1) umfasst hingegen explizite – also bewusst zugängliche – und verbal definierbare Inhalte. Im Wesentlichen unterscheidet man hier zwischen dem episodischen Gedächtnis, in dem autobiografische Inhalte in einem bestimmten zeitlich-räumlichen Kontext gespeichert werden, und dem semantischen Gedächtnis, in dem kontext-unabhängiges Faktenwissen gespeichert wird.
Wie entsteht unser Gedächtnis(1)? Förstl et al. (2006) beschreiben Wege der Informationsspeicherung und differenzieren die folgenden verschiedenen Verarbeitungsebenen:
Physiologische Aktivierungen im Hirnstamm und Mittelhirn stellen die niedrigste Regulationsebene für die Aufrechterhaltung von Körperfunktionen dar. Es wird angenommen, dass auch auf dieser basalen Ebene diffuse Erinnerungen physiologischer Zustände mit dem Charakter eines Körpergedächtnisses abgespeichert werden, welche als eine Art Resonanzboden für spätere emotionale Aktivierungen dienen könnten.
Subkortikale, emotional gesteuerte Aktivierungen. Durch die Amygdalae und den orbitofrontalen Kortex (OFC) erfolgt eine erste schnelle, implizite emotionale Bewertung von Aktivierungszuständen (lower pathways(1); (1)LeDoux 1998). Die Aktivierung dieser Ebene wird subjektiv als diffuse grob orientierende Reaktion mit innerer Anspannung und einer positiven oder negativen emotionalen Tönung sowie ohne bewusste bildhafte Erinnerung erlebt, wie etwa beim Hören eines positiv besetzten Musikstückes.
Einspeicherung in bewusstseinsfähige, kortikale Aktivierungen (über den Hippocampus). Die Weiterverarbeitung über den Hippocampus im limbischen System erfolgt etwas verzögert. Inhalte aus dem Arbeitsgedächtnis im präfrontalen Kortex scheinen dabei bevorzugt eingespeichert zu werden. Das Arbeitsgedächtnis stellt dann Verbindungen zu verschiedenen Repräsentationen her und kann dementsprechend die aktuelle Wahrnehmung einordnen. Im parietalen und temporalen Kortex scheinen sich kognitive Repräsentationen für einzelne Module (wie etwa Objekte, Raum, Wörter, Zahlen, Gesichter) zu befinden.
Einspeicherung in das episodische Gedächtnis(1) im sogenannten Default Mode Network(1) (DMN; siehe Abschn. 1.2.6). Die Verarbeitung erfolgt schnell, parallel und holistisch in nonverbalen Empfindungen bzw. Erinnerungsfilmen (Szenen) ohne eine exakte räumlich-zeitliche Einordnung. Diese Einspeicherungen mit verschiedenen Sinnesmodalitäten (Modalitäten) schaffen komplexe Repräsentationen vor dem Hintergrund der eigenen Lebensgeschichte. Im Modell der Schematherapie sind das eher die unkonditionalen Schemaanteile(1) (siehe Kap. 3.2). Dieses Erleben kann als Selbst als Prozess(1) beschrieben werden (Hayes et al. 2012). Allerdings geht dieses Selbsterleben noch nicht mit einem Bewusstsein einer eigenständigen, kontinuierlichen Identität bzw. Vorstellungen von sich selbst oder gar der Fähigkeit, sich selbst zu reflektieren, einher. Um diese Fähigkeiten zu entwickeln, bedarf es einer sprachverbunden (semantischen) Informationsverarbeitung, aus der das narrative Selbst(1) (bzw. Selbst als Inhalt(1); Hayes et al. 2012) entsteht.
Versprachlichung des Erlebensflusses im semantischen Gedächtnis(1) (ebenfalls im DMN) in Verbindung mit einem parieto-temporal gespeicherten kulturellen Wissen bezüglich der Welt, in der man lebt – wohlgemerkt in sprachlich repräsentierbarer Form (Nelson 2003) und damit durch die Einflüsse der sozialen Umwelt vermittelt (siehe Abschn. 1.4.4). Im Schematherapiemodell sind das eher die konditionalen Schemaanteile(1). Auch die Interpretation der sozialen und emotionalen Signale anderer Menschen erfolgt auf dieser Weise, was Siegel (2007) als »mind-reading« bezeichnete. Die Verarbeitung erfolgt langsamer, sequenziell, digital. Diese Prozesse ermöglichen eine rationalere und weniger emotionale Reaktion auf die o. g. spontaneren emotionalen Aktivierungen sowie die abstrakte Symbolisierung, die systematische Auswertung von Lernerfahrungen und die Regelextraktion.