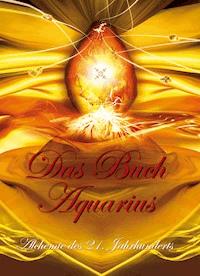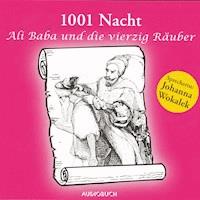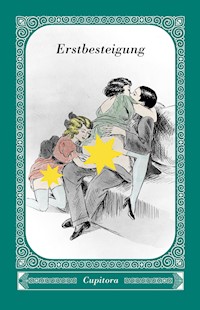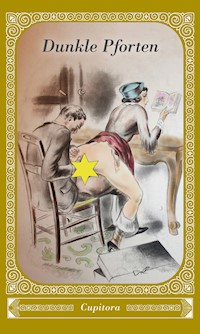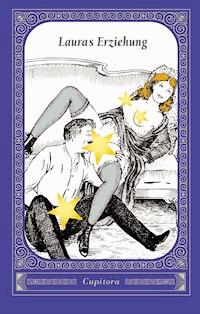Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dieses eBook: "Schi-King / Shi Jing - Das kanonische Liederbuch der Chinesen" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Das Buch der Lieder ist einer der Fünf Klassiker. Es ist die älteste Sammlung von chinesischen Gedichten und die größte aus vorchristlicher Zeit. Konfuzius soll, der Tradition nach, die Lieder aus einem Fundus von 3000 Gedichten ausgewählt und in ihren jetzigen Zustand gebracht haben. Das Buch der Lieder enthält eine Sammlung von 305 Liedern, die in 160 Volkslieder; 74 kleinere Festlieder oder Oden; 31 größere Festlieder und 40 Hymnen unterteilt ist. Im Konfuzianismus werden diese Gedichte moralisch interpretiert. Andere, insbesondere westliche Sinologen heben allerdings die Volksliedhaftigkeit der Lieder hervor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 388
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Schi-King / Shi Jing - Das kanonische Liederbuch der Chinesen oder Das Buch der Lieder: die älteste Sammlung von chinesischen Gedichten
Inhaltsverzeichnis
Einleitung.
Allgemeines.
Aus einer uralten Culturwelt unmittelbare Stimmen damals Lebender zu vernehmen, die uns deren Umgebungen und Verhältnisse, Gedanken und Gefühle, Leiden und Freuden in dichterisch erhöhter Stimmung vergegenwärtigen, wird für den Gebildeten immer von großem Interesse sein, um so mehr, wenn diese Äußerungen auch als Gedichte werthvoll und eigenthümlich sind. Beides ist der Fall mit den Liedern des Schī-kīng, des kanonischen Liederbuches der Chinesen.
Die Sammlung, wie sie vorliegt, ist durch Khùng-tsè oder Khùng-fu-tsè, den man als Confucius verlateint hat, um 483 v. Chr. abgeschlossen worden. Von den darin aufbewahrten Gedichten stammen dreihundert und vier aus dem Zeitraume vom zwölften bis siebenten Jahrhundert v. Chr., fünf aus noch höherem Alterthume; sechs sind verloren gegangen.
Ähnliche Sammlungen, ungefähr gleichen Alters und Ansehens, besitzen wir nur noch in den Psalmen der Ebräer und dem Rigvêda der Inder. Sind aber diese beiden, wenn auch auf sehr ungleichen Stufen, von hohem religiösem Geiste erfüllt, so tritt derselbe in den chinesischen Liedern beträchtlich zurück. Sie sind zumeist weltlicher Art. Dafür sind sie auch frei von allem eigentlich mythologischen Wesen, bewegen sich, einiges Sagenhafte abgerechnet, auf dem festen Boden der Wirklichkeit und stehen unserm Verständniß, unserer Gefühlsweise oft näher, als man bei dem großen Abstande der Zeit und der Volksart voraussetzen sollte. Man sieht auch hier, wie das rein Menschliche unter allen Zonen und zu allen Zeiten sich gleich bleibt.
Indeß kann kein Dichter, wer er auch sei, ich dem entziehen, was als Glaube, Gebrauch, Sitte, Lebensordnung und Überlieferung seine Mitlebenden bedingt. Ja, er muß, um zu fassen und gefaßt zu werden, alles dies voraussetzen als ein ihm und seinen Hörern gemeinsames Element, auf das er nur hinzudeuten, nur anzuspielen braucht, um sofort des vollen Verständnisses gewiß zu sein. Eben darin muß er aber dem Leser einer ganz andern Nation nach Jahrtausenden unverständlich sein.
Nun ist zwar nicht versäumt worden, das Besondere und Besonderste dieser Art in den Anmerkungen zu den übersetzten Liedern zu erläutern; das Allgemeine jedoch, aus dem das Besondere erst gleichsam zusammengerinnt, konnte dort keinen Platz finden. Eine einleitende Darstellung desselben, dem sich dann anzuschließen hat, was über das Schī-kīng selbst zu sagen ist, erscheint daher unerläßlich. Dabei kann es nur Absicht sein, unter Vermeidung alles gelehrten Beiwerks den Leser mit jener altchinesischen Welt insoweit bekannt zu machen, daß sie ihn nicht befremdet, ihm nicht unerklärlich ist, wo sie sich nach ihren Eigenthümlichkeiten in den Liedern abspiegelt.
Denn auch wer das gegenwärtige chinesische Wesen und Leben kennt, kennt noch nicht das alte. Es ist zwar herkömmliche Meinung, daß in China von jeher alles unverändert fortbestanden habe, ja, das Festhalten der Sitten und Einrichtungen des Alterthums ist sogar chinesisches Dogma; dennoch hat sich auch dort fast alles umgestaltet. Die völlige Änderung der Reichsverfassung mit ihrem zugeschärften Centralismus und Bureaukratismus und den jedes dritte Jahr stattfindenden Beamtenversetzungen, die Überwucherung der alten Glaubensformen durch den Buddhismus, religiöse Abstumpfung und Gleichgültigkeit bei den Gebildeten, allerlei absurder Aberglaube beim Volke, die weitverbreitete Sittenverderbniß, überdieß die häusliche Einschließung der Frauen und deren künstliche Fußverkrüppelung, die Zöpfe und das Opiumrauchen der Männer, – alles dieß und noch vieles Andere ist jüngeren Datums und zum Theil vom Auslande her eingeführt.
So einfache und anfängliche Zustände jedoch, wie die Vêda der Inder uns zeigen, finden sich weder in dem Zeitraume, in welchem unsere Lieder entstanden sind, noch in dem ganzen chinesischen Alterthume, über das wir zuverlässige Quellen haben. Denn was spätere Zeiten von den Ursprüngen chinesischer Civilisation erzählen, ist ohne geschichtlichen Werth. Im 22. Jahrhundert v. Chr., wo die urkundliche Geschichte beginnt, sehen wir bereits wolgeordnete öffentliche, wirthschaftliche und häusliche Zustände, die nur Ergebniß einer langen Vorentwicklung sein können.
Die Chinesen konnten sich dem Ausbau ihrer weltlichen Verhältnisse um so früher, um so aufmerksamer widmen, als ihnen jene kaum bewußte, aber vom Irdischen abziehende Geistesentwicklung fremd blieb, durch welche die übrigen alten Culturvölker zu ihren Mythologien gelangten. Allein wie das religiöse Bewußtsein der Menschen auch beschaffen sei, immer bleibt es das Grundbedingende ihrer Lebensgestaltung. Nach ihm messen und beurtheilen sie selbst die letztere, wenigstens in Zeiten ernster Einkehr und gesteigerter Selbstbesinnung, und diese werden dadurch bestimmend für das Leben. So dürfte denn auch hier mit diesem Gegenstande zu beginnen sein.
Zuvor aber müssen wir denselben bestimmter abgränzen.
Gegenwärtig nehmlich bestehen in China, außer dem später eingedrungenen Islam, drei Religionen. die der Sjû1 oder der Gelehrten, sodann die Taò-Lehre, endlich der Buddhismus; und der Höfliche sagt dort zu dem Andersgläubigen, der Aufgeklärte, der nichts mehr glaubt, zu Jedem, der es hören will. »Sān kiáo jĭ kiáo«, d.h. die drei Religionen sind Eine Religion. – Der Buddhismus aber ist erst um 65 n. Chr. zur Ausbreitung gekommen, und die Taò-Lehre, obgleich in ihrem Kerne wahrscheinlich uralt, ist eine so tiefsinnige theosophische Speculation, daß ihre Bekenner wol nie zahlreich gewesen sind. Da nun auch keins ihrer Lieder in das Schī-kīng aufgenommen ist, so können wir diese Lehre gleichfalls übergehen und uns auf den Glauben beschränken, den das Liederbuch allein kennt und der im Alterthume allgemein verbreitet war, weßhalb er damals auch noch nicht als Glaube der Gelehrten, als Sjû kiáo, bezeichnet wurde. Das Wort Sjû, sowie das Schriftzeichen dafür, kommt in den klassischen Büchern vor Khùng-tsè nicht vor.
Fußnoten
1 Mit Sj wird hier der weiche Zischlaut des französischen j bezeichnet.
Religion und Cultus.
Die Religion des chinesischen Alterthums kennt keine Mythologie, aber auch keine Offenbarung und weiß dennoch nur von Einem Gott. Auch darin, wie in manchem Andern, scheint das »schwarzhaarige Volk« Erbe der ältesten Menschheit zu sein. Ihm ist Gott auch nicht Nationalgott, und es kennt ihn so sehr nur als den Alleinigen und Einzigen, daß es nicht einmal einen Gattungsnamen für ihn hat. Es nennt ihn Tí, den HErrn oder Herrscher, Schàng Tí, den Höchsten HErrn, oder Thiân, den Himmel, mit dem Bewußtsein, daß jeder dieser Namen dasselbe Eine höchste Wesen bezeichne. – Hat man neuerdings die Bezeichnung »Schàng Tí« oder »Ti« durch »Gott« übertragen, so ist das nicht falsch, aber doch insofern ungenau, als es den bedeutsamen Eigennamen durch einen Gattungsnamen ersetzt. –
Der Höchste HErr nun, oder der Himmel, ist allherrschend und Niemand kann ihm widerstehen. Er ist bewußter Geist, der Alles sieht, hört und auf das lichtvollste erkennt. Er will und wirkt, doch ohne Laut und ohne Geruch, d.h. unkörperlich. So ist er allgegenwärtig, denn er geht mit dem Menschen aus und ein und ist über und unter ihm. Er giebt dem Menschen das Leben und den Völkern das Dasein. Alle Tugend und Weisheit stammt von ihm. Keinen bevorzugt er, hasset auch Keinen; aber er liebt, die ihn fürchten, belohnt und segnet die Guten. Der Bösen Frevel erzürnen ihn und er bestraft sie. So kommt von ihm aller Segen, von ihm alles Unglück. Er sieht den Weltgang voraus setzt demzufolge die Bestimmung der Menschen und beschließt über sie, je nachdem sie seinem Willen gehorchen. Darum regieren auch die Könige aus seinem Auftrage, und nach ihrem Verhalten zu seinem Willen macht er sie groß oder stürzt er sie. Die Erkenntniß seines Willens wird durch die von ihm bestimmte Naturordnung, vornehmlich auch durch das allgemeine Volksbewußtsein vermittelt; ja, nach einem unserer Lieder (III. 1, 7) hat der Höchste HErr sogar drei Mal zu dem Könige Wên unmittelbar geredet; eine Angabe, welche freilich die späteren chinesischen Ausleger in die größte Verlegenheit setzt.
Diese Aussagen des altchinesischen Gottesbewußtseins gehören aber sämmtlich einer Zeit an, da noch nicht philosophirt und speculirt wurde. Sie geben daher auf viele Fragen, die damit erst auftauchten, keine Antwort. Überdieß mangelte es an einem religiösen Grundbuche, so wie an einer Priesterschaft, die eine Theologie hätte entwickeln können. Alles beruhte auf unvordenklicher Überlieferung, welche sich mannigfaltigen Cultushandlungen anheftete.
Einen Monotheismus im höchsten Sinne kann man diesen Theismus allerdings nicht nennen, dennoch war in ihm das höchste Wesen zu sehr nach seiner in sich beschlossenen Einheit und Einzigkeit aufgefaßt, um sich im Bewußtsein der Menschen mythologisch, mithin polytheistisch zersetzen zu können. Ebendeßhalb aber war es in seiner scharfen Unterschiedenheit von der Welt auch so unerreichbar und ohne Selbstmittheilung, weil ohne Offenbarung, – dann die erwähnten Reden desselben an König Wên stehen ganz einsam und fremdartig in der altchinesischen Literatur – daß zwischen ihm und der Menschenwelt für das religiöse Gefühl eine Kluft blieb, die durch ein Vermittelndes ausgefüllt sein wollte. Diesem Bedürfnisse kam der Glaube an die Fortdauer abgeschiedener Menschenseelen und an eine Menge von Naturgeistern entgegen. Beide wurden als Vertreter der Menschen bei dem Höchsten HErrn und als Ausrichter seiner Befehle gedacht. Ihre Gunst zu erlangen und zu bewahren war daher vom größten Interesse, weßhalb dieser Ahnen und Geniendienst im Glauben und Cultus der alten Chinesen einen eben so großen Raum einnahm, wie bei dem katholischen Volke mancher Gegenden der Heiligen-und Engeldienst, der zwar auch den Gottesdienst nicht verdrängt, aber breit, vielgestaltig und mit mancher Superstition behaftet in den Vordergrund tritt.
Unangezweifelt bestand der Glaube an die persönliche Fortdauer der menschlichen Geister nach dem Tode. Von ihnen heißt es: sie sind aufgestiegen, sind droben, sind im Himmel, – wobei dann der Himmel, wie auch sonst oft, nur die überirdischen Räume und nicht etwa den Höchsten HErrn bezeichnet. Aber sie sind mit diesem in unmittelbarer enger Verbindung, und von dem Könige Wên, dem vielgepriesenen, heißt es, er leuchte im Himmel und sei des Höchsten HErrn linke und rechte Hand. Die Ahnen nehmen Theil an dem Ergehen ihrer Nachkommen und sorgen für sie, solange dieselben sich ihrer Gunst würdig erweisen. Man kann nie wissen, ob sie nicht anwesend sind, aber zu den fehllos und rechtzeitig dargebrachten Opfern steigen sie allemal hernieder, freuen sich ihrer und vergelten sie mit Glück und langem Leben. Die Geister der ältesten Kaiser nehmen einen besonderen Rang ein. Manche Heroengeister sind ganzen Lebensgebieten vorgesetzt; so der »Vater des Feldbaues«, des Krieges, der Pferdezucht. Insbesondere sind es die Ahnen des eigenen Hauses, vornehmlich die sechs nächsten und der allerälteste, denen in jeder Familie, vom Kaiser bis herunter zum Geringsten, gehuldigt wird. Sie bleiben in so nahem Verhältnisse mit den Lebenden, daß diese ihnen jeden Entschluß, jedes Ereigniß von Wichtigkeit ausdrücklich anzuzeigen für Pflicht erachten. Es wird ihnen sogar der höhere Rangtitel beigelegt, den die Nachkommen erlangen.
Ein Näheres über den jenseitigen Zustand der Abgeschiedenen erfahren wir nicht, wie denn auch von einer Unseligkeit oder Bestrafung der Bösen im Jenseits nirgends geredet wird. Belohnung und Bestrafung des sittlichen Verhaltens wurden so sehr nur in das Dießseits verlegt, daß man wol die Strafe der Bösen bei ihrem Tode schon für abgebüßt ansah. Vielleicht verhielt man sich auch solchen Fragen gegenüber aus Pietät naiv ablehnend.
Der klare und bewußte Theismus der alten Chinesen bewahrte sie vor der Vergötterung der Kräfte und Erscheinungen der sinnlichen Welt, und dieß dürfte ein starker Beweis für die Alterspriorität jenes Gottesbewußtseins sein. Eben so fern war ihnen aber auch eine todte materialistische Anschauung der Naturwelt. Sie dachten sich vielmehr diese und ihre Gebilde überall durchwirkt und belebt von seelenhaften Geistern, Genien oder Dämonen, deren Erscheinung die Naturgestalten selbst seien, in und mit denen sie auch geehrt und angerufen wurden. So werden als Geister des natürlichen Himmels Sonne, Mond, Planeten und einzelne Sternbilder verehrt, als irdische Geister vor Allem die Erde selbst, die vier Weltgegenden, dann Berge und Höhen, Wälder und Thäler, Meere, Flüsse und Quellen; auch giebt es einen Schutzgeist der Wege und Reisen, einen Genius der Dürre u.s.w. Diese Naturgeister folgen den allgemeinen Gesetzen und besonderen Geboten des Höchsten HErrn, sie haben Verstand, nehmen Antheil an den menschlichen Dingen und wirken auf dieselben ein, und darum wird mit Opfern und Anrufungen auch ihre Gunst gesucht, werden große Unternehmungen auch ihnen angezeigt. Immer aber werden sie, wie mächtig auch, doch endlich und beschränkt gedacht und durchaus unterworfen dem unendlichen und unbeschränkten Höchsten HErrn.
Denn wenn sie heraustreten aus ihrem wolthätigen regelmäßigen Gange, wenn Erdbeben und Bergstürze, verheerende Stürme, Dürre oder Überschwemmungen, Hungersnoth und Sterben, Sonnen-und Mondfinsternisse die Menschen schädigen oder schrecken, so sind das mahnende Zeichen, daß der Himmel unzufrieden ist mit dem Verhalten der Menschen und ihnen zürnt. Bei solchen Mahnungen sollen sie daher, insbesondere die Regierenden, sich selbst prüfen, ihre Sünden erkennen, Buße thun und dadurch, sowie mit Opfern und Gebeten, den Höchsten HErrn zu versöhnen trachten.
Aber auch dem Besten kann Mißerfolg und Unglück begegnen, wenn er aus menschlicher Kurzsichtigkeit unrichtig handelt oder auch das Rechte zur unrichtigen Zeit thut. Wer möchte daher nicht im Vor aus wissen, ob er bei einem Vorhaben die richtige Wahl, bei dessen Ausführung die richtige Zeit treffen werde? Darum finden wir von Alters her bis heute überall Orakel verschiedenster Art, die über das Künftige Aufschluß geben sollen, damit man sein Thun demselben gemäß mache. Bei den alten Chinesen galt es nicht bloß als Klugheit, sondern auch als Pflicht, bei jedem wichtigeren Vorhaben die Weissagung zu befragen, zuerst ob sie es überhaupt und in welcher Weise billige, sodann welches die Glückstage seien, die das Gelingen sicherten. Man entnahm den Schicksalsspruch aus den Rissen einer gerösteten Schildkrötenschale sowie aus den Blättern des Schikrautes, unsrer gemeinen Schafgarbe. An Höfen war dafür ein kundiger Weissager angestellt, doch scheint die Auslegung der Orakel allgemein bekannt gewesen zu sein. Jetzt kennt man sie nicht mehr.
Die kommenden Dinge kündeten sich aber auch wol ungesucht an, und zwar durch Träume, zu deren Auslegung ebenfalls besondere Traumdeuter verordnet waren. Eine Bemerkung in dem alten Schū-kīng zeigt uns, daß die Sendung eines prophetischen Traumes auf den Höchsten HErrn zurückgeführt wird.
Je lebendiger bei kräftig und innig empfindenden Menschen die Vorstellung einer höheren Macht ist, deren segnende Güte erfahren zu haben, deren Unwillen erregen zu können sie überzeugt sind, desto mehr werden sie sich gedrungen fühlen, ihrerseits derselben mit Dank und Furcht entgegenzukommen und ihr die Aufrichtigkeit dieser Gefühle tatsächlich zu erweisen. Der natürliche Ausdruck hierfür sind die Opfer, die darum so alt sind wie die Menschheit und auch bei den Chinesen schon im grauesten Alterthume stattfanden. Nicht minder natürlich ist es, daß die Opfer mit Weihungen und Gebeten begleitet werden, welche den Sinn und die Absicht des Darbringenden aussprechen.
Man hat gemeint, Häufigkeit der Opfer, eine feste Opferordnung und ein reich ausgebildetes Opferceremoniel müsse stets Erfindung einer Priesterschaft sein, die damit wol auch allerlei eigennützige Zwecke verfolgt habe. Dieß wird durch die alten Chinesen widerlegt. Denn während sie jene Dinge im vollsten Maße besaßen, hat es bei ihnen nie einen Priesterstand oder auch nur einzelne Priester gegeben. Alles priesterliche Thun war Sache des Hausvaters, der unter Beistand seiner Nächstverwandten für sich und alle ihm Zugehörigen opferte, – was abermals nur eine Fortsetzung ältester menschlicher Zustände sein dürfte. Nun aber zeigt sich sofort, wie den alten Chinesen dieses priesterliche Handeln mit dem durchgängigen Patriarchalismus ihrer Reichsordnung zusammenschmolz und durch diesen bestimmt wurde. Denn an der öffentlichen Stellung des Hausvaters stieg die Bedeutendheit seiner Opfer sowie seine Berechtigung zu denselben. Wenn den Ahnen jeder Hausvater opfern durfte, so durften nur die Großen, die Hochgestellten auch den Schutzgeistern des Hauses, nur die Reichsfürsten den Geistern des Bodens und Feldbaues, der Berge und Flüsse ihres Landes, und nur der Kaiser auch noch dem Himmel oder dem Höchsten HErrn, der Erde, den vier Weltgegenden und den Hauptgebirgen und großen Strömen des Reiches opfern. Daß auch der Fürst von Lù dem Höchsten HErrn opferte, war nur eine zugelassene Unregelmäßigkeit. Von Rechts wegen stand es allein dem Kaiser zu und er brachte dieß Opfer bei der Sommer-und Wintersonnenwende, wahrscheinlich auch bei Frühlings und Herbstes Anfang.
Alle Opfer, die dem Kaiser allein oder auch den Reichsfürsten vorbehalten waren, wurden unter freiem Himmel auf einem Erdaltare dargebracht. Tempel gab es weder für den Höchsten HErrn noch für die Naturgeister. Nur die Geister der Ahnen, die noch immer als zur Familie gehörend betrachtet wurden, hatten ihre besonderen Hallen oder Tempel und zwar beim Kaiser sieben, bei den Reichsfürsten fünf, drei bei den Großen, einen bei den übrigen Beamten. Dem einfachen Unterthan vertrat deren Stelle ein bestimmter Platz im Innern seines Hauses. Die Tempel, welche aus einer Vorhalle, einem Hauptsaal und einem hinteren Chor bestanden, enthielten weder Bilder noch Bildsäulen, doch bei den Feierbegängnissen eine Menge mannigfaltiger, zum Opferdienst erforderlicher Gefäße und Geräthe; auch Matten zum Sitzen für die Opfernden und Opfergäste und Lehnsitze für die Hochbejahrten. In ihnen wurde von den Vornehmen, im Hause von dem gemeinen Mann im ersten Monat jeder der vier Jahreszeiten den Geistern der Vorfahren geopfert.
Da in unsern Liedern eigentlich nur von den kaiserlichen Ahnenopfern die Rede ist, so wird eine kurze Beschreibung derselben hier genügen, wobei die unendlichen Einzelheiten des Ceremoniels wie sie das alte Jî-lì ausführlich enthält, übergangen werden mögen.
Nach Befragung der Weissagung über die Wahl des Tages und der Opferthiere bereiteten der Kaiser und seine Opferhelfer durch Fasten und allerlei Reinigungen sich zu der Feier vor, an welcher auch die Kaiserin und die Nebenfrauen theilnahmen, und erschienen zu derselben dann in der vorgeschriebenen Kleidung, die für jede Opferart verschieden bestimmt war. Als Opfergäste pflegten sich die Reichsfürsten zahlreich einzustellen, die schon bei ihrem Eintreffen feierlich empfangen waren. Ein besonderer Werth wurde auf die Anwesenheit der Nachkommen früherer Dynastien gelegt. Die erforderlichen Verrichtungen geschahen jedoch in der Regel von Mitgliedern des kaiserlichen Geschlechts. Außer den Opferbeamten waren alle Großen des Hofs und des Reiches gegenwärtig, und bei Aufstellung der Anwesenden wurde die strengste Etikette nach Rang und Alter beobachtet. Die Fürsten und Großen hielten dabei gewisse Würdenzeichen in der Hand, die man als Scepter und Halbscepter bezeichnet hat. Ein Halbscepter besteht aus einem eiförmig hohlgeschliffenen Nephrit oder Nierenstein, der, zierlich gefaßt und mit einem kostbaren Griffe versehen, auch zum Spenden der Trankopfer diente. Zwei derselben gegen einander gelegt, bildeten ein ganzes Scepter. An einem besonderen Platze standen zahlreiche Musiker, sämmtlich Blinde, welche auf Glocken und Pauken von ungleicher Größe, die an einem schön verzierten Gerüst hingen, sowie auf verschiedenen Blasinstrumenten spielten.
Nach einer Menge begrüßender Verneigungen und ceremoniösen Hin-und Hergehens begann die Handlung mit lauttönender Musik und Spenden von Trankopfern, wozu besondre Weine aus Hirse und Reiß dienten. Dadurch wurden die Ahnengeister herbeigerufen, und der »Beter«, ein besonderer Beamter, begrüßte, an der Hauptthür opfernd, ihren Einzug, den Niemand bezweifelte. Nach einer zweiten Trankspende holte der Kaiser selbst den rothen Opferstier herbei und dieser ward an einem Steinpfeiler festgebunden. Mit einem Messer, an dessen Griffe Glöckchen hin gen, schnitt er zuvörderst von dem Haare ab, um zu zeigen, daß der Stier die vorgeschriebene Farbe habe, tödtete ihn dann damit und löste, nachdem er geöffnet worden, das Fett heraus, welches mit duftender Stabwurz verbrannt wurde. Dem Opfer wurden noch eine Menge Schafe und Schweine hinzugefügt und das Fleisch der Thiere sofort mannigfaltig zubereitet. Dabei waren die Kaiserin und deren Begleiterinnen in schicklicher Weise beschäftigt, hatten aber alle Opferhelfer ihre gewiesenen Dienste zu leisten. War endlich die Opfermahlzeit aufgetragen, der noch allerlei Beigerichte und Leckereien hinzugethan wurden und der namentlich die Opferhirse, andre seine Hirsearten und Reiß nicht fehlen durften, so ließ man sich zum Mahle auf die am Boden ausgebreiteten Matten nieder. Von allen Speisen wurde auch den Ahnen, als ob sie leiblich noch gegenwärtig wären, ihr Antheil hingestellt.
Sie hatten aber auch ihren lebendigen Stellvertreter, – für welchen Rückert den treffenden Namen »der Todtenknabe«, als Übersetzung des chinesischen Schī, erfunden hat. Denn ein Knabe des kaiserlichen Hauses, am liebsten ein Enkel, nahm den Platz der Ahnen ein, empfing die ihnen gebürenden Ehren und wurde als von jenen gleichsam inspirirt angesehen. Er war mit dem Obergewande des von ihm besonders vertretenen Ahnherrn bekleidet, hatte einen vorzüglichen Ehrensitz, nahm an jenes Statt Speise und Trank und alle Huldigungen der Nachkommen entgegen, verkündete schließlich dem opfernden Familienhaupte die Zufriedenheit der Geister mit der Feier und verhieß ihm Glück und langes Leben.
Die ganze Feierlichkeit begleitete ein unendliches Neigen und Verbeugen, Knieen und Niederbücken, dazu Tänze oder tanzartige Umgänge, und sowol dabei wie bei verschiedenen andren Momenten der Handlung erklang Musik oder Gesang.
Bei der großen Opfermahlzeit, an welcher, dem Range nach einander ablösend, alle Anwesenden bis zu den Geringsten theilnahmen, herrschte eine anständige Munterkeit. Man trank einander zu und that Bescheid, man unterhielt sich und lachte. Der Kaiser mit seinen Nächstangehörigen scheint dabei nicht lange verweilt zu haben, denn wir wissen, daß er alsbald in einem andern Raume, wohin auch die Musik nachfolgte, sämmtliche Fürsten und Verwandte seines Hauses festlich bewirthete, wobei reichlich gegessen und getrunken wurde. Am folgenden Tage fand dann noch eine Opfermahlzeit zu Ehren des Todtenknaben statt.
Mit Recht bemerkt Legge von der in den Liedern enthaltenen Schilderung der Hauptfeier, sie sei eben so sehr die einer Gasterei als eines Opfers, und in der That seien diese großen vierteljährlichen Feste gewesen, was wir einen allgemeinen Geschlechtstag nen nen würden, an dem die Todten und die Lebenden zusammengekommen, miteinander gegessen und getrunken, die Lebenden die Todten verehrt und die Todten die Lebenden gesegnet hätten. So sehr dabei auf Würde und Anstand gehalten wurde, die auch das peinlich strenge Ceremoniel unterstützte, so war doch die Feier, ähnlich wie bei den alten Ägiptern, eine durchaus heitere, ja fröhliche, wie sich denn in der ganzen Religion der alten Chinesen nichts Finsteres oder Beängstigendes vorfindet; und daß dadurch nur der Glaube an die persönliche Unsterblichkeit erhalten, der Tod seiner Schrecken entkleidet, kindliche Ehrerbietung und Familiensinn gepflegt werden mußte, bedarf keines Nachweises.
Außer den erwähnten Hauptopfern gab es nun noch manche geringere, theils regelmäßig theils an besondre Anlässe geknüpfte, wie wenn vor einer Reise dem Schutzgeist der Wege, vor einer Schlacht dem »Vater des Krieges« geopfert wurde. Für solche Fälle waren die Feiergebräuche einfacher, obwol nicht minder bestimmt ausgebildet.
So war denn das ganze Leben jener alten Menschen mit Opfern und Gebeten durchzogen, welche ihm eine Weihe, eine Erhebung über das Gemeine ertheilten, die ihrer überwiegend für das Irdische und Praktische angelegten Natur ein wolthätiges Gegengewicht verliehen. Daß über den reichlichen Ahnen-und Geisterdiensten das reinere Gottesbewußtsein, die Verehrung des Höchsten HErrn und das Gebet zu ihm keineswegs verloren gingen, beweisen manche unserer Lieder, manche Stellen des alten Schū-kīng zur Genüge.
Sitten und Lebensweise.
Kein Volk hat ohne eine starke sittliche Grundlage jemals eine eigne Cultur entwickelt. Manche Forderungen an das sittliche Handeln gehen schon aus der Behauptung der Persönlichkeit im Zusammenleben hervor. Niemand will sein oder der Seinigen Leben gefährdet sehen, Niemand in seinem Weibe oder seinem Eigenthume geschädigt, Niemand belogen oder betrogen werden. Solche Forderungen kann man nicht an Andere stellen, ohne vom Gewissen überführt zu werden, daß man selbst sie zu erfüllen habe. Dann aber erkennt man auch, daß man dieß vor allem wollen muß, und erhebt sofort die weitere Forderung, es solle von Allen gewollt werden. Aus der allgemeinen Anerkennung dieser Forderung entsteht das Sittengesetz.
Über diesen anfänglichen Zustand finden wir die alten Chinesen bereits weit hinaus. Von dem höheren, dem edlen Menschen verlangten sie Gottesfurcht und Beobachtung heiliger Bräuche, ein reines fleckenloses Leben mit würdiger Haltung auch in der Einsamkeit, Tapferkeit und unbestechliche Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Wolthätigkeit, Wahrhaftigkeit und Rechtschaffenheit in allen Verhältnissen.
Es ist aber nicht zu verwundern, wenn unter dem Einflusse der geschilderten Religionsanschauungen die Pietät, die ehrerbietige treue Hingebung, als die erste aller Tugenden und als die Grundlage aller Tugenden anerkannt wurde. Von Uralters nahm man fünf Grundverhältnisse der Menschen an, in denen sie sich zu erweisen habe und deren pflichtgemäße Beobachtung die allgemeine Lebensordnung bedinge. Es waren dieß die Verhältnisse zwischen Obrigkeit und Unterthanen, Eltern und Kindern, Mann und Weib, älteren und jüngeren Brüdern und zwischen Freunden. Davon galt die ehrerbietige Hingebung der Kinder an Vater und Mutter (das Hiáo), die treue Sorge für sie, wenn sie gealtert waren, als das Preiswürdigste und ist bis heute ein Grundzug des chinesischen Wesens, dessen mehr als viertausendjähriger ununterbrochener Bestand wol als eine Erfüllung der Verheißung des vierten Gebotes anzusehen ist. Auch diese Eigenthümlichkeit dürfte Zustände der ältesten Menschheit fortsetzen und erklärt zugleich die hohe Verehrung, die den Vorschriften, Einrichtungen, Sitten und Vorbildern des Alterthums zugewendet wurde. Sie war ebensosehr eine kräftige Förderung des Ahnendienstes, als dieser wiederum sie in lebendiger Übung erhielt, und sie hatte die natürliche Folge, daß auch unter den Mitlebenden die Alten überall geachtet und geehrt wurden. Unsre Lieder zeigen, daß diese fromme Kindespflicht nicht bloß sittliche Forderung, sondern wirklicher Herzensdrang war. Wie oft beklagen Krieger im Felde, daß sie nun ihre Eltern nicht nähren und pflegen können, und sogar ungerathene Söhne klagen sich an, daß sie der Mutter Kummer bereiten.
Nun war es aber eine andere, gleichfalls schon alte Eigenthümlichkeit der Chinesen, möglichst Alles, auch sittliche Verhältnisse, unter gewisse unverbrüchliche Formen und Formeln zu bringen. So wir denn auch, was nur als freie Bethätigung unbegränzter Liebe Werth hat, die selbstloseste Hingebung, die bescheidenste Unterwürfigkeit des Sohnes gegen den Vater zur gesetzlich formulierten Forderung. Der Sohn ist ganz unselbständig und abhängig vom Vater, nach diesem von der Mutter, und das erstreckt sich, wenn er verheirathet ist, auch auf seine Frau. Neben dem Stammnamen erhält ein Sohn bei seiner Geburt einen Kindheitsnamen, mit dem zwanzigsten Jahre aber einen Ehrennamen, mit welchem er von da an von Anderen angeredet wird, während er auch dann, von sich selbst sprechend, aus Bescheidenheit sich wol mit seinem Kind heitsnamen bezeichnet. Ein Verstorbener erhält einen ihn ehrenden Todtennamen, mit welchem er unter den Ahnen der Familie aufgeführt wird. Beim Tode der Eltern war in alter Zeit eine einjährige, nur beim Kaiser eine dreijährige Trauer vorgeschrieben, doch wurde diese später allgemein. Während derselben mußte man sich den öffentlichen Geschäften und mancherlei Genüssen entziehen und in durchaus weißer Kleidung einhergehen. Die Unterlassung dieses Gebrauches wurde als ein Zeichen des Sittenverfalls beklagt; wie es denn freilich einen Mangel kindlicher Pietät anzeigt.
Da nur die Söhne die Familie fortsetzen und vornehmlich ihnen die kindlichen Pflichten beim Leben und nach dem Tode der Eltern zufielen, während die Töchter durch Heirath aus der Familie traten, so wurde nur auf die Geburt von Söhnen ein wirklicher Werth gelegt, Töchter fanden wenig Beachtung. Um Söhne zu erhalten, damit das Geschlecht fortdauere, war daher die Verehelichung von größte Wichtigkeit und galt allgemein als Pflicht, auch als Pflicht gegen die Vorfahren, die auch künftig der schuldigen Ehren und Opfer nicht entbehren sollten.
Schon frühe scheint man bemerkt zu haben, daß Ehen unter Verwandten und in zu großer Jugend geschlossen, schädlich seien für die Kraft und Gesundheit der Nachkommen. Die Verbindung eines Paares von demselben Familiennamen war daher unerlaubt, und obgleich dem Sohne mit dem zwanzigsten Jahre der Männerhut, der Tochter mit dem fünfzehnten die Nestelnadel feierlich übergeben wurde, um sie dadurch für Erwachsene zu erklären, so war es doch Regel, daß der Mann mit dem dreißigsten, das Mädchen nicht vor dem zwanzigsten Jahre heirathete.
Hierzu bedurfte der Mann der Einwilligung seiner Eltern, und waren sie gestorben, so wurde dieselbe von ihren Geistern an der geweiheten Stätte feierlich erbeten. Zunächst war es dann erforderlich, daß durch eine dritte Person die Werbung bei den Eltern des Mädchens angebracht wurde und diese ihre Zusage ertheilten. In der alten Zeit beruhte die Wahl selbst wol meist auf gegenseitiger Neigung; denn unsre Lieder zeigen, daß damals die Geschlechter keineswegs streng von einander abgeschlossen gewesen seien, daß vielmehr ein freier und natürliche. Verkehr unter ihnen stattgefunden habe, Liebesverhältnisse auch nicht selten gesucht, angeknüpft und bis zur Ehe fortgeführt wurden. Nach angenommener Werbung erfolgten feierliche Besuche des Bräutigams bei dem Brautvater, zuerst um die Zustimmung der Ahnen zu erwirken, dann zur Feststellung der Familiennamen, ferner zur Befragung des Looses; Geschenke für die Braut wurden übersendet; endlich durch die Weissagung ein glücklicher Tag für die Hochzeit ermittelt. Zu diesem bereitete sich das junge Paar durch Fasten und Reinigungen vor; wenn er erschien, kleideten beide sich in purpurrothe Seide und allerlei Schmuck, die Mutter that der Braut eine Schärpe um, der Bräutigam holte sie in einem besondern Wagen ab und fuhr ihr dann nach seiner Wohnung voraus. Hier empfing er sie, führte sie binein zu seinen Eltern, stellte sie den Geistern seiner Ahnen vor, und dann ward mit Verwandten, Freunden und Nachbarn ein festliches Hochzeitmahl gehalten. Später Aufzeichnungen schreiben bei dem Allen vielerlei Feiergebräuche und Förmlichkeiten vor, von denen indeß unsre Lieder kaum etwas andeuten. Wahrscheinlich nahmen dieselben mit dem Range des Bräutigams zu, reichten zum Theil aber wol nicht bis in das Alterthum hinauf. Nach einigen Liedern scheinen sie ziemlich läßlich behandelt, gelegentlich auch wol umgangen worden zu sein. Übrigens waren für die Eheschließungen auch bestimmte Zeiten im Jahre vorgeschrieben Auf die Erfüllung eines Eheverlöbnisses konnte geklagt werden, dann mußte aber auch allen herkömmlichen Bräuchen genügt sein.
Jeder Verheirathete hatte nur Eine vollberechtigte Frau, womit sich das untere Volk in der Regel begnügte. Doch waren Nebenfrauen, die dann mit einfacheren Feierlichkeiten geheirathet wurden, gestattet, ja sie gehörten bei dem Kaiser, den Fürsten und Hochgestellten zur Vollständigkeit des Hof-und Haushalts. Jedenfalls wurde nicht bloß die Versorgung der Töchter, sondern auch Zucht und Sittlichkeit durch fieses Institut befördert. Mag es aber, wie es auch noch besteht, unsern Begriffen von der Ehe widerstreben, so sollten wenigstens die nicht so entrüstet darüber auffahren, die vor der Vielweiberei des Königs David und andrer heiliger Männer des alten Testaments andächtig die Augen zuschließen. Auch war dieß Verhältniß in China schon in der alten Zeit rechtlich besser geordnet, als jemals im Volke Israel. Die Nebenfrauen waren der eigentlichen Gemahlin untergeordnet, ihre Kinder gehörten dieser und galten daher als völlig legitim. Allerdings konnte dieß Verhältniß schwere Mißstände für die erstberechtigte Gattin herbeiführen, wenn etwa eine Nebenfrau von dem Mann mehr als billig begünstigt wurde, wenn sie ihre Söhne den andern vorzudrängen wußte; allein es finden sich auch Beispiele der zärtlichsten Freundschaft zwischen der Gemahlin und einer Nebenfrau.
In dem Verhältnisse der Frau zum Manne zeigt sich, wie die kalte Härte des Gebotes vom warmen Leben menschlicher Zuneigung aufgelöst wird. Die Frau sollte zu dem Manne stets als zu ihrem »hohen Herrn« mit Ehrfurcht hinaufblicken, sie war ihm zu Unterwürfigkeit und strengem Gehorsam verpflichtet. Unsre Lieder aber geben reichliche Zeugnisse von sehr glücklichen Ehen, von dem vertraulichsten Einverständnisse der Gatten bei einer sehr würdigen Stellung der Frau, von liebevoller Anhänglichkeit bald auf der einen, bald auf der anderen Seite, und das Verlangen nach dem im Kriege oder im Reichsdienste abwesenden Manne spricht sich wiederholt auf das anmuthigste aus. Indeß wird uns auch der Tadel unwürdiger, werden uns Klagen vernachlässigter, zurückgesetzter, ja verstoßener Frauen nicht vorenthalten.
An Bildern fraulicher Beschäftigungen im Hause und für das Haus fehlt es nicht. Darin thätig und rührig zu sein, galt auch im alten China als löbliche Pflichterfüllung. So sehen wir die Frauen jedes Ranges geschäftig bei der Pflege der Seidenwürmer, bei der Anfertigung von Geweben und Kleidung, beim Einsammeln von Kräutern und Pflanzen zur Nahrung und zum Opferdienst, bei der Bereitung von Speisen, Einmachen von Früchten, und was sonst dahin gehören mag. Die Frauen der Ackerleute halfen auch bei den Feldarbeiten.
Starb der Mann, so konnte die Wittwe sich wieder verheirathen; allein es galt als preisenswerth, dieß abzulehnen, und edle weibliche Gemüther verharrten trotz alles Drängens auch dann bei ihrer Trauer und ihrer Treue.
Was die Beschäftigungen der Männer anlangt, so gedenken wir zunächst der zahlreichen Classe der Gebildeten, welche aus den Abkömmlingen der vielen Fürstenhäuser und der überaus großen Beamtenschaft hervorging, und gegenüber den Ständen der Ackerbauer, Handwerker und Kaufleute einen besonderen Stand ausmachte, sich in einzelnen Fällen auch wol aus diesen Ständen rekrutirte. Es war dieß eine Aristokratie im besten Sinne, da von jedem Gebieten den oder Vornehmen Besitz und Förderung der Bildung verlangt wurde, und im Reiche nur die Gebildetsten auch die Mächtigsten wurden. In dieser Beziehung ward zwischen den Angehörigen der Fürstenhäuser und den Söhnen der Beamtenschaft kein Unterschied gemacht. Alle widmeten sich auf irgend eine Weise dem öffentlichen Dienste im Frieden oder Kriege und mußten den Dienst von unten auf beginnen. Sie verharrten dann entweder lebenslänglich darin, oder zogen sich später auch wieder in das Privatleben zurück.
Für Anstellung und Beförderung entschied nicht das Wissen allein. Es zeugt von ächter Weisheit, daß die Tüchtigkeit des Einzelnen nach der gleichmäßigen sittlichen, geistigen und körperlichen Ausbildung geschätzt wurde. Um diese erlangen zu können, bestanden Schulen durch das ganze Reich, und zwar nach Alter Fähigkeit und Lehrgegenständen fünffach abgestufte. In die Kleinschulen traten die Achtjährigen ein, die Funfzehnjährigen in die Großschulen. Wer in diesen sich auszeichnete, wurde in das Distriktslyceum, und wer in diesem, in die hohe Fürstenschule aufgenommen. Die vorzüglichsten Schüler der letzteren erhielten in der kaiserlichen Hochschule ihre völlige Ausbildung. Nur von den beiden letzteren Anstalten ist in den Liedern die Rede; alle aber waren eben so sehr Erziehungs-, als Lehranstalten, wie dieß die Rubriken zeigen, nach denen die Abgegangenen schließlich beurtheilt wurden. Es waren dieß 1) die sechs Tugenden: Verstand, Menschenfreundlichkeit, Weisheit, Wahrhaftigkeit, Maaßhalten und Einträchtigkeit; 2) die sechs Pflichten: kindliche Ehrerbietung, Treue in der Freundschaft, gütiges Benehmen, Verwandtenliebe, Zuverlässigkeit und Barmherzigkeit; 3) die sechs Wissenschaften und Künste: die religiösen und sonstigen Gebräuche, die Musik, das Bogenschießen, das Wagenlenken, das Schriftthum, wozu alle literarische Kenntnisse und die der Schriftzeichen und Schriftarten gehörten, endlich die Arithmetik. Diesen Stücken scheint Manches ungerechnet worden zu sein, von dem wir jedoch nur unbestimmte Nachrichten haben. Das spätere Examinationswesen bestand im alten Reiche noch nicht. Man befragte das Urtheil der Lehrer und die Stimme des Volkes.
Wie wir wissen, durften die Söhne der anderen Stände an dem Unterricht in den Schulen teilnehmen; wiederum mußte auch der höhere Stand bei den eigentümlichen Besitz-und Besoldungsverhältnissen genauere Kenntnisse von der Landwirthschaft haben, auf welche der bei weitem größte Theil der Bevölkerung ebenfalls angewiesen war. Von jeher hielt man den Ackerbau hoch in Ehren. Man erkannte, daß er die Grundlage eines gesunden Volkskörpers sei, und die aufmerksame Pflege, die man ihm widmete, hatte ihn früh vervollkommnet. Der genau eingetheilte Boden wurde mit Pflug und Karst trefflich bearbeitet und für den Reiß mit Bewässerungsanlagen versehen. Die Getraidearten unterschied man sorgsam, behandelte jede ihrer Natur gemäß und reinigte die aufgegangenen Saaten fleißig von Unkraut und Ungeziefer. Nicht mindere Sorgfalt wurde der Ernte zugewendet, sowie der Aufbewahrung des Geernteten theils in Speichern, theils in Feimen. Allerlei Nutzpflanzen zur Nahrung, zu Geweben, zum Färben, wie Anil oder Indigo und Krapp, wurden gleichfalls angebaut. Es werden mancherlei Gemüse erwähnt, wie sie auch uns nicht fremd sind, Melonen und mehre Kürbißarten wurden gepflegt, Fruchtbäume, wie Kastanien, Pfirsich-, Kirschen-, Mispel-, Pflaumenbäume wurden gezogen, ebenso der Maulbeer für die Seidenzucht.
Auch die Viehzucht erfreute sich aufmerksamer Pflege. Jenseits der Ackerländereien lagen große Weidepläß für Pferde, Rindvieh, Schafe und Schweine. Zahmes Geflügel belebte die Umgebung der Wohnungen und auch an Hunden fürs Haus und zur Jagd fehlte es nicht. – Merkwürdig ist es, daß sich schon in den ältesten Zeiten der Gebrauch findet, das Eis in Kellern oder Gruben für die heiße Jahreszeit aufzubewahren, um sich dann Kühlung damit zu verschaffen.
Das Vorhandensein vielartiger Gewerbe erweist sich aus der Erwähnung ihrer Erzeugnisse. Es gab Bau-und Zimmerleute, Ziegler und Töpfer. Metalle, edle und geringere, wurden gewonnen und verarbeitet zum Gebrauch wie zum Schmuck; man kannte bereits Vergoldung. Eisen war schon vor dem zwölften Jahrhundert v. Chr. in Verwendung. Kostbare Steine wurden geschliffen und gravirt. Arbeiten aus Holz und Bambus sowie das kunstreiche Flechten von Körben und den viel angewandten Matten mußte zahlreiche Hände beschäftigen. Leder und Pelze wurden gegerlei und für mancherlei Gebrauch zubereitet. Die Färbereien lieferten ihre Produkte. Wagen und Waffen wurden hergestellt und mit allerlei Zierrath geschmückt. Musikalische Instrumente wurden verfertigt. Und so wäre noch Manches zu nennen, was einen schon beträchtlich ausgebildeten Zustand gewerblicher Thätigkeit bezeugt.
Während sich nun erklärlicher Weise in den Städten, wo Fürsten oder höhere Beamte ihre Sitze hatten, das Gewerbe sammelte, die ackerbauende Bevölkerung aber in Dörfern und Weilern seßhaft war, und doch jeder Theil sich auf die Erzeugnisse des anderen angewiesen sah, mußte sich bald, um beiden zu genügen, ein Handelsstand als Vermittler darbieten, der sich dann ebenfalls in den Städten niederließ. Geregelte Markt ordnungen, feste Bestimmungen über Münze, Maaße und Gewicht, treffliche Landstraßen waren dem Aufkommen des Handels schon in den frühesten Zeiten günstig. Indeß machten die damaligen engeren Gränzen des Reiches den Bewohnern manche Produkte wünschenswerth, welche nur im Auslande zu erhalten waren, wo man dann wiederum chinesische Waaren begehrenswerth fand. Daraus erwuchs ein Handelsverkehr in entlegenere Länder, von welchem, wie das Schū-kīng zeigt, schon im elften Jahrhundert v. Chr. die Gesetzgebung Notiz nahm.