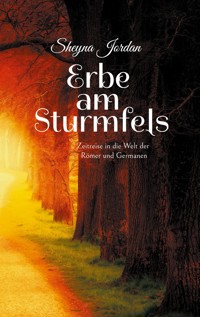Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Sturmfels
- Sprache: Deutsch
Auf der Suche nach ihrer verschwundenen Schwester verschlägt es die Archäologie-Studentin Tasha Schneider in die Welt der Römer und Germanen. Sie trifft auf einen charismatischen Fremden, der ihr in der unwirklichen und gefährlichen Umgebung beisteht. Wer ist der Unbekannte, und was wird Tasha am Ende finden?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 447
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über die Autorin:
Ich heiße Sheyna Jordan, wurde 1968 in Schotten/Hessen geboren, bin verheiratet und Mutter von drei Töchtern. Die Ahnen- und Ortsforschung ist eine meiner großen Leidenschaften.
Von Kindesbeinen an liebe ich das Genre Zeitreise und die Romantik. Da ich sehr heimatverbunden bin, reifte in mir die Idee, eine eigene Geschichte zu erzählen, unter Einbezug regionaler Gegebenheiten. Daraus entwickelte sich die Liebesgeschichte zweier aus unterschiedlichen Welten stammenden Menschen vor dem Hintergrund meiner Heimatregion und dem geschichtlichen Ereignis der Varusschlacht.
MARCUS TULLIUS CICERO
– römischer Philosoph –
(aus Briefen an Atticus)
DUM SPIRO SPERO
DUM SPERO AMO
DUM AMO VIVO
»Solange ich a tme, hoffe ich
Solange ich hoffe, liebe i ch
Solange ich liebe, lebe ich«
Inhalt
Prolog
Kapitel 1 - Tasha
Kapitel 2 - Ermin
Kapitel 3 –
Kapitel 4 –
Kapitel 5 –
Kapitel 6 –
Kapitel 7 -
Kapitel 8 -
Kapitel 9 -
Kapitel 10 -
Kapitel 11 -
Kapitel 12 -
Kapitel 13 -
Kapitel 14 -
Kapitel 15 -
Kapitel 16 -
Kapitel 17 -
Kapitel 18 -
Kapitel 19 -
Epilog
Genealogie Arminius
Genealogie Marcus
Personenverzeichnis
Ortsverzeichnis
STORNFELS ALIAS STURMFELS
PROLOG
In den ersten beiden Romanen
Band 1 »Geheimnis am Sturmfels«
Band 2 »Entscheidung am Sturmfels«
wird die außergewöhnliche Liebesgeschichte der selbstbewussten Frankfurter Polizistin Mara Schneider und des römischen Tribuns Marcus Caelius Aurelius erzählt.
Mara gerät durch Zufall in die Vergangenheit. Es verschlägt sie zweitausend Jahre in der Zeit zurück, direkt in den Konflikt zwischen Römern und Germanen – und in die Varusschlacht. Trotz aller Widrigkeiten kann sie sich erfolgreich behaupten und findet die Liebe ihres Lebens. Mit dem Römer Marcus lebt sie fortan in der Vergangenheit.
Doch plötzlich steht Maras Schwester Tasha auf ihrer Schwelle, die es auf der Suche nach ihrer verschwundenen Schwester ebenfalls in die Vergangenheit verschlagen hat.
Wie Tasha in diese Welt geraten konnte, welche Herausforderungen sie zu meistern hat, und welch schicksalshafte Begegnung ihr Leben für immer verändern wird, erfahrt ihr jetzt…
KAPITEL 1 - TASHA
Endlich! Ich habe es geschafft!
Gemeinsam mit Lando stehe ich im Haus meiner Schwester. Ich bin müde und zittere. Eine ältere Frau hat uns hereingebeten und Marcus geholt. Als er mich sieht, erkennt er mich nicht auf Anhieb. Verständlich – als wir uns zuletzt begegnet sind, hatte ich noch kurze rote Haare. Jetzt trage ich wieder meine Naturfarbe. Ein sehr dunkles Braun. Meine Haare sind auch wieder gewachsen, reichen bis zu den Schultern und sind zu einem Zopf zusammengebunden. Außerdem rechnet niemand mit mir – hier, in dieser Epoche.
Ich lächle Marcus an und spreche zu ihm in meiner Sprache – Deutsch. Es dauert ein wenig, bis es bei ihm Klick macht. Verwirrt und verblüfft zugleich fragt er: »Tasha? Du?«
Ich nicke nur kurz, denn mir versagt die Stimme. Ich bin unglaublich froh, es bis hierher geschafft und die beiden gefunden zu haben. Jetzt wird alles wieder gut.
»Wie?«, fragt er mich überrascht.
»Das ist eine lange Geschichte. Wo ist Mara?«
»Moment, ich rufe sie … Mara!«
Nur Augenblicke später taucht sie auf. O Gott, wie schön sie aussieht, und sie wirkt so glücklich. Sie trägt typisch römische Kleidung – eine helle Stola, also ein langes Kleid, das bis zu den Knöcheln reicht und in der Taille durch einen roten Gürtel gerafft ist. Am Saum ist eine Borte aus Purpur angenäht. Ihre Haare sind offen und lockig, die Brüste wirken in dem Kleid auffallend prall. Sie sieht fantastisch aus.
Als sie mich erkennt, wird sie erst blass und dann ohnmächtig. Marcus kann sie gerade noch rechtzeitig auffangen. Ihr Schock ist nachvollziehbar. Als ich in diese Zeit geschleudert wurde, erging es mir nicht anders. Es fällt mir immer noch schwer, das Ganze zu glauben.
Alles fing mit der Frage an: Wo ist meine Schwester Mara?
Sie und ihr Freund Marcus waren seit Monaten nicht auffindbar. In den Tagen vor ihrem Verschwinden fühlten sie sich beobachtet. Damals hat ein Fremder versucht, Mama über Marcus auszufragen. Als Mara zu einer Verabredung mit Mom nicht erschien und wir sie nicht auf dem Handy erreichen konnten, sorgten wir uns und informierten ihren Chef. Der nahm das ernst, denn ein solches Verhalten passt nicht zu Mara. Die Ermittlungen ergaben beunruhigenderweise, dass es sich bei dem Fremden um Anton Korber gehandelt haben könnte, der vor Kurzem aus der Psychiatrie ausgebrochen war. Er soll wiederholt massive Drohungen gegen die beiden ausgesprochen haben. Doch auch von ihm gab es nach seiner Flucht kein Lebenszeichen mehr. Was meinen Verdacht nährte, dass etwas Schlimmes geschehen sein muss.
Schließlich habe ich mir Maras Wohnung näher angeschaut und bei der Gelegenheit ihren Tresor geöffnet. Darin befanden sich Briefe an uns und an ihre Freundin Elfie. Im ersten Moment war ich wütend, denn es sah alles ganz danach aus, als wäre sie absichtlich verschwunden, ohne uns etwas zu sagen. Aber als ich den an mich gerichteten Brief las, gewann ich einen anderen Eindruck. Es war die Art, wie sie schrieb. Sie wäre nie gegangen, ohne uns noch einmal zu sehen. Außerdem enthielt der Safe einige persönliche Dinge von Paps. Die hätte sie nie zurückgelassen.
Auch der Briefinhalt hatte es in sich und war zu verrückt, um es glauben zu können.
Sie schrieb von einer Zeitreise und dass Marcus ein echter Römer sei, aus der Zeit um Christi Geburt. Das stürzte mich endgültig in Verwirrung, denn Mara war nie eine Träumerin oder Spinnerin gewesen. Vielleicht war sie auf Droge? Oder das Trauma im Tunnel hatte eine psychische Erkrankung ausgelöst?
Aber all das glaubte ich nicht ernsthaft. Auf mich hatte sie glücklich und zufrieden gewirkt. Ich verstand das alles nicht.
Nachdem ich tagelang gegrübelt hatte, ohne zu einem Ergebnis zu kommen, fasste ich einen Entschluss: Ich ging zur Ruine und den unterirdischen Gängen, die sie in ihrem Brief erwähnt hatte, in der Hoffnung, dort Hinweise auf den Verbleib der beiden zu finden. Vielleicht waren sie aus sentimentalen Gründen zur Burgfeste gegangen und erneut verschüttet worden? Der Gedanke war unerträglich, denn das konnten sie nach der langen Zeit nicht überlebt haben. Nur hätten wir dann immerhin Gewissheit.
Es dauerte eine Weile, bis ich die Ruine fand. Im Gegensatz zu Mara haben mich die Tunnel nie fasziniert. Für mein Desinteresse brachte sie kein Verständnis auf – ich hatte schließlich Archäologie studiert, also war sie der Ansicht, dass mich auch die heimischen Stätten interessieren müssten. Mich zieht es aber eher ins Ausland. Ich will Forschungen in Ägypten, Mesopotamien oder Asien betreiben. Nächsten Monat würde mich mein Professor mit nach Ägypten nehmen, zu einigen neu entdeckten Gräberfeldern. Das fasziniert mich, nicht die alten Germanen.
Dass das Angebot ausgerechnet jetzt kam, brachte mich in die Bredouille. Zum einen möchte ich Mom nicht allein lassen, sie knabbert schwer an Maras Abwesenheit, und zum anderen habe ich erst kürzlich einen netten Mann kennengelernt. Das könnte endlich etwas Festes werden. Aber sowohl Mom als auch Thomas haben mir geraten, die Chance mit Ägypten zu ergreifen.
Bevor ich aber abreiste, wollte ich dieser grotesken Geschichte aus Maras Brief auf den Grund gehen.
Und jetzt stehe ich hier, vor der Ruine. Das Tor zu den Tunneln scheint vor gar nicht allzu langer Zeit aufgebrochen worden zu sein. Bei dem Gedanken, dort hineinzugehen, gruselt es mich. Und welchen Gang soll ich überhaupt nehmen? Okay, dann – ene mene muh – nach links.
Je tiefer ich vordringe, desto lauter und heftiger werden Geräusche und Erschütterungen, die ich bereits am Eingang wahrgenommen habe. Könnte es sich um ein Erdbeben handeln? In unserer Gegend? Unwahrscheinlich. Zumindest in dieser Stärke.
Als immer mehr loses Material von der Decke bröckelt, bekomme ich es mit der Angst zu tun und will nur noch raus. In meiner Panik beginne ich zu rennen, halte instinktiv die Hände schützend über den Kopf. Trockener Staub wallt wie Nebel durch den Tunnel, und ich muss fürchterlich husten. Die Sicht ist gleich null. Dann werden die Vibrationen stärker, selbst der Boden beginnt zu wanken.
Ich habe Todesangst, und ich finde den Gang nach draußen nicht mehr. Verflucht! Meine Taschenlampe kommt nicht gegen den Staubnebel an. Fast blind haste ich den unterirdischen Weg entlang, bis ich über etwas stürze. Autsch!
O Gott, igitt. Das ist ja eine Leiche. Schnell stehe ich auf. Im Schein der Taschenlampe erkenne ich nicht viel. Nur, dass es sich um einen Mann handelt. Marcus? Nein! Der Tote ist kleiner. Er erinnert mich an den Irren, Korber, der mit Mara im Tunnel festsaß. Seine Kleidung wurde in einer Fahndung beschrieben. Ob er Papiere bei sich hat?
Nein, nein, nein! Ich werde ihn nicht durchsuchen. Bei dem bloßen Gedanken schüttelt es mich. Das soll die Polizei übernehmen.
Was, wenn auch Mara hier ist – tot? Wieder schüttelt es mich. Verdammt, ich muss hier raus!
So also muss sie sich gefühlt haben, als sie in diesem Drecksloch gefangen war. Meine arme Schwester. Ach, was sage ich denn da, ich bin nicht minder zu bemitleiden. Was ist, wenn ich von hier nicht mehr wegkomme? Niemand weiß, wo ich bin. O Gott.
Sekunden später schlägt das Schicksal zu. Etwas trifft mich hart im Genick. Ich stürze und werde bewusstlos.
Wo bin ich? Was ist passiert?
Schalte doch mal jemand das verdammte Licht an!
Nach und nach kommt die Erinnerung wieder. Dunkelheit und Hustenreiz machen mir zu schaffen, ich muss würgen und mich schließlich sogar übergeben. Was soll ich jetzt tun? Licht muss her. Verdammt, wo ist meine Taschenlampe? Nicht zu finden. Und wo ist mein Handy? Ah, hier.
Okay, das Licht ist an, aber der Akku fast leer. Tja, warum sollte es auch anders sein.
Sieht nicht gut aus. Überall liegt Geröll. Der Rückweg ist versperrt. Es gibt nur eine schmale Öffnung, einige Meter vor mir. Ich klettere auf den Schuttberg, aber das Gestein gibt nach, sodass ich nur mühevoll vorankomme. Verdammter Mist.
Nach einer gefühlten Ewigkeit, mit zerschundenen Händen und unzähligen blauen Flecken, schaffe ich es endlich, mich durch die schmale Öffnung zu quetschen. Aus der Anlage bin ich aber noch lange nicht heraus.
Einige Gänge sind vollkommen zerstört. Daher muss ich des Öfteren eine Kehrtwende einlegen und einen anderen Weg suchen. Das kostet Zeit und Kraft. Ich bin müde und muss mich dringend ausruhen. Ich habe kein Essen und kein Wasser dabei. Wer rechnet auch damit, längere Zeit in einem Tunnel festzusitzen? Werde ich hier sterben? So wie Mara? Ich beginne zu weinen und schlafe über diesen Gedanken vor Entkräftung ein.
Als ich erwache, schöpfe ich neuen Mut. Immerhin lebe ich noch. Also mache ich mich erneut auf die Suche nach einem Ausgang. Es dauert eine Weile, aber dann, endlich, ein Lichtschein. Hoffentlich fantasiere ich nicht. Nein, alles gut. Ich bin draußen. Hurra! Okay, Handy raus, Netzsuche.
Nichts!
Ist aber nicht so wichtig. Hauptsache, ich bin raus aus dem verfluchten Tunnel und habe dort drinnen nicht Maras Leiche gefunden, dann besteht noch Hoffnung. Jetzt muss ich dringend nach Hause und die Polizei informieren.
Viel Wald und kein Weg. Habe ich mich verlaufen? Verflixt, das ist vielleicht ein Scheiß. Mir tun die Füße weh, und ich habe Hunger. Ich treffe auf niemanden. Keinen Förster, Wanderer oder Mountainbiker. Da es nicht mal einen Trampelpfad gibt, gehe ich zwischen den Bäumen hindurch und muss nicht selten Umwege laufen, weil ich auf unpassierbare Stellen treffe. Zudem versuche ich seit Stunden, übers Handy jemanden zu erreichen, aber ich habe einfach kein Netz. Das macht mich wahnsinnig. Ich bilde mir bereits Geräusche ein, von Motoren oder Ähnlichem. Aber es erweist sich jedes Mal als Fehlinterpretation. Nun nehme ich wieder etwas wahr. Ob ich diesmal Glück habe? Yeah, habe ich. Ein Mann auf einem Pferd.
»Huhu, Sie da!« Laut rufend renne ich auf ihn zu und schwenke die Arme. »Können Sie mir bitte helfen?«
Er wird auf mich aufmerksam und kommt auf mich zu. Der Kerl ist groß und sieht ulkig aus, oder eher urig. Seine Kleidung wirkt archaisch, vor allem der Mantel. Es ist eher ein rechteckiges Tuch, das mit einer Gewandspange zusammengehalten wird. Damit sieht er aus wie ein – Germane. Und es wird noch seltsamer. Als er mich erreicht, brüllt er mich auf Latein an. Zuerst verstehe ich ihn nicht, dann wiederholt er seine Frage. Er will wissen, wer ich bin, und mustert mich von oben bis unten. Will der mich verarschen? Ich antworte mit einer Gegenfrage: »Was soll das? Ist das hier Versteckte Kamera?«
Der Blödmann schaut mich stumpf an. Warte. Jetzt weiß ich, was hier los ist. Das ist ein Jux. Ich lache ihn an: »Hey, alles klar. Du hast von meinen Kommilitonen den Auftrag bekommen, mir einen Streich zu spielen. Nicht wahr?«
Keine Reaktion. Er tut weiterhin so, als verstünde er kein Wort. Der Typ ist echt gut. Bleibt seiner Rolle treu. Vielleicht ein Student aus der Schauspielertruppe. Aber ein solcher Hüne wäre mir doch längst aufgefallen? Egal. Er wird sich schon noch verraten.
Da er keine Anstalten macht, mich aufzuklären, versuche ich eine andere Taktik. Ich werde ihn auf Latein zuquatschen, dann merkt er schnell, dass er eine Meisterin vor sich hat, und wird klein beigeben. »Ich bin Tasha. Wer bist du?«, sage ich lächelnd, aber er reagiert immer noch nicht. Also weiter: »Du studierst bestimmt Schauspiel, äh, Rhetorik. Ich habe dich an der Schule noch nie gesehen. Bist du neu? Woher kommst du?« Wieder null Reaktion. »Meine Freunde sind nett, aber dich hier herzuschicken, mitten in diese Ödnis, ist doch ziemlich verrückt. Sag mal, woher wusstet ihr überhaupt, dass ich hier bin? Ich weiß ja nicht mal selbst, wo genau ich bin?« Jetzt wird es unheimlich, denn damit habe ich laut ausgesprochen, was mich an dieser Situation instinktiv stört.
Sein Blick ist eigenartig. Wissend. Fast lauernd.
Ich muss hier weg. Der Typ ist vielleicht ein Irrer, ein Vergewaltiger.
Er erkennt meine Absicht und reitet direkt auf mich zu. Ich fliehe ins Dickicht. Da kommt er mit dem Pferd nicht hinterher. War ein guter Plan, nur springt er jäh von seinem Vierbeiner ab und folgt mir. Wie eine Wilde renne ich querfeldein. Ich schreie ihn an, dass er abhauen soll, dass ich die Bullen hole, aber es nützt nichts, und noch viel schlimmer: Er holt auf! Panik ergreift mich. Was soll ich tun? Ich bin keine Kämpferin wie Mara. Sie hat mir zwar ein paar Selbstverteidigungstricks beigebracht, aber das macht mich noch lange nicht zu einer Lara Croft. »Hau ab! Lass mich … in Ruhe!«, brülle ich atemlos.
O Gott, er hat mich gleich erreicht. Jetzt bekomme ich auch noch Seitenstechen. Verflucht, wäre ich nur weiter ins Training gegangen. Jetzt rächt sich meine Faulheit, ich bin eine richtig bequeme Couch-Potato geworden.
Und dann passiert es: Er packt mich von hinten und reißt mich zu Boden. Es tut weh! Grob dreht er mich zu sich um. Für den Bruchteil einer Sekunde bin ich wie gelähmt. Sein Blick, die Farbe seiner Augen, himmelblau, ziehen mich in den Bann. Er wirkt wütend, aber auch gierig, und das holt mich auf den Boden der Tatsachen zurück. Während er über mir kauert und meine Arme hart am Boden fixiert, strampele ich wie eine Verrückte. Dabei beschimpfe ich ihn aufs Übelste: »Du Drecksschwein, lass mich los … Lass mich frei … du Wichser. Sonst reiße ich dir die Eier ab!« Natürlich hilft das alles nichts. Warum sollte es auch? Als meine Gegenwehr schwindet, wird sein Griff lockerer. Das gibt mir die Gelegenheit, einen letzten Befreiungsschlag zu versuchen, und tatsächlich klappt es. Ich kann mein Knie richtig positionieren und erwische hart sein bestes Stück. Japsend und wimmernd fällt er in Embryohaltung auf die Seite. Rasch springe ich auf und renne davon. Ein kurzer Blick zurück genügt, um zu erkennen, dass er noch außer Gefecht gesetzt ist. Ich erreiche sein Pferd.
Soll ich? Warum nicht? Ich liebe Pferde und kann reiten. Wir Schneider-Mädels haben alle Reitunterricht genossen. Ich aber bin die Pferdenärrin in der Familie und nutze jede freie Minute. Also schnappe ich mir das Pferd des Fremden und gebe Fersengeld. Nur wohin? Das ist wurscht. Hauptsache weg von ihm.
Mein Weg führt mich wieder durch Wälder, baumbestandene Ebenen und Gestrüpp. Ich stoße weder auf Straßen, Dörfer, Höfe noch auf Menschen. Das ist ungewöhnlich und beängstigend. Der Akku meines Handys hat indes seinen Geist aufgegeben. Ich habe mich offenbar hoffnungslos verirrt. Kaum zu glauben, dass das in unserer dicht besiedelten Gegend möglich ist. Ich fühle mich in die Steinzeit zurückversetzt, und zu allem Überfluss bricht die Nacht herein. Die Dunkelheit kommt viel zu schnell, und weiterzureiten wäre zunehmend gefährlich. Ich binde das Pferd unter einem riesigen Baum an und beschließe, hier die Nacht zu verbringen. Mit dem Baum im Rücken ruhe ich mich aus. Morgen früh werde ich heimfinden. Ganz sicher! Das kann ja nicht so schwer sein.
Mein Magen knurrt. Positiv sehen, Tasha. Ein paar Kilos weniger schaden nicht. Und etwas Ablenkung tut jetzt auch not. Beim Blick in den sternenklaren Nachthimmel werde ich ruhiger, obwohl mir die Ereignisse des Tages durch den Kopf wirbeln. Auf die heutige Art von Spannung kann ich gut verzichten, auch wenn der Adrenalinanstieg zeitweise prickelnd war, beispielsweise bei der Begegnung mit dem Fremden. Optisch ein heißer Typ, muss ich zugeben, aber sein eigenartiges Verhalten hat mich sehr erschreckt.
Morgen bei Tageslicht sieht bestimmt vieles rosiger aus, sage ich mir. Also: Kopf hoch.
Irgendwann bin ich eingeschlafen und träume allerlei dummes Zeug. Auch der Hüne kommt darin vor. Der Traum ist viel zu realistisch. Plötzlich werde ich geschüttelt und verorte es zuerst als Teil meines Traums, aber dann öffne ich die Augen und sehe direkt in das wütende Gesicht des Kerls von gestern. Er zerrt mich mit einem Ruck auf die Füße. Mit seiner schieren Größe von deutlich über eins neunzig macht er mir Angst. Im Gegensatz zu ihm wirke ich mit meinen eins fünfundsechzig wie ein Zwerg, ich reiche ihm gerade mal bis zur Brust.
Während er mich in irgendeiner fremden Sprache anbrüllt, erstarre ich zur Salzsäule. Als er meinen panischen Gesichtsausdruck sieht und die Tränen, die ich nicht mehr unterdrücken kann, lässt er mich abrupt los. Jetzt spricht er wieder Latein, diesmal in ruhigem Ton und fast mitleidig. Er will erneut wissen, wer ich bin. Schluchzend nenne ich meinen Namen: »Tasha … Tasha Schneider.«
Als hätte er einen elektrischen Schlag bekommen, weicht er einen Schritt zurück.
»Woher kommst du?«, fragt er ausdruckslos.
»Aus Stornfels. Obwohl, ich wohne eigentlich in Gießen.«
»Wo ist deine Familie?«, geht die Fragestunde weiter.
»Ich habe nur noch meine Mutter und meine ältere Schwester Jenny. Papa ist vor einigen Jahren gestorben und meine Schwester Mara seit Monaten verschwunden.«
Warum ich so redselig gegenüber diesem Fremden bin, kann ich mir selbst nicht erklären. Wie ein Wasserfall plappere ich ihn voll, und er hört sich das Ganze völlig ruhig an, aber es kommt mir vor, als würde er mit jedem Satz blasser.
»Wie kommst du hierher?«, ist seine nächste Frage und ich antworte spontan: »Wo ist denn hier? Ich war im Tunnel, bei der Burgruine. Mara ist dort vor Monaten verschüttet worden. Ich hoffte, auf Hinweise zu stoßen, stattdessen stolperte ich über eine Leiche und wurde selbst beinahe verschüttet, als das Erdbeben losging.«
Ich verstehe mich selbst nicht. Wieso in Gottes Namen erzähle ich ihm das alles? Ich kenne ihn doch gar nicht. Hat das psychologische Gründe? Will ich ein Vertrauensverhältnis zu ihm aufbauen, damit er mir nichts tut, mich gehen lässt, aus Mitleid? Als er die nächste Frage auf mich abfeuern will, unterbreche ich ihn barsch: »Ich habe jetzt genug Fragen beantwortet! Ich will nur eins: hier raus! Kannst du mir dabei helfen? Du musst mich auch nicht begleiten. Sag mir einfach nur, in welcher Richtung ich ein Dorf oder wenigstens eine Straße finde.«
Warum rede ich eigentlich immer noch Latein? Und was ist mit ihm los? Er sieht mich ganz mitleidig an und berührt mit einer Hand sanft meine Wange. Das ist gar nicht mal unangenehm. Aber was will er?
Seine Stimme klingt mitfühlend. »Du hast keine Ahnung, nicht wahr? Du weißt es nicht.«
»Was weiß ich nicht?«, will ich genervt wissen.
»Wo du bist«, erklärt er nüchtern. Blitzmerker!
»Nein, ich weiß nicht genau, wo ich bin. Irgendwo im Vogelsberger Wald. Was soll die dämliche Frage?«
»Nicht wo, sondern eher wann«, sagt er kryptisch.
»Hä?« Ich blicke ihm direkt in seine blauen Augen, während er in meinen vermutlich riesige Fragezeichen sieht. Was meint er mit wann?
»Wann bist du geboren, Tasha?«, bohrt er weiter.
»Wieso willst du das wissen?«
»Sag schon! In welchem Jahrhundert?«
»Hältst du mich für blöd?«, erkundige ich mich gereizt.
»Nein. Du bist eine hübsche, seltsame junge Frau, die nicht weiß, dass sie in einer anderen Zeit ist«, platzt er nun mit seiner Wahrheit raus.
Was sagt er da? Das ist doch purer Stuss. Alles Blödsinn. Verarsche.
Jemand will mich zum Narren halten. Mara? Aber wieso?
»Warum machst du das? Wer hat dir den Auftrag gegeben, mir so einen Quatsch aufzutischen? Mir reicht's! Ich gehe jetzt!«
Ich drehe mich um und will einfach loslaufen, nur weg von hier, doch er hält mich am Arm fest. »Das kann ich nicht zulassen. Du kennst dich hier nicht aus. Ich kann dir Schutz bieten.«
Was glaubt er, wer er ist?
»Ich benötige keinen Schutz. Ich kann auf mich selber aufpassen«, fauche ich gereizt und reiße mich von ihm los.
Aber der Fremde lässt mich nicht gehen. Ich zucke zusammen, als er mich von hinten umfasst und mich einfach hochhebt. »Tut mir leid, aber du willst es nicht anders«, sagt er leise.
»Was? Wie? Lass mich sofort los!«, zische ich böse und strampele so heftig, dass ich ihn mehrmals hart an den Beinen erwische und er vor Schmerz aufstöhnt.
»Du bist hier nicht sicher, also kommst du mit mir«, entgegnet er unbeirrt und trägt mich zu seinem Pferd. Mühelos hält er mich mit nur einem Arm fest und wühlt mit der freien Hand in einem Beutel herum. Ich schreie ihn weiter an, aber er lässt sich nicht die Bohne davon beeindrucken. Was ist das nur für ein sturer Bock?
Ach herrje, er hat ein Seil hervorgeholt und will mich fesseln. Ich mag mir nicht vorstellen, was er mit mir vorhat. Als sein Oberarm in Reichweite ist, beiße ich kräftig zu. Vor Schmerz schreit er kurz auf und lässt mich abrupt los.
Super. Ziel erreicht. Die Chance nutze ich und renne los. Mein Herz pocht, als wollte es mir aus der Brust springen, mein Puls rast dahin wie ein ICE in voller Fahrt. Vor lauter Panik atme ich falsch, was mir erneutes Seitenstechen einbringt. Es ist, als wäre der Teufel hinter mir her. Was gar nicht so abwegig ist, denn der Fremde sprintet mir mit hochrotem Gesicht und grimmiger Miene nach. Er stolpert und stürzt – natürlich hält ihn das nicht lange auf, aber es verschafft mir einen kleinen Vorsprung.
Verdammt, er ist schneller als gedacht. Wo soll ich nur hin? Warum ist hier denn nirgends eine Menschenseele oder wenigstens eine Straße? Immer wieder schreie ich während der Hatz: »Hilfe! … Hallo … Hilfe!« Aber niemand kommt. Nur dieser Irre nähert sich unaufhörlich. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Nicht dein Ernst, lieber Gott.
Oh, da! Ich sehe ein Haus. Erleichterung steigt in mir auf. Ich schreie noch lauter um Hilfe, aber nichts geschieht. Verflucht, warum ist denn da niemand?
Die kurzzeitige Erleichterung weicht tiefer Ernüchterung. Das ist kein Haus, das ist eine armselige Hütte aus Stroh und ziemlich verfallen. Verflucht, ich habe aber auch einfach kein Glück. Als ich mich umblicke, sehe ich, wie der Hüne anhält. Ich denke nicht darüber nach, bin nur erleichtert – ich kann kaum noch laufen vor Erschöpfung, aber vielleicht finde ich ja in der Hütte einen Gegenstand, mit dem ich mich bewaffnen kann.
Die Hütte wirkt extrem baufällig. Ob ich mir damit einen Gefallen tue? Aber mir bleibt ja keine Wahl. Schnell, aber dennoch vorsichtig, betrete ich die Ruine. Igitt, überall Dreck, Spinnweben und Kot, von welchen Viechern auch immer.
Verflucht, ich bin geliefert. Nirgendwo gibt es eine Versteckmöglichkeit. Zu allem Überfluss höre ich Schritte hinter mir. Aus dem Augenwinkel heraus sehe ich die Silhouette des Fremden im Eingang. Mit seiner Präsenz scheint er das kleine Gebäude bis in den letzten Winkel auszufüllen. Als Blitz und Donner die Stille durchbrechen, zucke ich zusammen. Da kommt jetzt alles auf einmal, meine irrationale Angst vor Gewittern und dieser bedrohliche Kerl.
»Sieh es endlich ein. Ein Fluchtversuch ist zwecklos«, sagt er leise, seine Stimme duldet keinen Widerspruch.
Die Lage scheint tatsächlich aussichtslos, aber ich bin eine Schneider. So schnell geben wir nicht auf. Das hat Paps uns gelehrt. Nein, kampflos gebe ich mich nicht geschlagen!
In meiner Nähe liegt ein Brett. Er erkennt rasch, was ich vorhabe, und stöhnt genervt auf. Im selben Moment, als ich nach der behelfsmäßigen Waffe greife, ist er auch schon bei mir und schlägt sie mir aus der Hand. Aua!
»Verdammt, warum hörst du nicht einfach auf mich …«, flucht er gereizt.
Mein Fluchtimpuls ist noch nicht gebrochen. Ich versuche, an ihm vorbei zum Ausgang zu rennen, aber es ist zwecklos. Er reißt mich in seine Arme und umklammert mich, meine Brüste werden eng an seinen Körper gepresst, und ich spüre seine steinharten Muskeln. Selbst seinen schnellen Herzschlag nehme ich wahr und seinen Atem auf meiner Haut. Es kommt mir viel zu intim vor. Außerdem fällt mir das Atmen zunehmend schwer. Ich bäume mich in seinem Griff auf.
»Bei den Göttern, gib endlich auf!«
»Nein«, presse ich widerspenstig hervor.
Wieder höre ich ihn genervt aufstöhnen, und dann fühle ich einen Schlag. Dunkelheit umgibt mich …
KAPITEL 2 - ERMIN
Es sind bereits einige Vollmonde vergangen, seit mich Varus um meine Rache gebracht hat. Dieser Feigling hat es vorgezogen, sich selbst zu töten, statt gegen mich zu kämpfen.
Nun gut, wir haben gewonnen und drei römische Legionen dem Erdboden gleichgemacht. Aber das war erst der Anfang. Roms Rache wird kommen, das ist gewiss. Wir werden uns darauf vorbereiten. Viele der Stämme haben sich uns in der Schlacht im Saltus Teutoburgiensis angeschlossen und von unserem Sieg profitiert. Das werden sie wieder tun.
Die Opferungsrituale nach unserem Triumph gingen mir persönlich zwar zu weit, aber warum sollte ich den Männern ihre Genugtuung verwehren? Es gehört zu unserer Kultur und birgt auch einen entscheidenden taktischen Vorteil: Die Römer erbeben nun vor Angst, wenn sie einem Barbaren, wie sie uns nennen, gegenüberstehen. Lange Zeit haben sie uns in ihrem Hochmut unterschätzt. Jetzt wissen sie, wozu wir fähig sind, und das schadet ihrer Kampfmoral. Mara hat das nicht verstanden.
Mara! Der keltische Druide prophezeite ihr Kommen an Alban Hevin. Er sprach von einer Seherin aus der Anderswelt. Ich hielt es für Unsinn. Dennoch war meine Neugier geweckt, und er hat nicht zu viel versprochen. Sie lieferte mir wertvolle Informationen und sah meinen Sieg voraus. Zudem hatte ich mit ihrer Hilfe einige Zweifler überzeugen können, mir zu folgen.
Ob sie in Mogontiacum glücklich ist? Ich wünsche es ihr.
Bedauerlich, dass Marcus mehr Römer ist als Germane. Er hätte an meiner Seite kämpfen können. Mit unseren vereinten Fähigkeiten und dem Wissen über das römische Militärwesen wären wir unschlagbar gewesen – aber er wird Vater und will seine Familie in Sicherheit wissen. Verständlich.
Für Derartiges habe ich keine Zeit. Liebe ist nichts für mich. Sie ist nur hinderlich, macht einen Mann schwach. Obwohl – einen Augenblick lang habe ich es mir vorstellen können. Mara, diese germanische Kriegerin und Zauberin, hat Eindruck auf mich gemacht. Ihr Wissen, ihre Kampfkunst und ihre Schönheit haben mich tief beeindruckt. Was für Kinder hätte ich mit ihr zeugen können!
Noch heute verfolgt mich meine erste Begegnung mit ihr bis in meine Träume. Es ist nicht meine Art, anderen beim Liebesakt zuzusehen, aber die körperliche Vereinigung zwischen ihr und Marcus mitzuerleben, hatte Eifersucht in mir aufkeimen lassen. Lange verschüttet geglaubte Gefühle wurden geweckt. Warum musste es ausgerechnet ein Römer sein, der diesen wundervollen Körper in Besitz nahm?
Kurz hatte ich überlegt, meinen Rivalen auszuschalten. Gebracht hätte es mir nichts. Schnell war mir klar geworden, dass Maras Liebe nur ihm galt. Für ihn hatte sie ihre Welt aufgegeben und die Gefahren einer Schlacht auf sich genommen. Was für eine Frau …
Dieser Mut, diese Aufopferung, hatte mich dazu bewogen, den beiden zu helfen und ihnen die Flucht zu ermöglichen. Ich achte Mara und Marcus. Sie haben meinem Volk nichts getan. Sie verteidigten lediglich ihre Liebe und ihr Leben. Das verdient Respekt.
Ob alle Frauen aus ihrer Zeit so sind wie sie?
Vor einigen Monden habe ich den Druiden wiedergetroffen. Durch Mara wissen wir beide vom unbarmherzigen römischen Feldherrn Germanicus. Er warnte mich vor ihm und seiner beispiellosen Rache.
Warum will der Alte nicht verstehen, dass wir durch Maras Informationen Zeit gewonnen haben? Wir können uns wappnen und Pläne schmieden. Er aber ist überzeugt, dass die Prophezeiungen sich erfüllen werden, ganz gleich, welche Anstrengungen man unternimmt, und er kündigte das erneute Auftauchen einer Seherin an. Darin sollte er tatsächlich Recht behalten.
Nach all den Kämpfen und unnötigen Familienstreitigkeiten hatte ich eine Auszeit nötig. Schon als Kind habe ich mich in die Wälder zurückgezogen, wenn ich Ruhe zum Nachdenken brauchte. Der Kampf gegen meine ehemaligen römischen Verbündeten hat mich zu meinem eigenen Erstaunen ausgezehrt. Einige meiner Mitstreiter, und vor allem meine Familie, erwarten jetzt weitere Schlachten und schnelle Siege. Dafür benötigt man aber Strategien, Soldaten und Kraft.
Gegen den Willen meiner Leute zog ich mich für einige Zeit in die Einsamkeit unserer Wälder zurück. Und hier traf ich nun auf dieses seltsame Wesen, kratzbürstig und wehrhaft.
Im ersten Moment hatte mich diese wild winkende junge Frau mit ihrem dunklen Teint und fast schwarzen Haaren an eine typische Römerin erinnert, aber was sollte eine Römerin hier bei uns wollen, noch dazu ohne Begleitung?
Nein, das konnte ich mir nicht vorstellen, auch wenn sie, wie ich später feststellte, perfekt Latein sprach. Es wurde mir schnell klar, dass sie anders war. Ihre Haltung, ihre Kleidung, ihre Sprache, alles ist seltsam. Sie trägt eng anliegende Hosen, was mich an Mara erinnert, und ein ebenso eng sitzendes Oberteil, das mehr zeigt, als es verbirgt. Ihre prallen, festen Brüste zeichnen sich deutlich unter dem dünnen Stoff ab. Auf meine Frage, wer sie sei, reagierte sie zu Beginn mit Unverständnis und Zurückhaltung. Zudem sprach sie in einem mir unbekannten Dialekt.
Dann plötzlich änderte sich ihr Verhalten. Mit leuchtenden braunen Augen redete sie auf Latein auf mich ein. Ihr Name sei Tasha, und sie glaubte, dass ihre Freunde mich zu ihr geschickt hätten. Ich verstand nicht. Welche Freunde? Dass sie einem Irrtum aufgesessen war, bemerkte sie kurze Zeit später, und sofort versuchte sie zu fliehen.
So ein dummes Ding. Glaubte sie wirklich, mir entkommen zu können?
Mit meinem Pferd nahm ich die Verfolgung auf. Zugegeben: Es hat mir sogar Vergnügen bereitet, sie zu jagen und zu fangen. Als sie unter mir lag und ich sie festhielt, wirkte sie wie gelähmt. Ihre Augen, diese dunkelbraunen Augen, blickten tief in mich hinein. Ich genoss diesen Moment, ihren Duft und ihren Körper. Begierde erfasste mich. Leider war die Freude nur von kurzer Dauer, und sie schrie mich in ihrem fremdartigen Dialekt an. Kosewörter waren das sicherlich nicht. Ich hatte fast Mühe, sie zu kontrollieren, da sie sich wie eine Besessene wehrte. Allerdings schwand ihre Gegenwehr rasch, und ich glaubte schon, sie gebrochen zu haben.
Das war ein Irrtum!
Dieses kleine Aas nutzte einen schwachen, unachtsamen Moment aus und trat mir in meine empfindlichste Stelle. Bei der Erinnerung schmerzt mein Unterleib erneut. Hilflos musste ich mit ansehen, wie sie mein Pferd stahl und davonritt. Sobald ich wieder laufen konnte, folgte ich ihrer Spur. Jetzt endlich habe ich sie entdeckt.
Es ist noch früh am Morgen, und sie schläft, angelehnt an einem Baum. Obwohl ich mir beileibe keine Mühe gebe, leise zu sein, hört sie mich nicht kommen. Selbst als ich schon ganz nah bin, bemerkt sie mich nicht. Was für ein leichtsinniges Ding.
Sie wirkt entspannt und friedlich. Ein Lächeln umspielt ihre Mundwinkel. Was sie wohl träumt?
Schluss jetzt, du Narr. Was soll dieser Gedanke?
Ich beginne sie zu schütteln, aber sie erwacht nicht sofort. Das ärgert mich, daher ziehe ich sie mit einem Ruck vom Boden hoch und beschimpfe sie – ich bin immer noch wütend darüber, dass sie mir entkommen ist. Sie reißt die Augen auf und blickt mich zu Tode erschrocken an. Tränen laufen ihr übers Gesicht. Seltsamerweise rührt mich ihre Verletzlichkeit, und ich lasse sie abrupt los.
Erneut frage ich nach ihrem Namen und rechne mit Widerstand. Entgegen meiner Erwartung nennt sie ihn mir, und ich starre sie überrascht an. Tasha Schneider?
Ist es möglich, dass sie mit Mara verwandt ist? Aber Mara ist eine blonde Amazone, diese junge Frau das genaue Gegenteil: klein und dunkel.
Ich stelle ihr weitere Fragen, die sie ohne zu zögern beantwortet. Als sie ihre Schwestern dabei erwähnt, wird aus der Ahnung Gewissheit: Sie ist Maras Schwester und hat keine Ahnung, wo sie hineingeraten ist. Dumm nur, dass sie mir nicht vertraut, geschweige denn glaubt. Da ich mich merkwürdigerweise für sie verantwortlich fühle, werde ich sie mit mir nehmen und zum Druiden bringen. Er wird wissen, was zu tun ist. Nur ist dieses zänkische Weibsstück sturer als ein Esel. Sie hat wahrlich viel von ihrer Schwester. Mir ist schnell klar, dass sie freiwillig nicht mit mir kommen wird. Dann wird es eben Zeit, andere Maßnahmen zu ergreifen. Ich benötige ein Seil.
Als ich sie kurzerhand zum Pferd trage, reagiert mein Körper erneut auf ihre Nähe. Sie fühlt sich herrlich warm und weich an, und sie duftet hinreißend nach süßen Blumen. Zu meinem Pech erkennt sie meine Absicht, sie zu fesseln und wehrt sich. Sie schlägt die Zähne in meinen Oberarm. Verflucht, sie hat mich gut erwischt.
Auch diesmal nutzt sie den Moment der Schwäche und flieht. Wenn das meine Männer sähen, Spott und Hohn wären mir sicher.
Dieses kleine Biest ist schnell, aber nicht schnell genug. Während ich ihr hinterherjage, wächst von Schritt zu Schritt mein Zorn. Noch nie hat mich ein Weibsstück so genarrt. Jetzt beginnt es auch noch zu regnen, und zu allem Überfluss rutsche ich auf dem nassen Untergrund aus. Alles nur ihretwegen. Wenn ich dieses kleine Biest erwische, versohle ich ihr den Hintern, das ist das Allermindeste.
Sie will offensichtlich in mein altes Versteck. Helfen wird ihr das nicht. Es ist eine einfache, verfallene Kate. Nur ihre Lage macht sie besonders, da schwer zu finden, tief verborgen im Wald, umgeben von mannshohem Gestrüpp. Als ich eintrete, hat sie mir den Rücken zugewandt. Auf meine Aufforderung, endlich aufzugeben, reagiert sie, indem sie sich mit einem Brett bewaffnet.
Bin ich wirklich ein so angsteinflößendes Scheusal? Es reicht!
Mit wenigen Schritten bin ich bei ihr und schlage ihr das Holzstück aus der Hand. Sie gibt aber immer noch nicht auf. Als sie zur Tür flüchtet, packe ich sie und drücke sie an mich. Sie bebt und zittert und atmet schwer, wie auch ich. Sie ist so klein und zart, aber zäh. In ihrem Blick erkenne ich ihre Schwester. Den Kampfgeist jedenfalls haben die beiden gemein.
Als ich sie noch einmal auffordere, ihren Widerstand aufzugeben, und sie sich immer noch wehrt, reicht es mir. Sie will es nicht anders. Mit einem gezielten Hieb gegen ihre Schläfe schlage ich sie bewusstlos. Diesmal erhält sie keine Gelegenheit zur Flucht. Ich fessle sie an Händen und Füßen. Indes regnet es heftiger, ein Gewitter mit Sturmböen zieht auf, was unangenehme Erinnerungen weckt.
Verdammt, reiß dich zusammen.
In der Hütte sind wir geschützt, sie ist stabiler, als sie aussieht. Während ich versuche, es uns ein wenig gemütlich zu machen, beginne ich zu grübeln. Woher kommt nur diese Faszination, die ich in ihrer Gegenwart verspüre? Weil sie aus der Zukunft stammt? Oder weil sie Maras Schwester ist und mich an sie erinnert? Oder an eine andere ...
Ich kann mir keine Komplikationen in meinem Leben erlauben. Es gibt zu viele Feinde und Neider, die ich im Auge behalten muss. Eine Frau passt da nicht rein. Sie würde mich angreifbar machen.
Vielleicht sollte ich es aus einem anderen Blickwinkel betrachten und einfach etwas Spaß mit ihr haben – ein verlockender Gedanke.
Ich betrachte sie. Sie mag ein ganz anderer Typ sein als Mara, aber bei näherer Betrachtung erkenne ich Ähnlichkeiten, vor allem in ihren Gesichtszügen, in Augen, Nase und Mund.
Ihr Oberteil ist bei unserem Handgemenge hochgerutscht, und unwillkürlich fällt mein Blick auf ihren nackten Bauch. Sie ist gut genährt. Das mag ich an Frauen. Da hat man etwas in der Hand.
Verflucht, lass endlich diese Gedanken.
Sie gibt ein leises Stöhnen von sich. Lange wird es nicht dauern, bis sie erwachen wird und ihre hilflose Lage begreift. Als ich ihr Hemd herunterziehen will, beginnen ihre Augenlider bereits zu flattern, und dann blickt sie mich an. Jäh schreit sie los: »Was … was machst du da? Fass mich nicht an! Du … du Perversling.« Sie zappelt wie ein Fisch auf dem Trockenen.
»Verdammt, ich tu dir doch nichts«, wehre ich mich gereizt.
»Und warum hast du mich gefesselt?«, giftet sie zornig.
»Zu deinem Schutz!«
»Blödsinn! Du willst mich vergewaltigen!«
Sie ist sehr direkt. Das überrascht mich.
»Glaubst du, ich hab so etwas nötig?«
»Offenbar schon! Außerdem kenne ich dich nicht, und überhaupt, warum sonst hast du mich wehrlos gemacht und … mich angefasst? Du Schweinehund.«
»Es hat keinen Sinn, mit dir vernünftig reden zu wollen.« Ich gebe auf. Soll sie doch denken, was sie will. Klar könnte ich mir nehmen, was ich begehre. Es würde niemanden stören. Aber die Befriedigung meiner Lust kann ich mir zu jeder Zeit anderweitig holen, und das einvernehmlich.
Sie tobt derweil weiter und macht keinen Hehl aus ihrer Abneigung, bis plötzlich ein Blitz ganz in der Nähe der Hütte einschlägt und sie vor Schreck aufschreit. Der Knall ist ohrenbetäubend, und Tasha verstummt abrupt, rollt sich zusammen und schließt die Augen. Panische Angst erfasst ihren Körper, mit jedem Blitz erzittert und erbebt sie.
Warum nur rührt mich ihre Verletzlichkeit?
Als ich sie sachte berühre, zuckt sie heftig zusammen. Erneut brechen Blitz und Donner über uns herein, und ich ziehe sie kurzerhand in meine Arme. Leise wimmernd sucht sie von selbst den Körperkontakt zu mir. Eng presst sie sich an mich, und wieder muss ich mir eingestehen, dass es mir gefällt.
Ich streiche über ihr Haar und murmele besänftigende Worte. Jeder Donnerknall lässt sie erschauern. Ich hätte nichts dagegen, wenn das noch eine ganze Weile so weiterginge. Sie teilt diese Furcht mit vielen Germanen. Bei dem heftigen Unwetter in der Schlacht hat es mich viel Kraft und Zeit gekostet, die Krieger zu überzeugen, nicht Reißaus zu nehmen. Dass auch diese junge Frau aus der Anderswelt solche Panik davor hat, habe ich nicht erwartet. Ihrer Schwester macht Gewitter meines Wissens nichts aus.
Es ist dunkel geworden, die Nacht bricht an, aber das Unwetter tobt immer noch dort draußen. Zeitweise zerrt der Wind so stark am Dach, dass es einzustürzen droht, aber es hält stand. Die junge Frau ist derweil in meinen Armen eingeschlafen, was mich verwundert, aber als der Sturm endlich nachlässt, werde auch ich müde. Tiefe Schwärze umgibt mich.
Ich erwache, weil sie sich unruhig bewegt. »Was ist los?«
Keine Antwort. Ich halte sie immer noch in meinen Armen, nur hat sie sich leicht aufgerichtet.
Ich wiederhole meine Frage: »Was ist mit dir?«
Sie stöhnt kurz auf. »Ich muss mal … austreten … und verflucht, hör endlich auf, mit mir Latein zu reden!« Als ich unwillig knurre, ergänzt sie ungeduldig und provokativ: »Löst du jetzt meine Fesseln, oder willst du mir bei meiner Notdurft zur Hand gehen?«
Es ist noch nicht lange her, da habe ich sie getröstet, und nun beginnt sie mich wieder zu reizen.
Wortlos stehe ich auf und nehme ihr die Fesseln ab. Gleichzeitig bedeute ich ihr, sich in einer Ecke des Hauses zu erleichtern. In der Dunkelheit kann ich ihren Gesichtsausdruck nur schwerlich erkennen, aber ich höre, wie sie nach Luft schnappt, offenbar ganz und gar nicht begeistert von meinem Vorschlag. »Nein, das kann ich nicht«, flüstert sie unerwartet leise.
»Dann ist es nicht dringend«, entgegne ich gleichmütig.
»Lass mich wenigstens vor die Tür gehen«, fleht sie.
»Nun gut, aber ich bleibe bei dir.«
Wieder holt sie hörbar Luft, wispert dann aber ein kurzes »Ja.«
Sehr zögerlich verrichtet sie ihre Notdurft, während ich versuche, respektvoll Abstand zu halten. Einen Fluchtversuch scheint sie nicht unternehmen zu wollen.
Als wir wieder in der Hütte sind, binde ich ihre Hände und Füße wieder zusammen, rein vorsorglich. Sie will schon protestieren, unterlässt es aber dann, ohne dass ich etwas sagen muss. Braves Mädchen.
Eine Weile herrscht Schweigen, dann sagt sie: »Danke … Danke, dass du mir bei dem Unwetter beigestanden hast.«
Ich bin neugierig. »Woher kommt diese Angst?«
Zaghaft, aber verblüffend unverblümt berichtet sie: »Als mein Vater starb, war ich noch ein Kind. In der Nacht vor seinem Tod tobte ein schlimmer Orkan. Ein Blitz schlug im Nachbarhaus ein, es brannte bis auf die Grundmauern nieder. Seither verbinde ich mit Gewitter den Tod eines geliebten Menschen.«
Sie hat ein sehr weiches Herz. Frauen und Mädchen meiner Zeit müssen deutlich Schlimmeres ertragen und mit ansehen. Sie bemerkt mein Unverständnis und wirkt verletzt. »Verdammt, mal bist du unerwartet einfühlsam und dann wieder eiskalt … und überhaupt, ich habe keine Lust mehr, auf Latein zu reden. Hör endlich damit auf.« Sie ist gekränkt und zudem nicht willens, sich der Realität zu stellen. Aber das muss sie.
»Tasha. Sieh endlich ein, dass du nicht mehr in deiner Zeit bist.«
Sie unterbricht mich barsch: »Hör endlich auf mit dem Scheiß! Wer will, dass du mir solch einen Müll erzählst, und warum?«
Ich habe genug von ihrem Starrsinn, packe sie an den Schultern und schüttele sie kräftig. »Das ist die Wahrheit! Warum sollte ich dich belügen?«
Da wir uns in der Nähe eines Fensters befinden, fällt das Mondlicht auf ihr Gesicht. Furcht und auflodernder Trotz zeichnen sich darauf ab. Körperlich sind wir uns sehr nah. Sie atmet schwer. Ihre Brust hebt und senkt sich heftig, einzelne Haarlocken fallen wirr in ihr Gesicht. Als ich sie aus einem Reflex heraus zurückstreichen will, zuckt sie weg. Benetzt ihre Lippen mit der Zunge. Ich muss schlucken. Weiß dieses Mädchen denn nicht, wie erotisch das auf einen Mann wirkt? Was ist, wenn ich meiner Gier doch noch nachgebe? Sie hier und jetzt nehme, auch gegen ihren Willen? Dann hätte ich kurzweilige Befriedigung, aber ich will mehr.
Was? Mehr? Was soll das denn wieder? Eine Frau passt nicht in mein Leben. Schon gar nicht dieses anstrengende Exemplar. Ärgerlich presse ich hervor: »Lass das!«
»Was soll ich lassen?«, will sie wissen.
»Tu nicht so naiv. Deine körperlichen Reize ausspielen, das sollst du bleiben lassen«, entgegne ich gereizt.
»Wie bitte? Bist du bescheuert!«
Ihre Empörung ist echt. Sollte ich die Zeichen falsch gedeutet haben? Jedenfalls holt sie zum Gegenschlag aus und sagt angewidert: »Und wenn du der letzte Mann auf Erden wärst, würde ich nicht mit dir vögeln wollen.«
Also – das kann man auch anders ausdrücken. Und überhaupt – ihre Direktheit ist gewöhnungsbedürftig.
Was mich in diesem Moment packt, verstehe ich selbst nicht recht. Aber sie hat Strafe verdient. Mit einem Ruck ziehe ich sie an mich und nehme ihren Mund fordernd in Besitz. Sie ist zu überrascht, als dass sie reagieren könnte. Ihre Lippen schmecken süß, sind warm und feucht. Mit der Zungenspitze erkunde ich das Innere ihres Mundes. Mein Unterleib spannt sich, und ich bin sicher, dass auch ihr Körper auf mich reagiert.
Lange wird das aber nicht anhalten, sobald das Überraschungsmoment vorüber ist, wird sie sich wehren. Daher beende ich den Kuss so abrupt, wie ich ihn begonnen habe. Zugegeben, ich tu es nur sehr widerwillig, denn in mir brodelt ein normalerweise gut verborgener Hunger nach Leidenschaft und körperlicher Liebe. Das werde ich ihr aber nicht preisgeben. Kühl teile ich ihr mit: »Du wirst mich noch anflehen, dich zu nehmen.«
Atemlos und stumm blickt sie mich mit ihren riesigen dunklen Augen an.
Die restliche Nacht verbringen wir schweigend. Eines ist gewiss: Sie ist eine Gefahr für mich, und ich muss sie dringend loswerden. Meine Selbstbeherrschung schwindet in ihrer Nähe dahin, und seit ich von ihr gekostet habe, stehen meine Lippen, mein Körper förmlich in Flammen, lechzen nach mehr …
KAPITEL 3 –
Dieser Mistkerl hatte mich niedergeschlagen und gefesselt und vermutlich vorgehabt, mich zu vergewaltigen, aber Gott sei Dank bin ich rechtzeitig aufgewacht. Offenbar kann er es nur tun, wenn die Frau bewusstlos ist.
Außerdem geht mir das lateinische Gequatsche gehörig auf die Nerven, aber auf Deutsch reagiert er nicht, obwohl ich ihn aufs Übelste beschimpft habe. Jeder andere hätte mir den Mund mit Seife ausgewaschen. Ihn ließ es kalt.
Zu allem Pech kam mit dem Regen noch ein Gewitter. Der liebe Gott meinte es wirklich nicht gut mit mir. Das Unwetter ging gefühlt direkt über der alten Hütte nieder. Vor Blitz und Donner habe ich noch mehr Angst als vor diesem altertümlichen Riesen. Und zu meiner Überraschung hatte er beruhigend auf mich eingeredet, während ich am ganzen Leib zitterte, mit Atemaussetzern, Herzrasen und Schweißausbrüchen kämpfte. Vor lauter Angst hatte ich dumme Kuh die körperliche Sicherheit des Fremden gesucht, mich ihm regelrecht aufgedrängt. Wie peinlich! Und was tat er? Er gewährte mir seinen Schutz, und ich glaube, er hat es genossen.
Diese unerwartete Einfühlsamkeit macht ihn mir fast ein wenig sympathisch.
Oje, leide ich etwa bereits am Stockholm-Syndrom, bei dem Geiseln mit ihren Entführern zu sympathisieren beginnen? Bin ich wirklich so leicht zu beeinflussen?
Mara würde das bejahen. Wehmut kam auf. O Mara, wo bist du nur?
Was, wenn der Kerl recht hatte und ich in die Vergangenheit katapultiert wurde?
In ihrem Brief hat Mara nicht geschrieben, wie das funktioniert, nur dass die alten Tunnel die Verbindung zwischen den unterschiedlichen Epochen sind. Das wäre echt verrückt, dann wäre dieser Mann hier ein waschechter Germane – so groß und gutaussehend hatte ich sie mir gar nicht vorgestellt.
Hä? Was waren denn das nun wieder für verrückte Gedanken? Er war nur ein stinknormaler Entführer, und mich hatte es ganz sicher nicht in die Römerzeit verschlagen!
Irgendwann schlief ich über der ganzen Grübelei ein – in seinen Armen.
Es war noch dunkel, als ich erwachte und dringend Pipi machen musste. Nur – wie sollte ich das meinem Geiselnehmer sagen?
Warum stellte ich mich eigentlich so an? Es war doch ein normales menschliches Bedürfnis.
Er bemerkte meine Unruhe und verstand auch, was ich wollte. Allerdings forderte er mich doch glatt auf, in die Ecke des Hauses zu machen.
Im Haus! Vor seinen Augen! Der hatte doch einen Schaden!
Zum Glück siegte die Vernunft, und er ließ mir sogar ein Stück Privatsphäre. Natürlich dachte ich für einen kurzen Moment über die Vor- und Nachteile eines erneuten Fluchtversuchs nach. Verwarf die Idee aber. Taktisch klüger war es, ihn in Sicherheit zu wiegen und im richtigen Augenblick zu fliehen, wenn ich beispielsweise auf Menschen oder eine Straße traf. Ein guter Plan. Nur würde es dauern, bis ich eine Chance erhielt. Bis dahin hatte dieser Typ genug Zeit, um – um, wofür auch immer.
Zurück in der Bruchbude erfasste mich Katzenjammer, auch weil er mich wieder fesselte. Meinen Protest schluckte ich runter. Ich hatte beschlossen, eine Art Vertrauensbasis zu schaffen. Vielleicht hielt ihn das ja davon ab, mir etwas anzutun. Tatsächlich tat das Gespräch mit ihm gut – anfänglich zumindest. Ich erklärte ihm sogar, woher meine Gewitterangst stammte, aber der Blödmann schaffte es innerhalb von Sekunden, alles wieder kaputtzumachen. An seinem Verhalten merkte ich schnell, wie lächerlich er meine Furcht fand. Wieso hatte er mich dann überhaupt getröstet? Damit ich freiwillig mit ihm das Bett teilte?
Angenommen, er wäre wirklich ein zweitausend Jahre alter Germane, dann war er mal lieber ganz still. Denn einige seiner Kumpels, zum Beispiel die Kelten, sollen bei Blitz und Donner selbst eine irre Panik gehabt haben, dass der Himmel einstürzt.
Pah! Also, was ist dämlicher – die durchaus berechtigte Angst vor einem Blitzeinschlag oder die abergläubische Furcht, dass der Himmel einem auf den Kopf fällt?
Mich ärgerte sehr, wie er mich offenbar wahrnahm. Wir gerieten in ein hitziges Wortgefecht, und dann fing er wieder mit dem Zeitreisequatsch an. Ich machte ihm deutlich, was ich davon hielt. Er reagierte wütend und wurde handgreiflich, was mich zugegebenermaßen erschreckte. Die Krönung war sein Vorwurf, ich würde ihn anbaggern. Ausgerechnet ich! Der hatte doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Selbst wenn er der letzte Kerl auf Erden wäre, würde ich nicht mit ihm schlafen, und das sagte ich ihm auch. Na ja, ich formulierte es ein wenig drastischer. Mit dem, was dann kam, hatte ich allerdings nicht gerechnet.
Brutal riss er mich in seine Arme und zwang mir einen Kuss auf. Einen Zungenkuss. Ich erstarrte und konnte mich nicht rühren. Das Schlimmste daran: Mein Verstand wollte Gegenwehr leisten, aber mein Körper reagierte intensiv auf seine Berührung. So abrupt es begonnen hatte, endete es auch schon wieder, und dieser Mistkerl drehte den Spieß um. Eiskalt prophezeite er mir, dass ich ihn noch anflehen würde, mich zu nehmen. Der war doch völlig irre!
Ich war sprachlos, verwirrt und entsetzt. Meine Hoffnung ruhte auf Thomas und Mama. Sie würden mich bestimmt bald suchen, und dann endete endlich dieser Albtraum.
An Schlafen war jetzt nicht mehr zu denken. Noch immer fühlte ich seine Lippen auf den meinen und seine Erektion an meinem Körper. Ich wusste nicht, was mir mehr Angst machte: Das Verlangen dieses Mannes oder meine eigene verräterische Begierde.
Wir sprachen kein Wort mehr miteinander, aber er beobachtete mich – lauernd und intensiv. Offenbar glaubte er, ich würde es nicht bemerken. Ich war aber nicht minder neugierig, was sein weiteres Verhalten anging.
Frühmorgendliche Sonnenstrahlen dringen durch die unzähligen Ritzen in die Hütte. Er verlässt den Raum, vermutlich, um auszutreten. Als er längere Zeit nicht zurückkehrt, beginne ich mir Sorgen zu machen. Nicht um ihn, sondern um mich! Ich stecke in einer wirklich misslichen Lage.
Hier muss doch etwas zu finden sein, womit ich mich von den Fesseln befreien kann. Aber verdammt, nichts als Stroh und Holz. Kein Eisennagel, Scharnier oder ähnliches. Mir bleibt nichts anderes übrig, als um Hilfe zu rufen: »Hilfe! Hilfe! Hilfe …«
Wir können doch nicht die einzigen Menschen auf diesem Planeten sein, egal zu welcher Epoche? Ich bin schon ganz heiser, als ich endlich Geräusche höre. Auch auf die Gefahr hin, dass er es ist, muss ich es riskieren und brülle nun um so lauter. Ah, wie könnte es auch anders sein – er betritt die Hütte und blickt mich ärgerlich an.
»Schau nicht so!«, gifte ich ihn an. »Du hast mich zurückgelassen und bist nicht wieder aufgetaucht.«
»Wieso? Hier bin ich doch.« Sein Zorn scheint verflogen. Er wirkt eher amüsiert.
»Mach mich endlich los«, zische ich ihm zu und strample wild, soweit es mir möglich ist. Zweifelnd zieht er die Augenbraue hoch. Gereizt füge ich hinzu: »Verdammt, wie sollte ich dir schon entkommen können?«
Er kommt auf mich zu, packt mich unter den Armen, zieht mich hoch und hält mich dabei länger als nötig fest. Wieder meldet sich mein Körper, reagiert auf seine Nähe, als hätte ich einen Dauerlauf hinter mir und bekäme keine Luft. Mein Brustkorb hebt und senkt sich hektisch, und mein Entführer richtet den Blick auf meine Brüste und bedenkt mich mit einem unverschämt wissenden Grinsen. Ich reagiere so wie immer, wenn ich mich ertappt fühle: Ich erröte. Da Angriff die beste Verteidigung ist, poltere ich ungehalten drauflos, allerdings mit gesenktem Kopf: »Löse mir endlich die Fesseln! Meine Handgelenke schmerzen, und … wo warst du überhaupt so lange?«
Er lässt sich nicht beeindrucken und hebt vorsichtig mein Kinn an. Widerstand ist zwecklos, er ist stärker. Er sucht den Blickkontakt und mustert mich belustigt. Oh, wie ich ihn verabscheue.
»Ich habe uns etwas zu essen besorgt. Du hast doch sicher Hunger, oder?«
Dieses Stichwort lässt meinen Magen knurren, und er lacht laut auf.
Gleich darauf sind endlich meine Hände frei. Das Seil hat auf meiner Haut gescheuert und mir blutige Stellen eingebracht. Er sieht es und will sie mit einem dreckigen Tuch säubern. Ich jedoch entziehe mich ihm. Mit dieser Bakterienschleuder kommt er nicht in meine Nähe. Ich verwende lieber eines meiner Papiertaschentücher.
»Hast du etwas Wasser?«, will ich von ihm wissen. Er gibt mir einen mit Wasser gefüllten Lederbeutel. Sehr urig. »Und was gibt es nun zu essen?«, frage ich ihn, während ich die schmerzhaften Schürfwunden vorsichtig abtupfe.
»Ich habe noch etwas Brot und heute Morgen Beeren gesammelt«, verkündet er fröhlich.
»Ah, super. Eier und Speck wären mir lieber.« Ich verdrehe die Augen.
»Was?«
Okay, wieder auf Latein: »Danke. Das hört sich lecker an.« Er erkennt offenbar den Sarkasmus, äußert sich dazu aber nicht. Ist auch besser so.
Das Brot muss schon ein paar Tage alt sein. Es ist trocken und hart, aber wenigstens nicht schimmelig. Die Beeren sind richtig lecker. So süße Früchte habe ich schon lange nicht mehr gegessen.
Beim Essen beäugt mich der Fremde neugierig. Plötzlich fällt mir auf, dass er meinen Namen kennt, ich aber nicht seinen. »Wie heißt du eigentlich?«
»Ermin.«
»Ermin? Seltsamer Name … und wie weiter?«
»Wie … und wie weiter?«, hakt er unverständig nach.
»Na, dein Nachname.«
Seine Augen blitzen auf. »Ermin, Sohn des Segimer.«
Boah, er will ihn mir nicht nennen. Ich Dussel, das ist ja logisch. Warum sollte mir mein Entführer seine wahre Identität preisgeben? Zwischenzeitlich ist selbst mir klar geworden, dass es sich nicht um einen Streich meiner Freunde handeln kann. Hier ist etwas anderes im Gange. Vielleicht Kidnapping, mit Lösegeldforderung?
»Also Ermin, was hast du denn nun mit mir vor? Es wird kein Lösegeld geben. Meine Familie ist nicht reich.«
Erstaunt blickt er mich an, dann holt er tief Luft: »Was denkst du denn von mir?«
»Nur das Beste«, entgegne ich ironisch. Wieder holt er Luft. Er ist gereizt. Gut so.