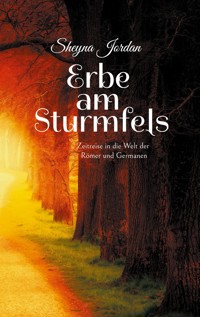Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Sturmfels
- Sprache: Deutsch
Die Frankfurter Polizistin Mara Schneider kann es kaum glauben: Der römische Tribun Marcus Caelius Aurelius ist in unsere Zeit gelangt. Sie ist glücklich über diese Schicksalsfügung. Doch Marcus plagen Schuldgefühle angesichts der Informationen, die er von ihr über die drohende Varusschlacht in seiner Welt erhalten hat. Er glaubt, seine Freunde im Stich gelassen zu haben. Mara muss eine Entscheidung treffen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 367
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über die Autorin:
Ich heiße Sheyna Jordan, wurde 1968 in Schotten/Hessen geboren, bin verheiratet und dreifache Mutter. Die Ahnen- und Ortsforschung ist eine meiner großen Leidenschaften.
Von Kindesbeinen an liebe ich das Genre Zeitreise und die Romantik. Da ich sehr heimatverbunden bin, reifte in mir die Idee, eine eigene Geschichte zu erzählen, unter Einbezug regionaler Gegebenheiten. Daraus entwickelte sich die Liebesgeschichte zweier aus unterschiedlichen Welten stammenden Menschen vor dem Hintergrund meiner Heimatregion und dem geschichtlichen Ereignis der Varusschlacht.
Inhalt
Prolog
Kapitel 1 - In salvo
(In Sicherheit)
Kapitel 2 - Wiedersehen
Kapitel 3 - Terra incognita
(Unbekanntes Land)
Kapitel 4 - Alltag
Kapitel 5 - Quo vadis?
(Wohin gehst du?)
Kapitel 6 - Entscheidung
Kapitel 7 - Novam vitam
(Neues Leben)
Kapitel 8 - In flagranti
Kapitel 9 - Rückkehr
Kapitel 10 - Vivere militare est
(Zu leben heißt zu kämpfen)
Kapitel 11 - Frust
Kapitel 12 - Dum spiro, spero
(Solange ich atme, hoffe ich)
Kapitel 13 - Vertrauen
Kapitel 14 - Aqua
Kapitel 15 - Der Weg
Kapitel 16 - Mortem et exitium
(Tod und Zerstörung)
Kapitel 17 - Ruhe in Frieden
(RIP)
Kapitel 18 - Varus
Kapitel 19 - Clades Variana
(Varus’ Niederlage)
Kapitel 20 - Ein Jahr später
(Die Zukunft beginnt, wenn der Schmerz endet)
Danksagung
Personenverzeichnis
Ortsverzeichnis
Genealogie
PROLOG
Im ersten Roman »Geheimnis am Sturmfels« beginnt die Geschichte der selbstbewussten Frankfurter Polizistin Mara Schneider. Sie gerät bei der Verfolgung des flüchtigen Verbrechers Anton Korber in weitläufige unterirdische Tunnelanlagen, die sich als Tor in die Vergangenheit erweisen.
Es verschlägt sie zweitausend Jahre in der Zeit zurück, direkt in den Konflikt zwischen Römern und Germanen und in die Wirren der drohenden Varusschlacht. Sie trifft auf den römischen Tribun Marcus Caelius Aurelius, der sie anfangs für eine germanische Spionin hält und gefangen nimmt. Erfolgreich kann sie sich in dieser archaischen Zeit behaupten und findet wider Erwarten in dem Tribun ihre große Liebe.
Doch dann werden die beiden getrennt: Mara muss mit Korber zurück in ihre eigene Zeit und Marcus allein zurücklassen. Schweren Herzens nehmen die beiden Abschied voneinander. Marcus hofft indes auf ein Wiedersehen.
Zurück in ihrer Zeit gesteht sich Mara ein, dass sie nicht mehr ohne ihn leben will, und bereitet ihre Reise in die Vergangenheit vor. Sie sammelt Informationsmaterial über die Schlacht im Teutoburger Wald und vieles mehr.
Ob Mara ihren Liebsten wiedersieht und die Liebesgeschichte der beiden ein glückliches Ende nimmt, erfahrt ihr jetzt ...
KAPITEL 1 - IN SALVO(IN SICHERHEIT)
Als ich Mara im Tunnel zurückließ, überfiel mich eine bis dahin nicht gekannte innere Leere. Eine Leere, die nichts und niemand heilen kann außer dem Menschen, der sie hinterlassen hat. Das machte mir Angst.
Angst davor, Mara vielleicht nie mehr wiederzusehen, sie niemals mehr im Arm halten zu dürfen; Angst davor, bis an mein Lebensende diesen Verlust zu spüren.
Kaum begreifbar, wie mir ein bis dahin ganz fremder Mensch in kürzester Zeit so unter die Haut gehen konnte und fester Bestandteil meines Ichs wurde.
Mara hingegen sträubte sich lange gegen die Vorstellung eines gemeinsamen Lebens in meiner Welt. Sie hat sich nur schwer an den militärischen Alltag im Castrum gewöhnen können, und als wäre diese Umstellung nicht problematisch genug, wurde sie auch noch Opfer körperlicher Gewalt.
Doch jetzt ist sie fort. Für immer?
Sie sagte zwar, sie wolle zurückkehren, aber was sollte sie dazu bewegen, ihre sichere Heimat zu verlassen? Wenn sie denn überhaupt heil dort angekommen ist.
Ich war bereits beim Tunneleingang, gemeinsam mit Tyra – einer fanatischen chattischen Seherin, die versucht hatte, beim Übergang Maras Platz einzunehmen –, als ich Maras Gesang hörte, ihre schöne Stimme. Das Lied klang traurig, zugleich aber hoffnungsvoll. Leicht wie die Federn eines Vogels. Selbst meine Freunde horchten auf. In diesem Augenblick traf ich eine Entscheidung.
Als ich Antonius die Seherin übergab, erkannte er sofort meine Absicht und schrie mir noch zu, es sein zu lassen. Rief mir hinterher, es sei zu spät, ich könne sie nicht mehr retten, aber darauf hörte ich nicht, denn ein Gedanke pochte unaufhörlich in meinem Schädel: Was, wenn es für sie keine Rückkehr in ihre Welt gibt? Dann wäre ich ihre einzige Hoffnung, wieder heil aus den unterirdischen Tunneln herauszukommen.
Ihr Gesang diente mir als Orientierung. Ich rief nach ihr, bekam aber keine Antwort. Je tiefer ich in die Gänge eindrang, umso weiter entfernte sich ihre Stimme, bis sie plötzlich ganz verstummte.
O Jupiter, hatte ich vielleicht im Dunkel eine falsche Abzweigung genommen, oder war es gar zu spät?
Die Erschütterungen wurden heftiger. Vergleichbar mit durch Erdbeben verursachte Schwankungen. Überall bröselte Gestein von Decke und Wänden. Die Fackel drohte zu erlöschen, ich konnte kaum noch etwas sehen. Das Atmen fiel mir zunehmend schwer. Ein Zurück gab es nicht, da Geröll den Rückweg blockierte.
Die Vibrationen erschütterten den Boden so heftig, dass ich mich kaum mehr auf den Beinen halten konnte. Dennoch rief ich immer wieder nach ihr, aber sie antwortete nicht. Für einen Moment schien ich zu halluzinieren. Ich glaubte Licht zu sehen und Maras Duft wahrzunehmen, als wäre sie ganz nah bei mir. Ein Trugschluss! Sie war nicht da. Und nur Augenblicke später wurde mir schwarz vor Augen.
Ich weiß nicht, wie lange ich bewusstlos gewesen bin. Nach meinem Erwachen fühle ich Schmerz – körperlichen wie seelischen. Aber wenigstens haben die Erschütterungen aufgehört. Ich lebe zwar, doch quält mich die Frage, was mit ihr geschehen ist.
Es dauert eine gefühlte Ewigkeit, bis ich das Geröll beiseiteschieben kann, und noch länger, bis ich einen Ausgang finde. Nur das mir Liebste finde ich nicht: Mara! Sie ist einfach nicht mehr da. Mein Herz ist bleischwer.
Der Tunnel hat mich wieder in den Wald geführt. Es ist aber nicht derselbe Gang, den ich gemeinsam mit Mara betreten habe. Jetzt bleibt mir nur die Hoffnung, dass sie es nach Hause geschafft hat. Damit kann ich mich abfinden, denn dann besteht wenigstens die Aussicht auf ein Wiedersehen. Schlimmer ist der Gedanke, sie könne im Tunnel verschüttet worden sein, und es gäbe keine Zukunft mehr mit ihr. Mir bleibt nichts anderes übrig, als mich auf den Weg ins Castrum zu begeben und zu warten – und zu hoffen.
Schon seltsam, der Wald ist nicht sonderlich dicht. Er wirkt eher – aufgeräumt.
Verflucht! Was ist das? Ein eigenartiges Geräusch dringt an mein Ohr. Kampfgeschrei?
Nein! Meine Neugier treibt mich in Richtung des Lärms. Ich muss wissen, was dort los ist.
Als ich an dem Ort ankomme, den ich für den Ausgangspunkt der schrillen Töne halte, ist da jedoch nichts. Nur ein Pfad, und der sieht eigenartig aus: dunkel und glatt. Er erinnert mich an den Bitumen Iudaicum. Wir nutzen dieses Pech im Straßenbau als Fugenmörtel. Hier aber ist ein sehr breiter Weg damit angelegt worden, so eigenartig rein und feinporig, wie ich es nie zuvor gesehen habe. Vermutlich eine neuartige Mischung. Allerdings kann ich mir die Germanen als Erzeuger dieses Materials nicht vorstellen.
Plötzlich nehme ich das Geräusch wieder wahr. Der grelle Ton kommt schnell näher und wird immer lauter. Etwas Großes, an dem Lichter befestigt sind, die mich blenden. Ich schütze mit den Händen meine Augen und hoffe, so das Ding besser erkennen zu können, da ertönt plötzlich Geschrei, noch lauter als der Lärm zuvor. Es klingt am ehesten nach – nach was? Nach einem wütenden Elefanten.
Ein Elefant in Germanien? Unmöglich!
Obwohl – einst hat schon einmal ein Kriegsherr diese Tiere für die Schlacht genutzt. Der Karthager Hannibal überquerte mit ihnen die Alpen und zog gegen Rom in den Krieg. Sollten die Germanen etwa Verbündete in der Provinz Afrika haben? Nein, nicht vorstellbar.
Während meiner Überlegungen hat sich der Elefant rasant genähert. Einzig ein beherzter Sprung kann mich vielleicht noch retten, wenn ich nicht von dem Tier zertrampelt werden will – zu spät!
Noch im Sprung spüre ich einen heftigen Schlag gegen die rechte Körperhälfte. Kurz bevor ich bewusstlos werde, kommt mir Mara in den Sinn. Werde ich sie je wiedersehen?
Ich erwache mit starken Schmerzen in einem weichen Bett, das in einem sehr hellen Raum steht. Meine Augen müssen sich an das grelle Licht erst gewöhnen. Etwas in meiner Nähe gibt hohe, wiederkehrende Töne ab, und ich kann mich kaum bewegen. Warum nicht? Verflucht, was ist das an meinem rechten Bein? Es sieht aus wie Gypsum.
Unvermittelt wird die Tür aufgerissen.
Männer und Frauen in weißen Gewändern erscheinen.
Bin ich tot?
Den Hades, unsere Totenwelt, habe ich mir anders vorgestellt. Ich war auch gar nicht bei Charon, dem Fährmann, der die Verstorbenen über den Unterweltfluss bringt. Ohne Obolus in Form einer Münze auch schlecht möglich.
Nein, dies ist nicht die Welt der Toten. Meine Schmerzen bestätigen es mir. Ein älterer Mann aus der Gruppe spricht mich an. Nur verstehe ich ihn nicht, daher antworte ich: »Non intelligitis.«
Überrascht blickt er die umstehenden Personen an. Dann richtet er erneut das Wort an mich, aber diesmal verständlich: »Medikus sum calidus Chris Miller ... qui es, unde venistis?«
Ah, er ist Arzt und will von mir wissen, wer ich bin. Ich stelle mich vor: »Romanus tribunatus sum calidus Marcus Caelius Aurelius.« Und frage, wo ich bin: »Ubi ego sum?«
Jetzt blicken die Anwesenden sehr verstört drein und reden untereinander erneut in einer Sprache, die ich nicht kenne. Doch halt – es klingt ähnlich wie Maras Dialekt!
Der ältere Mann ringt sichtlich um die richtigen Worte: »Tu es in hospitium ... et te accidens.«
Ich bin also in einem Hospital, weil ich einen Unfall hatte.
Der Elefant?
Jetzt unterhalten sie sich wieder untereinander, und ich verstehe rein gar nichts. Das frustriert mich.
Plötzlich wird mir übel, alles dreht sich. Ich falle zurück ins Bett. Der Medikus kommt auf mich zu. Ich spüre, dass sie mich berühren, bekomme aber nicht mehr mit, was genau sie tun. Erneut umgibt mich Dunkelheit.
KAPITEL 2 - WIEDERSEHEN
Heute rief mich meine beste Freundin an – Elfie. Sie arbeitet im Krankenhaus Schotten als Ärztin in der Unfallchirurgie. Seit einigen Wochen läge ein merkwürdiger Patient bei ihnen, erzählte sie mir. Er habe einen Autounfall gehabt. Was das mit mir zu tun habe, fragte ich sie.
Er habe ein Foto von mir dabei, gab sie zur Antwort.
Wie seltsam. Ich erkundigte mich nach seinem Namen, und sie erklärte mir, dass er keine Papiere dabeigehabt hätte und niemand seinen Namen wüsste.
Okay, das hat mich neugierig gemacht. Ich werde später im Krankenhaus vorbeifahren, um ihn mir anzuschauen, und die Gelegenheit nutzen, um mit Elfie einen kleinen Plausch zu halten. Bei Kaffee und Kuchen, in der Krankenhaus-Cafeteria. Das ist schon längst überfällig.
Wir sehen uns nicht mehr oft, wir haben beide stressige Berufe und sehr unterschiedliche Arbeitszeiten. Ich bedaure das sehr. Jedenfalls freue ich mich auf unser heutiges Treffen. Elfie war einige Zeit im Ausland und ist erst seit ein paar Tagen wieder zurück. Außerdem habe ich noch einen ganz anderen Grund, mit ihr reden zu wollen: Ich muss sie nach den Antibiotika fragen, die ich auf meiner Reise mitnehmen möchte. Ich hoffe, sie hilft mir, ohne näher nachzuhaken.
Die kleine Stimme in mir meldet sich nach langer Zeit mal wieder: Schmarrn! Sie kennt dich und wird merken, dass du etwas Blödes planst.
Als ich das Krankenhausgebäude betrete, wird mir mulmig in der Magengrube. Hier habe ich meinen Vater das letzte Mal lebend gesehen. Jetzt aber muss ich nach vorn blicken. Paps würde mich verstehen. Ganz sicher. Er wollte immer nur mein Glück, und das habe ich bei Marcus gefunden, auch wenn nun einige Wochen vergangen sind und die Erinnerung an ihn sich manchmal eintrübt und ich mich fast frage, ob all das wirklich geschehen ist. Doch immer, wenn ich zu zweifeln beginne, krame ich das Foto hervor, auf dem wir beide zu sehen sind: Ich und mein gutaussehender, einzigartiger Römer, der mich liebt, den ich liebe. Dann glaube ich ihn fast zu spüren.
Plötzlich tippt mich jemand von hinten an der Schulter an. Als ich mich umdrehe, steht da eine freudestrahlende Elfie und umarmt mich stürmisch. »Hallo Süße. Wir haben uns viel zu lange nicht gesehen.«
»Da hast du völlig recht.« Ich gebe ihr einen dicken Freundschaftsschmatzer auf die Wange. »Wo warst du überhaupt so lange?«
»Ich habe sechs Wochen in Sambia gearbeitet. In der Buschklinik eines kleinen Dorfs, das von den Good Shepard Sisters betrieben wird. Es war sehr lehrreich und hat mich ganz demütig gemacht, was unsere gute Versorgung hier betrifft ...« Sie stockt kurz, hakt sich bei mir unter und führt mich auf direktem Weg zur Cafeteria, währenddessen spricht sie weiter: »Aber das ist jetzt nicht wichtig. Du siehst verändert aus. Steckt ein Mann dahinter?«
Sie kennt mich gut und grinst mich breit an. Ich werde verlegen, und weil ich nicht gleich antworte, zwickt sie mich, so wie früher.
»Autsch.«
»Komm schon, erzähl mir von ihm!«
»Da gibt es nicht viel zu erzählen«, versuche ich mich rauszuwinden, wohlwissend, dass sie sich nie und nimmer damit zufriedengeben wird.
»Na, los! Spann mich nicht auf die Folter.«
Doch erst einmal decken wir uns mit Kaffee und Kuchen ein. Angestrengt überlege ich, was ich ihr erzählen kann – bloß nicht zu viel.
Nachdem wir uns einen Platz gesucht haben, beginne ich zögernd: »Also, er ist groß, dunkelhaarig, braune Augen. Wir kennen uns erst seit Ende Juni. Das muss wachsen.«
»Oh, Typ Südländer. Das ist gut für dich.« Sie lacht laut auf. Ihre ganz eigene, typische Art zu lachen. Es ist unglaublich ansteckend. Sie fährt fort: »Gerd war ja das genaue Gegenteil. Der passte überhaupt nicht zu dir und hat dich auch nicht verdient. Was macht der Blödmann jetzt eigentlich?«
Ich zucke mit den Schultern. »Keine Ahnung. Interessiert mich auch nicht. Vermutlich hat er sich nach der Letzten, die er nach mir hatte, schon wieder eine Neue gesucht.«
Elfie schaut angewidert drein. Sie mochte ihn nie – zu Recht.
»Jetzt komm schon! Erzähl mir mehr von deinem feurigen Südländer.« Sie lacht schon wieder auf, und ihre Augen leuchten übermütig.
Sie hat selbst jüngst eine schlimme Trennung hinter sich gebracht. Deshalb ist sie für eine Weile ins Ausland gegangen, das hatte ich noch mitbekommen. Nur ihren genauen Einsatzort kannte ich nicht, da es sich ganz kurzfristig ergeben hatte. Jetzt scheint es ihr jedenfalls viel besser zu gehen. Vielleicht steckt auch bei ihr ein neuer Mann dahinter?
Ich lenke von mir ab und hake nach: »Moment! Moment! Du bist aber auch wieder sehr vergnügt. Wer ist denn der Glückliche?« Verschwörerisch zwinkere ich ihr zu.
»Ach, du wieder.« Sie errötet verräterisch. Das passt nicht zu ihr. In mir regt sich ein Verdacht: »Och nö, Elfie. Ein Polizist?«
»Jaja, schon gut. Du hast mich immer vor ihnen gewarnt. Aber er ist anders. Glaub mir.« Sie lächelt. »Er ist ein wenig älter und geschieden. Kein junger Schnösel. Sehr erfahren. Ehrlich.« Bei den letzten Worten grinst sie wie ein Honigkuchenpferd. Ich weiß genau, was das bedeutet, und muss nun selbst schallend lachen.
»Du bist schon 'ne Marke. Ich werde dich vermissen.« Ups, jetzt habe ich mich vorzeitig verraten. Mist.
»Was soll das heißen ... Du wirst mich vermissen?« Schlagartig wird sie ernst. Da ich nicht sofort antworte, macht sie sich ihren eigenen Reim: »Liegt das an dem Südländer? Willst du mit ihm weggehen?«
»Ja«, antworte ich nur.
»Ja und was? Weit weg?«
»Ja.«
»Mensch Mara, jetzt lass dir doch nicht jedes Detail aus der Nase ziehen.«
Sie wird immer ungeduldiger, aber was soll ich ihr denn für Infos geben? Die Wahrheit ist zu verrückt. Anlügen möchte ich sie aber auch nicht. Verflucht.
Etwas zögerlich antworte ich: »Er ist ... Soldat ... im Auslandseinsatz. Ich war als Polizistin auch dort ... alles streng geheim. Kennst du doch schon aus früheren Tagen. Darf nicht darüber reden!« Ich hoffe, dass ich überzeugend genug bin. Tatsächlich ist das nicht neu für sie.
Grundsätzlich ist die deutsche Polizei zwar für die Wahrung von Sicherheit und Ordnung innerhalb Deutschlands zuständig, in den letzten Jahren kamen aber auch Beratungs- und Unterstützungstätigkeiten im Ausland hinzu, was den Aufbau von lokalen Polizeiorganisationen angeht, und vieles mehr. Elfie weiß, dass ich bei solchen Anlässen gern mitmische.
Sie schaut mich lange nachdenklich an. Grinst dann aber und bohrt nicht weiter nach. Sie kennt mich. Wenn es um meinen Job geht, kann ich verschlossen sein wie ein Grab. Wichtig ist nur, dass sie es mir abkauft.
Der Augenblick ist günstig, um sie wegen der Medizin anzuhauen. »Du, ich habe eine Frage, eher eine Bitte.«
»Okay, um was geht's?«
»Dort, wo ich hingehe, ist die medizinische Versorgung schlecht. Kannst du mir Antibiotika besorgen? So viel wie möglich?«
Wieder mustert sie mich sehr eindringlich. »Das dürfte klappen. Ich lasse meine Beziehungen spielen.« Sie zwinkert mir zu. Ich verstehe genau, was beziehungsweise wen sie damit meint. Sie hat einen Verehrer unter den Pharmahändlern, von dem kriegt sie fast alles.
Ich umarme sie stürmisch. »Super! Danke dir. Auf dich ist doch immer Verlass.« Fast verschluckt sie sich an einem Bissen ihrer Torte, nur um dann wieder vor Lachen laut loszuprusten. Das wird mir fehlen. Ihre unbändige Lebensfreude.
Sie ist auch gar nicht beunruhigt. Sie glaubt bestimmt, dass ich nur temporär abwesend sein werde. Ich lasse sie in dem Glauben. Zu gegebener Zeit werde ich ihr einen Brief schreiben und sie aufklären. Anders geht es leider nicht. Jetzt aber endlich mal zu dem Grund, weshalb sie mich überhaupt erst angerufen hat.
»Was ist das nun mit diesem Fremden, der im Besitz eines Fotos von mir ist?«
»Ich bin auch erst seit heute wieder hier, viel weiß ich nicht. Er wurde wohl vor ein paar Wochen eingeliefert. Fahrerflucht. Anfänglich lag er im Koma. Jetzt wacht er manchmal auf. Bei der gestrigen Visite wurde es unheimlich, da erwachte er mal wieder und sprach ...«
»Na, du weißt ja doch einiges über ihn«, unterbreche ich sie.
Elfie schüttelt den Kopf. »Hör dir doch erst einmal alles bis zum Ende an.«
»Sorry. Erzähl weiter.«
»Der Kerl sieht echt gut aus. Wenn du inzwischen den südländischen Typ bevorzugst, könnte er dir gefallen. Ich habe sogar einen Blick unters Laken gewagt. Sehr gut bestückt.« Bei diesen Worten grinst Elfie verschmitzt. Typisch für sie. Ihre ganz eigene Art von Humor. Ich verkneife mir ein Schmunzeln, während ich sie ungeduldig auffordere, fortzufahren: »Verdammt, Elfie, komm auf den Punkt!«
»Schon gut, schon gut. Ich will nur nicht unerwähnt lassen, was für ein Sahneschnittchen er ist.«
»Hab's kapiert. Und was genau war jetzt so seltsam an ihm?«
»Na, er sprach kein Deutsch ...«
»Und das ist so ungewöhnlich?«, unterbreche ich sie wieder. Natürlich bemerke ich sofort ihren tadelnden Blick und mache mit einer Fingerbewegung das Reißverschluss-Zeichen über meinen Lippen, was Elfie zufrieden registriert. Sie fährt fort: »Kein Deutsch, aber Latein.«
»Hä? Was? Latein?«
»Na, er sprach nur Latein. Gut, dass der Prof dabei war. Ich kann ja nur das Mediziner-Latein, aber mich auf Latein zu unterhalten ... das ist nicht meine Stärke. Es ist eben eine tote Sprache. Italienisch liegt mir da schon eher, wie du aus unserer Schulzeit sicher noch weißt. Jedenfalls, der Prof konnte es, also mit ihm auf Latein reden, aber der Patient hat schon bald darauf wieder das Bewusstsein verloren.
Neugierig, wie ich war, wollte ich Näheres über ihn erfahren. Die Schwestern erzählten mir, dass er keine Dokumente oder Papiere bei sich gehabt habe, mit Ausnahme eines Fotos. Das hat mein Interesse geweckt, und ich habe mir das Bild angesehen. Natürlich habe ich dich sofort erkannt und hoffe nun, dass du des Rätsels Lösung kennst.«
So lange habe ich Elfie noch nie am Stück reden lassen. Ich bin vollkommen in Gedanken verloren, weil sich in meinem Kopf ein irres Szenario zu entwickeln beginnt. Sie blickt mich verwundert an, da auch sie mein unüblich langes Schweigen bemerkt hat, nutzt dann aber die ungewohnte Chance und spricht munter weiter: »Auch seine Kleidung ist seltsam, eine Rüstung. Wenn ich es nicht besser wüsste, dann könnte man glauben, er wäre ein römischer Soldat. Sogar der Name passt dazu, er heißt Marcus.«
Sie lacht über ihre Schlussfolgerung, als wäre es ein Witz. Mir wird jäh schwindlig. Vor allem, als sie seinen Namen erwähnt. Mit belegter Stimme wiederhole ich: »Marcus?«
»Jep, als er erwachte, nannte er sich Tribun Marcus, blubber blubber ... Den Rest habe ich vergessen. Sorry.«
Jetzt werde ich kreidebleich. Meine Gedanken überschlagen sich. Ich schrecke auf, als Elfies Pieper losgeht.
»Sorry, Süße, aber ich muss weg.« Elfie umarmt mich eilig. »Er liegt auf der dritten Station. Frag nach Schwester Ingrid, sie weiß, dass du kommst. Er sollte längst in der Reha sein, aber die hatten noch keinen Platz für ihn frei.«
In der Tür dreht sie sich noch mal um. Ich sitze immer noch wie angewurzelt am Tisch: »Alles in Ordnung mit dir?«, fragt sie prüfend und ergänzt: »Ich weiß, du magst Krankenhäuser nicht sonderlich.«
Ich nicke und ringe mir ein Lächeln ab. Winke ihr zu und bedeute damit, dass es mir gut geht und sie gehen kann. Zum Sprechen fehlt mir gerade die Kraft.
Das kann doch jetzt nicht wahr sein? Oder doch?
Es passt alles. Ist er wirklich mit uns durch die Zeit gereist? Wenn es stimmt, hat er damit vielleicht alles durcheinandergebracht. Möglicherweise konnte ich deshalb am ersten August nicht durch das Portal? Und verdammt – er wurde angefahren, ist schon seit Wochen hier, ohne dass ich es erfahren habe. Verflucht! Ich brauche ein paar Minuten für mich. Diese Info muss ich erst einmal sacken lassen.
Als ich endlich den Mut finde, begebe ich mich in den dritten Stock. Mein Herz klopft so stark, als wollte es mir aus dem Leib springen. Ich bin extrem angespannt und nervös. Was mache ich denn, wenn er es wirklich ist?
Auf dem Flur im dritten Stock treffe ich auf eine Pflegerin. »Sind Sie Schwester Ingrid?«
»Ja«, antwortet sie freundlich. »Was kann ich für Sie tun?«
»Mein Name ist Schneider. Frau Dr. Meiser müsste mich angekündigt haben. Es geht um den Koma-Patienten.«
»Ah, ich sehe schon. Sie sind die Frau vom Foto.« Sie lächelt mich an. »Haben Sie eine Ahnung, wer er sein könnte?«
»Ich müsste ihn mir erst mal anschauen. Können Sie mir vielleicht Näheres über seinen Gesundheitszustand mitteilen?«
»Hat Ihnen Frau Meiser keine Auskunft erteilt?« Sie sieht mich skeptisch an. Doch dann wirft sie ihre Bedenken anscheinend über Bord. »Er wurde von einem Auto angefahren, hat ein Schädel-Hirn-Trauma und ein gebrochenes Bein. Inzwischen ist er aber stabil. Alles in allem geht es ihm gut. Als er gestern kurz bei Bewusstsein war, haben wir ihn von den Apparaten getrennt. Die hat er nicht mehr nötig. Was allerdings seltsam ist: Er sprach nur Latein ... Durchaus möglich, dass das am Unfall lag. Tatsächlich gibt es solche Fälle, die als Fremdsprachen-Akzent-Syndrom, kurz FAS, bezeichnet werden. Das ist aber extrem selten und meist nur temporär ...« Sie will noch etwas sagen, wird aber von einer anderen Schwester zu einem Notfall gerufen. »Er liegt in Zimmer dreihundertdrei«, sagt sie eilig. »Sie kommen sicherlich allein zurecht. Wenn Sie noch Fragen haben, finden Sie mich später im Schwesternzimmer.«
Ich nicke ihr zu, und schon ist sie weg.
Ich hasse Krankenhäuser. Ich mag die grau-weißen und meist bilderlosen Wände nicht und schon gar nicht den Geruch – er erinnert mich an den Tod.
Als ich die Tür des Zimmers öffne, rast mein Puls, und mir ist übel. Ich bin aufgeregt, frage mich, was – beziehungsweise wen – ich gleich erblicken werde. Aber ich sehe – nichts.
Das Bett befindet sich im toten Winkel des Raums, direkt hinter der Tür. Endlich ist die Sicht frei, doch es liegt niemand darin. Ich schaue noch mal auf die Zimmernummer, die ist aber korrekt. In dem Moment, als ich wieder hereinkomme, werde ich von hinten attackiert. Mittels eines gekonnten Schulterwurfs schleudere ich meinen Angreifer zu Boden. Er stöhnt vor Schmerz auf. Auch wenn ich erwartet habe, das vorzufinden, was ich sehe, ist es ein Schock. Es ist wirklich ... »Marcus!«
»Mara?«
Er schaut mich vom Boden aus fassungslos an, hilflos wie ein Käfer, der auf dem Rücken liegt. Ich ziehe ihn vorsichtig hoch, während er sein Gipsbein humpelnd hinter sich herzieht, und bringe ihn zum Bett. Als sich unsere Blicke treffen, spiegeln sich Freude und Ungläubigkeit in seinen Augen wider. Er ergreift als Erster das Wort. »Wo bin ich hier? Ist das deine Welt?«
»Ja.«
»Ich wollte dich im Tunnel retten. Dachte, du wärst verschüttet worden, bevor du überhaupt zurück nach Hause hättest gelangen können. Aber dann hat mich ein Elefant niedergetrampelt«, erklärt er mir bedrückt.
»Ein Elefant?« Ich muss lächeln. Er hat noch nie ein Auto live gesehen, nur in meinen Filmen auf dem Handy.
»Lachst du mich etwa aus?«, will er entrüstet wissen.
»Nein, nein. Du musst noch viel lernen. Diese Welt ist laut und hektisch und ganz anders als die, die du kennst.«
»Lass uns gehen.« Er steht auf und macht Anstalten, humpelnd das Zimmer zu verlassen.
»Halt!«, rufe ich. »Du kannst hier nicht einfach rausgehen. Außerdem hattest du einen schlimmen Unfall.«
»Mir geht es gut. Ich will hier weg. Weg von diesen ... Geistern.« Er klingt fast ein bisschen ängstlich und schüttelt sich unmerklich.
»Wie meinst du das?«
»Das ist nicht wichtig. Bring mich einfach nur hier raus, oder ich gehe allein«, fordert er mich auf. Unter der Drohung liegt Verzweiflung.
»Hör zu, übe dich bitte noch etwas in Geduld. Ich komme heute Abend wieder, und dann nehme ich dich mit. Jetzt wäre es zu auffällig. Ja?« Ich sehe ihn eindringlich an.
»Warum kann ich nicht sofort mit dir gehen?«, will er trotzig wissen.
»Weil der Verdacht direkt auf mich fiele.« Langsam gehe ich auf ihn zu, nehme sein Gesicht zwischen die Hände und sehe ihn zärtlich an. »Ich verspreche es dir. Ich hole dich ab. Vertrau mir.«
Er nickt und seufzt tief.
Seine Nähe tut unglaublich gut. Sein Blick wirkt verklärt. Er umfasst meine Taille und zieht mich dicht an sich, unsere Lippen vereinen sich zu einem Kuss. Wieder stöhnt er auf, während ich mich noch dichter an ihn dränge. Es ist ein gutes Gefühl, ihn wieder zu spüren.
Nicht zu fassen, dass er in meiner Zeitlinie ist.
»Du kratzt! Du brauchst eine Rasur«, teile ich ihm schmunzelnd mit, als wir uns voneinander lösen.
Er reibt sich den Bart und sieht mich mit seinem typischen gewinnenden Lächeln an – zum Dahinschmelzen. Das habe ich so vermisst.
»Mara?«
»Ja?«
»Ich verstehe hier vieles nicht. Aber als Erstes wäre ich einfach nur froh, zu erfahren, wo ich mich erleichtern kann?« Beschämt blickt er zu Boden.
»Kein Problem.« Ich ziehe ihn in Richtung des kleinen Bads und erkläre ihm die Toilette, die Wasserspülung und das Bedienen der Wasserhähne am Waschbecken. »Es ist gar nicht so anders als in deiner Zeit. Nur etwas moderner.«
Er staunt über die Einfachheit und Effektivität der Toilette, und da er keine Hemmungen kennt, benutzt er sie sogleich. Hastig verlasse ich den kleinen Raum. Bei seiner Rückkehr strahlt er mich an, aber seine Freude findet ein jähes Ende, als ich ihm sage, dass ich ihn nun verlassen muss.
»Ich komme wieder. Schau mal, da ist eine Uhr, ähm ... ein Zeitmesser. Heute Abend um zehn hole ich dich ab.«
Er versteht mich offensichtlich nicht. Verdammt, es sind natürlich keine römischen Ziffern. Hastig erkläre ich ihm unsere lateinische Zeit, und er lernt rasch. Als ich gehen will, zieht er mich erneut in seine Arme, und auch wenn es mir schwerfällt – ich kann nicht bleiben.
»Marcus, ich muss jetzt wirklich weg. Jeden Moment kann eine Schwester oder ein Arzt hereinkommen, und ich will unangenehmen Fragen zum lateinisch sprechenden Patienten, den ich so innig küsse, lieber aus dem Weg gehen«, erkläre ich schmunzelnd. Ich küsse ihn noch einmal, bevor ich mich schweren Herzens aus seiner Umarmung löse, was er mit einem tiefen, bedauernden Brummen quittiert.
»Leg dich besser wieder ins Bett und tu so, als seist du noch bewusstlos. Dann lassen sie dich in Ruhe.«
Sein Blick spricht Bände. Er wirkt verloren, aber ich muss ihn jetzt verlassen. Ich werfe ihm noch einen Luftkuss zu und breche auf. Gerade noch rechtzeitig, denn Schwester Ingrid steht vor der Tür und schaut mich neugierig und fragend an.
»Nein, tut mir leid, ich kenne den Mann nicht. Auf meine Fragen hat er auch nicht reagiert. Ich habe ein Foto von ihm gemacht und schaue mir mal unsere Vermissten-Kartei an. Vielleicht haben wir Erfolg. Ich muss jetzt los. Richten Sie bitte Frau Dr. Meiser schöne Grüße von mir aus.«
Sie lächelt mich freundlich an und nickt. »Werde ich machen. Und halten Sie uns bitte auf dem Laufenden.«
»Mach ich. Auf Wiedersehen.«
Als ich das Gebäude verlassen habe und in meinem Wagen sitze, hole ich tief Luft. Ich kann nicht fassen, dass er hier ist! Was für eine Wendung des Schicksals. Das könnte die Lösung für mich sein – für uns. Ich müsste keine Rückkehr in seine Zeit planen, zumal gar nicht sicher ist, dass ich zum selben Ausgangszeitpunkt zurückgekehrt wäre. Und außerdem ist es in meiner Welt viel angenehmer und gefahrloser, auch für ihn. Und Familie hat er nicht, die er vermissen könnte oder die ihn vermisst.
In mir macht sich Euphorie breit. Nur ist jetzt noch einiges zu organisieren. Und er sollte schnellstens unsere Sprache erlernen. Zudem muss er wissen, wie man die alltäglichen Gerätschaften benutzt und noch vieles mehr. Aber noch viel dringender: Er braucht Papiere! Und ich habe auch schon eine Idee, wer mir dabei behilflich sein könnte.
Jedenfalls werde ich ihn heute Nacht holen. Das ist gar nicht schwer. Über den Nebeneingang der Klinik gelangt man direkt zu den Fahrstühlen und zum Treppenhaus. Ich muss an keinem Pförtner vorbei, und abends wird da nicht mehr viel los sein.
Meine kleine Zweiflerstimme meldet sich, mahnt mich, dass eine Flucht schon heute Abend keine gute Idee sei. Ich weiß nicht, wie gut es ihm schon wieder geht, außerdem könnte man schnell darauf kommen, dass ich etwas damit zu tun habe. Aber ich habe es ihm doch versprochen ...
KAPITEL 3 - TERRA INCOGNITA(UNBEKANNTES LAND)
Nicht zu glauben! Ich bin in Maras Welt.
Nachdem ich erneut in dem weißen Raum erwacht war, galt mein einziger Gedanke der Flucht. Die weißen Geister haben mir Angst gemacht, obwohl ich mich wirklich nicht leicht fürchte.
Als Mara den Raum betrat, erkannte ich sie nicht auf Anhieb. Ich war ausschließlich auf mein Entkommen fokussiert. Als ich sie dann wirklich ansah, konnte ich mein Glück kaum fassen. Sie wirkte so frisch, so lebendig, so wunderschön, und so fühlte sie sich auch an. Nur verstehe ich nicht, warum ich nicht sofort mit ihr gehen durfte. Ich soll auf die Dunkelheit warten und auf den seltsamen Zeitmesser achten. Ich vertraue ihr, daher tu ich, was sie von mir verlangt, trotz meiner Zweifel.
Bisher habe ich von ihrer Welt nicht viel gesehen. Nur dieses Zimmer, das auch die Latrine beinhaltet. Selbst der Kaiser würde über einen solchen Luxus staunen. Das gilt auch für die Apparaturen zum Händewaschen: Man dreht an zwei Knöpfen, und kaltes wie auch warmes Wasser beginnt zu fließen. Und diese große Wand aus klarem Speculum in dem Raum, in dem das Bett steht. Das Glasfenster ist riesig und dermaßen durchsichtig, dass man annehmen könnte, es wäre gar nicht da, und wenn man hinausblickt, sieht man nur Wald.
Immer wieder höre ich schrille Töne und schnelle Schritte vor der Tür. Manchmal laute Stimmen. Auch meine Tür öffnet sich hin und wieder. Es schaut fast immer dieselbe Frau nach mir, und bei einem ihrer Besuche, die ansonsten nur ganz kurz sind, entfernt sie den Gypsum an meinem Bein. Es fällt mir irrsinnig schwer, sie einfach gewähren zu lassen. Aber Mara wies mich an, mich schlafend zu stellen – und ich halte mich an ihre Anweisung. Nun warte ich sehnsüchtig darauf, dass die Zeit vergeht und sie mich holen kommt. Immer öfter, immer unruhiger blicke ich auf den Zeitmesser.
Dann ist es endlich soweit, doch – sie ist nicht da. Die vereinbarte Zeit ist längst überschritten, und sie taucht nicht auf. Was soll ich machen? Weiterhin auf sie warten? Vielleicht will sie mich gar nicht mehr holen kommen? Ich bin für sie doch nur eine Belastung.
Plötzlich höre ich Schritte, und es betritt jemand den Raum. Vermutlich ist es dieselbe Frau, die den ganzen Tag bereits immer mal wieder nach mir gesehen hat. Ich stelle mich erneut schlafend. Das passt mir so langsam alles gar nicht mehr. Bitte Mara, komm!
Ich wage kaum noch zu hoffen, doch da höre ich, wie sie leise meinen Namen sagt: »Marcus?«
Mara hat ihr Versprechen gehalten. Ich bin erleichtert und glücklich.
»Ich dachte schon, du würdest mich nicht mehr holen«, flüstere ich leicht vorwurfsvoll.
»Das hast du gedacht? Nie und nimmer würde ich dich allein lassen!« Sie gibt mir einen flüchtigen Kuss. »Jetzt komm! Ich habe dir ein paar Kleidungsstücke besorgt. Zieh sie bitte schnell an.«
Ich tue, wozu sie mich auffordert. Nur bin ich noch etwas steif. Das lange Liegen und auch mein gerade erst verheiltes Bein fordern ihren Tribut. Aber die Kleidung ist unerwartet bequem, vor allem die blaue Bracca, mit der mir Mara behilflich ist, indem sie sie mir vorsichtig über die Beine zieht.
Nachdem ich fertig angezogen bin, registriere ich ihren intensiven Blick. Das verunsichert mich.
»Was ist? Habe ich etwas falsch gemacht, oder sehe ich komisch aus?« Ich blicke an mir herunter. Als ich wieder zu ihr aufschaue, grinst sie mich an.
»Nein! Ganz im Gegenteil. Du siehst verdammt gut darin aus.«
Dieses Kompliment gefällt mir, und muss sie spontan an mich ziehen.
»Dafür haben wir keine Zeit«, raunt sie.
Aber ich bemerke sehr wohl, dass ihr Körper etwas anderes möchte. Dieser erste intensive Kuss bringt all die Leidenschaft zurück, die ich vermisst habe. Ich begehre diese Frau. Ich liebe sie, und nun bin ich bei ihr.
Mara löst sich stöhnend aus meiner Umarmung, späht in den Flur hinaus und zieht mich dann aus dem Zimmer, ohne ein weiteres Wort zu verlieren.
Wir müssen einige Treppen abwärts steigen. Das ist anstrengend für mich, denn meine Muskulatur ist noch schwach. Mara hilft mir, indem sie mich stützt.
Als wir das Gebäude endlich verlassen haben, führt sie mich zu einer der pferdelosen Kutschen, die sie mir in ihren Filmen schon gezeigt hat. Sie öffnet die Tür und bedeutet mir, dass ich mich hineinsetzen soll. Dann bindet sie mich mit einem Riemen fest, der quer über meiner Brust verläuft. Auf meine Frage nach dem Warum antwortet sie nur knapp: »Zur Sicherheit.«
Es ist alles neu für mich. In dem seltsamen Gefährt schimmern Lichter auf, die bunt und wild leuchten. Geistermusik ertönt von irgendwoher, und dann ein tiefes Brummen, als Mara irgendetwas mit Händen und Füßen tut und dieses Monster urplötzlich zu leben beginnt.
Als es sich in Bewegung setzt, kralle ich mich unwillkürlich am Sitz fest. Und dann wird es immer schneller. Die Lichter der Kutsche leuchten zwar den Weg aus, aber bei der Geschwindigkeit, mit der wir durch die Dunkelheit rasen, wird mir schwindelig und übel. Ich schweige, um Mara nicht abzulenken, denn wer weiß, was das Monster dann macht.
Mara ist es, die schließlich das Wort ergreift: »Marcus? Geht es dir gut?«
»Ehrlich gesagt ... mir ist übel«, quetsche ich hervor.
»Oh ...« Abrupt wird das Gefährt langsamer. »Tut mir leid. Ist die Geschwindigkeit so besser?«
»Es geht.« Das ist nicht die ganze Wahrheit. Mir ist es immer noch zu schnell, aber sie soll nicht denken, dass ich schwach bin.
Ab und zu fahren andere Kutschen sehr rasch an uns vorbei. Ihre Fahrer scheinen ungehalten zu sein. Mara lässt sich davon aber nicht beirren. Das ist auch gut so, denn die Fahrt in diesem eigenartigen Fortbewegungsmittel verstört mich zutiefst. Ich nehme daher nur wenig von der Umgebung wahr. Achte kaum auf Häuser oder andere Dinge, an denen wir vorbeifahren.
Nach einer gefühlten Ewigkeit ruft sie freudestrahlend: »Wir sind da!«
Ich bin heilfroh, dass ich das monströse Gefährt endlich verlassen kann. Dafür benötige ich allerdings erneut Hilfe, denn ich bekomme den Riemen über meiner Brust nicht gelöst und die Tür nicht geöffnet. Mara hilft mir geduldig.
Endlich befreit aus den Klauen dieses Ungetüms, steige ich aus und sehe, dass Lampen den Weg zu einem hübschen kleinen Haus ausleuchten. Eine steile Treppe führt direkt zu einer Tür. Mara geht voran, dabei hält sie mich fest an der Hand.
Endlich im Haus angekommen, übermannen mich erneut viele Eindrücke. Mara drückt überall auf irgendwelche flachen, schrägen Erhebungen in der Wand, woraufhin Lichter an- und ausgehen. Als sie mein Erstaunen bemerkt, ist sie sehr bemüht, mir alles zu erklären. Da es auf Latein nicht immer adäquate Begriffe gibt, benennt sie es in ihrer Sprache. Ich muss es sowieso lernen. Zum Glück besitze ich eine gewisse Sprach-Begabung und lerne schnell. Auch, dass es sich bei diesen Erhebungen um Lichtschalter handelt. Ein seltsames Wort.
»Möchtest du etwas trinken? Oder hast du Hunger?«, will sie von mir wissen und beäugt mich neugierig.
»Nein, danke. Ehrlich gesagt, bin ich erschöpft. Wo kann ich mich ausruhen?«
»Natürlich«, sagt sie verständnisvoll. »Komm mit.«
Wir gehen ein Stockwerk höher. Dort befindet sich ein Schlafraum mit einem sehr großen und gemütlich wirkenden Bett. Sie gibt mir eine dünne Bracca für die Nacht – sie nennt es eine Hose –, dann erklärt sie mir erneut, wie man die Lichter an- und ausschaltet, wo ich die Latrine, also das Bad, finde, und wo ich mir etwas zu trinken und zu essen holen kann, sollte ich nachts wach werden.
Während ich mich umziehe, schaut sie mich nachdenklich an. Erwartet sie von mir etwas Bestimmtes? Ich würde die heutige Nacht gern mit ihr verbringen, aber ich bin zu kraftlos und glaube nicht, ihr gerecht werden zu können.
»Tut mir leid«, murmle ich bedauernd.
»Hm? Was?« Sie wirkt überrascht.
Da sie direkt vor mir steht, nehme ich sie zärtlich in den Arm. »Ich würde dich jetzt nur zu gern nach allen Regeln der Kunst verführen ...« Ich stöhne kurz auf, als ich sehe, wie sie ihre Lippen benetzt. »Aber ich fühle mich noch zu schwach, um dir heute ein guter Liebhaber sein zu können.«
Sie blickt mich erstaunt an. »Dafür haben wir noch alle Zeit der Welt.« Sie lacht. »Ich kann einfach noch nicht fassen, dass du hier bist.«
Sanft, aber bestimmt drückt sie mich auf die weichen Laken des Betts und deckt mich zu.
»Legst du dich nicht zu mir?«, frage ich verwundert.
»Doch, natürlich. Ich muss aber zuvor noch einen, äh ... Anruf tätigen.«
Was ist ein Anruf? Ach, unwichtig. Bevor sie mich verlässt, gibt sie mir einen Kuss auf die Stirn und flüstert: »Versuch zu schlafen. Ich komme bald nach.«
Es dauert nicht lange, und ich bin im Land der Träume. Aber sie sind unangenehm. Ich höre Antonius nach mir rufen. Und immer wieder sehe ich tote Legionäre und viel Blut. Zeitweise nehme ich wie durch einen Nebelschleier eine weibliche Stimme wahr, die beruhigend auf mich einredet.
Als ich erwache, bemerke ich erschrocken, dass Mara nicht an meiner Seite ist. Ich rufe nach ihr, aber sie antwortet nicht. Innerlich mahne ich mich zur Ruhe, denn allzu weit kann sie nicht sein.
Es ist ein warmer Morgen, und es duftet herrlich. Der Geruch kommt aus dem unteren Stockwerk. Etwas wackelig auf den Beinen verlasse ich das Bett und gehe zuerst zum Fenster, denn von dort vernehme ich plötzlich Geräusche, und da sehe ich sie auch schon, wie sie halbnackt in ein kleines, in den Boden eingelassenes Natatio springt. Es ist eckig und mit blauem Wasser gefüllt.
Mara ist eine Augenweide, wunderschön, sehr grazil. Ihr Anblick weckt meine Lebensgeister. Ich muss zu ihr. Doch zuvor will ich mich in ihrem Haus etwas umschauen. Gestern Nacht habe ich es mir nicht näher ansehen können. Jetzt nehme ich alles bewusster wahr.
Familienbilder säumen die Wand des Treppenaufgangs. Einige davon kenne ich bereits. Mara hatte kleinere Pergamente davon in ihrem Lederbeutel, als sie in meiner Welt war.
Im unteren Stockwerk befindet sich gegenüber dem Zimmer mit der Latrine ein Wohnraum mit gemütlich anmutenden Sitzgelegenheiten und großen Fenstern. Von dort aus blickt man auf germanischen Wald, aber auch auf ein paar Nachbarhäuser, und in der Ferne ist eine Siedlung erkennbar.
Der Duft ist intensiver geworden. Er kommt aus einer Nische am Ende des Raumes – von einer gedeckten Tafel. Doch so sehr diese auch lockt – Mara lockt mehr.
Ich verlasse das Haus und gehe zu ihr. Dabei beschleicht mich ein merkwürdiges Gefühl. Die Aussicht auf den Wald kommt mir seltsam bekannt vor. Womöglich ist dies die Gegend, in der wir in die unterirdische Anlage gelangten? Sturmfels! Ja, ich glaube, das könnte sein.
Alles hier wirkt so friedlich und harmonisch. Es macht den Anschein, ein guter Platz zum Leben zu sein.
Mara schwimmt ruhig und konzentriert durch das große eckige Becken. Noch hat sie mich nicht bemerkt. Sie ist fast nackt, lediglich ihre Scham und die Brüste sind mit ein wenig Stoff bedeckt. Ich kann meine Augen kaum von ihr abwenden. Nun hat meine Venus mich ebenfalls bemerkt. Sie schwimmt zum Rand des Beckens und hängt sich mit ihren Armen darüber. Dabei streicht sie sich ihre nassen Haare aus dem Gesicht.
»Guten Morgen, wie geht es dir?«, fragt sie mich lächelnd.
»Gut ... wirklich gut«, antworte ich ehrlich.
»Hilfst du mir bitte raus?«
Ich nicke, und schon streckt sie mir die Arme entgegen. Mit einem Ruck ziehe ich sie zu mir hoch. Berauschend wie eine Nymphe steht sie vor mir. Ihre nasse Haut glänzt golden in der Morgensonne.
»Gibst du mir bitte noch das Tuch hinter dir?«, fragt sie belustigt. Sie hat meinen begehrlichen Blick bemerkt. Ich drehe mich um, nehme das Laken und lege es ihr um die Schultern, wobei ich die Gelegenheit nutze und sie umarme. Mara legt den Kopf an meine Brust. Es fühlt sich unglaublich gut an, sie wieder zu spüren. Ich schließe die Augen und genieße den Moment.
Ringsum singen Vögel, während ich den Duft ihrer nassen Haut einatme, in dem eine eigenartige, fremde Essenz liegt, als hätte das Wasser einen seltsamen Eigengeruch.
Eine leichte Brise umweht uns und lässt Mara frösteln. Ich schließe sie noch etwas fester in die Arme, dabei flüstere ich ihr zu: »Du hast mein Herz erobert und bist schnell Teil meines Lebens geworden. Ich brach in Panik aus, als ich dich verloren zu haben glaubte.«
Sie löst sich von mir und sieht mir in die Augen. »Mir geht es doch genauso. Daher habe ich alles für eine Rückkehr zu dir vorbereitet.«
Ihr Blick, ihre glänzende Haut, alles an ihr strahlt pure Sinnlichkeit aus. Mit einer Hand an ihrem Kinn führe ich ihre Lippen zu den meinen. Unser Kuss beginnt sanft, nur um dann leidenschaftlicher zu werden. Sie spürt meine Erregung und drängt sich dichter an mich. »Ich habe dich vermisst«, stößt sie atemlos hervor.
Es befriedigt und beruhigt mich, dass sie mich begehrt. Ich hatte schon die Befürchtung, dass sie mich vergessen haben könnte. »Dann lass uns reingehen, bevor sich noch Zuschauer einfinden, oder kommt hier niemals jemand vorbei?«, erkundige ich mich lächelnd. Sie schmunzelt, und wir beeilen uns, ins Haus zurückzukehren.
Kaum dass wir die Tür hinter uns geschlossen haben, streife ich die Hose ab und ziehe Mara hoch auf meine Hüften. Auf den leichten Schmerz in meinem rechten Bein achte ich nicht weiter, denn ich will sie spüren. Jetzt!
Sie schiebt das kleine Stück Stoff zwischen ihren Beinen zur Seite, sodass ich ohne Umschweife in sie eindringen kann. Ein leichtes Zittern erfasst meinen Körper, gefolgt von einem Prickeln auf der Haut. Auch Mara ist Gefangene ihrer Lust. Ihre wohligen Seufzer tun mir gut.
Maras Augen sind geschlossen. Sie hält mich fest umklammert und beginnt mich von der Brust aufwärts zu küssen. So vereinigt, gehe ich mit ihr hinauf ins Schlafzimmer. Behutsam setze ich mich mit ihr aufs Bett. Sie löst sich aus der Umarmung, um eine bessere Position zu finden, und beginnt sich langsam auf meinem Schoß auf und ab zu bewegen. Währenddessen widme ich mich ihren vollen Brüsten und sauge an den steifen Knospen. Mit Genugtuung höre ich sie aufstöhnen. Im Moment des Höhepunkts entringen sich ihr kleine, wollüstige Schreie. Vom schnellen, aber intensiven Akt berauscht, lasse ich mich mit ihr rücklings aufs Bett fallen. Für einen Augenblick liegen wir still darnieder, bis mein Magen anfängt zu knurren.