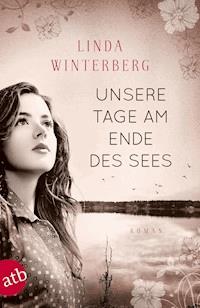9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die große Hebammen-Saga
- Sprache: Deutsch
Drei junge Frauen kämpfen für die Freiheit.
Berlin, 1942: Der Krieg hinterlässt Spuren in der Stadt. Während Edith ihr Glück fernab der Heimat sucht, arbeitet Luise als Hebamme in der Frauenklinik Neukölln. Als sie erfährt, was mit den Neugeborenen der Zwangsarbeiterinnen geschieht, nimmt sie all ihren Mut zusammen und versucht, sie zu retten. Margot hat eine Stelle im Frauengefängnis angenommen. Als eine junge Schwangere vor ihr steht, die im Widerstand kämpfte und zum Tode verurteilt wurde, weiß Margot, dass sie alles versuchen muss, um sie zu retten. Auch wenn sie sich dabei in Lebensgefahr begibt.
Die große Hebammen-Saga: historisch fundiert, atmosphärisch und voller liebenswerter Figuren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 460
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über das Buch
Drei junge Frauen kämpfen für die Freiheit.
Berlin, 1942: Der Krieg hinterlässt Spuren in der Stadt. Während Edith ihr Glück fernab der Heimat sucht, arbeitet Luise als Hebamme in der Frauenklinik Neukölln. Als sie erfährt, was mit den Neugeborenen der Zwangsarbeiterinnen geschieht, nimmt sie all ihren Mut zusammen und versucht, sie zu retten. Margot hat eine Stelle im Frauengefängnis angenommen. Als eine junge Schwangere vor ihr steht, die im Widerstand kämpfte und zum Tode verurteilt wurde, weiß Margot, dass sie alles versuchen muss, um sie zu retten. Auch wenn sie sich dabei in Lebensgefahr begibt …
Die große Hebammen-Saga: historisch fundiert, atmosphärisch und voller liebenswerter Figuren.
Über Linda Winterberg
Hinter Linda Winterberg verbirgt sich Nicole Steyer, eine erfolgreiche Autorin historischer Romane. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Töchtern im Taunus. Im Aufbau Taschenbuch und bei Rütten & Loening liegen von ihr die Romane »Das Haus der verlorenen Kinder«, »Solange die Hoffnung uns gehört«, »Unsere Tage am Ende des Sees«, »Die verlorene Schwester«, »Für immer Weihnachten«, »Die Kinder des Nordlichts« sowie die ersten beiden Teile der großen Hebammen-Saga »Aufbruch in ein neues Leben« und »Jahre der Veränderung« vor.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Linda Winterberg
Schicksalhafte Zeiten
Die Hebammen-Saga
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Nachwort
Dank
Impressum
— 1 —
BERLIN, JULI 1942
Luise legte das Baby auf die Waage und schob die Gewichte von links nach rechts. Ihr Blick fiel auf die Wiegekarte, und ihre Miene wurde ernst.
»Ihre Tochter hat abgenommen, Frau Walbach«, sagte sie zu der neben ihr stehenden Mutter, einer blonden Frau Mitte zwanzig. »Das ist gar nicht gut.«
»Sie will eben nicht anständig trinken«, rechtfertigte sich Frau Walbach. »Immer wenn ich sie anlege, nuckelt sie nur ein wenig und hört dann auf. In meinem Erziehungsratgeber steht, dass das Stillen nicht länger als zwanzig Minuten dauern darf. Ich lass sie ja auch schreien, bis sie wohl richtig Hunger hat. Aber immer ist es dasselbe.«
Luise schmerzten die Ausführungen der Frau. Sie schreien zu lassen, war in ihren Augen kein Weg, mit Säuglingen umzugehen. Die kleine Margarete auf der Waage war zwei Monate alt. Margot hatte sie bei einer Hausgeburt auf die Welt geholt. Immerhin etwas. Margot verabscheute die neuerdings häufig angewandte Praxis, die Kinder nach der Geburt aus dem Raum zu bringen und sie erst am nächsten Tag ihren Müttern zum Stillen zu reichen, ebenso wie Luise. Bei Hausgeburten war es möglich, sie zu umgehen, in der Klinik wurde diese Regelung inzwischen von vielen Hebammen eingehalten. Deshalb war es Luise zur Gewohnheit geworden, öfter in das Säuglingszimmer zu gehen, um nach den Kleinen zu sehen, das eine oder andere Baby im Arm zu halten, mit ihm zu reden und es zu streicheln. Ein Neugeborenes brauchte in ihren Augen Zuwendung, Hautkontakt, keine Regeln oder festen Zeitpläne. Luise wusste, dass Ermahnungen ihrerseits gegenüber Frau Walbach nichts bringen würden. Trotzdem wagte sie einen Versuch.
»Manche Babys haben es gern, wenn sie etwas auf dem Arm gehalten werden«, sagte sie. »Das Stillen ist ein recht vertraulicher Vorgang zwischen Mutter und Kind. Vielleicht hilft es, sie dabei zu streicheln, ihr in die Augen zu sehen und sie mit liebevollen Worten zu ermuntern.«
»Aber dann verzärtle ich sie ja«, sagte die Frau. Entrüstung lag in ihrer Stimme. »Am Ende tanzt mir das Balg dann auf der Nase herum. Sie sind ja eine feine Hebamme, wenn Sie einen solchen Unsinn empfehlen.«
Luise schluckt ihre aufsteigende Wut und die bissige Bemerkung, die ihr auf der Zunge lag, hinunter. Wieder einmal verfluchte sie die Ärztin Johanna Haarer, die den abscheulichen Erziehungsratgeber geschrieben hatte, an den sich Hedwig Walbach und so viele andere Frauen in Erziehungsdingen seit einigen Jahren hielten. Margot hatte es auf den Punkt gebracht, indem sie neulich dieses Werk als »die Pest« bezeichnet hatte.
»Also diesen Angriff auf Fräulein Mertens verbitte ich mir«, mischte sich plötzlich eine andere Frau in das Gespräch ein. Es war Bärbel Grabewitz, jedes einzelne ihrer Kinder hatte Luise auf die Welt geholt.
»Sie ist eine hervorragende und erfahrene Hebamme, die jedes meiner acht Kinder auf diese Welt geholt und mir stets mit Rat und Tat zur Seite gestanden hat. Ohne sie hätte ich oftmals nicht gewusst, wie es weitergehen soll.«
»Ach wirklich«, sagte Frau Walbach. »Acht Kinder. Respekt. Dann tragen Sie ja bereits das goldene Mutterkreuz.«
»Sehr wohl trage ich das«, erwiderte Frau Grabewitz. »Bei meinen letzten beiden Kindern ist der Führer sogar Pate.« Stolz schwang in ihrer Stimme mit. »Hören Sie mal lieber auf das Fräulein Mertens. Und glauben Sie nicht alles, was in diesen Ratgebern steht. Mein Peterchen, mein Erstgeborener, hat auch länger gebraucht, um sich an die Brust zu gewöhnen. Manchmal hab ich mit ihm zwei Stunden auf dem Sofa gesessen. Und dann plötzlich trank er ganz flott. Und heute ist er schon vierzehn Jahre alt und Mitglied der Hitlerjugend. Seine Uniform ist immer fein gebügelt. Wir wollen dem Führer schließlich Ehre machen.«
»Oh, das wollen wir auch«, sagte Frau Walbach. »Ich arbeite in einer der Rüstungsfabriken als Sekretärin, die Kleine kann ich währenddessen in einer Heimstätte unterbringen. Ganz recht ist mir das nicht, denn dort sind in der Küche neuerdings auch Ostarbeiterinnen tätig. Ich möchte ungern, dass meine Margarete Kontakt zu einer Polin oder Russin hat. Man weiß ja nie, was in den Lagern grassiert, in denen sie untergebracht sind. Ich hätte ja gern weitere Kinder, aber mein Erwin ist im Osten an der Front.«
»Ich unterbreche die Damen nur ungern«, mischte sich Luise in das Gespräch ein. »Aber es warten noch weitere Mütter mit ihren Kindern, und die heutige Sprechstunde neigt sich bereits dem Ende zu. Vielleicht kann Ihnen Frau Grabewitz als erfahrene Mutter noch einige hilfreiche Ratschläge mit auf den Weg geben.« Luise schenkte Bärbel Grabewitz ein Lächeln und reichte Hedwig Walbach die kleine Margarete mit den Worten: »Es wäre gut, wenn Sie in ein paar Tagen zu einer erneuten Gewichtskontrolle kommen würden. Sollte die Kleine dann erneut abgenommen haben, müsste mit dem Fläschchen zugefüttert werden.«
»Um Himmels willen, alles nur das nicht«, antwortete Hedwig Walbach entsetzt. »Jede deutsche Mutter hat zu stillen. Damit erfüllen wir unsere rassische Pflicht. Und Flaschenkinder sterben leichter.«
»Unterernährte Kinder sterben jedoch noch leichter«, antwortete Luise, bemüht darum, das Gerede von der rassischen Pflicht zu überhören. Sie sah auf ihre Armbanduhr. Wo ist nur die Zeit geblieben, dachte sie. In zwanzig Minuten musste sie einen Vortrag für die Hebammenschülerinnen in der Frauenklinik halten. Sie verabschiedete sich von den Damen.
Als sie wenig später im hellen Sonnenlicht auf der Weichselstraße stand, atmete sie tief durch. Der Kommentar mit den Ostarbeiterinnen hatte ihr zugesetzt. In der Klinik waren inzwischen einige von ihnen beschäftigt, und die Frauen waren stets höflich und zuvorkommend. Auch hatte Luise bereits die junge und äußerst liebenswerte Polin Irina von einem gesunden Jungen entbunden. Sie war verheiratet und lebte mit ihrem Mann in einem Zwangsarbeiterlager in der Berliner Straße. Er arbeitete in der Metallwarenfabrik Golliasch, die, wie die meisten Fabriken Berlins, zu einem Rüstungsbetrieb geworden war. Die Zahl der Ostarbeiterinnen in der Klinik könnte durch das Inkrafttreten des neuen Mutterschutzgesetztes noch zunehmen, das besagte, dass Frauen acht Wochen vor und nach der Geburt nicht beschäftigt werden durften. Es stand zu befürchten, dass die Hausschwangeren, die bisher aufgrund ihrer sozialen Not einige Wochen vor der Entbindung in der Klinik gearbeitet hatten, nun keinen Finger mehr krumm machen würden. Benno Ottow arbeitete bereits daran, das Gesetz zu umgehen. Jede Hausschwangere sollte bereits bei der Aufnahme schriftlich bestätigen, dass sie über die Nichtanwendbarkeit des Mutterschutzgesetztes informiert worden war.
Luises Blick wanderte auf die andere Straßenseite. Dort saß eine ältere Frau auf einem Balkon im ersten Stock und beäugte sie neugierig. Zwischen den in Balkonkästen blühenden Blumen waren Hakenkreuzfähnchen gesteckt. Luise kannte die linientreue Dame, die die Rolle des Blockwarts innehatte, nur vom Sehen. Ihr Name war Waltraud Schön. Sie und ihr Mann hatten lange ein Gemüsegeschäft in der Berliner Straße geleitet. Nach seinem Tod hatte sie den Laden noch eine Weile allein weitergeführt, dann jedoch aufgegeben. Kinder gab es keine, Personal fand sich keines. Bei dem alten Drachen, wie es Margot einmal ausgedrückt hatte, würde sie auch nicht arbeiten wollen. In den Laden der Schöns hätten sie sich schon als Kinder nicht hineingetraut. Luise lächelte Frau Schön zu und ging zu ihrem Fahrrad. Es stand vor einem Ladengeschäft, das früher einmal einer jüdischen Familie gehört hatte. Die Rosenbaums hatten Deutschland bereits kurz nach Hitlers Machtergreifung verlassen. Es war eine gute Entscheidung gewesen, wenn man sah, wie erbärmlich die Juden im Land inzwischen behandelt wurden. Mit dem Judenstern gekennzeichnet, wurden sie beschimpft, ausgegrenzt, enteignet, zur Zwangsarbeit genötigt, interniert und verschleppt. Wohin, das wusste niemand so genau. Luise betrachtete den Laden traurig. Heute war die Änderungsschneiderei von Heidrun Braubach darin untergebracht. Ihr Mann war im Krieg gefallen, sie musste ihre fünf Kinder allein großziehen. Das letzte war gerade mal acht Monate alt. Viel war von ihrem Mutterstolz nicht mehr übrig. Sie hatte mindestens das silberne Mutterkreuz erreichen wollen. Dazu würde es nun nicht mehr kommen. Immerhin war durch die Geburt ihres vierten Kindes, der kleinen Lotte, das vom Amt gegebene Ehestandsdarlehen zurückbezahlt, und sie stand nicht auch noch vor einem Berg von Schulden.
Luise schwang sich auf ihr Fahrrad, fuhr die Weichselstraße hinunter und bog in die Braunauer Straße ab. Wieder eine Veränderung, dachte sie, als sie an einem der Straßenschilder vorüberfuhr. Die Umbenennung der Straße nach dem Geburtsort des Führers. Bisher hatte sie sich noch nicht daran gewöhnt. Die letzten Jahre lasteten schwer auf ihr. Am meisten jedoch schmerzte noch immer, dass Edith weggegangen war. Sie hatten so sehr darauf gehofft, dass der Spuk mit Hitler nur vorübergehend sein würde und sie und Jonas bald wieder nach Berlin zurückkehren könnten. Immerhin wusste Luise die beiden in der Schweiz in Sicherheit, wo sie in Zürich an einer Frauenklinik arbeiteten. Es bestand regelmäßiger Briefkontakt, doch sie mussten aufgrund der Zensur stets darauf bedacht sein, gesinnungskonform zu bleiben. Auch über den neuen Leiter der Klinik, Benno Ottow, durfte kein schlechtes Wort fallen, was besonders Margot schwerfiel. Sie arbeitete schon seit einigen Jahren nicht mehr in der Klinik, da ihr Ottows Überzeugungen widerstrebten. Inzwischen wurden dort auch Zwangssterilisationen durchgeführt.
Luise hatte lange mit sich gehadert, es Margot gleichzutun. Doch sie hatte es nicht fertiggebracht, der Klinik den Rücken zu kehren. Und das, obwohl Ottow ihr bereits vor einer Weile den Posten der Oberhebamme entzogen hatte. Ottow und die Leiterin der Reichshebammenfachschaft, Nana Conti, verband durch die Herausgabe der Hebammenzeitschrift eine langjährige Freundschaft, und als Krönung ihrer Zusammenarbeit hatten sie in der Klinik eine Reichshebammenschule eingerichtet, eine sogenannte Oberschule für die deutsche Hebamme. Margarete Lungershausen war Contis Wunschkandidatin für den Posten der Oberhebamme gewesen, und Luise hatte, auch weil sie sich strikt weigerte, Parteimitglied zu werden, das Nachsehen gehabt.
Sie erreichte den Mariendorfer Weg und blieb ein Stück entfernt vom Klinikgelände stehen. Man sah den Gebäuden die Veränderungen nicht an. Das Verwaltungsgebäude, in dem die Poliklinik und die Schlafräume der Hebammenschülerinnen sowie die Speisesäle untergebracht waren, das Herz der Anlage, das Entbindungshaus, Wäschereigebäude und Kesselhaus. Doch der Schein trog. Hinter diesen Mauern geschah Tag für Tag Schreckliches, und Luise konnte es nicht verhindern. Sie fühlte die Schuld, die auch auf ihren Schultern lastete. Ihr Blick wanderte zum Direktorwohnhaus, wo heute Benno Ottow wohnte. Sie dachte an Siegfried Hammerschlag. Er war in Persien geblieben und baute dort voller Tatkraft eine Frauenklinik auf. Sie wusste, dass auch er sich nichts sehnlicher wünschte, als nach Berlin heimkehren zu können. Dieser ganze Irrsinn konnte doch nicht für immer so weitergehen. Darauf hoffte Luise. Und darauf, dass ihr der Herrgott im Himmel ihre Schuld irgendwann vergeben würde. Sie sollte so tapfer wie Margot sein, doch sie war es nicht und schämte sich dafür.
— 2 —
BERLIN, JULI 1942
Margot saß Christa gegenüber am Frühstückstisch, nippte an ihrem mit Malzkaffee gefüllten Becher und verzog das Gesicht.
»Wie sehr ich diese Plörre doch verabscheue«, sagte sie und stellte den Becher auf den Tisch. »Besonders nach Nächten wie der letzten wünsch ich mir nichts mehr als eine anständige Tasse Bohnenkaffee, stark, schwarz und mit viel Zucker. Unsere Magda konnte ihn am besten kochen. Es ist ein Jammer, dass sie nicht mehr da ist.«
Christa nickte kauend und schob eine Strähne ihres dunklen Haares hinters Ohr, die sich aus ihrer Hochsteckfrisur gelöst hatte. Sie schluckte und antwortete: »Obwohl sie ein recht scharfes Regiment geführt hat. Wer nicht pünktlich zur Frühstückszeit am Tisch saß, ging leer aus.«
»Ja, so war sie, unser Feldwebel.« Margots Stimme klang wehmütig. »Und jetzt ist sie schon bald acht Jahre tot.« Sie seufzte. Es entstand ein Moment der Stille.
Inzwischen gab es die kleine Wohngemeinschaft in der Werderstraße nicht mehr. Luise bewohnte, obwohl sie die Position der Oberhebamme verloren hatte, eine kleine Wohnung im ersten Stock des Verwaltungsgebäudes. Margot war mit Georg in eine geräumige Wohnung in die Nähe des Körnerparks umgezogen, und Christa war nach Magdas Tod, Lungenkrebs hatte sie in nur wenigen Wochen dahingerafft, in einem Schwesternwohnheim untergekommen.
Nachdem Georg bei einem Bombenangriff auf einen Zug ums Leben gekommen war, hatte Margot es nicht ertragen, in der Wohnung am Körnerpark zu bleiben. Christa hatte es im Schwesternwohnheim nicht mehr ausgehalten. Und so waren sie vor einem Jahr zusammen in diese kleine Wohnung direkt am Richardplatz gezogen. Es tat Margot gut, nicht allein leben zu müssen. Zeit ihres Lebens war sie es gewohnt gewesen, Menschen um sich zu haben. Ihre Familie, von der ihr nur noch ihre Schwester Klara geblieben war, die mit ihrem Mann und ihren drei Kindern inzwischen in Hamburg lebte, Luise und Edith – Georg. Sie vermisste ihn jeden Tag. Seine Stimme, seinen Geruch, seine Wärme und Nähe, ihre langen Gespräche, selbst seine schlechten Angewohnheiten fehlten ihr. Er hatte ständig in der ganzen Wohnung seine Sachen verteilt. Mitten auf dem Flur hatten oftmals seine Schuhe gelegen. Sie konnte nicht zählen, wie häufig sie darüber gestolpert war und ihn für seine Unordnung verflucht hatte. Er hatte nie seine Zigaretten richtig ausgemacht und stets die aufgeschlagene Zeitung auf dem Esstisch liegen gelassen. Sie hatten sich Kinder gewünscht, doch es hatte nicht sein sollen. Eine Fehlgeburt hatte sie im vierten Monat erlitten.
»Wie lief es denn bei Frau Bauer?«, fragte Christa und wechselte das Thema.
»Für eine Erstgebärende hat sie sich tapfer geschlagen und einen gesunden Jungen geboren. Er war nur etwas dünn. Kein Wunder, war ja auch zwei Wochen zu früh. Aber Mutter und Kind sind wohlauf. Ich werde heute Nachmittag noch einmal nach ihnen sehen. Wie läuft es in der Klinik? Wie geht es Luise? Ich hab sie viel zu lange nicht gesehen.«
»Alles wie gewohnt«, antwortete Christa. »Ich bewundere sie jeden Tag dafür, wie sie die Schikanen der Lungershausen hinnimmt. Dieses Naziweib lässt keine Gelegenheit aus, um sie kleinzumachen. Sie weiß ganz genau, dass Luise die erfahrenere und bessere Hebamme und die heimliche Oberhebamme für viele von uns ist und auch bleiben wird. Das schmeckt ihr so gar nicht.«
»Das glaub ich gern«, antwortete Margot und streckte sich gähnend. Sie wollte noch etwas hinzufügen, kam jedoch nicht mehr dazu, denn das Läuten des Telefons unterbrach sie.
»Um diese Zeit …« Christas Blick wanderte zur Uhr. Es war erst kurz nach sieben.
»Riecht nach Arbeit«, antwortete Margot. Sie ging in den Flur und nahm das Gespräch an. Eine aufgeregte Männerstimme war zu hören.
»Es ist Trude Hellweg«, erklärte Margot, nachdem sie den Hörer aufgelegt hatte. »Die Wehen haben eingesetzt. Ich mach mich gleich auf den Weg. Immerhin ist es ihr sechstes Kind. Da kann es schon mal schnell gehen.« Ihr Blick fiel in den Spiegel der Flurkommode. Sie sah scheußlich aus. Vierzehn Stunden Geburtsbetreuung gingen an keiner Hebamme spurlos vorüber. Sie begann hektisch an ihrem braunen, welligen Haar zu zupfen und steckte es seitlich mit einigen Haarnadeln fest, die sie in ihrer Rocktasche fand. Rasch holte sie das Puderdöschen aus ihrem Zimmer und begann sich über das Gesicht zu tupfen. Nichts war schlimmer, als eine übernächtig aussehende Hebamme, die den Anschein machte, nicht Herrin der Lage zu sein.
»Hellweg? Von der Gärtnerei?«, fragte Christa.
»Ja. Wenn wir Glück haben, bekomme ich einige Naturalien. Kartoffeln könnten wir gut gebrauchen.«
»Tomaten wären auch fein«, sagte Christa und begann, den Tisch abzuräumen. »Wir haben noch Zwiebeln und Gurken. Dann könnten wir uns heute Abend einen Salat machen und uns ein wenig auf den Balkon setzen.«
»Vielleicht hat Luise Zeit, uns Gesellschaft zu leisten. Es wäre herrlich, mal wieder wie in alten Zeiten zu quatschen.«
»Ich werde sie gleich fragen. Aber du weißt ja, wie sie ist«, antwortete Christa.
»Ich weiß, ich weiß«, erwiderte Margot, während sie in ihre Schuhe schlüpfte. »Mit der Arbeit verheiratet.« Sie verabschiedete sich von Christa mit einer Umarmung, dann verließ sie mit ihrem Hebammenkoffer die Wohnung. Draußen empfing Margot schon so früh am Morgen schwülwarme Luft. Sie holte ihr Fahrrad aus dem Schuppen im Hof und machte sich auf den Weg zur Gärtnerei Hellweg. Diese lag am Ende der Braunauer Straße in der Nähe des Waldgebietes Königs Heide. Trude Hellweg hatte all ihre Kinder zu Hause auf die Welt gebracht. Und dies nicht etwa deshalb, weil das Naziregime die Hausgeburt propagierte. Sie hatte schlichtweg Angst vor Krankenhäusern. Da gehen die Leute zum Sterben hin, hatte sie bei ihrer letzten Entbindung zu Margot gesagt. Margots Vorgängerin war Sybille Kohlbeck gewesen, eine Hebammeninstanz der freien Hebammen in Neukölln, die sich vor drei Jahren zur Ruhe gesetzt hatte und zu ihrer Tochter aufs Land gezogen war. Sybille hatte Margot ihren Kundenstamm gern überlassen. Sie respektierte die jüngere Kollegin, denn Margot hatte die Klinik am Mariendorfer Weg aufgrund ihrer Überzeugungen verlassen. Nur die Klappe solle sie halten, hatte Sybille zu ihr gesagt. Kritik am System war nicht erwünscht. Ein falsches Wort, und man landete im Kittchen.
»Irgendwann hat dieser Spuk ein Ende«, hatte sie gesagt. »Man muss nur irgendwie durchkommen und dabei sein Gewissen bewahren. Wir sind Hebammen, wir holen das Leben auf die Welt, wert oder unwert gibt es bei uns nicht.«
Margot versuchte, so gut es ging, diesen Leitsätzen zu folgen. Wertes und unwertes Leben. Das von den Nazis erzeugte Bild des perfekten Deutschen war durch Benno Ottow in der Klinik traurige Realität geworden. Er war ein glühender Verfechter der Zwangssterilisation, seit einigen Jahren sogar Mitglied des Erbgesundheitsobergerichtes, was ihm zum Richter und Vollstrecker in einer Person hatte werden lassen. Die Frauenklinik am Mariendorfer Weg hatte er in den letzten Jahren zu einem Zentrum für Zwangssterilisationen ausgebaut. Für die betroffenen Frauen, manche nicht älter als vierzehn oder fünfzehn, gab es eine eigene Abteilung, in der sie von sogenannten »Irrenpflegerinnen« betreut wurden. Margot hatte sich die Entscheidung, die Klinik zu verlassen, nicht leicht gemacht. Doch Tag für Tag mitzuerleben, wie in der Klinik, die für sie stets das Bollwerk für das Leben gewesen war, diese Verbrechen durchgeführt wurden, war für sie unerträglich geworden, und sie hatte ihre Kündigung eingereicht. Doch die Gesetze der Nazis beeinflussten auch ihre Arbeit als freie Hebamme. Sie hatte der Partei beitreten müssen, sonst hätte sie ihre Tätigkeit nicht weiter ausüben dürfen. Auch hatte sie einige Fortbildungskurse besuchen müssen, in denen ihnen die Ziele der nationalsozialistischen Gesundheitspolitik nähergebracht worden waren. Als Hebammen waren sie für die Selektion zuständig und sollten die rassisch einwandfreie Frau zum Gebären vieler Kinder ermuntern. Margot musste ein lückenloses Hebammentagebuch führen und Auffälligkeiten beim Neugeborenen sofort melden. Regelmäßig hatte sie einem Amtsarzt gegenüber Rechenschafft abzuliefern. Den meisten freien Hebammen gefiel diese Kontrolle nicht, manch eine weigerte sich auch, die Regeln einzuhalten. Eine von ihnen, Anna Kaiser, war im selben Ausbildungsjahrgang wie Margot gewesen und hatte wegen einer Nichtmeldung zwei Jahre Gefängnis und Zwangsarbeit bekommen. Es ging das Gerücht um, dass sie sich in ihrer Zelle das Leben genommen habe, doch Genaueres wusste niemand.
Margot erreichte die Gärtnerei Hellweg und stellte ihr Fahrrad vor dem Wohnhaus ab. Das Gelände war weitläufig. Es gab mehrere Gewächshäuser, dazu einige Gemüsefelder und eine Baumschule, um die sich Trudes Bruder kümmerte. Er bewohnte mit seiner Frau einen unweit der Gärtnerei gelegenen Bauernhof.
Zwei junge Frauen liefen mit gesenkten Köpfen an Margot vorbei. Auf ihren abgerissen aussehenden Kleidern war jeweils ein Abzeichen mit dem Buchstaben P angebracht, das für Polen stand. Margot hätte die beiden am liebsten freundlich gegrüßt, doch sie verkniff es sich, denn vor dem Gewächshaus stand eine ältere Frau, die in ihre Richtung blickte. Es war den Deutschen verboten, freundschaftliche Kontakte mit den Ostarbeitern zu pflegen. Wer es doch tat, konnte rasch gemeldet werden. Die beiden Mädchen, Margot schätzte sie auf nicht älter als sechzehn oder siebzehn, taten ihr leid. Sie wusste, dass in den meisten Lagern für Zwangsarbeiter schreckliche Zustände herrschten. Es gab oftmals zu wenig oder minderwertiges Essen, die Unterbringungen waren schmutzig, die Betten voller Wanzen, es gab kaum sanitäre Einrichtungen. In einem Lager in der Jägerstraße, wo Mitarbeiter der AEG untergebracht waren, hatte es erst vor Kurzem Fälle von Vergiftungen gegeben, an denen zwei Menschen gestorben waren. Eine Bekannte von ihr, Brigitte Landmann, arbeitete als Krankenschwester im Neuköllner Krankenhaus. Sie hatte Margot erzählt, dass sie im Lager manchmal mit einem befreundeten Arzt Hilfe leiste. Manche schwangeren Frauen müssten dort ohne Hilfe ihre Kinder zur Welt bringen. Eine Hebamme könnten sie gut gebrauchen. Doch Margot hatte sich noch nicht dazu durchringen können. Eine solche Tätigkeit konnte einem rasch Verhöre bei der Gestapo, am Ende sogar eine Haftstrafe einbringen. Doch der Anblick der beiden Mädchen brachte ihre Zweifel nun erneut ins Wanken. Sie war Hebamme. War es nicht ihre Pflicht zu helfen? Doch zunächst müsste die jeweilige Lagerleitung ihre Tätigkeit billigen.
Die Haustür öffnete sich, noch bevor Margot die wenigen Stufen hinaufgelaufen war. Trudes Älteste, ein blondes Mädchen von zehn Jahren, winkte sie ins Haus.
»Sie ist oben.«
Margot trat in den Flur. Am unteren Ende der Treppe hatten sich sämtliche Kinder versammelt. Die blonde Lene, die Zwillinge Hannes und Günter. Sie waren fünf Jahre alt und strohblond wie ihre Mutter. Die perfekten arischen Nachkömmlinge. Die kleine Barbara, die Margot auf die Welt geholt hatte, war im Frühjahr drei geworden. Neben ihr saß der Kleinste, noch keine zwei Jahre alt und das Gesicht voller Sommersprossen. Er hieß Adolf, und der Führer war sein Pate geworden. Die Kinderschar der Familie wuchs und gedieh. Johannes Hellweg war altersbedingt nicht mehr eingezogen worden, auch plagte ihn eine Kriegsverletzung, die er sich im Ersten Weltkrieg zugezogen hatte. Trude war noch nicht einmal Mitte dreißig. Es galt zu vermuten, dass noch weitere Nachkommen folgen würden.
Margot begrüßte die Kinder mit einem Lächeln, dann eilte sie die Treppe nach oben. Als sie das Schlafzimmer betrat, bot sich ihr ein eigentümliches Bild. Trude Hellwig hatte sich auf der Fensterbank abgestützt. Ihre Schwägerin, Linde Hellweg, kniete unter ihr auf dem Boden und hatte die Hände unter ihrem Kleid. Trude stieß einen markerschütternden Schrei aus.
»Es kommt! Ich spür es. Hol es raus, verdammt! Hol es endlich raus.«
»Hebamme wäre jetzt da«, sagte Margot und eilte zu ihr.
»Wo bleiben Sie denn so lange?«, sagte Linde Hellweg und erhob sich stöhnend. »Ist die reinste Sturzgeburt.«
»Ich bin ja jetzt hier«, versuchte Margot, sie zu beruhigen. »Guten Tag, Frau Hellweg. Na, da hat es aber jemand eilig, auf die Welt zu kommen.« Sie kniete sich hin und verschaffte sich einen Überblick. »Der Kopf ist schon draußen«, sagte sie. »Nur noch ein wenig pressen. Ganz vorsichtig. Sie machen das großartig.«
Die nächste Wehe kam, und Margot drehte behutsam die Schultern des Kleinen aus dem Leib seiner Mutter. Dann rutschte der Säugling auch schon in ihre Hände.
»Herzlich willkommen auf der Welt, Kleines«, begrüßte Margot das Baby lächelnd. Sofort begann das kleine Mädchen zu weinen.
»Sie haben eine ganz bezaubernde kleine Tochter«, sagte sie zu Trude Hellweg und durchtrennte mit geübtem Griff die Nabelschnur. Linde Hellweg reichte ihr ein Handtuch, in das sie die Kleine behutsam einwickelte. Sie übergab das Mädchen rasch der Schwägerin, deckte das eheliche Bett mit einer sauberen Unterlage ab und half der eben Entbundenen sich hinzulegen. Es dauerte nicht lange, bis die Nachgeburt folgte. Linde Hellweg legte ihrer Schwägerin das kleine Bündel Mensch in die Arme.
»Sieh nur, ist sie nicht niedlich?«, fragte sie mit Tränen in den Augen.
»Ja, das ist sie«, sagte Trude. »Und ganz der Papa. Obwohl er ja schon ganz gern noch einen Sohn gehabt hätte. Aber das kann man eben nicht bestimmen.« Sie berührte zärtlich das Händchen ihrer Tochter. Margot lächelte. In ihr hatte sich das wohlig warme Glücksgefühl ausgebreitet, das sie nach jeder Entbindung verspürte. Mitzuerleben, wie sich Mutter und Kind zum ersten Mal in die Augen blickten, war für sie auch noch nach all den Jahren ein kleines Wunder.
»Dann machen wir euch beide mal schnell zurecht«, sagte sie. »Im Treppenhaus stehen bereits die Geschwisterchen und wollen bestimmt einen Blick auf ihre Schwester werfen.«
»Ja, und der Johannes auch«, sagte Trude. »Er ist bestimmt in einem der Gewächshäuser. Linde, bitte sei so lieb und geh ihn rasch holen. Sag ihm, er soll ein Paket für Frau Lingau zurechtmachen lassen. Und er soll auch von den Tomaten und Erdbeeren reintun.« Margot bedankte sich.
»Ach, das ist doch nicht der Rede wert. Obwohl Sie dieses Mal ja reichlich spät dranwaren. Aber wer kann auch ahnen, dass es so schnell gehen würde. Die erste Wehe ist keine zwei Stunden her.«
Margot nahm Trude das Neugeborene aus den Armen, badete es in der Zinkwanne, die ein Hausmädchen gebracht hatte, und verabreichte der Kleinen die notwendigen Augentropfen. Diese wurden vorsorglich zur Verhütung von Infektionen allen Neugeborenen verabreicht. Danach zog sie den Säugling mit der bereitliegenden Wäsche an, wickelte ihn in ein wollenes Tuch und reichte ihn seiner Mutter. Beim Bad hatte das kleine Mädchen noch geschimpft, jetzt war es eingeschlafen.
»Sie ist wirklich niedlich«, sagte Trude. »Ich werde sie Eva nennen. So hieß eine ihrer Großtanten.«
Lautes Geschrei, das von draußen zu ihnen hereindrang, ließ Margot aufblicken und ans Fenster treten. Die alte Frau, die eben noch vor dem Gewächshaus gestanden hatte, prügelte mit einem Knüppel auf eine der jungen Polinnen ein. Das arme Ding kreischte herzzerreißend und hielt sich schützend die Hände über den Kopf.
»Hat sich wieder eine danebenbenommen?«, fragte Trude Hellweg. »Es ist ein Kreuz mit diesen Ostarbeiterinnen. Die können alle nicht richtig arbeiten. Und verlaust sind die meisten von ihnen auch. Ich sag den Kindern immer, dass sie sich von ihnen fernhalten sollen. Am liebsten hätte ich die Weiber gar nicht im Haus. Aber was soll man machen? Bis auf unseren alten Gerhard und den Uwe haben sie alle unsere männlichen Mitarbeiter eingezogen. Da bleiben einem nur noch die Polinnen und Russen. Und die klauen wie die Raben. Bestimmt hat Alma das Luder in der Küche erwischt. Besonders auf das Brot müssen wir achtgeben. Neulich fehlten zwei ganze Wecken, und es wollte niemand gewesen sein.«
Margot beobachtete fassungslos, wie das Mädchen nun auch noch von einem Mann mit dem Gartenschlauch abgespritzt wurde und unter den Schlägen in die Knie ging. Ihre Schreie verstummten. Wie ein Häufchen Elend lag es da und hielt sich noch immer schützend die Hände über den Kopf. Die Frau hatte zu prügeln aufgehört, doch der Mann hatte weiterhin Freude daran, sie mit dem Wasserschlauch abzuspritzen. Er ging sogar näher heran und trat mit dem Fuß nach ihr. In Margot bebte alles. Am liebsten wäre sie hinuntergelaufen und dazwischengegangen. Warum wohl stahl jemand Brot aus einer Küche? Wie konnten diese Menschen nur so grausam sein? Sie fühlte sich wie erstarrt.
Die Kinder stürmten nun in den Raum. Margot nutzte den Moment, um sich mit knappen Worten zu verabschieden. Sie musste hier weg. Rasch schloss sie ihre Tasche, murmelte leise, dass sie morgen wieder vorbeikommen werde, und eilte aus dem Raum. Als sie auf den Hof trat, wurde das vollkommen durchnässte Mädchen von einem weiteren weggebracht. Es blutete an der Lippe und schluchzte erbärmlich.
Margot hätte zu gern geholfen und tröstende Worte gefunden. Doch der ältere Mann, der das Wasser über das Mädchen gekippt hatte, sprach sie an und erkundigte sich nach der Geburt. Sie beantwortete seine Fragen mit knappen Worten, dann stieg sie auf ihr Fahrrad und trat kräftig in die Pedale. Sie wollte nur noch fort von hier.
Eine Entscheidung hatte sie nun endgültig getroffen: Sie würde den Frauen in den Lagern helfen und Menschlichkeit zeigen. Und sollte sie deshalb ins Gefängnis kommen, dann war das eben so.
— 3 —
Zürich, 1. August 1942
Ihr Lieben,
ich habe gute Neuigkeiten zu verkünden: Jonas und ich sind stolze Eltern eines gesunden Jungen geworden. Unser kleiner Walter hat am letzten Dienstag um Punkt acht Uhr das Licht der Welt erblickt. Er wiegt bereits stolze sechseinhalb Pfund und ist zweiundfünfzig Zentimeter lang. Ihr wollt bestimmt alle Einzelheiten wissen. Ich hoffte ja, da es unser drittes Kind ist, dass es dieses Mal etwas schneller vorangehen würde, aber dem war nicht so. Ich kämpfte über zwanzig Stunden und war am Ende sehr erschöpft. Aber wieder betreute mich meine geliebte Anni, eine wunderbare Hebamme und Freundin, die mir stets Mut machte und unermüdlich an meiner Seite blieb. So wie ihr beiden es gewiss auch gewesen wärt. Ich habe diesem Brief einige Fotografien beigelegt, darunter auch eine des Kleinen. Ist er nicht zuckersüß? Wir sind ganz verliebt. Mariechen und Jule streiten bereits, wer ihn öfter im Arm halten darf. Ich hab Euch auch noch ein aktuelles Bild der Mädchen beigelegt. Jule träumt bereits jetzt davon, Ärztin zu werden. Das Zeug dazu hätte sie. Ach, ich wünschte, Ihr beiden könntet jetzt bei mir sein, und wir würden die Geburt gemeinsam gebührend feiern. Und was wäre es schön, wenn wir wie früher gemeinsam mal wieder um die Häuser ziehen könnten. Wie geht es Elfi? Betreibt sie noch ihr kleines Theater? Wie geht es Dir, liebe Margot? Ich hoffe, Du kommst zurecht. Ich wünschte mir, als ich Deineberührenden Zeilen nach Georgs so plötzlichem Tod las, so sehr, ich könnte Dich in die Arme nehmen und fest an mich drücken. Stattdessen sende ich Dir auch heute wieder Trostküsse in diesem Brief. Richte Christa bitte Grüße von mir aus! Luise, meine Liebe. Wie geht es Dir? Was macht die Klinik? Für uns ist es noch immer vollkommen unverständlich, dass Du den Posten der Oberhebamme nicht mehr innehast. Du bist und bleibst die beste Hebamme, die mir jemals im Leben begegnet ist. Auch Deine Andeutungen im letzten Brief haben uns erschüttert. Ich frage mich, ob Professor Hammerschlag weiß, was in seiner Klinik geschieht. Vermutlich schon. Er mag im fernen Persien weilen, doch mit Sicherheit hält er weiterhin Kontakt in die Heimat. Ich hätte auch noch eine Bitte. Ich schrieb an Alex und Mama, bereits vor Monaten. Doch ich erhielt keine Antwort. Vielleicht wäre es Euch möglich, Kontakt mit ihnen aufzunehmen. Es würde mich doch sehr beruhigen, zu hören, dass es ihnen gutgeht. Ich kann Euch gar nicht sagen, wie sehr Ihr, wie sehr Berlin mir fehlt. Ich wünschte, ich könnte heimkehren und Euch wieder in die Arme schließen. Ich hoffe, es wird eines Tages möglich sein.
Es sendet Euch tausend Küsse und Umarmungen
Eure Edith
Luise faltete den Brief zusammen und legte ihn auf den Tisch.
»Ein Junge also. Wie schön!«, sagte Margot und betrachtete das Bild des Säuglings. »Er ist ganz der Papa.«
»Und die Mädchen sind groß geworden.« Luise besah sich die beigelegte Fotografie von Jule und Marie näher. Auf dem Bild standen sie am Ufer des Zürichsees in hübschen, geblümten Kleidern. Marie war fünf, Jule neun Jahre alt. Sie hatte eine Papiertüte in Händen, eine Schar Enten und Gänse befand sich vor ihnen auf dem Wasser. »Sie ähneln beide Edith. Besonders Jule. Bald schon werden die zwei den Jungen die Köpfe verdrehen.«
»Und wir sind Fremde für sie«, erwiderte Margot. »Frauen, die sie nur von Bildern und Erzählungen ihrer Eltern kennen.« Ihre Stimme klang traurig. »Ob sie uns jemals kennenlernen werden?«
»Ich weiß es nicht«, antwortete Luise. »Wenn Deutschland diesen Krieg gewinnt, wohl niemals. Sie sind Juden.«
Die beiden saßen in Luises Wohnung im Verwaltungsgebäude der Klinik an dem kleinen Tisch am Fenster, auf den die Strahlen der Abendsonne fielen. Den Tag über hatte es mehrfach kurze Gewitterschauer gegeben. Nun war der Himmel wolkenlos und wirkte wie reingewaschen.
Luise hatte belegte Brote und mit Himbeersirup gesüßtes Wasser bereitgestellt. Es war einige Wochen her, dass sie zuletzt so vertraut beisammengesessen waren.
»Ich wünschte, wir könnten ehrlich und offen schreiben«, sagte Margot. »Diese elende Zensur, überall hat man achtzugeben. Edith hätte es verdient, zu erfahren, was hier tatsächlich passiert.«
»Ja«, erwiderte Luise und trank einen Schluck Wasser. »Ich war heute in Potsdam bei ihrem Elternhaus. Ich hatte angerufen, aber keine Verbindung bekommen. In dem Haus wohnt jetzt jemand anderes. Ich hab eine Frau mit drei Kindern im Garten gesehen. An der Tür steht der Name Graber.«
Margot nickte. »Vermutlich wohnen sie jetzt in einem der Judenhäuser«, sagte sie.
»Oder aber …«
»Daran will ich nicht denken«, schnitt Margot Luise das Wort ab. »Es darf nicht sein.«
»Wir wissen beide, dass sie die Menschen mit Zügen fortbringen. Ich hab es neulich am Bahnhof beobachtet. Sie werden wie Vieh in die Waggons geladen. Neben mir hat ein alter Mann gestanden und den Kopf geschüttelt. In den Osten würden sie sie bringen, hat er gesagt, sie alle töten. Da bin ich fortgelaufen und musste mich übergeben. Es waren Kinder unter ihnen, Frauen mit Säuglingen im Arm, alte Menschen.«
Margot wusste nicht, was sie erwidern sollte. Sie nahm eine Fotografie von Edith zur Hand. Sie saß lächelnd inmitten von Kissen, ihren Sohn im Arm. Sie war noch immer hübsch, obwohl das Leben bereits seine Spuren hinterlassen hatte. Ihr blondes Haar lag in Wellen, sie war geschminkt. Gewiss hatte sie sich extra für das Bild zurechtgemacht. Das hätte es gar nicht gebraucht. Margot hatte sie ungeschminkt stets am hübschesten gefunden.
»Wann hattest du mit Alex zuletzt Kontakt?«, fragte Margot. Luise überlegte. »Ist eine Weile her. Vielleicht drei oder vier Jahre. Sie hatte gefragt, ob ich ihr bei der Geburt ihres Kindes beistehen kann. Ich musste ablehnen, denn in der Klinik gab es zu viel zu tun. Dich hatte sie damals doch auch kontaktiert, oder?«
»Hat sie«, antwortete Margot. »Aber damals war …« Sie kam kurz ins Stocken. »Meine Fehlgeburt.« Tränen stiegen ihr in die Augen. Die Erinnerungen an diesen Tag wollten nicht verblassen. Sie hatte es nicht wahrhaben wollen, sich gegen die Krämpfe und gegen Luise gewehrt, die die ganze Zeit über bei ihr geblieben und das kleine, nicht lebensfähige Wesen fortgebracht, sich gekümmert hatte. Georg hatte sie stundenlang gehalten, sie erinnerte sich an das Schluchzen, die Verzweiflung, die gottverdammte Wut und diesen elenden Schmerz in ihrem Innern. Noch immer suchte er sich an manchen Tagen seinen Weg nach oben. Nichts war ihr geblieben.
Luise legte ihre Hand auf die von Margot und drückte sie. »Es könnte also sein, dass sie längst ausgereist sind, oder?« Sie ging bewusst nicht auf Margots Fehlgeburt ein, sondern hielt an ihrem vorherigen Gesprächsthema fest.
»Ja, das wäre möglich. Aber hätte sie dann nicht längst den Kontakt zu Edith gesucht?«
Luise wusste nicht, was sie darauf erwidern sollte. Sie hatte recht. Margots Antwort zerstörte das bisschen in ihrem Inneren aufgekeimte Hoffnung.
»Wir müssen es ihr schreiben«, sagte Luise irgendwann.
»Und wie willst du das machen? Offen können wir es wegen der Zensur nicht erwähnen.«
»Es gibt wohl eine Art Code unter den Juden«, antwortete Luise. »›Deine Angehörigen sind verreist‹, schreiben sie. Edith wird diesen Satz gewiss zu deuten wissen.«
Margot nickte. »Verreist. Als ob sie in den Urlaub gefahren wären.«
Wieder herrschte Schweigen. Normalerweise freuten sie sich immer über Ediths Briefe und die Ablenkung von ihrem Alltag. Doch heute war ihnen nicht danach zumute.
»Ich gehe morgen mit Brigitte Landmann in eines der Lager an der Braunauer Straße«, sagte Margot.
»Wie, in eines der Lager? Von den Ostarbeitern?«
»Ja, ich will dort helfen. Es gibt aktuell zwei Schwangere, die Betreuung benötigen. Eine steht wohl kurz vor der Niederkunft. Der Lagerleiter hat unsere Fürsorge erlaubt.«
»Du weißt, dass du dir damit Ärger einhandeln kannst«, gab Luise zu bedenken. »Wir dürfen mit den bei uns im Haus beschäftigten Ostarbeitern nur den notwendigsten Umgang pflegen. Zur Betreuung von schwangeren Ostarbeiterinnen wurden vor einer Weile zwei Russinnen eingestellt. Eine von ihnen ist auch Hebamme. In der Klinik gibt es strenge Regeln. Einmal wurde eine Hilfsschwester dabei erwischt, wie sie einem Mädchen ein Stück Brot und einen Apfel zugesteckt hat. Die Lungershausen hat sie sofort einbestellt und ihr die Kündigung überreicht. Ich hab sie weinend im Treppenhaus gefunden und versucht, sie aufzuheitern. Ich rate dir dringend davon ab, dich im Lager zu engagieren. Du kommst in Teufels Küche und riskierst, deine Arbeit zu verlieren. Oder Schlimmeres.«
»Das ist also neuerdings deine Devise?«, fragte Margot. »Ärger vermeiden? Wegsehen?« Sie sah Luise herausfordernd an. »Ist es nicht unsere Pflicht als Hebammen, das Leben zu bewahren und dafür einzustehen? Jeden Tag geschieht um uns herum schreckliches Unrecht, und was machen wir? Wir sehen zu. Warum? Um lebendig aus der Sache rauszukommen? Damit du deinen Posten zurückbekommst?«
»Du wirst ungerecht«, entgegnete Luise. »Wir tun alle jeden Tag unser Bestes.«
»Aber vielleicht ist das gerade nicht genug«, antwortete Margot und stand auf. »Wir sehen weg, wenn Unrecht geschieht. Warum laufen wir nicht zu den Waggons und holen die Menschen wieder heraus? Weshalb stürmen wir nicht in die Operationssäle und verhindern die Verstümmelung der Frauen? Wieso sind wir alle still und nehmen es immer nur hin? So viele dort draußen wollen das alles nicht. Doch sie sehen tatenlos zu, schicken ihre eigenen Söhne, Väter, Brüder in den Tod. Wir wissen doch, wohin all das führen wird. Wir haben es bereits erlebt. Krieg bringt niemals etwas Gutes. Und dieser hier frisst uns im Inneren auf.« Margot hatte sich in Rage geredet.
»Nicht so laut«, ermahnte Luise sie und sah zur Tür. »Was ist nur in dich gefahren? Wenn das jemand hört, führen sie uns gleich ab. Weißt du eigentlich, wie es in einer der Zellen der Gestapo ist? Warst du schon einmal in einer? Ich kann es dir sagen: Es ist schrecklich. Ich war neulich dort und wurde befragt.«
»Du?« Verdutzt sah Margot Luise an.
»Ja, ich«, erwiderte Luise. »Sie haben mich vor zwei Wochen abgeholt, weil ich Erkundigungen nach Fritz’ Verbleib angestellt habe.«
Margot stand der Mund offen. »Fritz. Aber ich dachte, ich meine …«
»Er ist nicht mehr in der Nervenheilanstalt. Das gesamte Heim gibt es nicht mehr. Alle Bewohner wurden in einer Nacht- und Nebelaktion fortgebracht. Wohin, wollte man mir nicht sagen. Aber ich kann es mir denken.«
Margot war fassungslos. Fritz war fort, vermutlich tot. Er war in den letzten Jahren eine der Konstanten in Luises Leben gewesen. Als ihren Seelenverwandten hatte sie ihn oftmals bezeichnet. Bunt und voller Lebensfreude war der Transvestit vor über zehn Jahren in ihr Leben getreten und hatte ihr das Lachen nach dem grausamen Verlust ihres Verlobten zurückgegeben. Eine Liebesbeziehung blieb den beiden verwehrt. Marina, das Wesen der vom Licht der Leuchtreklamen erfüllten Berliner Nacht – Fritz konnte sie nicht ziehen lassen. Marina war seine Fluchtmöglichkeit, um die Gräuel des Ersten Weltkriegs zu vergessen. Sie kostete ihn damals beinahe das Leben und machte ihn fast zu einem Krüppel. Auf offener Straße wurde er zusammengeschlagen, ihm seine Würde genommen, nur weil er anders war.
»Bei wem hast du dich erkundigt?«, fragte Margot.
»Bei einer ehemaligen Schwester der Nervenklinik. Sie war damals auf Fritz’ Station eingeteilt. Ich dachte, ich könnte ihr vertrauen. Sie hat mich gemeldet und behauptet, ich hätte eine Liebesbeziehung zu einem Irren.« In Luises Augen traten Tränen. »Er war doch nie irre. Sie haben ihn kaputt gemacht. Und jetzt? Vielleicht ist er längst tot.«
Margot setzte sich wieder. »Es tut mir leid«, sagt sie. »Ich wollte dich nicht angreifen. Aber warum hast du denn nichts gesagt?«
»Wann denn? In den letzten Wochen blieb uns keine freie Minute füreinander. Wir leben doch nur noch aneinander vorbei. Es war schlimm. Stundenlang musste ich in einer finsteren Kellerkammer ausharren. Der Mann, der mich verhörte, hat mich geschlagen und als die Hure eines Irren beschimpft. Ich dachte, mein letztes Stündlein hätte geschlagen. Doch sie ließen mich laufen. Warum, weiß ich nicht. Am frühen Morgen stand ich wieder auf der Straße. Ich habe überlegt, zu dir und Christa zu gehen, doch mein Dienstbeginn stand kurz bevor. Ich hatte Angst, sie würden mich aus der Klinik werfen. Wer beschäftigt schon eine Hebamme, die etwas mit einem Irren hatte? Aber man hat bis heute kein Wort darüber verloren, und ich bin erleichtert. Und ja, ich gebe zu, dass ich es aussitze. Wie so viele dort draußen. Ich habe solche Angst. Es frisst uns auf. Wir sind nicht mehr die, die wir noch gestern waren. Oma hat einmal gesagt: ›Die Zeit verändert sich, und wir verändern uns mit. Wir können es nicht aufhalten. So spielt nun mal das Leben.‹ Doch ich wünschte, ich könnte es aufhalten. Ich wünschte, ich könnte in diesem Augenblick gemeinsam mit Fritz in der Scala sein. Ich wünschte, er wäre wieder Marina, bunt und voller Heiterkeit.«
Nun rannen die Tränen über ihre Wangen. Sie wischte sie hastig ab.
»Es tut mir leid, dass ich dir das mit dem Verhör nicht gesagt habe«, sagte sie. »Ich hatte nur solche Angst, ich dachte, wenn …«
»Scht«, machte Margot und legte Luise ihren Finger auf die Lippen. »Ich versteh das schon. Auch ich habe Angst, die ganze Zeit. Aber wir dürfen uns von ihr nicht unterkriegen lassen. Wenn wir das tun, dann gewinnen die dort draußen. Dann ertrage ich mein eigenes Gewissen nicht mehr.«
Luise nickte, antwortete jedoch nichts. Da war er wieder: Margots Kampfgeist. Ihr unbedingter Wille, das Richtige zu tun. Sie war und blieb das Neuköllner Mädchen aus dem vierten Hinterhof, das früh hatte lernen müssen, tapfer zu sein und zu überleben. Und sie überlebte Richards Tod, ihr Jugendfreund und Seelenverwandter, die Verluste in ihrer Familie. Auch Georg hatte sie verloren. Luise wusste, wie schwach sie im Gegensatz zu ihr war. Das Mädchen aus Ostpreußen, geprägt von der liebevollen Erziehung ihrer Großmutter. Erst seit sie in Berlin war, wusste sie, wie schwer es war, nach dem Hinfallen wieder aufzustehen. Und sie fiel ständig. Überall waren Stolperfallen. Erneut dachte sie an die Worte ihrer Oma. Die Zeit verändert sich, und wir verändern uns mit. Das mochte sein. Aber diese Veränderung musste nicht bedeuten, zum Mitläufer, am Ende sogar zum Täter zu werden. Es galt, die Angst zu besiegen und das Spiel des Lebens nach eigenen Regeln zu spielen. Es galt, aufzustehen und weiterzugehen. Sie wusste nur noch nicht, wie das funktionieren sollte.
— 4 —
BERLIN, SEPTEMBER 1942
Luise mochte die Hausschwangere Merle Kolbeck, mit der sie nun bereits seit zwei Stunden den Klinikflur rauf- und runterlief, um die Wehentätigkeit zu verstärken. Die junge Frau war neunzehn Jahre alt und ungewollt von einem Arbeitskollegen bei AEG Telefunken schwanger geworden, wo sie nach dem Ablegen des Notabiturs eine Ausbildung zur Funktechnikerin gemacht hatte. Eigentlich hatte sie Kunst und Philosophie studieren wollen. Doch die finanzielle Situation der Familie hatte das nicht zugelassen. Der Vater des Kindes stand zu Merle. Eigentlich hätten sie im März heiraten wollen, doch er kämpfte im Osten an der Front, und sein Heimaturlaub war nicht genehmigt worden. Sogar ein Hochzeitskleid gab es schon. Merle bewahrte es in ihrem Koffer wie einen Schatz. Sie hatte es gebraucht gekauft und umgenäht. Rüschen, schimmernde weiße Seide, dazu ein Spitzenschleier. Luise hatte es vor einigen Tagen bewundern dürfen. Nun musste es wohl erneut geändert werden.
»Denken Sie, es ist möglich, ein Bild von mir und dem Baby zu machen? Ich würde es gern meinem Rudolf an die Front schicken. Er wird sich bestimmt darüber freuen.«
»Gewiss«, antwortete Luise. »Für solche Fälle haben wir im Schwesternzimmer einen Fotoapparat bereitliegen.«
Merle nickte. Sie atmete schwer und blieb stehen. »Uh, jetzt aber.« Sie legte ihre Hand auf den Bauch.
»So soll es sein«, antwortete Luise und sah auf ihre Armbanduhr. »Abstände von zwei Minuten. Ich denke, wir sollten in den Kreißsaal zurückgehen. Jetzt kann es nicht mehr lange dauern.« Luise stützte Merle, während sie die wenigen Schritte zurücklegten. Sie kämpfte bereits seit mehr als zwanzig Stunden mit den Wehen. Selbst der von Luise verabreichte Einlauf hatte keine Beschleunigung gebracht, was selten vorkam. Mehr als sechs Stunden war der Befund stets gleichgeblieben, und das, obwohl Merle alle fünf Minuten von heftigen Wehen geplagt worden war. Nun jedoch schien es endlich voranzugehen. Luise half Merle in ihr Krankenbett und winkte eine der Hebammenschülerinnen, ihr Name war Ina, heran.
Ina hatte erst vor wenigen Wochen mit ihrer Ausbildung zur Hebamme begonnen und war nicht gerade eine der Geschicktesten. Margarete Lungershausen wollte sie schon vor die Tür setzen, aber Luise hatte Mitleid mit dem Mädchen. Im Gegensatz zu ihrer Vorgesetzten unterhielt sie sich mit jeder Hebammenschülerin zu Beginn ihrer Ausbildung eine Weile. Sie erkundigte sich nach ihrer Herkunft, den Familienverhältnissen und wollte wissen, weshalb sie sich für den Beruf der Hebamme entschieden hatten. Ina stammte vom Land, irgendein Nest südlich von Berlin, Luise hatte den Namen vergessen. Ihre älteste Schwester hatte gemeinsam mit ihrem Mann nach dem Tod der Mutter den Hof übernommen. Das Verhältnis der Geschwister war zerrüttet. Ina war zu ihrer Tante nach Berlin gezogen und hatte eine Stellung als Hilfskraft in einer Schneiderei angenommen. Dort hatte sie miterlebt, wie ein Kind geboren worden war. Das Ereignis hatte sie so sehr beeindruckt, dass sie sich dazu entschlossen hatte, Hebamme zu werden. Auch Edith war nach einem solchen Erlebnis Hebamme geworden. Das war es dann aber auch schon mit den Gemeinsamkeiten. Margarete Lungershausen hatte schon recht mit ihren Kritikpunkten. Ina hatte keine schnelle Auffassungsgabe, aber vielleicht wurde es mit etwas Geduld ja besser. Sie wäre nicht die erste schwierige Schülerin, die Luise auf den richtigen Weg und zu einem guten Abschluss führen würde.
»Wärst du so nett, Ina, und würdest Merle untersuchen? Ich hätte gerne deine Meinung zum Fortgang der Entbindung. Die Wehen kommen inzwischen alle zwei Minuten.«
Ina nickte und krempelte ihre Ärmel hoch. Behutsam öffnete sie die Beine der Gebärenden und fuhr in ihr Innerstes. Es war nicht das erste Mal, dass Ina eine solche Untersuchung durchführte, doch sie benötigte sehr lange, um einen Befund festzustellen.
»Muttermund sechs Zentimeter eröffnet«, sagte sie. Ihre Stimme klang unsicher. Luise nickte und bat sie, zur Seite zu treten. Sie prüfte das Ergebnis nach. Währenddessen platzte die Fruchtblase.
»Vollkommen eröffnet«, stellte sie fest und sah Ina streng an. »Fruchtblase geplatzt. Da hat es nun jemand eilig.« Sie tätschelte Merle das Bein und wies Ina an, hinter sie zu treten, um sie bei den Presswehen zu unterstützen.
»Pressen, meine Liebe«, sagte Luise. »Fest pressen. So ist es gut. Ich kann das Köpfchen bereits fühlen. Fest pressen. Immer weiter.« Die Wehe ebbte ab, und Merle lehnte sich erschöpft zurück. Ina tupfte ihr mit einem Tuch den Schweiß von der Stirn. Die nächste Wehe kam, und Merle presste erneut. Dieses Mal wimmerte sie herzzerreißend. Nachdem die Wehe abgeebbt war, begann sie zu jammern. »Ich kann das nicht. Ich will aufhören. Es geht nicht. Es tut so weh.«
»Es geht ganz bestimmt«, versuchte Ina sie zu trösten. »Gleich ist es geschafft. Ich helfe auch mit. Wir machen das gemeinsam.« Sie tupfte Merle erneut den Schweiß von der Stirn, nahm ihre Hand und sah ihr eindringlich in die Augen. »Nur noch wenige Male pressen, dann liegt das kleine Wunder in deinen Armen.«
Genau das war der Grund dafür, weshalb Luise das Mädchen nicht wegschickte. Ina hatte von Beginn an eine besondere Sensibilität im Umgang mit den Schwangeren gezeigt. Mit jeder Frau wusste sie richtig umzugehen, sie zu ermutigen, ihr die Angst zu nehmen und Sicherheit zu geben. Und das, obwohl sie fachlich gesehen nach einem halben Jahr Ausbildung die Schlechteste ihres Jahrganges war. Luise nahm sich in diesem Moment vor, mit Ina später noch einmal zu sprechen. Und wenn sie sich eigenhändig mit ihr hinsetzen und mit ihr die Theorie pauken, sie Hunderte Male würde anleiten müssen, dieses Mädchen war es wert. Sie würde eine gute Hebamme werden. Es brauchte nur Geduld, viel Geduld, einen ganzen Sack davon. Aber es würde sich auszahlen.
Während der nächsten Presswehen half Ina kräftig mit und schob Merle mit nach vorn.
»Du machst das großartig, Merle«, lobte Luise. »Nur noch einmal pressen. Und atmen, ja, ein wenig schieben. So ist es gut! Der Kopf ist da. Gleich ist es geschafft. So ist es gut.« Im nächsten Moment rutschte das Neugeborene in Luises Hände und begann sofort zu weinen.
»Herzlich willkommen auf der Welt, Kleines«, sagte Luise lächelnd. »Du hast einen ganz bezaubernden kleinen Sohn, Merle. Das hast du großartig gemacht.« Sie durchtrennte die Nabelschnur und wickelte den Kleinen, der bereits kräftig schimpfte, in das Handtuch, das Ina ihr reichte. Sie legte ihn in die Arme seiner Mutter. Dort hörte er zu weinen auf und öffnete die Augen.
»So ein hübscher junger Mann«, konstatierte Ina. Merle war von der Geburt vollkommen überwältigt und brachte keinen Ton heraus. Tränen rannen über ihre Wangen. Zaghaft berührte sie das kleine Händchen ihres Sohnes. Luise kümmerte sich unterdes um die Geburtsnachsorge. Als sie die Nachgeburt überprüfte, bemerkte sie, dass etwas nicht so war, wie es sein sollte. Ihr Blick fiel zwischen Merles Beine. Sie blutete ungewöhnlich heftig.
»Hier stimmt etwas nicht«, raunte Luise Ina zu. »Schnell, informiere den Arzt. Ich denke, sie wird ausgeschabt werden müssen.«
Ina eilte los, Luise trat neben Merle und nahm ihr den kleinen Jungen aus den Armen.
»Du blutest ungewöhnlich stark«, erklärte sie so behutsam wie möglich. »Aber es wird bestimmt alles gut. Der Arzt ist gleich da. Du bist bei uns in guten Händen. Ich kümmere mich solange um den Kleinen, fest versprochen.«
Merle nickte. Im nächsten Moment kippte ihr Kopf zur Seite. Sie war bewusstlos geworden.
Doktor Martin Glausitz betrat den Raum. Der hochgewachsene dunkelhaarige Mann arbeitete seit fünf Jahren in der Klinik. Luise mochte ihn nicht sonderlich. Er war arrogant und behandelte die Hebammen oftmals herabsetzend. Auch jetzt ignorierte er Luise, die zu einer Erklärung ansetzte. Rasch wies er, nach einer kurzen Untersuchung, zwei Krankenschwestern an, die Patientin sofort in den Operationssaal zu bringen. Ohne ein weiteres Wort verließ er den Entbindungssaal. Kopfschüttelnd sah Luise ihm nach, sagte jedoch nichts. Ina stand neben ihr, und vor einer Hebammenschülerin gehörte es sich nicht, abwertend über die Ärzteschaft zu sprechen.
»Komm, Ina«, sagte sie. »Wir baden den kleinen Mann und ziehen ihn an.« Dem Baby zugewandt fügte sie hinzu: »Wir machen dich hübsch für deine Mama. Sie wird bald wieder bei dir sein, das verspreche ich dir.« Ina machte sich unter der strengen Aufsicht von Luise daran, den Säugling zu baden. Danach bekam er die üblichen Augentropfen verabreicht, wurde gewickelt und eingekleidet.
»Das hast du sehr gut gemacht«, lobte Luise und brachte Ina damit zum Lächeln. »Und das mit dem Muttermund bekommen wir auch noch geregelt. Es ist noch keine Hebammenschülerin vom Himmel gefallen.«
»Meinen Sie?«, fragte Ina. Zweifel lag in ihrem Blick. »Ich soll morgen zu einem Gespräch zu Frau Lungershausen kommen. Ich habe solche Angst, dass sie mich rauswirft. Meine letzte schriftliche Prüfung war schrecklich.«
»Schriftliche Prüfungen sind nicht alles«, erwiderte Luise. »Zum Hebammesein gehört mehr als die Kenntnisse der weiblichen Anatomie. Ich wollte nachher sowieso zu ihr gehen, um etwas mit ihr zu besprechen. Ich werde die heutige Geburt lobend erwähnen.«
Sie wandte ihre Aufmerksamkeit wieder dem kleinen Jungen zu, wickelte ihn in ein wollenes Tuch und verließ dann mit ihm auf dem Arm den Raum. Auf dem Flur begegnete ihr die Hausschwangere Henni Balzer in Begleitung einer Krankenschwester. Sie war gerade mal fünfzehn Jahre alt und wollte das Kind nach der Geburt zur Adoption freigeben.
»Die Fruchtblase ist geplatzt«, sagte die Krankenschwester. Luise wies sie an, Henni in den Kreißsaal zu bringen. Ina könnte sich vorerst um sie kümmern.
»Ist heute ein ordentlicher Betrieb«, sagte sie zu dem kleinen Bündel in ihrem Arm, während sie durchs Treppenhaus lief. »Da will noch jemand auf die Welt kommen und braucht meine Hilfe.« Im nächsten Moment zuckte sie erschrocken zusammen. Etwas war von oben an ihr vorbeigefallen. Sie hörte einen markerschütternden Schrei. Luise lehnte sich über das Treppengeländer und erstarrte. Im unteren Flur lag eine Frau im Morgenmantel auf dem gefliesten Boden. Rasch wurde sie von Krankenschwestern, Pflegern und Ärzten umringt. Eine Blutlache breitete sich um den Kopf der braunhaarigen Frau aus. Eine Schwesternschülerin neben Luise schien die Frau zu kennen.
»Ach du je. Das ist die Diepold. Der haben sie gestern erst das Kind weggemacht und sie sterilisiert. Ich glaub, sie hatte Fallsucht, oder war es doch Schwachsinn? Ist ja auch egal. Wird wohl für die Irrenschwestern ordentlich Ärger geben. Erst neulich ist ihnen eine der Verrückten entwischt. Die konnten sie aber im Garten wieder einfangen.«
Luise biss sich auf die Zunge, um nichts Falsches zu sagen. Wie konnte dieses Mädchen nur so herzlos reden? Die Frau war verzweifelt genug gewesen, um in den Tod zu springen.
»Soll ich das Kind ins Kinderzimmer bringen?«, fragte die Schwesternschülerin.
»Nein, das mach ich schon«, erwiderte Luise. Ihr Blick war noch immer auf die Geschehnisse im unteren Treppenhaus gerichtet. Die Menschenansammlung wurde immer größer, sogar Benno Ottow war nun anwesend. Übelkeit stieg in ihr auf. Sie musste hier weg.
Eilig lief sie die Stufen hinauf und erreichte wenig später die Wochenbettstation der Hausschwangeren. Im dortigen Säuglingszimmer waren derzeit fünf Bettchen belegt, eine Kinderschwester wickelte gerade ein Baby.
»Guten Tag, Fräulein Mertens«, grüßte sie freundlich. »Ein Neuzugang. Ist es das Kleine von Merle Kohlbeck? Legen Sie es doch in das Bettchen am Fenster. Wo ist denn seine Mutter?«
Luise erläuterte kurz, was passiert war.
»Eine Ausschabung. Na, das wird sie überstehen. Allerdings …« Die Miene der Schwester wurde ernst.
»Was allerdings?«, hakte Luise nach.
»Es gab Post für das Fräulein Kohlbeck.«
Luise ahnte, um welche Sorte Post es sich handelte.
»Guter Gott, nein«, sagte sie.
»Wenn sie Glück hat, ist er nur verwundet«, sagte die Schwester. »Und wenn sie noch mehr Glück hat, bedeutet das, dass er für längere Zeit auf Heimaturlaub kommen darf. Dann können die beiden endlich heiraten und haben etwas Zeit füreinander.« Sie tätschelte dem Baby das Bäuchlein und hob es hoch.
Luise erwiderte nichts. Sie hoffte darauf, dass die Schwester recht hatte und Merles Verlobter nur verwundet war. Der kleine Junge sollte doch seinen Papa kennenlernen dürfen. Sie legte ihn in eines der Gitterbettchen, verließ den Raum und ging zu einer Tür, die ins hintere Treppenhaus führte. Vermutlich hatten sie die Tote bereits fortgebracht, doch sie wollte nicht riskieren, ihren Anblick erneut ertragen zu müssen. Sie lief die Stufen nach unten und trat nach draußen, um etwas frische Luft zu atmen. Auf der Treppe vor der Tür saß Christa, eine Zigarette in ihrer rechten Hand, die zitterte. Luise setzte sich neben sie und fragte: »Darf ich auch mal ziehen?«
Wortlos reichte Christa ihr die Kippe, und Luise nahm einen kräftigen Zug. Der Rauch füllte ihre Lungen, und sie entspannte sich ein wenig.