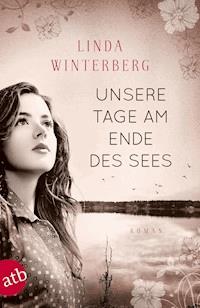9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Leben, von dem wir träumten. Bern, 1968: Nach dem Tod des Vaters werden die Schwestern Marie und Lena der kranken Mutter von der Fürsorge entrissen. Die Mädchen werden getrennt und an Pflegefamilien „verdingt“, bei denen sie schwer arbeiten müssen. Als eine der beiden schwanger wird, soll ihr das Baby weggenommen werden. Doch sie will die Hoffnung nicht aufgeben, mit ihrem Kind in Freiheit zu leben – und auch ihre Schwester wiederzufinden. Jahre später zeigt sich eine Spur, die nach Deutschland führt ... "Die Verdingkinder in der Schweiz sind ein Thema, das betroffen macht und nicht vergessen werden darf." Ulrike Renk, Autorin von "Die Zeit der Kraniche"
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 527
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Über Linda Winterberg
Hinter Linda Winterberg verbirgt sich Nicole Steyer, eine erfolgreiche Autorin historischer Romane. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Töchtern im Taunus und begann schon im Kindesalter erste Geschichten zu schreiben, ganz besonders zu Weihnachten, was sie schon immer liebte. Bei atb liegen von ihr die Romane »Das Haus der verlorenen Kinder«, »Solange die Hoffnung uns gehört« und »Unsere Tage am Ende des Sees« vor.
Informationen zum Buch
Das Leben, von dem wir träumten
Bern, 1968: Nach dem Tod des Vaters werden die Schwestern Marie und Lena der kranken Mutter von der Fürsorge entrissen. Die Mädchen werden getrennt und an Pflegefamilien »verdingt«, bei denen sie schwer arbeiten müssen. Als eine der beiden schwanger wird, droht ihr das Baby weggenommen zu werden. Doch sie will die Hoffnung nicht aufgeben, mit ihrem Kind in Freiheit zu leben – und auch ihre Schwester wiederzufinden. Jahre später zeigt sich eine Spur, die nach Deutschland führt.
»Die Verdingkinder in der Schweiz sind ein Thema, das betroffen macht und nicht vergessen werden darf.« Ulrike Renk, Autorin der Ostpreußen-Saga
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Linda Winterberg
Die verlorene Schwester
Roman
Inhaltsübersicht
Über Linda Winterberg
Informationen zum Buch
Newsletter
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Nachwort
Dank
Impressum
Prolog
2008
Das Gewitter war abgezogen, und die dunklen Wolken lichteten sich. Es hatte kurz, dafür heftig gewütet. Prasselnder Regen, Wind, der an den Bäumen rüttelte und die Schwüle des Tages vertrieb. Nun kehrten die Sonnenstrahlen zurück, die das feuchte Gras funkeln ließen. Ein Regenbogen zeichnete sich gegen die schwarze Wand im Osten ab, Donnergrollen, das sich entfernte. Bald würde es ganz verstummen. Sie öffnete das Fenster, trat auf die Terrasse und ließ ihren Blick über den Garten bis zum nahen Waldrand schweifen. Heute war wieder einer dieser Tage, an denen sie an sie denken musste, versuchte, sich ihre Stimme in Erinnerung zu rufen, ihre Nähe und Wärme. Der Schmerz saß tief. Er wollte nicht zurücktreten, raubte ihr den Schlaf. Die Vergangenheit wog schwerer als das Leben, das sie heute hatte. Oder war sie ungerecht? Es hatte viele gute Stunden gegeben. Sie hatte die Liebe gefunden, ein Zuhause. Doch sie lebte eine Lüge. Jeden Tag, jede Stunde – und sie konnte, durfte es nicht ändern.
Heute war ihr Geburtstag. Wieder ein Geburtstag ohne sie. Zweiundfünfzig Kerzen auf einer Torte, vielleicht freute sie sich, feierte mit Enkelkindern, einem Ehemann. Würde sie an ihre Schwester denken? Sie vermissen? Sie war kein Teil ihres Lebens, schon so lange nicht mehr. Getrennt, ein Wiedersehen war nicht vorgesehen. Sonst würde das Gestern kommen und sie zur Rechenschaft ziehen, für das, was sie getan hatte.
Sie holte die zerknitterte Fotografie aus der Tasche ihrer Strickjacke und berührte sie zärtlich mit den Fingerspitzen. Sie sahen sich so ähnlich. Dunkles Haar, Mandelaugen. Arm in Arm standen sie da, fröhlich lachend. Nicht ahnend, was die Zukunft bringen würde. Nur ein Jahr darauf war ihre Welt in sich zusammengebrochen, und sie hatten nichts dagegen tun können.
Sie trat zurück ins Wohnzimmer und ging zu dem kleinen Sekretär in der Ecke. Dort lag sie. Ihre Telefonnummer. Sorgfältig notiert auf einem Zettel. Wie ein Wunder erschienen ihr die wenigen Zahlen. Sollte sie sie anrufen? Nur ein Mal ihre Stimme hören. Fragen, ob es ihr gutging. Das würde schon reichen. Oder doch nicht? Würde sie dann nach mehr verlangen und auf ein Wiedersehen hoffen? Das jedoch durfte es nicht geben. Sie war tot, gestorben, zu einer anderen geworden, um leben zu können. Um der Hölle zu entfliehen.
Sie zerknüllte das Papier und warf es in den Mülleimer. Fischte den Zettel wieder heraus, strich ihn glatt, nahm den Telefonhörer ab, legte ihn wieder auf. Nur einmal ihre Stimme hören. Mehr nicht. Sie tippte die Nummer und drückte auf die Wählentaste. Das Klingeln, einmal, zweimal. Dann nahm sie ab.
»Hallo?«
Die Stimme ihrer Schwester. Eindeutig. Tränen stiegen ihr in die Augen.
»Wer ist denn da?«
Kein Wort kam über ihre Lippen. Sie weinte still.
»Aber da ist doch jemand.«
Stille, ihr Atem. Es wurde aufgelegt.
Sie ließ den Hörer sinken und stand einfach nur da. Starrte auf den Boden, über den Sonnenflecken tanzten. Ihre Stimme. Sie klang so fremd und doch vertraut. Der Hörer glitt ihr aus der Hand und fiel zu Boden. Sie trat zurück auf die Terrasse, wo der Regenbogen verblasste. Sie sah ihm dabei zu, wie er sich immer weiter auflöste und irgendwann ganz verschwunden war. Wie die Vergangenheit, wie ein gemeinsames Leben, das ihnen geraubt worden war – damals, als die Stille in das Haus ihrer Kindheit eingezogen war und alles zerstörte.
Kapitel 1
ZÜRICH, MAI 2008
Anna erreichte den Platzspitz hinter dem Schweizerischen Nationalmuseum, an dem ihre gewohnte Joggingrunde begann, die an der Limmat entlangführte, und hätte am liebsten gleich wieder umgedreht, denn dort am Ufer stand ihr Exfreund Markus. Reichten nicht schon seine Anrufe? Sogar in der Bank, wo es langsam peinlich wurde. Was verstand der Mann nicht an: Es ist vorbei? Ein halbes Jahr hatte sie es mit ihm ausgehalten. Dann war ihr seine ständige Eifersucht endgültig so auf die Nerven gegangen, dass sie sich von ihm getrennt hatte. Sie brauchte keinen Aufpasser, der bei jedem Telefonat die Ohren spitzte und sie beinahe täglich von der Arbeit abholte, womit er ihr anfangs noch schmeichelte. Zunächst schien er noch ein vollendeter Gentleman mit seinen rehbraunen Augen und dem dunklen, lockigen Haar, gutaussehend, zuvorkommend, aber mit der Zeit wurde es anstrengend mit ihm. Sie hatte ihn in einem Café während ihrer Mittagspause kennengelernt. Zwei Abende später hatte er sie zum Essen eingeladen, und sie waren im Bett gelandet, was Anna am nächsten Morgen, als sie allein aufwachte, zunächst bereute. Sagte ihre Freundin Sara nicht immer wieder, dass beim ersten Date auf keinen Fall zu viel passieren durfte? Markus war jedoch geblieben und innerhalb weniger Wochen zu einer Klette mutiert, die ihresgleichen suchte.
Jetzt lehnte er also am Geländer des Mattenstegs und schenkte ihr sein strahlendstes Lächeln.
»Markus«, begrüßte Anna ihn mit säuerlicher Miene. »Was machst du hier?«
»Ich dachte, ich könnte mit dir laufen«, antwortete er. »Wir könnten noch einmal über alles reden. Weißt du …«
Weiter kam er nicht.
»Es gibt nichts mehr zu reden«, ließ Anna ihn nicht ausreden. »Wie oft soll ich es dir noch sagen? Es ist vorbei. Ich brauche kein Kindermädchen und auch keinen Bodyguard, der sogar mein Handy überwacht.«
Als sie ihn vor zwei Wochen dabei erwischte, wie er ihre SMS kontrollierte, war es endgültig vorbei gewesen, und sie hatte ihn wütend rausgeworfen.
»Sara wird gleich kommen und mit mir laufen. Wir sind verabredet.« Demonstrativ schaute Anna auf ihre Armbanduhr.
»Komm schon, Anna.« Er setzte seinen Dackelblick auf. Anna wandte sich ab. Noch vor einer Weile hatte sie es süß gefunden, wenn er sie auf diese Weise ansah. Mit der rosaroten Brille auf den Augen hatte er sie damit jedes Mal milde gestimmt. Doch dieses Mal würde er auf Granit beißen. Sollte er sich doch eine andere Dumme suchen, die seine Eifersuchtsanfälle und Schnüffeleien ertrug.
»Es ist vorbei, Markus«, antwortete sie um einen schroffen Unterton bemüht. »Und hör damit auf, mich ständig anzurufen oder mir irgendwo aufzulauern.«
Sein Blick wurde traurig. Er ließ die Schultern hängen. Er war ein guter Schauspieler, das musste sie ihm lassen. Doch dieses Mal würde ihm seine Show nichts nützen.
»Ich werde dir auch allen Freiraum lassen, den du brauchst«, startete er einen weiteren Versuch. »Ich war ein Esel. Ich liebe dich, Anna, ich will dich nicht verlieren.« Er machte einen Schritt auf sie zu und streckte die Hand nach ihr aus.
Anna versank in seinen traurigen Augen. In ihrem Magen begann es zu kribbeln. Reiß dich zusammen, schalt sie sich. Nicht wieder schwach werden. In spätestens drei Tagen wäre alles wie vorher.
»Hallo Anna«, kam ihr Sara zu Hilfe, die plötzlich hinter ihr auftauchte. »Markus, du auch hier?«
Anna atmete erleichtert auf und wandte sich um.
»Sara, wie schön. Da bist du ja endlich. Markus wollte gerade gehen.« Sie warf ihrem Exfreund einen kühlen Blick zu.
»Dann können wir ja los«, sagte Sara. »Sonst kommen wir auf dem Rückweg noch in die Dunkelheit. Bis irgendwann mal, Markus.« Ihre Stimme klang aufgesetzt freundlich, ihr Lächeln war unverbindlich und kühl. Anna, die sich ebenfalls mit knappen Worten von ihm verabschiedete, musste schmunzeln. Markus hatte Sara noch nie leiden können, was auf Gegenseitigkeit beruhte. Der geschleckte Typ bringt nur Ärger, hatte Sara von Anfang an gesagt. Wie recht sie doch hatte, dachte Anna, während sie Sara den Mattensteg über die Limmat folgte. Am anderen Ufer bogen sie in den Kloster-Fahr-Weg ein, der am Ufer entlang bis zum Kraftwerk Höngg ging, was den Wendepunkt ihrer Laufstrecke darstellte. Dort liefen sie über die Werdinsel ans rechte Ufer und zurück. Anna hatte nach ihrer Ankunft in Zürich vor drei Jahren mehrere Joggingrunden ausprobiert, und diese war zu ihrem Favoriten geworden. Sie liebte es, am Fluss entlangzulaufen und über das Wasser zu blicken, auf dem sich Schwäne, Enten und Blesshühner tummelten.
»Entschuldige, dass ich mich verspätet habe«, sagte Sara. »Aber es konnte ja keiner ahnen, dass er dir sogar hier auflauert.«
»Ich habe es fast befürchtet«, antwortete Anna seufzend. »Vor der Bank hat er ja schon mehrfach gestanden, und auch in meinem Stammcafé ist er vorgestern aufgetaucht. Ich bin ihm nur entgangen, weil ich sofort auf dem Absatz kehrtgemacht habe, bevor er mich entdeckt hatte.«
»Wenn das so weitergeht, wirst du noch eine Verfügung bei der Polizei erwirken müssen, damit er dich in Ruhe lässt. Ich habe dir ja gleich gesagt …«
»Ja, ja«, unterbrach Anna sie. »Er ist ein unangenehmer Typ, mit dem es nur Ärger geben wird – ich weiß. Die Polizei wird es schon nicht brauchen. Irgendwann wird er schon kapieren, dass es aus ist.«
»Hoffentlich findet er bald ein neues Opfer«, meinte Sara. »Irgendein Dummchen, das ihn vielleicht sogar heiratet. Dann hast du ein für alle Mal deine Ruhe.« Sie blieb stehen und japste nach Luft. Die Hände auf die Oberschenkel gestützt, ging sie sogar leicht in die Knie. Besorgt sah Anna ihre Freundin an.
»Was ist los? Geht es dir nicht gut?«
»Es wird schon besser. Plötzlich war mir schwindelig.«
»Das muss am Wetter liegen«, sagte Anna. »Diese ständige Schwüle geht mir auch an die Substanz, und ich bin kein wetterfühliger Mensch.«
»Nein, daran liegt es nicht«, erwiderte Sara und richtete sich auf. Plötzlich umspielte ein Lächeln ihre Lippen.
Annas Augen wurden groß.
»Nein … Du bist doch nicht etwa schwanger?«
»Doch. Sechste Woche«, platzte Sara heraus. »Deswegen war ich auch zu spät. Ich hatte noch einen Arzttermin. Sogar das kleine Herz schlägt schon. Ich habe es auf dem Monitor gesehen.«
»Gratuliere.« Anna umarmte Sara freudig. Sie wusste, wie lange Sara und Johannes sich schon ein Kind wünschten. Sie hatten die Hoffnung, dass es auf natürlichem Weg klappen könnte, beinahe aufgegeben. Sogar einen Termin in einer Fruchtbarkeitsklinik hatte Sara vor einigen Wochen vereinbart.
»Wie schön. Weiß es Johannes schon?«
»Noch nicht«, antwortete Sara. Die beiden setzten sich wieder in Bewegung, liefen aber nicht mehr, sondern spazierten einfach am Ufer entlang.
»Ich weiß gar nicht, wie ich ihm die guten Neuigkeiten mitteilen soll. Es einfach so zu sagen wäre doch unpassend nach all der Zeit, die wir darauf gewartet haben. Vielleicht sollte ich Babyschühchen kaufen oder einen Schnuller.«
»Das ist eine süße Idee. Ich freu mich so für dich!« Anna blieb stehen und umarmte die Freundin noch einmal. »Hoffentlich geht auch alles gut«, antwortete Sara. »Immerhin bin ich schon über dreißig.«
»Jetzt mach mal halblang«, suchte Anna, sie zu beruhigen. Du bist erst einunddreißig. Bestimmt wird alles völlig unkompliziert verlaufen. Allerdings müssen wir jetzt auf dich aufpassen. Ist dir übel?«
»Ein wenig morgens. Doch es ist erträglich. Und wie man sieht, wird mir beim Laufen schwindelig. Aber der Arzt meinte, ich könnte ganz normal weiter Sport machen. Nur Trampolinspringen sollte ich fürs Erste lassen.« Sie grinste. Die beiden fielen wieder in einen leichten Trab.
»Dann werde ich dich also bald als Schreibtischkollegin verlieren«, sagte Anna. »Wie soll ich ohne dich all diese Zicken ertragen?«
»So schlimm ist es auch wieder nicht. Mit den meisten verstehst du dich doch ganz gut.«
»Aber ohne dich wird es nicht dasselbe sein.«
»Vielleicht komme ich ja schon bald nach der Geburt zurück. Wir müssen sowieso überlegen, wie es weitergeht. Eine größere Wohnung können wir uns in Zürich kaum leisten, schon gar nicht mit einem Gehalt.«
»Da hast du recht«, erwiderte Anna seufzend. Auch sie bezahlte für ihre kleine Zweizimmerwohnung, die im Stadtteil Oerlikon lag, ein halbes Vermögen. Größere Sprünge waren, obwohl sie sehr gut verdiente, nicht drin. Bevor sie nach Zürich gekommen war, hatte sie auf deutscher Seite eine kleine Wohnung gehabt, die weniger als die Hälfte gekostet hatte. Doch der Ehrgeiz hatte sie in die Bankenmetropole geführt, wo sie bei der UBS-Bank als Investmentbankerin arbeitete. Sie war vier Jahre älter als Sara und verschwendete im Gegensatz zu ihr keinen Gedanken an Familie oder Kinderkriegen. Vielleicht war es auch das gewesen, was sie mit der Zeit an Markus geärgert hatte. Immer wieder hatte er vom Heiraten und einer Familie gesprochen. Ein Haus mit Garten, Idylle auf dem Land. Langeweile war da doch vorprogrammiert.
»Johannes spielt schon seit einer Weile mit dem Gedanken, aus Zürich wegzugehen. Basel ist auch interessant, und er müsste nur einen Versetzungsantrag stellen.«
»Und Johannes’ Eltern sind in Basel«, vervollständigte Anna Saras Ausführungen. »Also wirst du über kurz oder lang nicht nur deinen Schreibtisch, sondern auch Zürich verlassen?«
»Vermutlich. Aber sicher ist das noch nicht«, erwiderte Sara. »Es kann dauern, bis Versetzungsanträge genehmigt werden. Sollte es jedoch so kommen, haben wir es ja nicht weit. Basel ist nicht aus der Welt.«
»Nein, ist es nicht«, erwiderte Anna, wissend, dass sie Sara verlieren würde. Genauso war es mit ihrer Freundin Greta in Konstanz gewesen, wo noch immer ihre Mutter lebte. Sie kannten sich seit der Schulzeit und waren wie Pech und Schwefel gewesen. Dann jedoch hatte Greta geheiratet, war mit ihrem Ehemann nach Bern gezogen und schwanger geworden. Inzwischen hatte sie drei Kinder, ein Mädchen und Zwillingsjungen, die Anna einmal erlebt hatte, was sie niemals wiederholen wollte. Greta war mit der Rasselbande sichtlich überfordert gewesen und hatte ihr fast schon leidgetan. Inzwischen hatten sie kaum noch Kontakt. Gewiss würde es mit Sara so ähnlich enden, was Anna schon jetzt bedauerte.
Den Rest des Weges unterhielten sie sich über die Arbeit. Es ging um Aktienkurse und Kunden, die sie mal mehr, mal weniger leiden konnten. Der Bürokomplex der UBS wurde um einen Anbau erweitert, was in den nächsten Wochen eine Menge Baulärm bedeutete. Als sie den Platzspitz wieder erreichten, war es bereits dunkel geworden.
»Ist eben noch nicht Sommer«, kommentierte Sara den raschen Einbruch der Nacht.
»Aber es dauert nicht mehr lang«, antwortete Anna mit einem Lächeln. »Ich finde, es riecht schon danach.« Sie atmete die milde, nach Blumen duftende Abendluft ein und lächelte.
»Ich glaube, ich überrasche ihn mit den Schühchen«, ging Sara nicht auf Annas Antwort ein.
»Das ist eine gute Idee«, antwortete Anna, die diese Sorte Gedankensprünge von Sara gewohnt war.
»Bei Manor gibt es bestimmt schöne. Wenn du magst, können wir morgen in der Mittagspause zusammen welche aussuchen.«
»Das würdest du wirklich mit mir machen?«, fragte Sara.
»Aber natürlich«, erwiderte Anna und legte ihr den Arm über die Schulter. Sie liefen Richtung Museum. »Wann willst du es dem Chef sagen?«
»Erst nach dem dritten Monat«, antwortete Sara. »Dann ist es sicher.«
Sie erreichten die Straßenbahnhaltestelle und verabschiedeten sich voneinander, als Annas Bahn einfuhr. Anna nahm am Fenster Platz und winkte Sara zum Abschied noch einmal zu. Wie glücklich sie aussah, ihre Augen strahlten so. Vielleicht war es ja doch nicht so schlimm, eine Familie zu gründen? Anna schob den Gedanken beiseite und lehnte ihren Kopf, der leicht zu dröhnen begonnen hatte, gegen die Scheibe. Bei ihrem Händchen für Männer würde es mit dem Familienglück sowieso nichts werden. Als sie in Oerlikon ausstieg, lief sie wie immer am Hotel Stern vorüber, bog unweit davon in eine Seitenstraße ab und betrat kurz darauf den engen Hinterhof, in dem ihre Wohnung in einem von der Straße abgewandten Gebäude aus den fünfziger Jahren lag. Als sie in ihrem winzigen Flur das Licht anknipste, fiel ihr sofort das Blinken ihres Anrufbeantworters auf. Sie drückte auf die Playtaste, und die Stimme ihrer Mutter ertönte.
»Anna, bist du da? Du musst sofort herkommen. Ich hatte einen Fahrradunfall und liege im Krankenhaus.«
»Auch das noch«, fluchte Anna. Sie würde sich morgen den Tag frei nehmen müssen, was Thomas, ihrem direkten Vorgesetzten, vermutlich nicht gefiele. Am besten wäre es, sie sagte ihm gleich Bescheid und Sara auch. Dann musste sie eben die Schühchen für die Babyüberraschung ohne sie aussuchen. Anna fischte ihr BlackBerry aus der Tasche und begann, zwei Nachrichten zu tippen. Thomas antwortete sofort, verständnisvoller als erwartet, und schlug ihr sogar vor, sich bis zum Wochenende frei zu nehmen. Anna stimmte gern zu, dann hätte sie noch etwas Zeit, um Konstanz, ihre Heimatstadt, zu genießen. Vielleicht ergab sich ja auch die Möglichkeit, einige alte Freunde wiederzutreffen. Sie beschloss, gleich aufzubrechen. Nur schnell duschen und packen, dann würde sie sich auf den Weg machen.
Einige Stunden später öffnete Anna die Tür zu ihrem Elternhaus, das in einem ruhigen Ortsteil von Konstanz lag, in dem es hauptsächlich Einfamilienhäuser gab. Abgestandene Luft schlug ihr im Flur entgegen. Im Wohnzimmer entdeckte Anna jedoch, dass die Terrassentür offen stand. Ihre Mutter war noch nie gut darin gewesen, auf das Haus zu achten. Sie hatte nur Glück, dass Konstanz’ Einbrecherschaft von ihrer Schusseligkeit noch nichts mitbekommen hatte. Anna trat auf die Terrasse und ließ ihren Blick über die Gartenmöbel aus Teakholz in den dunklen Garten schweifen, der früher das Reich ihres Vaters gewesen war. Jetzt war er schon vier Jahre tot. Herzinfarkt mit zweiundsiebzig. Dabei hatten ihre Eltern noch so viele Pläne gehabt, nachdem er sich ein halbes Jahr vor seinem Tod endlich dazu durchgerungen hatte, seine Kanzlei an seinen Nachfolger zu übergeben. Ihre Mutter hatte sein plötzlicher Tod in ein tiefes Loch gerissen, aus dem sie nur langsam wieder herauskroch. Doch das Leben musste weitergehen. Inzwischen hatte sie einige neue Freundschaften geschlossen und ging auch wieder zum Yoga. Besonders Hilde, die Nachbarin von gegenüber, hatte sich sehr um ihre Mutter bemüht.
Ein klirrendes Geräusch hinter ihr ließ Anna zusammenzucken, sie wandte sich erschrocken um. Doch es war nur Felix, der grau-weiß getigerte Kater ihrer Mutter, der einen Blumentopf vom Fensterbrett gefegt hatte und sie mit seinen großen blauen Katzenaugen unschuldig ansah. Seufzend ging Anna zurück ins Haus und streichelte dem Kater über den Kopf, der sofort den Schwanz hob und vertrauensselig zu schnurren begann.
»Felix, du alter Gauner. Du hast mich erschreckt. Wenn das die Mama sieht.« Sie hob mahnend den Zeigefinger. Der Kater sprang vom Fensterbrett und strich um ihre Beine. »Du hast bestimmt Hunger, was?« Anna ging in die Küche und knipste das Licht an. Wie immer war alles ordentlich aufgeräumt. Von ihrer Mutter, einer wahren Putzfanatikerin, hatte sie auch nichts anderes erwartet. Glücklicherweise hatte sie Annas kleines Reich in Zürich noch nie betreten, in dem das Chaos einer berufstätigen Frau herrschte, womit Anna ihre Unordentlichkeit gern entschuldigte. Ihrer Meinung nach war Zeit etwas viel zu Kostbares, um sie mit Putzen zu verbringen. Die Küche ihrer Eltern war im Landhausstil gehalten, was Anna nicht sonderlich gefiel. Sie mochte lieber modernes Design und klare Linien. Aber die Größe des Raumes liebte sie. Es gab eine Kochinsel und eine gemütliche Essecke, in der ihre Mutter nun allein sitzen musste. Während Anna den Kühlschrank öffnete und das Katzenfutter herausholte, dachte sie darüber nach, wie oft sie ihrer Mutter schon vorgeschlagen hatte, das Haus zu verkaufen. Wer brauchte für sich allein schon über zweihundert Quadratmeter Wohnfläche? Vom riesigen Garten ganz zu schweigen. Doch ihre Mutter wiegelte jedes Mal ab. Hier war sie doch zu Hause. Woanders würde sie sich nicht wohlfühlen. So putzte sie sich also jeden Tag durch die Etagen bis ins Dachgeschoss, wo Annas früheres Reich lag. Ein geräumiges Zimmer mit eigenem Balkon und einem rosa gefliesten Badezimmer.
Genau in dem Moment, als Anna dem Kater sein Futter hinstellte, klingelte das Telefon. Als sie abhob, erklang die Stimme ihrer Mutter.
»Hab ich mir doch gedacht, dass du schon da bist«, sagte sie, ohne Anna zu begrüßen.
»Guten Abend, Mama«, erwiderte Anna mit einem Grinsen. »Was machst du denn? Was ist passiert?«
»Frag nicht«, antwortete ihre Mutter. »Dieser dämliche Gemüselaster. Wie ich den übersehen konnte, bleibt mir ein Rätsel. Gott sei Dank hat der junge Mann schnell reagiert, sonst wäre weiß der Himmel was passiert. So ist es nur ein Gipsbein.«
»Was schon schlimm genug ist«, sagte Anna.
»Leider ist Hilde nicht da, sonst hätte ich sie gefragt, ob sie mir ein paar Sachen ins Krankenhaus bringen kann. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm, dass ich dich von der Arbeit wegholen musste?«
»Gerade geht es«, antwortete Anna. Sie wusste, dass die Erkundigung ihrer Mutter nach der Arbeit reine Höflichkeit war. Wäre es nach ihr gegangen, hätte Anna Jura studieren sollen, um die Kanzlei ihres Vaters zu übernehmen. Doch mit Jura, dazu noch Strafrecht, konnte Anna überhaupt nichts anfangen. Bis heute hatte die Mutter ihr nicht verziehen, dass sie damals den Familienbetrieb nicht hatte weiterführen wollen. So war der Name der Kanzlei Volkmann nach der Übernahme bald geändert worden, was für ihre Mutter umso schwerer gewesen war. Ihr Vater hatte auf Annas Entschluss verständnisvoller reagiert. Ich werde dich zu nichts zwingen, hatte er ihr nach ihrem Abitur gesagt und Annas Entscheidung auch gegenüber seiner Frau verteidigt. Gewiss wäre er heute stolz darauf, wie gut sie sich in ihrem Job schlug.
»Du musst in Johannes’ Büro die Unterlagen für die Unfallversicherung suchen. Sie sind irgendwo dort abgelegt. Ich kann dir leider nicht mehr sagen, wo. Aber du wirst sie schon finden. Ich glaube, wir haben da eine Police, mit der man Schmerzensgeld bei Knochenbrüchen bekommt, was wenigstens ein kleiner Trost wäre.«
»Ich mache mich auf die Suche«, antwortete Anna. »Was soll ich noch mitbringen?«
Annas Mutter zählte eine lange Liste an Dingen auf. Nachthemd, Morgenmantel, das Buch, das sie gerade las, Toilettenartikel, das Shampoo sei bald leer und müsse neu gekauft werden, dazu noch Zeitschriften gegen die Langeweile. Als sie zum Schluss noch fragte, wann Anna am nächsten Tag käme, und diese sagte, im Laufe des Vormittags, kommentierte ihre Mutter dies mit dem üblichen Brummen, das darauf verwies, wie sehr ihr Annas ungenaue Zeitangabe missfiel.
Als sie aufgelegt hatte, fühlte Anna sich erschöpft, wie so oft, wenn sie länger mit ihrer Mutter gesprochen oder Zeit mit ihr verbracht hatte. Sie wusste nicht, warum, aber bei jedem Gespräch und jedem Treffen gab ihre Mutter ihr das Gefühl, ihren Ansprüchen nicht zu genügen. Die Tochter, die nicht rechtzeitig kam, die in Zürich arbeitete, nicht in die Fußstapfen des Vaters trat, so selten anrief, mal wieder zugenommen hatte und keinen anständigen Schwiegersohn, geschweige denn Enkelkinder ins Haus brachte. Anna schob ihren aufsteigenden Groll beiseite. Es hatte keinen Sinn, sich aufzuregen. Sie würde ihrer Mutter die Sachen vorbeibringen und dann ihre freien Tage in Konstanz genießen. Den Kater, der in Rekordzeit seine Schüssel leergefuttert hatte, im Schlepptau, verließ sie die Küche und betrat das Arbeitszimmer ihres Vaters, das ihre Mutter seit seinem Tod nicht verändert hatte. Sogar frische Blumen stellte sie wie seit Jahren zweimal die Woche auf den Tisch neben dem imposanten Bücherregal, das die komplette Längsseite des Raumes ausfüllte und Anna jedes Mal wieder beeindruckte. Vor dem Regal stand sein großer dunkel gebeizter Schreibtisch aus Eichenholz, der angeblich bereits seinem Großvater gehört hatte und inzwischen über hundert Jahre auf dem Buckel hatte. Zärtlich berührte sie die Lehne des Bürostuhls, dessen schwarzes Leder an den Armlehnen bereits etwas abgewetzt war. Plötzlich glaubte sie den Geruch seines Tabaks in der Nase zu haben, der zu diesem Raum genauso gehörte wie die dunklen Samtvorhänge an den Fenstern und das Bild ihres Großvaters an der Wand, der die Kanzlei aufgebaut hatte.
»Ich vermisse dich so sehr«, sagte Anna leise. »Weißt du noch, wie ich dich einmal gefragt habe, wie du es mit ihr aushältst? Du hast gesagt, du liebst sie einfach. Mehr braucht es nicht dazu. Und manchmal hilft es, nicht so genau hinzuhören.« Schelmisch hatte er ihr damals zugezwinkert. Wie sehr sich Anna doch wünschte, diese Gabe von ihm geerbt zu haben. Gewiss hätte sie es im Leben bedeutend leichter, wenn sie sich viele Dinge nicht so zu Herzen nehmen würde. Seufzend öffnete sie das Aktenschränkchen neben dem Bücherregal und ließ ihren Blick über die vielen ordentlich beschrifteten Ordner schweifen. Ganz unten links entdeckte sie, wonach sie gesucht hatte. Familie Volkmann – Privates stand in der Handschrift ihres Vaters darauf. Sie nahm den Ordner heraus, setzte sich damit an den Schreibtisch und begann, ihn durchzublättern. Unter einer Lasche waren hier die Heiratsunterlagen ihrer Eltern und ihre Geburtsurkunde abgelegt. Sie öffnete die Lasche und wurde stutzig, als ihr der Begriff Adoption ins Auge fiel. Welche Adoption? Sie blätterte die Unterlagen durch, und ihre Augen weiteten sich. Wenn sie diese Unterlagen richtig deutete, dann ging es hier um ihre eigene Adoption. Aber das konnte doch gar nicht sein. Niemals war darüber gesprochen worden. Sie war Anna Volkmann, die ihrem Vater, ja sogar ihrem Großvater ähnelte. Jedenfalls sagten das die Leute immer. Dunkle Augen, welliges dunkelbraunes Haar, Grübchen an den Mundwinkeln, derselbe Dickkopf. Doch hier stand es schwarz auf weiß. Ihr Name war von Regula, wie in den Unterlagen stand, auf Anna geändert worden.
»Regula«, murmelte Anna fassungslos, während sie ihre Geburtsurkunde überflog, die ganz anders aussah als das Dokument, das sie in ihren Unterlagen bei sich zu Hause aufbewahrte. Jetzt fiel ihr wieder ein, was für einen Wirbel ihre Mutter damals veranstaltet hatte, als Anna nach ihrer Geburtsurkunde wegen der Beantragung eines Reisepasses gefragt hatte. Es hatte geschlagene drei Wochen gedauert, bis ihre Mutter endlich mit dem Dokument rausrückte, in dem alles ganz normal aussah. Mutter unbekannt stand auf dieser Urkunde. Anna sei in einem Ort namens Hindelbank geboren worden. Fassungslos las sie Datum und Uhrzeit. Das war ihr Geburtsdatum, daran gab es keinen Zweifel. War sie etwa gar keine Volkmann?
Ihr Blick wanderte zu der Schwarzweißfotografie ihres Großvaters, von dem sie angeblich die Grübchen geerbt haben sollte. Fassungslosigkeit breitete sich in ihr aus. Ihr ganzes Leben lang war sie belogen worden. Ihr wurde übel. Sie sprang auf und rannte in den Garten, wo sie sich übergab. Die Tränen schossen ihr in die Augen. Nur in Filmen oder Büchern machten Menschen solche Entdeckungen, aber doch nicht im realen Leben. Sie war nicht Anna Volkmann, sondern ein Mädchen namens Regula. Diesen Namen hatte ihre wirkliche Mutter ihr gegeben. Diese Erkenntnis traf Anna bis ins Mark. Ihre wirkliche Mutter, der sie vielleicht tatsächlich ähnelte. Eine Lüge. All die Jahre war sie belogen worden. Das innere Gefühl, war es Instinkt gewesen? Sie hatte es gespürt, geahnt. Sie hatte eine richtige Mutter, die sie vielleicht so geliebt hätte, wie sie war. Das machten richtige Mütter doch. Sie umarmten ihre Kinder, drückten sie fest an sich, lobten sie, sagten ihnen, wie sehr sie sie liebten. Hatte ihre Mutter jemals gesagt, dass sie sie liebte? Anna wusste es nicht mehr.
Doch wieso hatte ihre richtige Mutter sie weggegeben? Wer war die Person, deren Name in den Unterlagen nicht genannt wurde? Wer war sie wirklich, und woher stammte sie? Regula. Was für ein hübscher Name. Wieso hatten ihre Eltern ihn geändert? So viele Fragen, und sie konnte nur einen einzigen Menschen um Antworten bitten. Ihre Mutter. Oder jedenfalls die Frau, die sie all die Jahre dafür gehalten hatte. Anna schniefte, zog die Nase hoch, rieb sich fröstelnd über die Arme und blickte zum Haus. Sollte sie ihre Mutter gleich anrufen und danach fragen? Sie entschied sich dagegen. Solche Dinge besprach man nicht am Telefon. Aber wie redete man überhaupt darüber? Was sollte sie sagen? Ich wurde adoptiert. Du hast mich belogen. Schon bei dem Gedanken daran wusste Anna, dass sie heulen müsste. Sie wollte nicht vor ihrer Mutter heulen, alles, nur keine Schwäche zeigen. Wer Schwäche zeigt, verliert, hatte ihre Mutter immer gesagt. Wie Anna diesen Satz hasste. Dann würde sie eben heulen. Das war jetzt auch egal. Sie war nicht ihre richtige Tochter, also durfte sie auch Schwäche zeigen. Starke Mädchen weinen nicht, hatte es immer geheißen. Vielleicht wäre Regula in den Arm genommen und getröstet worden. Entschlossen ballte Anna die Fäuste. Ihre Mutter schuldete ihr Antworten, ob es ihr gefiel oder nicht.
Sie ging zurück ins Arbeitszimmer ihres Vaters, klappte den Ordner zu und nahm ihn mit ins Dachgeschoss, wo sie die vertraute Welt ihrer Kindheit empfing, die mit einem Schlag Risse bekommen hatte. Sie knipste die Stehlampe neben der Tür an und ließ ihren Blick durch den Raum schweifen. Ihr Schreibtisch unter dem Dachfenster, ihr breites Bett mit den vielen Kuscheltieren darauf, um das sie ihre Freundinnen stets beneidet hatten, der große weiße Kleiderschrank mit dem Spiegel in der Mitte, in dem jetzt alte Wintermäntel und Tischtücher aufbewahrt wurden. Anna blieb vor dem Spiegel stehen und sah sich an. Die braunen Augen, die Grübchen, das wellige dunkle Haar. Sie glich tatsächlich ihrem Vater. Selbst er, der doch stets ihr Verbündeter im Kampf gegen die Mutter gewesen war, hatte sie all die Jahre belogen. Weshalb nur? Aus Feigheit? Die Angst vor dem, was kommen würde. Die Angst, sie zu verlieren. Er hatte sie akzeptiert, wie sie war, ihr zugehört und stets Mut gemacht – er hatte sie geliebt. Wieso nur hatte er nie etwas gesagt? Seine Antwort auf diese Frage hatte er mit ins Grab genommen. Seufzend wandte sich Anna vom Spiegel ab und setzte sich aufs Bett. Der Kater Felix sprang neben sie und rollte sich zwischen den Kuscheltieren zusammen. Anna sah ihm einen Moment dabei zu, wie er die richtige Schlafposition suchte. Erneut traten Tränen in ihre Augen. Ohne Vorwarnung war etwas so Unbegreifliches über sie hereingebrochen, und sie wusste nicht, wie sie damit umgehen sollte. Irgendwann sank sie neben dem Kater in die Kissen und ließ ihren Tränen freien Lauf. Dieses Zimmer, dieses Haus, das Vertraute fühlte sich plötzlich fremd an. Die Gedanken wirbelten in ihrem Kopf durcheinander. Regula. Wer war sie wirklich? Irgendwann schlief sie erschöpft ein.
Helles Sonnenlicht, das durch das Dachfenster aufs Bett fiel, weckte Anna am nächsten Morgen. Sie öffnete die Augen und blinzelte. Felix war verschwunden, und der Großteil der Kuscheltiere lag auf dem Boden. Die Zeiten, in denen sie Teddys und Diddlmäuse benötigte, die über ihren Schlaf wachten, waren lange vorbei. Sie richtete sich gähnend auf und blickte auf den Familienordner, der neben dem Bett auf dem Boden lag. Er war plötzlich zum Hassobjekt geworden. Ohne ihn und seinen dämlichen Inhalt wäre alles wie immer. Hätte sich ihre Mutter doch niemals das Bein gebrochen, dann würde sie jetzt in Zürich in ihrem Büro sitzen und später gemeinsam mit Sara Babyschühchen aussuchen gehen. Doch nun war alles anders, ihr ganzes Leben stand in Frage. Adoptiert, ein fremdes Kind. War das die Erklärung für das schwierige Verhältnis zu ihrer Mutter? Sie kannte doch genug Leute, die sich mit einem Elternteil nicht verstanden. Und gewiss waren nicht alle von ihnen adoptiert worden. Die Beziehung zu ihrer Mutter war nicht perfekt, aber was war schon perfekt? Überall gab es doch Reibereien und Meinungsverschiedenheiten. Vor ihrem inneren Auge tauchte das Bild ihres Großvaters auf, der bereits vor ihrer Geburt gestorben war. Heinrich Volkmann, der bekannte Jurist, der die führende Kanzlei Volkmann aufgebaut und an seinen Sohn Johannes weitergegeben hatte. Die nicht eintretende Schwangerschaft musste für ihre Eltern eine große Schmach gewesen sein. Und dann war da das Adoptivkind gewesen. Ein Mädchen, das sich mit Händen und Füßen weigerte, Jura zu studieren. Das Mädchen, das eine andere Mutter hatte und erst jetzt zu begreifen begann, weshalb die Dinge so waren, wie sie nun einmal waren. Ihr Vater schien es verstanden zu haben. Aber vielleicht hatte er auch einfach nur resigniert. Sie war nicht der erhoffte Sohn, der in seine Fußstapfen treten und seinem Vater Ehre machen würde. Er schien begriffen zu haben, dass sie nie ein wirklicher Teil von ihnen gewesen war, und hatte sie vielleicht gerade deshalb unterstützt. Die vielen Diskussionen mit ihrer Mutter, das Gefühl, sich fehl am Platz, ja nicht richtig geliebt zu fühlen. Plötzlich fand sich eine Erklärung für all diese Empfindungen. Oder war sie jetzt ungerecht? Wie viel Liebe musste man für ein fremdes Kind empfinden, um es als sein eigenes anzunehmen und aufzuziehen? Sie wusste es nicht. Bis gestern hatte sie sich über solche Dinge nie Gedanken machen müssen. Sie war einfach Anna Volkmann, die Tochter des renommierten Anwalts Johannes Volkmann gewesen. So sehr wünschte sie sich plötzlich, er wäre noch da. Mit ihm würde es ihr leichter fallen, über all ihre Fragen zu sprechen. Er würde den Arm um sie legen und sie in sein Gartenreich entführen, wo sie so viele Stunden miteinander verbracht hatten. Auf der Bank am Teich sitzend, würde er erklären, was damals geschehen war. Und gewiss würde er ihr sagen, dass er sie liebte. In Annas Augen traten Tränen, und sie sagte laut: »Ich liebe dich auch, Papa.«
Eine erste Träne kullerte über ihre Wange. Sie wischte sie ab, zwang sich zu einem Lächeln. »Ich weiß, du magst es nicht, wenn ich heule. Ich hör ja auch schon wieder auf damit.«
Genau in diesem Moment tauchte der Kater Felix wieder auf, eine Maus in der Schnauze.
»Felix, nein!«, rief Anna erschrocken aus und sprang auf. Stolz legte das Tier seine Jagdtrophäe vor ihr auf den Teppich und sah sie erwartungsvoll an.
»Und jetzt willst du auch noch gelobt werden«, entrüstete sich Anna und stemmte die Hände in die Hüften. Doch plötzlich kam Leben in die Maus, und sie huschte unters Bett.
»Iihhhh!«, rief Anna. »Die lebt ja noch.«
Felix folgte der Maus blitzschnell unters Bett. Anna sprang zur Seite. Die Maus sauste an ihr vorüber in den Flur und ins Badezimmer, verfolgt von Felix.
»Jetzt muss ich auch noch eine Maus retten.« Anna schüttelte den Kopf und folgte dem Kater. Die Maus schien sich hinter dem Waschbeckenunterschrank verkrochen zu haben.
»Da hast du uns ja einen netten Gast ins Haus geschleppt«, sagte Anna zu Felix und hob ihn in die Höhe. Der Kater reagierte unleidig, wehrte sich gegen sie und kratzte sie am Unterarm. Doch Anna ließ sich nicht beirren. Sie schaffte den zappelnden Burschen aus dem Raum und erklärte ihm, dass die Maus jetzt offiziell unter ihrem Schutz stünde. In ihrem alten Badezimmer würde es keine Morde geben. Das wäre ja noch schöner. Nachdem der Kater draußen war, schob sie den Waschbeckenunterschrank zur Seite, und das Mäuschen floh in die Zimmerecke hinter der Toilette, wo Anna es schließlich mit Hilfe des Körbchens, in dem normalerweise die Haarbürsten lagen, einfangen konnte. Rasch drehte sie den Korb um und deckte ihn mit den Händen ab.
»Das wäre geschafft«, sagte sie und öffnete die Badezimmertür. Sofort stürmte erneut Felix in den Raum. Anna schloss hinter ihm die Tür und lief grinsend die Treppe nach unten. Ein kleiner Sieg für das Leben am Morgen. Das hob ihre Stimmung. Im Wohnzimmer bemerkte sie schuldbewusst, dass auch sie die Terrassentür gestern Abend offen gelassen hatte, was erklärte, wie Felix an die Maus gekommen war. Sie lief ein Stück in den Garten und ließ das Mäuschen in der Nähe der blühenden Rhododendronbüsche frei. Schnell huschte der kleine Kerl davon.
»Und nimm dich vor weiteren Katzen in Acht«, rief Anna ihm lächelnd hinterher. Sie wandte sich um und blickte auf ihr Elternhaus, das friedlich in der Morgensonne vor ihr lag. Die Mäusejagd hatte sie sonderbarerweise ruhiger werden lassen. Alltag, das Leben, es hielt sich selten an irgendwelche Regeln. Und vielleicht fand sich durch die Wahrheit endgültig die Gelegenheit, den anderen besser zu verstehen. Sie hoffte es jedenfalls.
Zwei Stunden später stand Anna vor dem großen Klinikgebäude und blickte die Fensterfront hinauf. Was würde sie sagen? Auf dem Weg hierher war sie tausend Möglichkeiten im Kopf durchgegangen. Keine hatte sich wirklich gut angehört. In Händen trug sie die Reisetasche ihrer Mutter und eine Tüte voller Zeitungen und Knabberkram, selbstverständlich auch mit dem Shampoo. Ein normaler Krankenbesuch, wie ihn Familienangehörige übernahmen. Denn das war die Frau, die hinter einem dieser Zimmer auf sie wartete, für sie, ob adoptiert oder nicht. Eine andere Mutter kannte sie nicht. Sie hatte niemals zu ihrer Tochter gestanden, die nicht einmal ihren Namen kannte. Er stand nicht in den Unterlagen. Ihre wirkliche Mutter war eine Fremde für sie. Vielleicht war sie am Ende sogar froh gewesen, sie los zu sein. Ein Kind konnte eine Belastung darstellen. Oder vielleicht doch nicht? Vielleicht war diese Frau traurig gewesen, ihr Kind fortgeben zu müssen. Anna schob den Gedanken beiseite. Grübeln würde sie jetzt nicht weiterbringen. Sie atmete tief durch und ging weiter. Irgendwie würde sie es schon hinbekommen, das Thema anzuschneiden. Und manchmal reinigte die Wahrheit ja auch die Luft und machte vieles leichter.
Sie betrat das Krankenhaus, erkundigte sich am Empfang nach der Zimmernummer ihrer Mutter und stand keine fünf Minuten später vor ihrer Tür. Jetzt gab es kein Zurück mehr, dachte sie, während sie die Türklinke nach unten drückte und den Raum betrat.
Ines Volkmann hatte selbstverständlich ein Einzelzimmer. Etwas anderes kam für die Witwe eines erfolgreichen Anwalts gar nicht in Frage. Sie begrüßte Anna mit spitzer Stimme.
»Da bist du ja endlich. Ist ja gleich Mittag. Ich dachte schon, du kommst gar nicht mehr.« Sie zog sich an einem Bügel hoch, der über ihrem Bett hing, und deutete auf die Reisetasche.
»Ich hoffe, du hast nichts vergessen. Hast du noch Shampoo besorgt? Ich sehe scheußlich aus. Die Schwester muss mir später beim Haarewaschen helfen. Bettlägerigkeit muss ja nicht gleich Ungepflegtheit nach sich ziehen.« Missbilligend musterte sie Anna, die Jeans, T-Shirt und ihre ausgetretenen Sneaker trug, von oben bis unten. »Wie du wieder aussiehst. Und ich dachte immer, Investmentbankerinnen laufen den ganzen Tag im Kostüm und mit Stöckelschuhen durch die Gegend. Und was hast du mit deinen Haaren gemacht? Sie sind so struppig.«
Anna bemühte sich um Fassung.
»Dir auch einen guten Morgen, Mama. Selbstverständlich habe ich dein Shampoo besorgt, natürlich auch deine Lieblingszeitungen.« Auf die kritischen Anmerkungen ihrer Mutter ging sie nicht ein, stattdessen fragte sie, während sie die Reisetasche öffnete und die Toilettentasche ins Bad brachte, was der Arzt gesagt habe.
»Der war eben erst hier und hat mir die frohe Kunde von einer Operation überbracht, die morgen gemacht werden soll. Der Knochen muss verschraubt werden.«
»Das hört sich übel an.«
»Da werde ich wohl meine Reise nach Südfrankreich dieses Jahr vergessen können. Und Hilde hat schon unser Ferienhäuschen gebucht. Sie wird nach ihrer Rückkehr aus allen Wolken fallen.«
»Wo steckt sie überhaupt?«, fragte Anna.
»Bei ihrer Mutter in St. Gallen. Die ist dort in einem Heim untergebracht und hatte gestern Geburtstag, den fünfundneunzigsten. Vielleicht könnte Hilde ja allein fahren …«
»Jetzt warte doch erst einmal ab«, antwortete Anna. »Ihr fahrt doch erst Mitte August. Wahrscheinlich ist bis dahin alles wieder in Ordnung. Hat der Arzt eine Prognose gegeben, wie lange der Heilungsprozess dauern wird?«
»Er meinte, in sechs Wochen sei alles vorbei. Aber ich kann das gar nicht glauben. Das Bein schmerzt, trotz der Medikamente, die sie mir geben, ganz fürchterlich.«
»Jetzt noch. Aber wenn du erst einmal die Operation überstanden hast, wird es bestimmt schnell besser«, suchte Anna, ihre Mutter zu beruhigen.
»Wenn ich doch nur nicht so flott um die Kurve gefahren wäre. Dieser dämliche Gemüselaster. Der hat eine Vollbremsung hingelegt, das kann ich dir sagen.«
»Gott sei Dank hat er die hingelegt«, entgegnete Anna. »Sonst hättest du jetzt ganz andere Sorgen als ein gebrochenes Bein.«
»Vermutlich hätte ich dann gar keine Sorgen mehr«, antwortete Ines. Dann fragte sie: »Hast du die Versicherungspolice gefunden? Es wäre wenigstens ein kleiner Trost, wenn es für diesen Blödsinn Schmerzensgeld gäbe.«
»Ja, habe ich«, antwortete Anna. Ihr Herz schlug schneller, sie spürte ihren Pulsschlag am Hals. Sie wandte sich von ihrer Mutter ab und zog den mitgebrachten Ordner mit den Familiendokumenten aus der Reisetasche, in der sich neben den Geburts- und Heiratsurkunden auch die Versicherungsunterlagen für die Lebens- und Unfallversicherung befanden.
»Ich habe noch mehr gefunden.« Anna machte eine kurze Pause, bevor sie sich mit dem Ordner in Händen umdrehte. Sie schaute ihrer Mutter direkt in die Augen, als sie sagte: »Meine Adoptionsunterlagen.«
Ines erblasste. Zum ersten Mal, seit Anna denken konnte, schienen ihrer Mutter die Worte zu fehlen. Einen Moment lang sahen sie einander nur an. In Annas Ohren begann es zu rauschen.
»Ach Anna«, sagte ihre Mutter leise. Anna glaubte Tränen in ihren Augen zu erkennen, die sie sonderbarerweise ruhiger werden ließen. »Komm, und setz dich zu mir.« Sie bedeutete Anna, auf dem Stuhl neben dem Bett Platz zu nehmen, was sie auch tat. »Dein Vater hat immer gesagt, sie hat ein Recht darauf, es zu erfahren, doch er wollte warten, bis du alt genug bist, um es zu verstehen. Ich meine, ein Kind kann doch mit solchen Dingen nicht umgehen. Doch dann verging die Zeit, du wurdest ein Teenager und irgendwann volljährig, und je mehr Zeit verstrich, desto unwichtiger erschien es uns, die Wahrheit zu sagen. Du warst ein Teil von uns, siehst deinem Vater sogar ähnlich, findest du nicht?« Sie berührte zärtlich Annas Hand und fuhr fort, ohne eine Antwort von Anna abzuwarten.
»Es kam einfach nicht mehr zur Sprache. Du bist unser Kind, meine Tochter, die ich liebe, sonst nichts.«
Anna wusste nicht, was sie erwidern sollte. Die Worte ihrer Mutter überwältigten sie. All die Kritik der letzten Jahre, ihre oftmals harschen Worte. Mit wenigen Sätzen hatte sie es fertiggebracht, alles fortzuwischen.
»Wir haben lange versucht, eigene Kinder zu bekommen«, fuhr ihre Mutter fort. »Doch es sollte einfach nicht sein. Aber ich wollte immer ein Kind haben. Deshalb schlug Johannes irgendwann vor, wir sollten eines adoptieren.«
»Und warum gerade mich?«, fragte Anna. »Ich meine, ich bin doch ein Mädchen. Wollte Papa nicht lieber einen Jungen haben, der eines Tages die Kanzlei übernehmen würde?«
»Das stimmt schon, aber wir haben damals nicht konkret angegeben, dass wir einen Jungen haben wollten. Als wir damals aufbrachen, um dich aus dem Waisenhaus abzuholen, wussten wir nicht, ob ein Junge oder ein Mädchen auf uns wartete. Die Dame von der Jugendfürsorge hatte nur von einem Neugeborenen erzählt, das zwei Wochen alt war und zur Vermittlung stand. Ich weiß noch genau, wie dein Vater dich zum ersten Mal gesehen hat. Wir standen vor dem kleinen Gitterbettchen, und seine Augen strahlten auf diese besondere Art und Weise. So hat er sein ganzes Leben lang nur dich angesehen. Behutsam hat er dich auf den Arm genommen und dir sofort den Namen Anna gegeben. Seit diesem Tag hat euch irgendetwas verbunden. Es mag keine Bluts-, aber gewiss eine Seelenverwandtschaft gewesen sein. Dessen bin ich mir sicher.«
»Und was ist mit dir?«, fragte Anna.
»Was soll mit mir sein?«
»Liebtest du mich auch vom ersten Augenblick an?« Diese Frage schien Ines zu treffen. Sie brauchte einen Moment, um die richtige Antwort zu finden.
»Ehrlich gesagt: Ich weiß es nicht«, antwortete sie irgendwann. »Ich hatte mir das alles anders vorgestellt. Eine Schwangerschaft, eine Geburt, etwas, das von mir bleibt. Und dann trafen wir die Entscheidung zur Adoption, und plötzlich warst du da. Es gab keinen dicken Bauch, keine Morgenübelkeit, nichts von dem, was die Frauen um mich herum erlebten. Ich fühlte mich, besonders in den ersten Jahren, in der Gesellschaft anderer Mütter stets unwohl. Ständig dachte ich, ich wäre gar keine richtige Mutter, weil ich dich ja nicht auf die Welt gebracht hatte. Mir fehlten all die Erfahrungen, die die anderen Mütter gemacht hatten, als sie ihre Kinder zur Welt brachten. Verstehst du das?«
»Vielleicht«, erwiderte Anna zögerlich und versuchte, den Kloß im Hals hinunterzuschlucken. »Aber weißt du: Für mich warst du meine richtige Mutter. Ich hatte keine andere.« Tränen stiegen in Annas Augen. Sie blinzelte und wandte den Blick ab.
»Ach Mädchen.« Ines nahm die Hand ihrer Tochter und drückte sie fest. »Es tut mir so leid. Ich wollte es dich nicht spüren lassen. Wirklich nicht. Ich liebe dich doch. Das musst du mir glauben.«
Anna wischte sich über die Augen und nickte. Es tat gut, diese Worte aus dem Mund ihrer Mutter zu hören.
»Ich glaube, das hast du noch nie gesagt«, sagte sie.
»Was habe ich noch nie gesagt?«
»Dass du mich liebst. Nie hast du es ausgesprochen. Oder mich in den Arm genommen, wie es andere Mütter mit ihren Kindern machen.«
Überrascht schaute Ines Anna an, dann breitete sie plötzlich die Arme aus. »Dann tue ich es jetzt. Wenn du es noch willst?«
»Natürlich will ich das«, antwortete Anna, stand auf und ließ sich von ihr umarmen. Ihr Krankenhausnachthemd roch nach Desinfektionsmittel, ein letzter Hauch Parfüm hing noch in ihrem Haar. Fest drückte Anna ihre Mutter an sich. Es fühlte sich an, als hätten sie sich endlich gefunden. Eine Krankenschwester war es, die den Moment zerstörte. Sie öffnete die Tür und betrat fröhlich grüßend den Raum. Wie ertappt löste sich Anna aus der Umarmung und sank zurück auf ihren Stuhl.
»Oh, Sie haben Besuch, Frau Volkmann. Wie schön. Ich bringe Ihr Mittagessen.« Sie stellte ein Tablett auf den Krankenhausnachttisch neben dem Bett und verschwand wieder. Argwöhnisch beäugte Ines den daraufstehenden Teller, der von einer grünen Plastikhaube abgedeckt wurde.
»Krankenhausfraß.«
»Lass uns erst einmal nachsehen, was es gibt«, erwiderte Anna. »Vielleicht ist es ja gar nicht so übel.« Der Moment der Annäherung schien mit einem Schlag wie fortgewischt zu sein.
Ines hob den Deckel in die Höhe und blickte auf ein undefinierbares Stück Fleisch, das in einer hellbraunen Soße schwamm. Dazu gab es Reis.
»Reis, ich hasse Reis.«
»Ich könnte einen Lieferservice anrufen, und wir essen gemeinsam zu Mittag«, schlug Anna vor.
»Musst du nicht zurück nach Zürich?«, fragte ihre Mutter erstaunt. »Ich dachte, ihr Investmentbanker hättet immer so viel zu tun.«
»Mein Chef hat mir bis zum Wochenende freigegeben«, antwortete Anna und zückte ihr Handy. »Liefert Paolo noch aus?«
»Aber sicher«, antwortete ihre Mutter mit einem Lächeln. Hanna orderte also einmal hausgemachte Ravioli und eine Pizza Funghi, dazu zwei gemischte Salate. Als sie auflegte, lehnte sich ihre Mutter lächelnd zurück.
»Es ist schön, dich hier zu haben. Jetzt fühlt sich das Krankenhaus nur noch halb so schlimm an.«
Anna nickte, hatte jedoch noch ein paar Fragen.
»Weißt du eigentlich, wer meine Mutter war?«
Die Frage schien ihre Mutter zu treffen. Das Lächeln auf ihren Lippen erstarb. Sie schüttelte den Kopf.
»Nein, das weiß ich nicht. Die Frau von der Fürsorge sagte auf mein Nachfragen, ein junges Mädchen, das mit dir überfordert gewesen sei.«
Anna nickte. Mit einer Antwort dieser Art hatte sie gerechnet.
»Aber es ist doch auch nicht wichtig, oder?« Ines nahm Annas Hand. »Ich bin deine Mutter, und Johannes war dein Vater, kein anderer. Diesen Gedanken darfst du niemals zulassen. Hörst du!«
»Das werde ich nicht«, versprach Anna und schlug den Ordner mit den Papieren, der noch immer geöffnet auf dem Bett lag, zu. Nach einem Moment der Stille sagte sie: »Denn er war der beste Vater, den sich ein Mädchen nur wünschen kann.«
Kapitel 2
BERN, OKTOBER 1969
Lena lief neben ihrer Freundin Franzi und streckte ihre Nase der Sonne entgegen. Allzu lange würde diese wohl nicht mehr scheinen. Eine dicke Wolkenwand am Horizont kündigte Regen an. Die beiden Mädchen waren auf dem Rückweg vom Bärenplatz, wo Franzis Vater einen Kiosk hatte. Franzi brachte ihm jeden Tag um zwei seine Mittagssuppe, wobei Lena sie häufig begleitete. Franzis Vater, ein rundlicher Mann mit Nickelbrille, schenkte den Mädchen oft ein Karamellbonbon, manchmal sogar bunte Aufkleber oder ein Comic-Heft der letzten Woche. Heute war einer dieser Tage gewesen. Zwei Comic-Hefte hatte er Lena geschenkt, eines für sie und eines für ihre Schwester Marie. Dazu zwei Karamellbonbons, von denen eines gerade auf Lenas Zunge zerging. Lena gefiel der Zeitungskiosk, der mit seinen vielen Zeitungen und Illustrierten so schön bunt war. Sie mochte auch die Tauben, die auf dem Dach des runden Häuschens saßen und gurrten. Franzis Vater hingegen nannte die Vögel »Ratten der Lüfte« und scheuchte sie fort, da sie ihm auf die Zeitungen machten und ihm das Geschäft im wahrsten Sinne des Wortes versauten. Der Verkaufsstand war schon lange in Familienbesitz. Vermutlich würde auch Karl, Franzis Bruder, Zeitungen verkaufen, weshalb seine Schwester neidisch auf ihn war, die das Geschäft selbst gern weitergeführt hätte. Aber innerhalb der Familie Gruber wurde der Kiosk nur an Männer weitergegeben. Allerdings fand Karl, der einige Jahre älter als Franzi war, die Aussicht, Zeitungen zu verkaufen, völlig uninteressant. Er schraubte lieber an Autos herum und hasste es, wenn er im Geschäft helfen musste. Franzi hoffte darauf, dass ihr Vater doch noch ein Einsehen hätte und ihr den Kiosk überließe. Allerdings war sie genau wie Lena erst elf Jahre alt, und es würde noch viel Wasser die Aare hinunterlaufen, bis es so weit wäre, und die beiden Mädchen hatten ein anderes Thema.
»Im Bäckerladen reden sie über dich und Marie«, sagte Franzi. »Die Stellmacherin und die Großackerin. Sie sagten, dass was passieren muss und es so nicht weitergehen kann. Ihr würdet verwahrlosen. Und andere Frauen würden auch ihren Mann verlieren und sich nicht so anstellen.«
»Sollen sie doch reden«, antwortete Lena und reckte das Kinn nach vorn. »Mama geht es schon viel besser.« Franzi warf ihr einen kurzen Seitenblick zu, der alles sagte. »Na gut. Fast besser«, gab sie zu. »Aber gestern hat sie Marie immerhin angelächelt, als sie ihr die Suppe brachte.«
»Aber sie redet noch immer nicht, oder?«, fragte Franzi.
Lena schüttelte den Kopf und spürte einen Kloß im Hals. Gleich würde sie heulen, und das wollte sie nicht. Niemand sollte wissen, wie verzweifelt sie war. Seit dem Tod ihres Vaters vor einem Jahr war ihr Leben ein anderes geworden. Ihre Mutter hatte sich sehr verändert. Sie redete nicht mehr, schlich wie ein Geist durchs Haus und kümmerte sich um nichts. Es schien, als wäre sie mit Papa gestorben. Ihre Schwester Marie meinte, die Traurigkeit der Mutter würde gewiss enden und bald schon würde sie sich wieder um ihre beiden Töchter kümmern. Lena wollte so gern daran glauben, doch besonders in der letzten Zeit zweifelte sie immer häufiger daran. Und der Bericht ihrer Freundin befeuerte ihre Ängste noch mehr. Kinder, die verwahrlosten, kamen ins Heim und wurden verdingt. Das wusste Lena von Martin aus der Nachbarschaft, der hatte einen Freund, der im Heim gewesen war und nun bei Martins Vater im Laden arbeitete und bei ihnen wohnte. Sein Name war Simon, und seine Mutter war eine Hure, jedenfalls sagte Martin das. Und damit Simon nicht verwahrloste, sei er ins Heim gekommen und wurde verdingt, wie man es nannte, wenn die Heimkinder arbeiten gingen.
Aber Lenas Mutter war keine Hure, und sie verwahrlosten auch nicht.
»Die Stellmacherin soll mal schön still sein, das alte Tratschweib«, sagte Lena. »Ständig hat sie bei uns anschreiben lassen, und nicht nur einmal hat Papa nachfragen müssen, wo das Geld bleibt. Einmal war er deswegen schon so wütend, dass er gesagt hat, er würde sie nicht mehr bedienen.«
»Das stimmt«, meinte Franzi. »Im Anschreibenlassen ist sie gut. Das macht sie bei uns auch immer. Aber mir gefällt nicht, dass die Nachbarn reden. Am Ende melden sie euch noch der Fürsorge.«
»Und dann?«, entgegnete Lena trotzig. »Wir werden ihnen sagen, dass es uns gutgeht. Mama ist nur traurig, mehr nicht. Wir sind keine Waisen und verwahrlost auch nicht. Ich hab jeden Tag ein sauberes Kleid an, und Marie kocht für uns.«
»Und was ist mit dem Geld?«, fragte Franzi vorsichtig.
»Was soll damit sein?«, antwortete Lena. »Es ist in der Keksdose in der Küche.«
»Und du denkst, da gehört es hin?«
»Wieso nicht? Marie meint, da ist es besser aufgehoben als in der Ladenkasse. Am Ende bricht noch einer ein und klaut es. So ist es schon in Ordnung. Bis in unsere Küche kommt gewiss kein Dieb.«
»Aber um das Geld sollte sich doch deine Mama kümmern. Sie ist doch die Erwachsene.«
»Das tut sie ja auch«, log Lena und vermied es, Franzi anzusehen, die es zu schnell bemerkte, wenn sie log, und die nun mit einem tiefen Seufzer antwortete.
Sie erreichten den Hinterhof, in dem Lenas Zuhause lag. Die beiden verabschiedeten sich voneinander mit dem Versprechen, am nächsten Morgen gemeinsam zur Schule zu gehen. Lena betrat den Innenhof, in dessen Mitte eine große Linde stand, die etwas Grün in den ansonsten schmucklosen Hof zauberte, mit ihren ausladenden Zweigen allerdings auch das Licht in den Wohnungen raubte, weshalb schon öfter darüber diskutiert worden war, sie zu fällen. Getraut hatte sich das bisher jedoch niemand, dafür war der Baum einfach zu schön. Ihr Elternhaus war ein schmales Gebäude, das eingezwängt zwischen einer Lagerhalle und einem Mietshaus lag. Im Untergeschoss war der Laden ihres Vaters, darüber die Wohnung. Im Hof gab es auch noch eine Änderungsschneiderei, die ein Italiener führte. Antonio Flioretti war ein alter Herr, dem seine Tochter zur Hand ging. Sie wohnten ebenfalls in der Wohnung über ihrem Laden und waren eher stille Leute. Als Lena an der Schneiderei vorüberging, stand Antonio wie so oft mit einer Zigarette in der Hand davor. Sie grüßte freundlich, erhielt jedoch nur ein Kopfnicken zur Antwort, was sie gewohnt war.
Der Laden im Untergeschoss ihres Elternhauses, in dem früher die Schusterei ihres Vaters gewesen war, stand jetzt leer, und die undekorierten Schaufenster sahen trostlos aus. Das Schild über dem Eingang war geblieben: Schuster Flaucher. An der Tür hing noch das Schild mit den Öffnungszeiten. Jeden Tag von acht bis vier. Von zwölf bis eins war Mittag. Lena betrat den Laden. Wie immer läutete die Glocke über der Tür. Doch einen Kunden würde sie niemals wieder ankündigen. Sie lief durch das leere Geschäft zur Hintertür. Als sie diese öffnete, hörte sie Maries Stimme. Ihre Schwester schimpfte laut, was noch nie vorgekommen war. Marie war ein starker Mensch, doch sie wählte eher die leisen Töne. Lena lief die Treppe nach oben und betrat die Wohnung. Maries Stimme kam aus der Wohnstube. Lena blieb in der Tür stehen. Marie schien das Auftauchen ihrer Schwester nicht zu bemerken, denn sie schimpfte weiter. Vor ihr saß ihre Mutter wie gewohnt in dem Lehnstuhl am Fenster. Marie hielt ein Stück Papier in die Höhe.
»Jetzt hör auf, verdammt noch mal. Es ist genug. Sieh es dir an. Sie kommen uns holen, weil sie denken, wir würden verwahrlosen. Sie denken, wir wären arm. Verstehst du! Sie wollen uns von dir wegnehmen. Wach verdammt noch mal auf, und komm zu dir.« Sie beugte sich über ihre Mutter und rüttelte an ihren Schultern. »Rede endlich wieder. Schlag mich, schrei mich an, tu doch nur irgendwas!« Ihre Mutter reagierte nicht. Marie ließ sie los, und ihr Blick fiel auf Lena.
»Es ist vorbei«, sagte sie. »Hier drin steht es. Sie werden kommen und uns holen.« Sie schüttelte den Kopf, warf das Papier in den Schoß ihrer Mutter und ging ohne ein weiteres Wort aus dem Raum. Lena hörte ihre Schritte auf der Treppe. Sie ahnte, wohin Marie gehen würde. In den Laden, wo sie immer hinging, wenn sie allein sein wollte. Sie folgte ihrer Schwester nicht, sondern trat neben ihre Mutter, nahm das Schreiben vom Amt aus ihrem Schoß und überflog die mit Schreibmaschine geschriebenen Zeilen. Verwahrlosung … Fürsorgepflicht obliegt dem Amt … Obhut der Behörden. Die Worte sprangen vor ihren Augen auf und ab, und ihr Pulsschlag beschleunigte sich. Sie dachte an Franzis Worte. Das Gerede der Leute. Die Großackerin und die Stellmacherin, ihnen traute Lena zu, dass sie das Amt eingeschaltet hatten. Oder war es tatsächlich Franzis Mutter gewesen? In der letzten Zeit hatte sie immer wieder gefragt, wie es zu Hause ginge.
»Rede doch wieder«, sagte sie zu ihrer Mutter. »Tu etwas. Ich vermisse ihn auch, weißt du. Aber wir sind noch da. Wir brauchen dich. Es muss doch weitergehen.« Lena suchte den Augenkontakt mit ihrer Mutter, doch diese reagierte nicht. Ihr Blick blieb teilnahmslos wie immer in letzter Zeit. Als wäre sie in einer anderen Welt, zu der sie keinen Zugang fanden. Lena schüttelte den Kopf, legte den Brief vom Amt zurück in den Schoß ihrer Mutter und verließ den Raum.
Lina Flaucher hörte, wie eine Tür laut zugeschlagen wurde, vermutlich die des Mädchenzimmers. Lena und Marie waren wütend auf sie, und das zu Recht. Sie musste aufstehen und sich bewegen. Sie musste ihn endlich gehen lassen und sich dem Leben ohne ihn stellen. Doch es fiel ihr so schwer, ohne ihn schien ihr alles sinnlos. Ihr Blick wanderte zu dem Schreiben in ihrem Schoß. Langsam nahm sie es zur Hand und begann, die Zeilen zu lesen.
Marie saß im Laden und lauschte dem Wind, der an der angelehnten Tür rüttelte und die darüber hängende Glocke zum Läuten brachte. Ihr heller Klang war so vertraut, er gehörte zu ihrem Leben, seit sie denken konnte. Genauso wie die Gerüche von Leder, Leim und alten Schuhen in diesem Raum, der knarrende Dielenboden, die Regale an den Wänden, vom Ruß vergangener Zeiten geschwärzte Deckenbalken, die Staubflusen, die im Licht der Sonne tanzten. Still war es geworden, und diese Stille schmerzte. Da tat der Klang der Glocke gut, er beschwor andere Geräusche und Stimmen herauf und erinnerte an bessere Tage, an das Hämmern und Schimpfen, Lachen und Fluchen von einst. Ihr Klang ließ die Gegenwart ihres Vaters wiederkehren. Marie sah ihn vor Augen. Mit der braunen Lederschürze, die Nickelbrille auf der Nase, stets einen Stift hinter dem Ohr. Schuhe brauchen sie alle, ob arm oder reich, sagte er immer. Und er verstand sich darauf, sie anzufertigen. Ob festes Schuhwerk für die Arbeiter, Winterstiefel mit warmem Fell, Absatzschuhe für die Damen oder auf Hochglanz polierte Lederschuhe für den Herrn von Welt. Er vermaß sie alle, ob ein armer, ein reicher, kleiner, schmutziger oder krummer Fuß. Er machte den passenden Schuh, flickte Löcher, besohlte neu, wenn es gewünscht war, bestickte er sie sogar mit Rosen. Bis er zu husten begonnen und nicht mehr aufgehört hatte. Ein neues Geräusch hatte sich eingeschlichen, war immer lauter geworden und übertönte selbst die Glocke. Bis es still wurde.
Er starb an einem kalten Wintertag. Es schneite unaufhörlich und war gar nicht erst hell geworden. Der Schnee hatte das rastlose Bern ruhiger werden lassen. Marie hatte ihm damals die auf Hochglanz polierten Lederschuhe angezogen, die er für sich selbst angefertigt hatte und die all die Jahre im Schaufenster standen. Zu den Hochzeiten seiner Töchter hatte er sie anziehen wollen, mit dem feinen Anzug, der im Schrank neben seinem einzigen weißen Hemd hing. Jetzt trug er ihn zu seiner Beerdigung. Sie hatte ihm die Schnürsenkel gebunden und sich daran erinnert, wie er ihr das Binden beigebracht hatte. An einem sonnigen Nachmittag, auf der Treppe vor dem Laden sitzend mit viel Geduld. Immer wieder hatte er es ihr gezeigt, die Bänder übereinandergelegt, die Schlaufe gebildet, sie durchgezogen, ihre kleinen Finger angeleitet. Er hatte seine Aufgabe gut gemacht. Hatte seine Mädchen behütet, geliebt. An diesem kalten Wintertag hatte sie die Bänder übereinandergelegt und die Schleife genauso durchgezogen, wie von ihm gelernt, und dabei geweint.
Marie hörte Lenas Schritte auf der Treppe. Gleich würde ihre Stimme die beruhigende Stille im Raum vertreiben. Lena, ihre kleine Schwester, die ihr so ähnelte, als wären