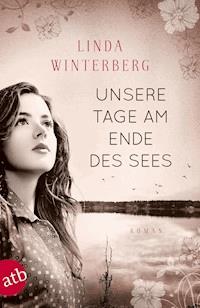9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die große Hebammen-Saga
- Sprache: Deutsch
Das Licht der Welt.
Berlin 1917: Edith, Margot und Luise könnten unterschiedlich nicht sein, als sie sich bei der Hebammenausbildung kennenlernen. Was sie jedoch verbindet, ist ihr Wunsch nach Freiheit und Selbständigkeit – als Flucht vor dem dominanten Vater, vor der Armut der Großfamilie oder den Schatten der Vergangenheit. In einer Zeit, in der die Welt im Kriegs-Chaos versinkt, ist die Sehnsucht nach Frieden genauso groß wie das Elend, mit dem die drei Frauen täglich konfrontiert sind. Aber sie geben nicht auf, denn sie wissen, dass sie jeden Tag aufs Neue die Chance haben, Leben zu schenken …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 517
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Über Linda Winterberg
Hinter Linda Winterberg verbirgt sich Nicole Steyer, eine erfolgreiche Autorin historischer Romane. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Töchtern im Taunus und begann schon im Kindesalter erste Geschichten zu schreiben, ganz besonders zu Weihnachten, was sie schon immer liebte. Bei atb liegen von ihr die Romane »Das Haus der verlorenen Kinder«, »Solange die Hoffnung uns gehört« und »Unsere Tage am Ende des Sees« vor.
Informationen zum Buch
Berlin 1917: Edith, Margot und Luise könnten unterschiedlich nicht sein, als sie sich bei der Hebammenausbildung kennenlernen. Was sie jedoch verbindet, ist ihr Wunsch nach Freiheit und Selbständigkeit – als Flucht vor dem dominanten Vater, vor der Armut der Großfamilie oder den Schatten der Vergangenheit. In einer Zeit, in der die Welt im Kriegs-Chaos versinkt, ist die Sehnsucht nach Frieden genauso groß wie das Elend, mit dem die drei Frauen täglich konfrontiert sind. Aber sie geben nicht auf, denn sie wissen, dass sie jeden Tag aufs Neue die Chance haben, Leben zu schenken …
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Linda Winterberg
Aufbruch in ein neues Leben
Die Hebammen-Saga
Inhaltsübersicht
Über Hinter Linda
Informationen zum Buch
Newsletter
Kapitel 1 – Berlin, Juli 1917
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4 – Neukölln, August 1917
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11 – Neukölln, September 1917
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14 – Neukölln, Oktober 1917
Kapitel 15
Kapitel 16 – Neukölln, November 1917
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21 – Neukölln, Dezember 1917
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25 – Neukölln, 2. Februar 1918
Kapitel 26
Kapitel 27 – Neukölln, März 1918
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30 – Neukölln, April 1918
Kapitel 31
Kapitel 32 – Neukölln, Juni 1918
Kapitel 33
Kapitel 34 – Neukölln, August 1918
Kapitel 35 – Neukölln, September 1918
Kapitel 36 – Neukölln, Oktober 1918
Kapitel 37
Kapitel 38 – Neukölln, November 1918
Kapitel 39
Kapitel 40 – Neukölln, Dezember 1918
Kapitel 41
Nachwort
Dank
Impressum
— 1 —Berlin, Juli 1917
Luise blickte staunend aus dem Zugfenster. So hatte sie sich Berlin immer vorgestellt: breite Straßen mit mehrgeschossigen, herrschaftlichen Häusern, die Bürgersteige genauso belebt wie die Fahrbahnen, auf denen sie neben vielen Kraftdroschken auch einige Automobile fahren sah. Diese Stadt würde also in den nächsten Jahren ihre Heimat werden. Oder besser gesagt, das direkt angrenzende Neukölln, wo sie in wenigen Tagen ihre Ausbildung zur Hebamme beginnen würde.
Wieder spürte sie die Aufregung, die sie in den letzten Tagen und Wochen begleitet hatte. Dann musste sie an ihre Großmutter Else denken, von der sie sich heute Morgen tränenreich verabschiedet hatte. Als sie auf das Fuhrwerk ihres Nachbarn gestiegen war, das sie zum nächsten Bahnhof bringen sollte, war die alte Frau, die zwar Mühe beim Gehen hatte und doch ständig in Bewegung war, noch lange vor dem alten Holzhaus mit den grüngestrichenen Fensterläden stehen geblieben, die Hand schützend gegen die Sonne erhoben, und hatte ihr nachgeblickt. Es war das erste Mal, dass Luise ihre Heimat, das kleine Dorf Eckersberg in Ostpreußen, verließ. Seit sie ihre Eltern im Alter von vier Jahren nach einem Unfall verloren hatte, lebte sie im Haus ihrer Großmutter. Von ihrer Mutter hatte sie das kastanienbraune Haar geerbt und die etwas zu breite Nase. Von ihrem Vater den Sturschädel, wie ihre Oma behauptete.
Else war die einzige Hebamme in der Umgebung. Da sie alleinstehend war und es niemanden gab, der auf Luise hätte aufpassen können, nahm sie ihre Enkelin immer mit. Bereits als kleines Mädchen war sie mit stöhnenden Frauen über Äcker gelaufen, hatte sie winseln und schreien gehört und ihnen zur Beruhigung nächtelang all die Kinderlieder vorgesungen, die sie kannte. Wie hatte sie sich jedes Mal gefreut, wenn ein kleiner Erdenbürger das Licht der Welt erblickt hatte! Und wie stolz war sie gewesen, als sie zum ersten Mal hatte helfen dürfen, ein Neugeborenes zu baden. Und doch hatte ihre Großmutter ihr eines Tages einen Zeitungsartikel unter die Nase gehalten, in dem von dem Bau einer großen Hebammenlehranstalt in Neukölln berichtet worden war. Dorthin sollte sie gehen, hatte sie gesagt, und eine anständige Ausbildung bekommen mit Zeugnis und allem, was dazugehörte. Anfangs hatte Luise sich geweigert. Sie war doch bereits Hebamme, fuhr inzwischen häufig allein zu den Frauen und kümmerte sich problemlos auch um die schwierigen Fälle. Doch ihre Oma war stur geblieben. Die Zeiten änderten sich, und es gebe viele neue Dinge, die eine Hebamme lernen müsse. Als sie von Professor Doktor Hammerschlag erzählt hatte, dem ärztlichen Leiter der Schule, war sie richtig ins Schwärmen geraten. Sein guter Ruf war sogar bis in die Provinz vorgedrungen.
Wochenlang hatten sie gestritten und diskutiert. Den Ausschlag hatte schließlich die schwierige Geburt von Charlotte Sieglers Tochter Maria gegeben. Sie waren in der Nacht gerufen worden. Ihre Großmutter hatte ein Hexenschuss geplagt, weshalb sie nicht hatte mitkommen können. Auf dem alten Gutshof hatte sich die Geburt in die Länge gezogen, und Luise hatte Mühe gehabt, den quer liegenden Säugling im Bauch der Mutter zu drehen. Beinahe hätte die kleine Maria es nicht überlebt. Blau angelaufen, die Nabelschnur mehrfach um den Hals gewickelt, erblickte sie schließlich das Licht der Welt, und es dauerte qualvoll lange Minuten, bis sie ihren ersten Atemzug tat. Luise weinte, als sie das kleine Mädchen ihrer Mutter schließlich in die Arme legte. Als sie erschöpft am frühen Morgen nach Hause fuhr, hatte sie erkannt, dass ihre Großmutter recht gehabt hatte. Sie musste nach Berlin fahren und mehr lernen. Nach der Ausbildung würde sie heimkehren und Elses Lebenswerk weiterführen.
Eine Durchsage kündigte die baldige Ankunft des Zuges am Schlesischen Bahnhof an. Hier musste Luise aussteigen. Jetzt galt es, dachte sie und holte ihren Koffer aus dem Gepäcknetz.
Auf dem Bahnsteig sah sie sich erst einmal um. Es herrschte reges Treiben. Da waren Soldaten, die von hier aus an die Ostfront fuhren, und die Frauen, Mütter und Kinder, die sich tränenreich von ihnen verabschiedeten. Ein junges Pärchen küsste sich ungeniert mitten auf dem Bahnsteig. Luise beschleunigte ihre Schritte. Sie kannte das Gesicht des Krieges zur Genüge. Auch bei ihr in der Nähe war ein Lazarett eingerichtet worden, in dem sie häufig ausgeholfen hatte. Sie wusste, was den jungen Männern an der Front blühte. Anfangs waren noch alle euphorisch gewesen, Weihnachten sei man wieder zu Hause, hatte es geheißen. Doch schnell war die Ernüchterung gekommen. Hunderttausende waren gestorben, einige von ihnen auch unter ihrer Hand. Wie Johannes, ein junger Leutnant aus Bremen. Ihm hatte sie kurz vor seinem Tod einen Brief seiner Verlobten vorgelesen und dabei seine Hand gehalten. Ihre letzten Worte hatte er jedoch nicht mehr gehört. Bald drei Jahre tobte nun dieser unsägliche Krieg, in dem es nur Verlierer geben würde. So sagte es jedenfalls ihre Oma, wenn sie unter sich waren. Laut durfte man das nicht aussprechen, sondern man musste an der Überzeugung festhalten, dass der Sieg kurz bevorstand.
Am Ende des Bahnsteigs sah sich Luise suchend um. Sie musste zur sogenannten Ringbahn, die sie in die Hermannstraße nach Neukölln bringen sollte. Schließlich entschied sie sich, die ältere Dame zu fragen, die in der Bahnhofshalle an einem klapprigen Holzstand Blumen verkaufte.
»Nach Rixdorf wollen Sie. Da müssen Sie da raus und dann links.« Sie deutete zu einem Seitenausgang.
Luise sah die Frau verwundert an: »Nein, nicht nach Rixdorf. Ich möchte nach Neukölln.«
»Das ist doch dasselbe, Mädchen. Haben sie umbenannt.« Dann wandte sie ihre Aufmerksamkeit einem jungen Burschen in Uniform zu.
Luise blieb nichts anderes übrig, als ihr zu glauben. Es dauerte nicht lange, bis ein Zug einfuhr, doch an einen Sitzplatz war in der überfüllten Bahn nicht zu denken. Dicht drängten sich die Passagiere in dem Abteil. Trotz der geöffneten Fenster war die Luft stickig. So viele Menschen auf einem Fleck hatte Luise noch nie gesehen. Krampfhaft hielt sie ihren Koffer fest, die Tasche hatte sie eng an sich gedrückt. Dann endlich rief der Schaffner »Hermannstraße« durch den Waggon. Sie war da.
Als sie aus dem dämmrigen Bahnhofsgebäude in das gleißende Licht der Nachmittagssonne trat, hielt sie erst einmal inne. Die vielen mehrstöckigen Stadthäuser, dazu das dichte Gedränge und die Lautstärke schüchterten sie ein. Die Straßenbahn fuhr laut bimmelnd an ihr vorbei. Automobile, Kraftdroschken und Pferdefuhrwerke fuhren auf und ab. Dazwischen liefen Unmengen von Menschen herum. Vor dem Bahnhofsgebäude saßen zwei Kriegsversehrte und bettelten; unweit von ihr hatte sich eine lange Schlange vor einem Laden gebildet. Vermutlich gab es dort etwas zu essen. Ihre Oma hatte ihr davon erzählt, dass die Menschen in den großen Städten oftmals stundenlang für Lebensmittel wie Butter oder Brot anstehen mussten. Unter den Wartenden entdeckte Luise sogar Kinder, die sich die Wartezeit mit Klatschspielen vertrieben. Das hier war also Neukölln, wo sie die nächsten achtzehn Monate ihres Lebens verbringen würde.
Plötzlich wurde sie von hinten angerempelt. »Hoppla, Verzeihung!« Eine junge blonde Frau in einem dunkelblauen, teuren Ausgehkleid lächelte sie entschuldigend an. »Es tut mir leid. Ich wollte Sie nicht umrennen. So ein Trampel hat mich gestoßen.«
»Keine Ursache«, murmelte Luise. Selten hatte sie eine derart schöne Frau gesehen. Ihr Gesicht glich dem der Madonnenfigur in ihrer kleinen Dorfkirche.
»Vielleicht können Sie mir weiterhelfen«, unterbrach die Blondine ihre Gedanken. »Ich muss zum Mariendorfer Weg. Wissen Sie zufällig, wie ich dorthin komme?«
Luise sah die Frau verdutzt an.
»Wollen Sie zufällig zur Hebammenschule? Dann haben wir den gleichen Weg. Ich beginne dort meine Ausbildung zur Hebamme.«
»Welch ein Zufall, ich auch! Das ist ja schön, dass wir uns gleich hier kennenlernen. Mein Name ist Edith, Edith Stern. Und wie heißt du? Wir können doch bestimmt du sagen, oder?«
»Aber ja, gerne. Ich heiße Luise Mertens.«
Sie konnte es kaum glauben. Eine so wohlhabende Frau wollte eine Ausbildung machen? Normalerweise heirateten solche Frauen doch jung und bekamen schnell Kinder. Jedenfalls war das in Ostpreußen so.
Als hätte Edith ihre Gedanken erraten, sagte sie, während sie sich auf den Weg zur Straßenbahnhaltestelle machten: »Ich komme aus Potsdam. Mein Vater besitzt dort ein großes Kaufhaus. Er war gegen die Ausbildung zur Hebamme, aber meine Mutter unterstützt mich, sie findet es richtig, dass ich meinen eigenen Weg gehe. Ich habe mich deshalb mit meinem Vater gestritten. Aber inzwischen hat sich die Lage wieder beruhigt. Meine große Schwester Alexandra, ich nenne sie Alex, interessiert sich für das Geschäft. Sie und ihr Ehemann wollen es eines Tages übernehmen, wenn er, so Gott will, gesund und an einem Stück von der Front heimkehrt.« Edith sah sie erwartungsvoll an.
Luise erzählte mit knappen Worten, dass sie aus Ostpreußen komme, ihre Oma dort als Hebamme arbeite und sie in ihre Fußstapfen treten wolle.
»Oh, wie schön, dann habe ich ja bereits eine Fachfrau an meiner Seite«, freute sich Edith.
Die Straßenbahn kam, und sie stiegen ein. Luise überlegte während der Fahrt, ob sie Edith mögen solle. Sie war nett, keine Frage. Aber doch recht schwatzhaft und aufdringlich. War dies ein Fehler? Es konnte gewiss nicht schaden, Bekanntschaften zu schließen.
An der Haltestelle der Hebammenlehranstalt stiegen vier weitere Frauen mit ihnen aus. Der Gebäudekomplex, in dem die Schule untergebracht war, erstreckte sich über ein großes Grundstück und bestand aus mehreren Häusern.
»Das ist ja größer, als ich dachte«, sagte Edith. »Dann lass uns mal zusehen, dass wir reinkommen. Gleich am ersten Tag zu spät zu kommen, hinterlässt keinen guten Eindruck.«
Luise nickte.
Als sie durch das schmiedeeiserne Eingangstor trat, entdeckte Luise eine junge, leicht gedrungene Frau, die auf der anderen Straßenseite stand und einen verlorenen Eindruck machte. »Ich komme gleich nach. Nimmst du meinen Koffer schon mal mit?«, sagte sie und lief über die Straße. »Kann ich Ihnen helfen?«
»Ich weiß nicht recht.«
»Was wissen Sie nicht recht?«, fragte Luise verwundert.
»Na, ob ich wirklich reingehen soll. Am Ende bringt das Schreiben von der Fürsorgerin nichts, und sie schicken mich wieder weg.«
»Welches Schreiben?«
»Vom Büro des Vaterländischen Frauenvereins. Sie haben mich hergeschickt und gesagt, wenn ich das Schreiben abgebe, könne ich hier meine Ausbildung machen, auch wenn ich kein Geld habe. Aber was ist, wenn das nicht funktioniert und sie mich fortschicken? Und es ist doch auch ungerecht, oder? All die anderen Frauen müssen ja auch für ihre Ausbildung bezahlen.«
Luise wusste nicht, was sie antworten sollte.
Die Frau sprach weiter. »Ich wohne mit meiner Familie in einem der Hinterhäuser in einer Kellerwohnung, nicht weit von hier. Frau Brausitz vom Frauenverein hat sich beim Herrn Professor für mich eingesetzt. Ihr ist es wichtig, dass in der Schule auch Frauen aus den ärmeren Bezirken Neuköllns ausgebildet werden. Wir haben uns durch meine Arbeit in einer Kinderkrippe kennengelernt. Ich heiße übrigens Margot Bach. Und du?«
»Wieso denkst du, dass etwas mit deinem Empfehlungsschreiben nicht in Ordnung sein könnte?«, fragte Luise, nachdem sie sich vorgestellt hatte. »Das hört sich doch alles gut an.«
»Weiß nicht, ich kann es einfach nicht glauben. Mir ist noch nie etwas geschenkt worden«, sagte Margot und blickte auf das gefaltete Stück Papier in ihrer Hand, um das Luise sie ein wenig beneidete. »Außerdem … Mama hat heute Morgen geweint«, sagte sie unvermittelt. »Papas Name hat auf der Liste gestanden.«
Luise wusste sofort, was gemeint war: die Gefallenenlisten, die an den Rathäusern aushingen. Wie schrecklich musste es sein, wenn man den Namen eines seiner Angehörigen darauf entdeckte? Wie elend musste sich Margot fühlen? Kein Wunder, dass sie zögerte und ängstlich war.
»Das tut mir sehr leid«, murmelte sie und berührte sanft ihren Arm.
»Er war in Frankreich, hat oft geschrieben und uns immer Küsse geschickt. Manchmal auch Fotos.« In Margots Augen traten Tränen; rasch wischte sie sie ab. »Jetzt steht Mama mit allem allein da, und sie geht ja auch noch in die Fabrik. Zu AEG nach Hennigsdorf, da stellen sie Munition her. Ich war so traurig und hilflos, und da bin ich einfach gegangen. Schließlich hatte ich doch das Schreiben. Aber jetzt …« »Jetzt weißt du nicht, ob es nicht besser wäre, wieder zu ihr zu gehen«, vollendete Luise ihren Satz.
Margot nickte. Eine Weile standen sie schweigend nebeneinander. Dann holte Margot tief Luft. »Ich gehe wieder. Ich kann sie nicht einfach allein lassen. Danke, dass du mir zugehört hast. Und viel Glück bei der Ausbildung.«
Mit eiligen Schritten ging sie davon. Luise sah ihr nach. Sie sah zum Eingang der Hebammenschule und seufzte. So ging das nicht. Mit eiligen Schritten rannte sie hinter ihr her. Als sie an der Kreuzung zur Hermannstraße ankam, war von Margot nichts mehr zu sehen. Hilflos blickte sie sich um. Und was nun? Irgendwo hier musste sie abgeblieben sein.
»Wer bist du denn?«, fragte plötzlich ein kleines, rothaariges Mädchen neben ihr, das keine Schuhe trug.
»Mein Name ist Luise, und wer bist du?«
»Mathilde, kannst mich aber Matti nennen. Das machen alle so. Was machst'n hier?«
»Ich suche eine Freundin von mir. Ihr Name ist Margot Bach. Kennst du sie zufällig?«
»Klar doch.« Auffordernd sah die Kleine sie an.
Luise verstand. Auskünfte gab es hier nicht umsonst. Sie griff in ihre Tasche, holte einen Groschen heraus und reichte ihn dem Mädchen.
»Margot wohnt gleich dort vorn im vierten Hinterhof links unten.« Matti deutete die Straße runter, drehte sich um und lief davon.
Mit klopfendem Herzen ging Luise zu dem Hoftor, auf das die Kleine gedeutet hatte. Im Innenhof war eine Art Werkstatt untergebracht. Lautes Hämmern erfüllte den ganzen Hof. Zwischen den Hauswänden waren Wäscheleinen gespannt, auf denen weiße Laken hingen. Eine alte Frau stand an einem geöffneten Fenster und beäugte sie misstrauisch. Luise durchschritt den Hof und erreichte durch einen Durchgang den nächsten Hof, der dem ersten ähnelte, nur etwas kleiner und düsterer war. Hier wuschen zwei junge Frauen in abgerissener Kleidung in einem großen Bottich Wäsche. Sie hielten in ihrer Arbeit inne und sahen Luise neugierig an.
»Wo willst du denn hin?«, fragte die eine.
»Zu Margot Bach«, antwortete Luise, nun doch etwas eingeschüchtert. Auf was hatte sie sich nur eingelassen? Sie kannte sich doch mit dem Stadtleben gar nicht aus. Am Ende geschähe ihr noch etwas als Fremde in diesen finsteren Hinterhöfen.
»Die wohnt da hinten«, antwortete die andere. »Ist eben durch und hat geflennt. Ich hab gleich gesagt, dass das mit dem Hebammending nix ist. Aber sie wollte es mir ja nicht glauben, die feine Dame. Spielte sich auf, als sei sie was Besseres. Das hat sie nun davon. Weggeschickt haben sie sie. Was willst'n von ihr?« Sie sah Luise abschätzend von oben bis unten an.
»Nichts Besonderes«, erwiderte Luise.
»Deswegen läufst ihr auch nach, was?«, fragte die eine und wischte sich mit den feuchten Händen eine Haarsträhne aus der Stirn.
Luise wusste nicht, was sie antworten sollte. Sie entschied sich, mit einem knappen Gruß weiterzugehen. Die eine rief ihr noch etwas nach, doch ihre Worte gingen in dem lauten Lachen einer Kindergruppe unter, die im dritten Hof spielte. Die Häuserwände standen so eng, dass jetzt am späten Nachmittag kaum mehr Licht in den Hof fiel. Die Kinder beäugten Luise neugierig und fragten, wo sie herkam und was sie hier wollte. Luise schaffte es, sie irgendwann loszuwerden, und betrat den vierten Hof, der noch kleiner als der zweite und dritte war. Hinter einem Verschlag standen Mülltonnen, die scheußlich stanken. Rechts führte eine Treppe ins Haus. Luise erkundigte sich bei einem Mann nach Margot Bach. Er deutete mit einem Kopfnicken zur Kellerwohnung.
Luise stieg die wenigen Stufen nach unten. Ein muffiger Geruch schlug ihr entgegen, der ihr für einen Moment den Atem raubte. Dann klopfte sie an die schäbige Holztür, an der ein Namensschild mit dem Namen Bach hing. Es kam keine Antwort. Sie lauschte. Jemand weinte. Das musste Margot sein. Sie legte die Hand auf die Klinke und drückte sie nach unten. Knarrend öffnete sich die Tür und gab den Blick auf eine schmale Kammer frei, die anscheinend gleichzeitig als Küche sowie Wohn- und Schlafraum diente. Am Fenster stand ein kleiner Tisch, daneben eine Anrichte, in der Geschirr untergebracht war. Gleich neben dem Tisch stand der Herd mit Töpfen darauf, und ein Regal mit Gewürzdosen, Tellern und Bechern hing darüber. Gegenüber dem Herd stand ein Bett, eine einfache Pritsche, auf der Margot saß. Eine schmale, nur angelehnte Tür führte in einen Nebenraum. An den grauen Wänden hingen einige Fotos von Familienmitgliedern, die aus besseren Zeiten zu stammen schienen.
»Was machst du hier?«, fragte Margot.
»Ich wollte noch einmal mit dir reden. Bist du allein?« Luise setzte sich, ohne zu fragen, neben Margot und ließ ihren Blick durch den Raum schweifen. »Das ist also eine Kellerwohnung im vierten Hinterhof.«
»Ja, das ist es. In diesem Bett schlafe ich mit meiner Schwester Hilde. Sie ist nur ein Jahr jünger als ich, kümmert sich um unsere kleineren Geschwister und arbeitet stundenweise in der Neuen Welt in der Küche. Ihr Peter ist an der Front in Frankreich. Bisher lebt er noch. Das hoffen wir jedenfalls. Erst gestern kam ein Brief von ihm, der sogar ein Foto enthielt. Er ist Fotograf. Wenn er zurück ist, will er einen eigenen Laden aufmachen. Hilde und ich beten jeden Abend für ihn. Das haben wir auch für Papa getan. Genützt hat es nichts. Mama schläft mit den Kleinen im Nebenraum. Wenn sie mal bei uns ist, denn bis nach Hennigsdorf ist es ein Stück. Meistens übernachtet sie in der Fabrik. Nur am Sonntag kommt sie zu uns. Sie hoffte auf eine Anstellung bei den Britzer Farbenwerken, aber da war alles voll. Die Lotte Kohlhaber von gegenüber ist da letzte Woche untergekommen. Mama will es auch noch mal versuchen. Wäre schön, wenn es klappen würde.«
»Das wäre es«, antwortete Luise, der zwar die Britzer Farbenwerke nichts sagten, aber wenn Margots Mama darauf hoffte, schien es besser als das weiter entfernte Hennigsdorf zu sein, von dem sie ebenfalls noch nie gehört hatte.
»Mama ist wieder los. Nach Hennigsdorf. Muss ja weitergehen. Wenn sie wegbleibt, wird ihr der Lohn für den Tag gestrichen, und nun kriegen wir nur noch eine mickrige Witwen- und Waisenrente.«
Luise nickte und fragte: »Und was wirst du jetzt machen?«
»Weiß nicht. Erst einmal wieder in die Krippe gehen und dann weitersehen.«
»Weil es dort eine warme Mahlzeit gibt.«
Margots Miene verfinsterte sich. »Was weißt du schon? Ich kenne dich nicht einmal. Läufst mir nach und meinst, mir was erzählen zu können.«
»Aber so ist das doch gar nicht, ich …«
»Weshalb bist du denn sonst hier?«, unterbrach Margot sie wütend.
»Weiß nicht. Weil ich dumm bin. Bestimmt hat die Einführungsveranstaltung schon angefangen, und ich bekomme Ärger wegen meines Zuspätkommens. Am Ende verpasse ich sie ganz. Aber ich hatte das Gefühl, ich sollte dir nachlaufen. Und meine Oma sagt immer, dass das erste Gefühl meistens richtig ist.«
Margot lachte bitter. »Deine Oma.«
»Ja, meine Oma. Ich bin bei ihr aufgewachsen, denn meine Eltern sind gestorben, als ich vier war.«
»Das tut mir leid«, antwortete Margot.
»Ist nicht schlimm. Mir fehlt die Erinnerung an sie. Ich habe ja meine Oma. Und stell dir vor, sie ist auch Hebamme. Gemeinsam haben wir ganz viele Babys auf die Welt geholt.«
»Und was willst du dann hier, wenn du das schon kannst?«, fragte Margot.
»Oma meinte, es gehöre sich, es richtig zu lernen. So mit Ausbildung. Sie hat ihre ganzen Ersparnisse dafür geopfert, dass ich herkommen kann.«
Margot nickte. »Ich weiß schon, was du mir damit sagen willst. Ich kriege geschenkt, was euch andere Geld kostet. Alle werden so reagieren.«
»Es müssen ja nicht alle wissen, oder? Ich sage es niemanden, versprochen.«
»Bist du dir sicher?«, fragte Margot und sah Luise skeptisch an.
»Ja, das bin ich. Nach den achtzehn Monaten der Ausbildung wirst du als Hebamme viel mehr verdienen als in der Krippe und deine Familie damit besser unterstützen können. Eine warme Mahlzeit bekommst du in der Lehranstalt auch. Und jetzt ist alles gesagt. Ich geh dann mal. Wenn du magst, kannst du mitkommen.« Luise stand auf, verließ den Raum und durchquerte rasch das muffig riechende Treppenhaus.
Sie hatte den vorderen Hof noch nicht erreicht, da war Margot schon neben ihr und sagte: »Sollte ein abfälliges Wort von irgendwem fallen, dann bin ich wieder weg.«
— 2 —
Als Luise und Margot in der Schule eintrafen, dauerte es einen Moment, bis sie sich orientiert hatten. Der Pförtner, ein älterer Herr, der etwas schwerhörig schien, verwies sie zum Entbindungshaus, wo Professor Hammerschlag die Neuankömmlinge im Tauf- und Sitzungssaal begrüßte. Sie eilten in die Richtung, die ihnen der Mann genannt hatte, und verliefen sich prompt. Sie hatten die Türen zu einem Wochenzimmer, einer Wäschekammer und sogar einem Operationsraum geöffnet, bevor sie im großen Saal ankamen. Als sie eintrafen, war jedoch nur noch Professor Hammerschlag da, der gerade seine Unterlagen in einer Aktentasche verstaute. Der Professor sah genauso aus wie auf dem Foto in dem Zeitungsartikel, den ihre Großmutter ihr gezeigt hatte. Er hatte nur noch wenige Haare auf dem Kopf, dichte, dunkle Augenbrauen und einen Schnauzbart, der seine Oberlippe zierte.
Verwundert blickte er die beiden an. »Die Damen? Wie kann ich Ihnen helfen?«
»Guten Tag, Herr Professor. Wir waren, wir sind …« Luise geriet ins Stocken und setzte erneut an. »Es tut uns leid, wir haben uns verspätet. Es ist … Wir hatten einige Schwierigkeiten.« Sie verstummte.
»Ausreden zählen nicht«, erwiderte der Professor und sah von Luise zu Margot. »Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit sind Tribute, die eine Hebamme unter allen Umständen zu beherzigen hat. Die werdenden Mütter verlassen sich schließlich auf Sie. Ihre Namen bitte?« Er horchte auf, als er Margots Namen hörte. »Margot Bach. Der Name sagt mir etwas. Sind Sie nicht das junge Fräulein, das mir von Frau Brausitz vom Vaterländischen Frauenverein so warm empfohlen wurde?«
Margot deutete ein Nicken an. Tränen schimmerten in ihren Augen.
»Heute Morgen stand sein Name auf der Liste«, sagte Luise rasch. »Ihr Vater ist gefallen. Sie wusste nicht …«
»Das ist keine Entschuldigung«, fiel Margot ihr ins Wort. »Der Herr Professor hat recht. Eine Hebamme hat in jeder Situation zuverlässig zu sein. Ich geh dann wohl besser. Es tut mir leid. Es war anscheinend doch nicht das Richtige für mich.« Sie wollte sich abwenden, doch Luise hielt sie am Arm zurück. Flehend sah sie den Professor an, dessen Blick milder wurde.
»Aber eine Hebamme ist auch nur ein Mensch«, sagte er.
»Unter diesen Umständen werde ich noch einmal ein Auge zudrücken. Ihr Vater ist im Kampf für unser Vaterland gefallen. Darauf können Sie stolz sein. Das dürfen Sie niemals vergessen. Und nun gehen Sie rasch ins Obergeschoss des Verwaltungsgebäudes. Dort finden gerade die Kleiderausgabe und die Zuteilung der Schlafräume statt. Auf eine gute Zusammenarbeit, die Damen. Und bitte beherzigen Sie es ab jetzt, pünktlich zu sein.« Er schenkte ihnen ein Lächeln. Luise und Margot nickten erleichtert. Der Professor verließ den Raum.
»Puh, das ist gerade noch einmal gutgegangen«, sagte Luise und stieß Margot in die Seite. »Komm. Lass uns schnell ins Verwaltungsgebäude laufen.«
Die beiden verließen das Entbindungshaus durch den Haupteingang und gingen zu dem danebenliegenden dreistöckigen Verwaltungsgebäude. Der Pförtner am Eingang nuschelte auf ihre Nachfrage hin etwas vom zweiten Obergeschoss und dem Raum Nummer zweiundsiebzig. Als sie dort eintrafen, schloss eine korpulente Frau mit braunem Haar, die ein graues Kleid mit einer weißen Schürze trug, gerade einen großen Wandschrank.
»Entschuldigen Sie bitte unsere Verspätung«, sagte Luise etwas außer Atem.
Die Frau sah sie verwundert an. »Noch welche. Wo kommt ihr zwei Hübschen denn so plötzlich her?« »Wir sind aufgehalten worden«, antwortete sie und setzte ein verbindliches Lächeln auf.
»Aufgehalten worden. Na, lasst das mal nicht eure Ausbilderin, die Marquard hören. Die zieht euch sonst beiden wegen so einer mickrigen Ausrede die Ohren lang.« Sie öffnete den Wandschrank wieder und holte jeweils ein weißes Kleid und zwei weiße Schürzen heraus, dazu eine passende Haube sowie Wäsche und legte die Sachen auf einen Tisch.
»Sollte etwas dreckig sein, gebt Bescheid. Allgemeiner Wechsel ist alle drei Tage. Mich findet ihr drüben im Wäschereigebäude. Mein Name ist Lene. Und jetzt seht zu, dass ihr fortkommt. Die Schlafräume sind gleich um die Ecke.« Sie wedelte mit den Armen.
Luise und Margot nahmen ihre Kleider und liefen eilig den Flur entlang. Die meisten der Betten waren bereits belegt, doch im hinteren Zimmer, es war etwas kleiner und lag direkt neben dem Hebammenzimmer, waren noch zwei von vier Betten frei. Erleichtert grinsten sie sich an; so wie es aussah, würden sie Zimmernachbarinnen sein.
Der weißgetünchte Raum war karg eingerichtet, trotzdem wirkte er heimelig. Neben den vier Betten, die mit rot-weiß karierter Wäsche bezogen waren, gab es zwei schmale Kleiderschränke. Ein Tisch mit vier Stühlen stand unter einem der beiden Fenster.
Als sie eintraten, blickte Edith auf. Sie war gerade damit beschäftigt, ihre neu erhaltene Kleidung durchzusehen. »Da bist du ja wieder«, begrüßte sie Luise. »Deinen Koffer habe ich dahinten in die Ecke gestellt.« Dann sah sie zu Margot. »Und wer bist du?«
Schüchtern nannte Margot ihren Namen. Luise konnte sie gut verstehen. Edith wirkte so elegant, dagegen fühlte sie sich wie ein Bauerntrampel. Jedoch war sie nett, und ihr Blick auf Margot hatte nicht abfällig gewirkt, was erneut für sie sprach.
»Welches Bett möchtest du haben?«, fragte Luise Margot. »Vielleicht das am Fenster. Da hast du mehr Licht.«
Margot nickte schüchtern und legte ihren Koffer und die eben erhaltenen Kleidungsstücke darauf.
»Und wo hast du nun gesteckt?«, fragte Edith und knöpfte ihr Kleid auf.
Luise sah zu Margot, die begann, ihre Bluse zu öffnen. Bevor sie etwas sagen konnte, ergriff Margot das Wort. »Sie hat mich davon überzeugt, doch mit der Ausbildung zu beginnen. Ich dachte, ich wollte …« In ihre Augen traten erneut Tränen.
»Ihr Vater ist gefallen«, sagte Luise leise. »Sie hat es heute erfahren.«
»Wie schrecklich«, sagte Edith betroffen, dann drehte sie sich um und nahm Margot fest in den Arm.
Nach einer Weile löste sich Margot aus der Umarmung. »Meine Mutter hat nur kurz geweint. Dann hat sie sich die Tränen von den Wangen gewischt, ist aufgestanden und in die Fabrik gegangen. ›Muss ja weitergehen‹, hat sie gesagt. Und das tut es jetzt. Es geht weiter.« Ihre Stimme bekam etwas Trotziges.
Edith nickte. »Ja, das tut es immer irgendwie. Mein Schwager ist an der Westfront bei Verdun. Es ist schrecklich für meine Schwester. Seit sie ein Kind war, hat sie von einer großen Hochzeit geträumt. Eine feierliche Trauung und im Anschluss ein Gartenfest, auf dem sie bis in die Nacht hinein tanzen wollte. Doch es wurde nur eine Blitzheirat auf dem Standesamt im kleinen Kreis kurz nach der Kriegserklärung. Jeden Tag treibt sie jetzt die Sorge um, ob er überhaupt zurückkehren wird.«
»Meine Großmutter sagt immer, Krieg habe noch nie was Gutes gebracht«, sagte Luise leise.
»Womit sie recht hat«, antwortete Edith. »Aber Jammern macht es nicht besser. Also lasst uns anpacken, ihr Lieben. Jetzt wollen wir erst einmal die neuen Kleider anprobieren. Was meint ihr?«
Margot und Luise stimmten zu. Die drei schlüpften aus ihren Sachen und zogen zum ersten Mal ihre Schwesterntracht an. Die Kleider passten ihnen, als wären sie für sie genäht worden. Edith band Margot die Schürze und setzte ihr die weiße Haube auf. Margot betrachtete sich im Spiegel. »Was solch eine Tracht doch ausmacht«, sagte sie. »Ich erkenne mich selbst kaum wieder.«
»Es macht es so offiziell«, sagte Luise hinter ihr.
»Ja, das stimmt«, antwortete Edith. Sie stand hinter Margot und strich über ihre Schürze. »Jetzt wird es also endlich Wirklichkeit. Ich habe schon so lange davon geträumt, Hebamme zu werden. Als ich dann von der Schule gelesen habe, wusste ich sofort: Das ist es!«
»Wie bist du darauf gekommen? Ist doch eigentlich ungewöhnlich für eine Frau aus deinen Kreisen, oder?«, fragte Margot.
Edith schwieg einen Moment.
»Ich … ich habe nie jemandem erzählt, weshalb ich unbedingt Hebamme werden möchte. Es ist jetzt bald zwei Jahre her, da habe ich eine Geburt miterlebt. Es war bei uns im Kaufhaus. Also in einem der Hinterzimmer. Dorthin ist die werdende Mutter rasch gebracht worden, nachdem ihr in der Galanteriewarenabteilung die Fruchtblase geplatzt ist. Ich bin bei ihr geblieben und habe sie getröstet und mich um sie gekümmert. Ihr Name war Helene, sie ist Stammkundin bei uns im Haus. Es war ihr erstes Kind, und sie hatte Angst. So große Angst, dass sie mich anflehte, bei ihr zu bleiben, auch als die Hebamme da war. Ich war völlig überfordert von ihrem Wunsch, konnte ihn ihr aber nicht abschlagen. Und dann … Es war das Ergreifendste, was ich je erlebt habe, wirklich der schönste Moment meines Lebens. Dieses Wunder, wenn plötzlich ein neuer Mensch auf die Welt kommt, das erste Mal atmet, das erste Mal die Augen öffnet. Das ganze Leben liegt noch vor ihm. Und dann das unglaubliche Glück in den Augen der Mutter zu sehen, die es gar nicht fassen kann … Alles andere kam mir plötzlich nebensächlich vor. Ich wollte nur noch eines: Es wieder und wieder erleben und Frauen dazu verhelfen, dass sie ihr Kind mit genau dieser Liebe anschauen und auf der Welt begrüßen können, wie ich es bei Helene erlebt habe.«
Für einen Moment herrschte Stille im Raum. Ediths Beschreibung hatte sie alle ergriffen.
»Ich hab meine Oma irgendwann einmal gefragt, ob es jemals alltäglich wird, Kinder auf die Welt zu holen«, sagte Luise irgendwann. »Sie hat den Kopf geschüttelt und geantwortet: ›Das Leben selbst ist das Wunder, und wenn es beginnt, ist es am allerschönsten. Und es ist jedes Mal eine Ehre, ihm dabei behilflich zu sein‹.«
»Dann wollen wir das tun«, sagte Edith und rückte Margots Haube zurecht. »Aber jetzt lass uns zu Abend essen. Denn ich bin kurz vorm Verhungern, und hungrig kann ich nicht denken.«
Alle drei lachten, besonders laut Margot. Luise gefielen ihre strahlenden Augen. Es war gut, dass sie ihr gefolgt war und sie zurückgeholt hatte.
— 3 —
Luise betrat hinter Edith und Margot den Hörsaal der Lehranstalt, der sie durch seine Größe beeindruckte. Der Raum war wie ein Amphitheater angelegt, seine Sitzreihen reichten bis in den Dachraum hinein. Ein großes Bogenfenster sorgte für ausreichend Licht, und die Decke war mit Stuck verziert. Auguste Marquard, die Oberhebamme, erwartete sie bereits. Luise betrachtete sie genauer, während sie neben Edith in einer der oberen Reihen Platz nahm. Sie hatte schwarzes Haar, das unter einer Haube verschwand, und trug ebenfalls ein weißes Kleid und eine Schürze darüber. Luise schätzte sie auf Mitte fünfzig. Ihre Miene war ausdruckslos, sie wirkte kühl und unnahbar.
»Sie ist bestimmt ein Besen«, raunte Edith ihr ins Ohr. »Ich hatte früher ein Kindermädchen, das ihr ähnelt. Mit ihr sollten wir uns lieber von Anfang an gut stellen.« Sie machte eine kurze Pause und fügte hinzu: »Wenn das überhaupt möglich ist.«
Nachdem alle Schülerinnen Platz genommen hatten, begann Schwester Auguste mit ihren Ausführungen. Sie berichtete von der allgemeinen Hierarchie im Haus und erläuterte, was mit Patienten erster, zweiter und dritter Klasse gemeint war und was es mit den Hausschwangeren auf sich hatte.
»Neben der medizinischen und pädagogischen Arbeit sehen wir als Klinik unsere sozialfürsorglichen Pflichten als äußerst wichtig an. In unserem Haus stehen rund einhundertsechzig Betten für schwangere Frauen und Mädchen zur Verfügung, die unentgeltlich etwa sechs Wochen vor der Niederkunft aufgenommen werden. Meist sind dies Frauen, die unehelich schwanger geworden, verwitwet oder anderweitig in Not geraten sind. Die Hausschwangeren leisten, selbstverständlich unter ärztlicher Aufsicht und je nach Vorkenntnissen, leichte Hausarbeit, Garten- oder Büroarbeiten. Nach der Entbindung kümmert sich die Fürsorge um die Frauen. Sie bemüht sich darum, dass sie entweder in ihre Heimat und an ihre frühere Dienststelle zurückkehren können, oder bringt sie mit ihren Kindern in Säuglingsheimen unter. Wenn möglich, werden für die Frauen auch neue Anstellungen besorgt. Regelmäßig ist deshalb die Fürsorge im Haus, die sich um die Frauen und ihre Anliegen kümmert. Ich möchte Sie alle bitten, die Damen mit besten Kräften bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Während Ihrer Ausbildung werden Sie die Hebammen auch bei ihren Hausrunden in der Stadt begleiten. Zumeist geht es um Vorsorge, aber auch um die Nachsorge für das Kind. Nicht jede Frau geht zu den Fürsorgestellen, und es ist uns wichtig, trotzdem für das Wohl des Kindes zu sorgen.«
Luise berührten die Worten von Frau Marquard. Wie anders wurde auf dem Land mit Frauen umgegangen, die ungewollt schwanger geworden waren. In den meisten Fällen wurden sie von der Gesellschaft ausgegrenzt und als liederlich bezeichnet. Dabei wurde nicht danach gefragt, wie es zu der Schwangerschaft gekommen war, ob nicht gar eine der Frauen missbraucht worden war. Nicht wenige hatten nach Feststellung der Schwangerschaft in ihrer Verzweiflung mit allen Mitteln versucht, sie zu beenden, und immer wieder hatte eine junge Frau dies mit ihrem Leben bezahlt. Luise war froh, zu sehen, dass in der Stadt mit solchen Themen anscheinend fortschrittlicher umgegangen wurde und die Frauen Unterstützung bekamen.
Nachdem Frau Marquard noch einige weitere organisatorische Dinge erläutert hatte, brachen sie alle zu einer Führung über das Gelände auf.
Dicht am Eingang war eine Poliklinik untergebracht, die sie als Erstes besichtigten. Hier gab es auch ein Sprechzimmer für die Säuglingsfürsorge, das gut besucht war. Mütter saßen mit ihren Säuglingen auf dem Arm im Warteraum, Kleinkinder krabbelten oder liefen über den Fußboden, und es herrschte eine recht ordentliche Lautstärke. Zwei Fürsorgeschwestern, eine Hebamme und ein Arzt kümmerten sich um die Patienten.
Dann ging es weiter in den westlichen Flügel, wo die Aufnahmeräume und die Schlafräume für vierzig Hausschwangere waren. Luise sah nur kurz in den spartanisch eingerichteten Schlafsaal mit den weißen Gitterbetten. Sonnenlicht fiel auf den blauen Linoleumboden.
Im nördlichen Flügel lagen die Wohnungen für die Oberhebamme und die Aufnahmeschwestern. Zusätzlich befanden sich hier die Speisesäle für Hausschwangere, Hebammen, Schwestern und Schülerinnen im Anschluss an die Küche, die durch einen Aufzug mit dem Tiefkeller verbunden war, in dem sich die Milchsterilisations- und Kühlräume befanden. Dann ging es zurück in den Speisesaal. Er war hellgelb gestrichen, und Bilder mit Landschaftsaufnahmen hingen an den Wänden. Tische und Stühle standen in kleinen Gruppen, und Sonnenlicht fiel durch die großen Fenster.
»Alles sehr hübsch hier, oder? Und so modern!«, sagte Edith zu Luise, die die ganze Zeit neben ihr gelaufen war. Luise nickte. Die vielen Räume und Eindrücke begannen sie zu überfordern.
Es ging weiter über das Gelände. Verwaltungsräume gab es im westlichen Flügel, dazu die Wohnung für den Betriebsinspektor und eine Bücherei. Hier lagen auch die Wohnungen für unverheiratete Ärzte. Es war ihnen strikt untersagt, sich mit ihnen in irgendeiner Form einzulassen. Liebesbeziehungen zwischen Mitarbeitern wurden unter keinen Umständen geduldet und hatten die sofortige Entlassung zur Folge.
Weiter ging es ins Entbindungshaus, das das größte Gebäude der Anlage war und ihren Mittelpunkt bildete. Das Haus war so gelegen, dass sämtliche mit Wöchnerinnen, Kranken und Säuglingen belegten Räume nach Süden ausgerichtet waren. Operations- und Entbindungssäle waren in dem sich nach Norden erstreckenden Teil untergebracht. Sie besichtigten das Säuglingsbad, die Operationssäle und die Wöchnerinnenzimmer, in denen bereits so kurz nach Eröffnung mehrere Betten belegt waren. In sämtlichen Geschossen befanden sich Teeküchen und Wärmeschränke. Was Luise aber am meisten faszinierte, war ein durchgehender Aufzug, der so geräumig war, dass sogar Patienten in ihren Betten darin befördert werden konnten.
Zum Abschluss wurde das Wäschereigebäude besichtigt, in dem sich im Erdgeschoss die Wäscherei und oben die Trockenräume befanden. Luise staunte, wie viele Frauen hier arbeiteten. In dem Gebäude waren außerdem noch Flick- und Plätträume und Wohnungen für weitere Angestellte wie den Maschinenmeister, die Heizer sowie den Hausgärtner, der sich im Moment um den Anbau von Kartoffeln und Kohl im weitläufigen Anstaltsgarten kümmerte. Diese Schule war wie eine eigene Welt, fand Luise. Und sie war ein Teil davon! Luise schwirrte ob der Größe der Gebäude der Kopf. Allein der Verwaltungsbau wies unendlich viele unterschiedliche Räumlichkeiten auf, von dem großen Entbindungsgebäude ganz zu schweigen. Wie sollte sie sich hier nur je zurechtfinden?
Im Anschluss an die Führung blieben sie vor dem Direktorenhaus stehen, in dem der Herr Professor mit seiner Familie wohnte.
Auguste Marquard verkündete, dass es Zeit zum Mittagessen sei, danach finde die erste Vorlesung mit dem Herrn Professor im Hörsaal statt.
»Ist schon was anderes als bei euch auf dem Land«, sagte Edith zu Luise, während sie zurück zum Speisesaal gingen.
»Also mir gefällt es«, sagte Margot. »Es ist alles so neu, sauber und ordentlich. Wir werden uns gewiss schnell zurechtfinden.«
Sie betraten den Speisesaal, nahmen sich von der Kartoffelsuppe, die es heute gab, und setzten sich zu einer Gruppe anderer Schülerinnen.
Eine von ihnen, sie war rothaarig und hatte viele Sommersprossen auf der Nase, musterte Margot abfällig. »Da sieh mal einer an, die Margot. Hätte nicht gedacht, dass deine Familie das Geld für die Schule aufbringen kann. Arbeitet deine Mutter nicht in der Munitionsfabrik? Das muss sie nur deshalb, weil dein Vater so ein armer Schlucker ist und es nur zum Heizer gebracht hat. Wohnt ihr noch in dem Kellerloch im vierten Hinterhof in der Knesebeckstraße?«
Margot wurde blass. Sie hatte Gerda, die Tochter des Stadtrats Adolf Hartwig und eine der größten Ziegen von Neukölln, vorhin gar nicht bemerkt. Was machte die denn hier?
Empört blickte Edith die Rothaarige an. »Und wer bist du, wenn ich fragen darf?«
Gerda zog die Augenbrauen hoch. »Und wer will das wissen?«
»Ich heiße Edith und komme aus Potsdam.«
»Eine Auswärtige also. Mein Name ist Gerda, und mein Vater ist Stadtrat in Neukölln.«
»Wie nett. Die Tochter eines Politikers und dann auch noch ein Stadtrat«, erwiderte Edith mit einem zuckersüßen Lächeln. »Und sein Töchterchen macht eine Ausbildung zur Hebamme. Fand sich kein Kerl zum Heiraten?«
Das hatte gesessen, beinahe wäre Gerda der Löffel aus der Hand gefallen. »Was bildest du dir …?«, setzte sie an, doch weiter kam sie nicht, denn eine junge Krankenschwester trat an den Tisch und bat Edith nach draußen. Ihre Mutter warte im Büro des Herrn Professor auf sie.
Edith wurde bleich, erhob sich und folgte der Frau aus dem Raum. Verdutzt sahen die anderen ihr nach.
»Die hat bestimmt etwas ausgefressen«, sagte Gerda gehässig.
»Halt die Klappe«, fuhr Margot sie an und wunderte sich über ihre eigene Courage. Ediths Einschreiten eben hatte sie mutiger werden lassen. Jahrelang hatte sie vor wohlhabenderen Mädchen wie Gerda gekuscht, die wie Königinnen über die Straßen Neuköllns gelaufen waren, nur weil sie in einem der feineren Stadthäuser wohnten und sich teure Kleidung kaufen konnten. Doch nun waren die Karten neu gemischt. Als Schülerinnen der Hebammenschule standen sie alle auf einer Stufe. Ab jetzt würde sie sich so etwas nicht mehr gefallen lassen.
Dorothea Stern erhob sich, als Edith das Büro von Professor Hammerschlag betrat. Sie sah aus, als hätte sie geweint, und begann ohne ein Grußwort sofort auf ihre Tochter einzureden. »Wie konntest du uns das antun, Edith? Dein Vater ist außer sich. Du kannst dich auf etwas gefasst machen, junges Fräulein, das sage ich dir.«
»Nun setzen Sie sich erst einmal«, sagte Professor Hammerschlag, den die Situation zu überfordern schien.
Edith nahm Platz, und ihre Mutter begann zu heulen. Sie schluchzte theatralisch und holte ein Taschentuch aus ihrer Tasche. Oh, wie sehr Edith dieses Gehabe verabscheute. Ihre Mutter war zu einem wehleidigen Irgendwas an der Seite ihres herrischen Vaters verkommen, der seine Vorstellungen des perfekten Lebens seiner Familie mit allen Mitteln durchsetzen wollte. Nur leider lief nicht immer alles nach Plan, und sie waren keine Schaufensterpuppen seines Kaufhauses, mit denen er tun und lassen konnte, was er wollte.
Ihr älterer Bruder Tom war schon vor Jahren nach Amerika ausgewandert, wo er mittlerweile bei einer Zeitung in Boston arbeitete. Sie schrieben einander regelmäßig, und er unterstützte sie in ihrem Vorhaben. Das Geld für die Ausbildung an der Hebammenschule hatte er ihr gegeben. Doch sie wünschte, ihre Mutter hätte es getan. Sie wünschte, die Worte, die sie so scheinbar arglos bei ihrem ersten Aufeinandertreffen zu Luise gesagt hatte, wären wahr gewesen. Doch sie hatte gelogen. Ihre Mutter hätte sie niemals unterstützt. Ihr hatte sie von der Ausbildung nicht einmal erzählt, denn ihre Antwort kannte sie bereits. Eine Stern ging nicht in die Lehre. Eine Stern hatte gefälligst einen gutsituierten Mann zu heiraten, am besten einen Juden, der irgendwann ins Familiengeschäft einsteigen würde. Deswegen hatte sich Edith gestern in den frühen Morgenstunden aus dem Haus geschlichen und nur eine kurze Nachricht hinterlassen, in der stand, dass sie ihre eigenen Wege gehen wolle und es ihr gut gehe. Vermutlich war es ihre Freundin Karin gewesen, die ihrer Mutter gesagt hatte, wo sie sie finden würde.
»Sie möchten also, dass Ihre Tochter die Ausbildung an unserer Schule nicht beginnt. Sehe ich das richtig?«, fragte Professor Hammerschlag.
»Ja, das sehen Sie richtig«, antwortete Dorothea Stern. »Sie hat die Ausbildung ohne unser Wissen angetreten. Es tut mir wirklich sehr leid, dass Sie wegen dieser Angelegenheit solche Umstände haben. Edith und ich werden Sie nicht mehr länger behelligen. Sie wird rasch ihre Sachen zusammenpacken und mit mir kommen.«
Der Blick des Professors wanderte zu Edith.
»Gar nichts werde ich«, sagte sie fest. »Ich bin volljährig und kann meine eigenen Entscheidungen treffen. Ich werde hierbleiben und die Ausbildung zur Hebamme antreten, ob es euch gefällt oder nicht. Und du kannst Papa gern ausrichten, dass mir sein ganzes Geld egal ist.« Edith spürte die aufsteigenden Tränen, während sie die Worte aussprach. Das ständige Rebellieren kostete Kraft. Wieso nur konnten ihre Eltern sie nicht akzeptieren, wie sie war?
»Aber du bist doch erst vor zwei Wochen einundzwanzig geworden«, sagte ihre Mutter. »Du bist also quasi noch ein halbes Kind, und die Familie hat …«
»Wenn ich Ihnen widersprechen darf, Frau Stern«, mischte sich der Professor ein, »es hat keine Bedeutung, wann Ihre Tochter die Volljährigkeit erreicht hat. Sie ist einundzwanzig und kann ihre Entscheidungen eigenständig treffen. Sie können sie nicht daran hindern, die Ausbildung in unserem Haus anzutreten, was, soweit ich sehe, Fräulein Stern gern tun würde.«
»Sie fallen mir also in den Rücken«, antwortete Dorothea kalt und erhob sich. »Das hätte ich von einem Mann wie Ihnen nicht erwartet. Das wird ein Nachspiel haben. Ich rede mit deinem Vater, Edith«, sagte sie zu ihrer Tochter. »Das letzte Wort ist in dieser Angelegenheit noch lange nicht gesprochen.«
Edith zuckte zusammen, als die Tür hinter ihr ins Schloss fiel. Einen Moment herrschte Schweigen, dann setzte sie zu einer Entschuldigung an.
Doch der Professor unterbrach sie, indem er die Hand hob. Edith verstummte. »Es ist Ihre Entscheidung«, sagte er. »Und ich ziehe den Hut vor Ihrer Courage. Es ist nicht leicht, gegen den Willen seiner Eltern zu handeln. Sagen Sie mir, weshalb wollen Sie unbedingt Hebamme werden? Sollte es nur aus dem Grund der Rebellion sein, rate ich dringend davon ab. Der Beruf der Hebamme bedeutet so vieles, besonders Hingebung und Aufopferung. Er sollte nicht aus einer Laune heraus erlernt werden.«
»Das werde ich auch nicht«, antwortete Edith. »Meine Mutter weiß so einiges nicht. Ich habe eine Weile ehrenamtlich in einer Fürsorgestelle in Potsdam gearbeitet, wo auch werdende Mütter betreut wurden. Es hat mir große Freude gemacht und mich mit Glück erfüllt. In unserem Kaufhaus durfte ich zufällig bei der Geburt eines Kindes dabei sein. Das war ein ergreifender Moment für mich. Da wusste ich, dass ich Hebamme werden möchte. Ich will nicht die Frau von jemandem sein, sondern meinen eigenen Weg gehen. Und ich denke, dieser hier ist der richtige. Verstehen Sie das?«
»Nur zu gut«, antwortete der Professor mit einem Lächeln und erhob sich. »Dann wollen wir zu unser beider Wohl hoffen, dass dies der letzte Auftritt Ihrer Frau Mama war. Aber ich befürchte, sie wird wiederkommen.«
»Das denke ich auch«, antwortete Edith und seufzte.
»Wir werden das Kind schon schaukeln«, antwortete er. »Sie sind jetzt Teil meiner Lehranstalt, und gemeinsam wird sich ein Weg finden, wie wir uns diesem Problem stellen. Und jetzt«, er sah auf seine Armbanduhr, »müssen wir uns sputen, denn mein erster Vortrag im Hörsaal beginnt in wenigen Minuten, und wir wollen doch beide pünktlich sein, nicht wahr?«
»Ja, das wollen wir«, antwortete Edith und lächelte ihn an. Es tat so gut, endlich einmal nicht das Gefühl zu haben, allein zu sein.
Auf dem Flur trafen sie auf Luise und Margot, die voller Sorge um sie gewartet hatten. Die beiden begannen Edith sofort mit Fragen zu löchern. Während Edith ihnen zögerlich ihre Situation schilderte, wurde Luise bewusst, dass sie alle, jede auf ihre Art, ihr Päckchen zu tragen hatten. Das Bild der perfekten Blondine hatte Risse bekommen und war nun noch schöner als zuvor. Es schien, als hätten sie einander gefunden.
— 4 —Neukölln, August 1917
Margot saß im Entbindungssaal neben einer Frau, die ihr neugeborenes Mädchen in den Armen hielt und laut schluchzte. Margot fand keine Worte mehr, die Gerlinde Martin beruhigen konnten. Hilfesuchend sah sie sich nach der diensthabenden Hebamme, einer Frau Ende vierzig mit krausem, blondem Haar um. Ihr Name war Frieda, und sie kam aus Prenzlauer Berg. Diese hatte jedoch alle Hände voll zu tun, denn bei zwei Frauen schien die Geburt kurz bevorzustehen. Eine zweite Hebammenschülerin, ein verschüchtert wirkendes, schwarzhaariges Ding aus irgendeinem Nest in Brandenburg, Margot konnte sich ihren Namen nicht merken, betreute eine von ihnen. Sie massierte der Frau den Rücken und sprach ihr immer wieder Mut zu.
Der Ausbildungsalltag war rasch eingekehrt. Der Dienst begann morgens um sechs und endete um acht Uhr abends. Jede Schülerin hatte einen festen Stundenplan erhalten, nach dem es sich zu richten galt. In jeder Abteilung blieben sie in der Regel zwei Monate, wobei alle vierzehn Tage gewechselt wurde. So durchliefen sie die Stationen. Wochenstation, Entbindungssaal, gynäkologische Abteilung und Poliklinik. Zusätzlich würden sie im benachbarten Säuglingsheim sechs Wochen Dienst tun und in der Fürsorge arbeiten. Hin und wieder hatten sie auch Nachtdienst. Den nächsten Tag durften sie sich freinehmen und mussten lediglich zu den Vorlesungen von Professor Hammerschlag erscheinen. »Babys kennen keinen Zeitplan«, wurde die Marquard nicht müde zu sagen.
Heute war ein besonders warmer Tag, und im Raum stand die Luft. Margot wischte sich mit einem Tuch den Schweiß von der Stirn und überlegte, wie sie die Frau vor sich noch trösten könnte. Sie war Mitte vierzig und damit eine der Spätgebärenden. Das Kind war während des letzten Heimaturlaubs ihres Gatten gezeugt worden; drei Wochen nach seiner Rückkehr an die Ostfront war er tot. Bereits fünf Kinder hatte Frau Martin großgezogen. Der Älteste, sein Name war Joachim, war vor zwei Wochen achtzehn geworden und unterstützte sie, wo er nur konnte. Er hatte Arbeit in einer Fabrik gefunden, hatte sie voller Stolz erzählt. Und er besorgte auf dem Schwarzmarkt immer ein Stückchen Butter. Was sie ja nicht zu laut sagen dürfe, denn ihre Nachbarin, die alte Lehmann, war recht neidend. Aber gerade ihre Jüngste, die kleine Johanna, sei doch immer so schwächlich. Da sei es wichtig, dass sie genug Fett bekam. Und jetzt war das eingetreten, wovor sich die Frau die letzten Wochen am allermeisten gefürchtet hatte: Ihr Joachim war an die Front beordert worden. Wie sollte es ohne ihn weitergehen? Sie selbst konnte nicht in die Fabrik gehen, denn wer sollte auf den Säugling aufpassen? Und von dem bisschen Witwenrente konnten sie nicht leben.
Margot kannte solche Geschichten zur Genüge. Sie geisterten durch die Straßen Neuköllns und waren genauso alltäglich geworden wie der Anblick der Kriegsversehrten oder das stundenlange Anstehen vor irgendwelchen Lebensmittelgeschäften. Die Frau strich ihrer neugeborenen Tochter über die Wange, ihre Tränen tropften auf das Tuch, in das die Kleine gewickelt war. Was für eine Zukunft würde dieses Kind erwarten? Sie dachte an die winzige Kellerwohnung, in der ihre Mutter und ihre Geschwister hausten. Vermutlich würde das kleine Mädchen mit dem blonden Flaum auf dem Kopf ein ähnlich ärmliches Leben fristen, falls es die ersten Jahre überstand. Die Kindersterblichkeitsrate war hoch, und durch den allgegenwärtigen Mangel wurde es jeden Tag schlimmer. Margot graute es davor, an den nächsten Winter zu denken.
»Margot, kommst du bitte mal?«, riss Frieda sie aus ihren Gedanken.
Margot erhob sich und trat neben die Hebamme, die ein ernstes Gesicht machte, was ungewöhnlich war, denn normalerweise hatte Frieda stets ein Lächeln auf den Lippen und schaffte es mit ihrem fröhlichen Wesen, die Frauen von den Geburtsschmerzen abzulenken.
»Es stimmt etwas mit Frau Landmann nicht. Das Kind will nicht rauskommen, und ich höre kaum noch die Herztöne. Geh und hol einen der Ärzte. Sie haben gerade Besprechung im Arztzimmer. Wir müssen einen Kaiserschnitt machen, sonst verlieren wir das Kind.«
Rasch lief Margot aus dem Raum und den Flur hinunter. Im Arztzimmer, dessen Tür sie nach kurzem Anklopfen öffnete, sahen vier Männer sie verwundert an. »Frieda schickt mich. Die Herztöne des Babys von Frau Landmann sind kaum noch hörbar«, sagte Margot.
Sofort sprangen zwei der Männer auf und eilten in den Entbindungssaal. Margot folgte ihnen. Frieda erklärte die Situation.
Dr. Erich Olsewitz begann sofort den Bauch der Patientin abzutasten, suchte ebenfalls mit dem Hörrohr nach dem Herzschlag des Kindes und nickte. »Nur noch schwach. Wir müssen uns beeilen. Sie muss sofort in einen der Operationssäle. Schwester, schnell.«
Frieda seufzte hörbar, nachdem sich die schwere Flügeltür hinter dem Bett von Frau Landmann geschlossen hatte.
»Hoffentlich schaffen sie es, das kleine Würmchen zu retten. Die arme Frau Landmann hat bereits drei Totgeburten hinter sich. Es ist ihr zu wünschen, dass sie dieses Kind lebend im Arm halten und aufwachsen sehen kann.« Zum ersten Mal, seit Margot Frieda kannte, schwang so etwas wie Wehmut in ihrer Stimme mit. »Seinen Vater wird das Kindchen nicht mehr kennenlernen. Er ist in Verdun gefallen. Es ist schrecklich. Ich kann gar nicht mehr zählen, wie viele Waisen ich in den letzten drei Jahren auf die Welt geholt habe. Was soll aus diesen Kindern nur werden? Mein Bruder hat von Anfang an gesagt, dass dieser Krieg der reinste Wahnsinn ist. Er ist Sozialdemokrat und saß für seine Überzeugungen sogar eine Weile im Gefängnis ein. Jetzt schickt er seinem Sohn Geschenke an die Front. Lebensmittel, Kleidung, Zigaretten. Der Bub ist im Osten, da ist es im Winter schrecklich kalt. Ich hab ihm einen Schal und Handschuhe gestrickt. Ich bete jeden Tag dafür, dass er heil wieder nach Hause kommt.« In ihre Augen traten Tränen, die sie hektisch fortwischte. »Es tut mir leid. Ich wollte nicht …«
»Ist schon gut«, beruhigte Margot sie. »Viele von uns sprechen inzwischen ihre Sehnsucht nach Frieden offen aus. Vor mir hast du nichts zu befürchten. Wie du weißt, ist mein Vater gefallen. Mama trifft sein Verlust hart und das nicht nur der Existenz wegen. Sie hat ihn so sehr geliebt.«
Frieda nickte und antwortete nach einem kurzen Moment des Schweigens: »Komm. Lass uns zurückgehen und weitermachen. Sonst muss Christine das Kindchen von Frau Groslechner noch allein auf die Welt holen, und ich befürchte, damit wäre sie überfordert.«
Richtig, Christine hieß ihre dunkelhaarige Kommilitonin aus Brandenburg. Es würde noch eine ganze Weile dauern, bis sie die vielen Namen würde behalten können.
Als sie den Entbindungssaal wieder betraten, staunten sie nicht schlecht. Luise stand neben Christine, die gerade Frau Groslechner mit einem Lächeln ihren Sohn in die Arme legte. Frieda trat näher und klopfte sowohl Luise als auch Christine auf die Schultern. »Da bringt man mal flott eine Patientin in den Operationssaal und dann so etwas. Das habt ihr beiden großartig gemacht«, lobte sie.
»Es ging plötzlich so schnell, und Sie waren nicht da, und dann kam Luise, und sie weiß doch schon so viel. Da hat sie mir geholfen«, redete Christine wie ein Wasserfall drauflos.
»Schon gut«, sagte Frieda. »Heute ist es ein wenig chaotisch, weil Käthe und Berta erkrankt sind und im anderen Entbindungssaal die Hölle los ist. Und jetzt auch noch der Notfall mit Frau Landmann. Ich denke, wir haben uns einen Tee verdient. Möchten Sie auch einen Becher?«, fragte sie Frau Groslechner. Die Patientin nickte.
»Na fein«, sagte Frieda. Sie hatte ihre gute Laune wiedergefunden. »Dann kümmere ich mich jetzt mit Margot um die Nachgeburt, und Christine reinigt das Bett. Luise, geh du Tee kochen.« Sie klatschte in die Hände.
Alle drei nickten, und Luise machte sich auf den Weg in die Küche, wo sie auf einen der unverheirateten Ärzte traf. Günter Berger war blond, und seine Oberlippe zierte ein schmaler Schnauzbart. Seine blauen Augen verschwanden hinter einer Brille, die jedoch sein gutes Aussehen nicht schmälerte. Luise war ihm erstmals bei einem Vortrag begegnet. Er hatte eine Gruppe Schülerinnen angeleitet, wie man eine Schwangere untersuchen sollte. Dabei war er sehr feinfühlig mit seinem Vorführobjekt, einer der Hausschwangeren, umgegangen, was ihr gefallen hatte. Er war ihr sympathisch, und sie fand ihn attraktiv. Das taten die meisten Hebammenschülerinnen. Jedes Mal, wenn er irgendwo auftauchte, verstummten die Gespräche, er wurde freundlich gegrüßt, und die Blicke vieler Damen bekamen etwas Schmachtendes. Gewiss würde es bald die ersten Techtelmechtel im Haus geben. Luise konnte da nur verständnislos den Kopf schütteln. Nie würde sie ihre Ausbildung für so etwas riskieren.
Günter Berger grüßte sie freundlich zurück und fragte dann: »Sind Sie nicht Luise Mertens? Neulich erst hat der Herr Professor Sie lobend erwähnt. Sie scheinen mit Abstand die erfahrenste aller Schülerinnen zu sein. Er meinte sogar scherzhaft, dass sie bereits unterrichten könnten. Darf ich fragen, wie dieser Umstand zustande gekommen ist?«
Luise spürte, wie sie rot wurde. Sie berichtete dem Arzt in knappen Worten, wie sie aufgewachsen war.
»Dann sind Sie also sozusagen in den Beruf hineingewachsen«, sagte er mit einem Lächeln, das Luise dahinschmelzen ließ. »Solche Menschen wie Sie braucht das Reich. Aber sagen Sie, weshalb machen Sie dann noch die Ausbildung an unserer Schule?«
»Weil ich nicht einfach so als Hebamme arbeiten darf. Jedenfalls sagt das meine Oma. Ich brauche ein Hebammenprüfungszeugnis und später auch die Genehmigung eines Bezirksamtes, damit ich in der Region als Hebamme tätig sein kann. Meine Oma besitzt natürlich die erforderlichen Dokumente, aber sie können nicht vererbt werden.«
»Dokumente nicht, aber das Wissen«, antwortete Günter Berger und nahm seinen Kaffeebecher in die Hand. »Und das ist mehr wert als jedes Prüfungszeugnis. ›Papier ist geduldig‹, sagte mein Großvater immer.« Er zwinkerte Luise zu und verließ mit einem Abschiedsgruß auf den Lippen den Raum. Für einen Moment lächelte sie selig, dann schalt sie sich. Schluss jetzt. Du bist nicht der Männer wegen nach Neukölln gekommen, und einen Ehemann suchst du schon gar nicht.
Ende nächsten Jahres würde sie wieder in Ostpreußen sein, ihrer Oma stolz ihr Zeugnis zeigen und beim dortigen Bezirksamt die nötigen Anträge stellen. Und bis dahin galt es, sich an die Regeln zu halten.
Als sie wenig später zurück in den Entbindungssaal kam, wurde von einer Schwester gerade eine neue Patientin gebracht. Die braunhaarige Frau um die vierzig stöhnte bereits heftig und setzte sich schwerfällig auf eines der Betten.
»Ist noch gar nicht an der Zeit«, sagte sie zu Margot, die sogleich näher herangetreten war, um sich um sie zu kümmern. »Sollte erst in drei Wochen kommen. Aber nun ist die Fruchtblase geplatzt. So eine Sauerei. Den Kneipenboden muss jetzt das Julchen aufwischen. Mich hat gleich die Mallmann hergeschleppt. Die ist ja eigentlich 'ne rechte Schlampe, tanzt angeblich in einer Revue. Aber jetzt war ich dankbar, dass sie zufällig da gewesen ist. Hat schon bös gezwickt im Bauch auf dem Weg hierher, und in der Straßenbahn rumpelt das so heftig.«
Frieda kannte die Dame bereits von der Schwangerschaftsfürsorge. »Frau Kranewitz, was machen Sie denn schon hier? Da scheint es jemand mächtig eilig zu haben.« Sie half der Schwangeren dabei, die Schuhe auszuziehen.
»Der Bub will seinen Vater kennenlernen«, sagte Frau Kranewitz und begann erneut zu stöhnen. Sie legte die Hand auf ihren Rücken und verzog das Gesicht. »Der kommt nämlich morgen auf Heimaturlaub. Drei Wochen bleibt er da. Na, der wird Augen machen.«
»Heimaturlaub, wie schön. Na, das sind doch mal gute Neuigkeiten«, antwortete Frieda, während sie der Kneipenwirtin aus dem Kleid half. »Dann müssen wir uns beeilen und das Kindchen schnell auf die Welt holen. Ob es ein Junge wird, kann ich noch nicht sagen.«
Margot brachte rasch ein sauberes Hemd, das sie Frau Kranewitz überzogen.
Als Frieda ihren Bauch abtastete, betrat Dr. Berger den Entbindungssaal und kam näher. »Eine neue Patientin. Guten Tag, die Dame. Wen haben wir hier?«
»Ist 'n bisschen früh dran, das Kindchen. Aber es dürfte keine Probleme geben. Ich wollte gerade nach den Herztönen sehen und dann den Muttermund überprüfen.«
»Das kann ich gern übernehmen«, antwortete der Arzt. »Von der Aufnahme kommen zwei weitere Patientinnen nach oben. Heute ist viel Betrieb.«
Er hatte den letzten Satz noch nicht zu Ende gesprochen, da öffnete sich die Tür, und zwei Schwestern brachten die Patientinnen in den Raum, die in den letzten beiden unbelegten Betten Platz fanden. Margot und Luise halfen beim Umkleiden, stellten die ersten Fragen und füllten die Behandlungsbögen aus.
Frieda bat eine der Schwestern darum, rasch in den anderen Kreißsaal zu laufen, denn sie würden Unterstützung benötigen. »Ich kann nur hoffen, dass Käthe und Berta morgen wieder hier sind.« Dann trat sie zu Luise und sagte leise: »Auf dich kann ich mich am meisten verlassen. Wirst heute ein bisschen mehr machen als die anderen Schülerinnen. Wir müssen es ja nicht an die große Glocke hängen.«
Luise nickte.
Edith mochte den Dienst in der Fürsorgestelle der Kinderklinik, für den sie seit Beginn ihrer Ausbildung eingeteilt worden war. Den ganzen Tag war sie von Müttern mit ihren Kindern umringt, und es herrschte eine ganz besondere Art von Trubel. Gerade legte sie einen nur mit einer Stoffwindel bekleideten Säugling vor sich auf eine Waage und schob die Gewichte hin und her. Sie sah auf die Wiegekarte des Kleinen, die von der städtischen Säuglingsfürsorge Neukölln für jedes Neugeborene ausgestellt wurde, und legte die Stirn in Falten. »Er hat leider abgenommen«, sagte sie zu der neben ihr stehenden Mutter. »Stillen Sie den Kleinen regelmäßig?«
»Aber gewiss doch«, antwortete die Frau. »Aber es kommt oftmals nicht genug Milch. Ständig ist er am Weinen und Schreien. Er saugt mich regelrecht aus.«
Edith nickte. Die Frau wirkte ausgemergelt, und tiefe Ringe unterlegten ihre Augen. Das dunkelblaue Kleid, das sie trug, war an mehreren Stellen bereits geflickt. »Wie viele Kinder leben noch bei Ihnen im Haushalt?«, fragte sie.
»Vier«, antwortete die Frau. »Zwei Mädchen, die sind jetzt sieben und acht, und zwei fünfjährige Buben, Zwillinge. Sie bekommen in der Krippe regelmäßig Essen, aber daheim haben sie auch ständig Hunger. Und gestern war die Butter in der Ausgabestelle wieder