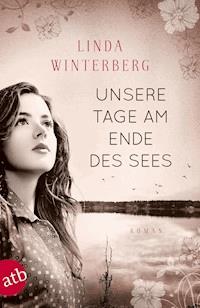9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die große Hebammen-Saga
- Sprache: Deutsch
Drei junge Frauen folgen dem Ruf des Lebens.
Berlin 1929: Die drei Freundinnen haben ihren Weg gefunden: Edith arbeitet als Hebamme in der Klinik und in der Beratungsstelle für Frauen. Margots Leben steht Kopf, nachdem sie sich in einen verheirateten Mann verliebt hat, und Luise unterrichtet inzwischen Hebammen-Schülerinnen und stürzt sich ins Nachtleben der schillernden Metropole. Gleichzeitig zeigen sich die Spuren der Weltwirtschaftskrise nur zu deutlich in Berlin. Armut und Leid sind allgegenwärtig. Als Edith ein verlockendes Angebot bekommt, das ihr Leben verändern wird, ist die Freundschaft der drei Frauen auf eine harte Probe gestellt. Die große Hebammen-Saga: historisch fundiert, atmosphärisch und voller liebenswerter Figuren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 521
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über Hinter Linda Winterberg
Hinter Linda Winterberg verbirgt sich Nicole Steyer, eine erfolgreiche Autorin historischer Romane. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Töchtern im Taunus und begann im Kindesalter erste Geschichten zu schreiben, ganz besonders zu Weihnachten, was sie schon immer liebte. In der Aufbau Verlagsgruppe liegen von ihr die Romane »Das Haus der verlorenen Kinder«, »Solange die Hoffnung uns gehört«, »Unsere Tage am Ende des Sees«, »Die verlorene Schwester«, »Für immer Weihnachten« sowie der erste Teil der Hebammen-Saga »Aufbruch in ein neues Leben« vor.
Informationen zum Buch
Drei junge Frauen folgen dem Ruf des Lebens.
Berlin 1929: Die drei Freundinnen haben ihren Weg gefunden: Edith arbeitet als Hebamme in der Klinik und in der Beratungsstelle für Frauen. Margots Leben steht Kopf, nachdem sie sich in einen verheirateten Mann verliebt hat, und Luise unterrichtet inzwischen Hebammen-Schülerinnen und stürzt sich ins Nachtleben der schillernden Metropole. Gleichzeitig zeigen sich die Spuren der Weltwirtschaftskrise nur zu deutlich in Berlin. Armut und Leid sind allgegenwärtig. Als Edith ein verlockendes Angebot bekommt, das ihr Leben verändern wird, ist die Freundschaft der drei Frauen auf eine harte Probe gestellt.
Die große Hebammen-Saga: historisch fundiert, atmosphärisch und voller liebenswerter Figuren.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Linda Winterberg
Jahre der Veränderung
Die Hebammen-Saga Teil 2
Inhaltsübersicht
Über Hinter Linda Winterberg
Informationen zum Buch
Newsletter
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Nachwort
Dank
Impressum
— 1 —
BERLIN, 15.JULI 1929
Luise spürte, wie jemand an ihrer Schulter rüttelte, und eine ihr wohlbekannte Stimme drang in ihr Ohr. »Luise, aufwachen. Luise, jetzt mach schon. Du sollst in einer Stunde einen Vortrag im Hörsaal halten. Luise!« Das Rütteln wurde stärker, Edith ließ mal wieder nicht locker. Luise grummelte etwas Unverständliches. Am liebsten würde sie sich die Decke über den Kopf ziehen und weiterschlafen. Aber das ging nicht. Edith hatte recht, sie musste den vermaledeiten Vortrag über den Verlauf von Fehlgeburten halten. »Ich habe dir gleich gesagt, du sollst nicht zu Elfi ins Theater gehen«, sagte Edith und zog ihr die Decke weg. »Aber du wolltest ja nicht auf mich hören.«
»Du immer mit deiner Vernunft.« Luise setzte sich auf und blinzelte gegen das helle Sonnenlicht, das durch das Fenster in ihr Zimmer fiel. Sie trug nur ihre Unterwäsche, ihr kurz geschnittenes, braunes Haar war zerzaust.
»Siehst schlimm aus«, konstatierte Edith. »Da wirst du eine Menge Puder und Rouge brauchen.«
Luise zog eine Grimasse und setzte sich auf die Bettkante. Auf dem Fußboden verteilt lag ihre Kleidung vom gestrigen Abend. Das schmal geschnittene Paillettenkleid, ihre Strümpfe und die Absatzschuhe.
»Hat es sich wenigstens gelohnt?«, fragte Edith.
»Ging so«, antwortete Luise und streckte sich gähnend. »Hab schon bessere Revuen gesehen. Neulich in der Scala …«
»Du kannst Elfis kleines Theater doch nicht mit der Scala vergleichen«, fiel Edith ihr ins Wort.
»Auch wieder wahr.« Luise stand auf und blickte in den Spiegel des kleinen Toilettentischs, der gegenüber des Bettes stand. »Du liebe Güte. Ich sehe wie ein Gespenst aus. Und ehrlich gesagt, fühle ich mich auch wie eines.«
»Ach, das wird schon wieder. Bisschen Wasser ins Gesicht, eine Haarbürste und die übliche Kriegsbemalung, und alles ist schick«, erwiderte Edith grinsend. »Magda hat Kaffee gekocht, und es gibt Schrippen vom Bäcker an der Ecke.«
»Kaffee klingt gut«, erwiderte Luise. »Schrippen weniger.«
»Ich muss dann auch los«, sagte Edith und umarmte Luise kurz. Sie schnupperte ihren sanften Parfümgeruch. »Hab heute die Frühschicht in der Beratungsstelle, danach bin ich wie gewohnt in der Klinik. Wir sehen uns.«
»Bis später«, murmelte Luise und ließ ihren Blick durch den kleinen Raum schweifen. Es herrschte die gewohnte Unordnung. Die oberste Schublade der Kommode stand offen, ein Strumpf hing heraus. Über einem Stuhl hingen Röcke, Blusen und Kleider wild durcheinander, ihre Schwesterntracht lag obenauf. Gut, dass Magda Brückner, ihre Hauswirtin, dieses Durcheinander nicht sah. Sie war eine resolute Person, die Liederlichkeit nicht duldete. Magdas Tochter war vor einigen Jahren Patientin bei ihnen in der Klinik gewesen, und Magda hatte von dem Haus in der Weserstraße erzählt, das sie unverhofft geerbt hatte und in dem sie mehrere Zimmer vermieten wollte. Aber nur an anständige junge Damen. Schauspielerinnen oder andere Theatermädchen kämen ihr nicht ins Haus. So waren Margot, Edith und Luise bei ihr eingezogen. Jede von ihnen bewohnte ein voll möbliertes Zimmer mit hohen Decken und Stuck und kamen in den Genuss der Brückner’schen Fürsorge. Frühstück jeden Morgen ab sieben Uhr, Abendessen um sechs. Es gab ein Gemeinschaftsbad, in dem sogar eine Badewanne vorhanden war, und eine oberste Hausregel: kein Herrenbesuch. Aber daran dachte Luise sowieso nicht. Seit Günters Tod hatte sie keinen Mann mehr an sich rangelassen. Jedenfalls nicht in ihr Herz. Auch wenn sie das schlechte Gewissen plagte, auf körperliche Nähe konnte sie nicht verzichten. Sie musterte sich im Spiegel. Sah man ihr die Sünde an? Ihre Oma hatte mal gesagt, eine Schlampe würde sie auf den ersten Blick erkennen. Doch war man gleich eine Schlampe, nur weil man für wenige Stunden die Nähe eines Mannes suchte?
»Du würdest es hassen«, sagte Luise laut. »Und ich tue es auch. Ich hasse mich selbst dafür. Aber es lässt sich nicht ändern.«
Ihre Zimmertür öffnete sich, ohne dass angeklopft wurde, und Margot trat ein. Sie trug bereits ihre Schwesterntracht. Ihr ebenfalls kurz geschnittenes, braunes Haar war in Wellen gelegt. Ein Hauch ihres blumigen Parfüms stieg Luise in die Nase. »Morgen, Luise. Du bist ja noch gar nicht fertig. Noch zehn Minuten, dann räumt Magda den Frühstückstisch ab. Wenn du noch einen Kaffee bekommen willst, solltest du dich beeilen. Hast du Elfi die Grüße von mir ausgerichtet?«
Luise nickte. »Habe ich«, erwiderte sie. Doch Margot hörte ihre Worte nicht mehr. Sie hatte die Tür bereits wieder geschlossen. Margot hatte glücklich ausgesehen. Luise kannte den Grund dafür. Er war blond, eins achtzig groß, hatte schöne blaue Augen und arbeitete seit einigen Monaten in der septischen Abteilung. Allerdings war Georg verheiratet, was die Angelegenheit kompliziert machte. Margot beteuerte stets, dass er sich bald von seiner Frau scheiden lassen würde. Doch solche Geschichten hatte Luise zur Genüge gehört. Sie war sich sicher: Diese Scheidung würde es niemals geben. Aber ein Gutes hatte die Liebesbeziehung: Margot war sichtlich aufgeblüht. Im Gegensatz zu ihr, schien sie den Verlust von Richard, ihrer Jugendliebe, besser verarbeitet zu haben. Vielleicht lag das daran, dass Margot bereits mehrere Verluste erlitten hatte. Ihr Vater war im Krieg gefallen, ihre Mutter im Frühjahr 1919 an der Spanischen Grippe gestorben. Ihre Schwester Hilde hatte sich mit Syphilis angesteckt und sich vor fünf Jahren vor einen Zug geworfen. Luises Blick wanderte zu dem gerahmten Foto auf ihrer Kommode. Darauf war ihre Großmutter zu sehen, die vor ihrem Haus stand. Ihre Oma, aber auch ihr Zuhause in Ostpreußen fehlten ihr sehr. Besonders die Stille auf dem Land war es, die sie oftmals vermisste. Berlin schlief nie, es war stets trubelig und laut, selbst in den Nächten. Luise seufzte. Der Verlust von geliebten Menschen, von Heimat. Jeder ging anders damit um. »Du hättest jetzt gesagt: ›Hör mit der Grübelei auf. Bringt ja doch nichts‹«, sagte sie zum Foto. »Und du hast ja recht. Es geht immer irgendwie weiter.«
Ein lautes Klopfen an der Tür ließ sie zusammenzucken.
»Luise. Willst du jetzt noch Frühstück?«, rief Magda Brückner.
»Nein, heute nicht«, antwortete Luise.
»Auch recht«, antwortete ihre Hauswirtin. Ihre Schritte entfernten sich.
Nachdem sie sich gewaschen, frisiert und geschminkt hatte, schlüpfte sie rasch in ihre bequemen Schuhe, zog eine Strickjacke über und verließ ihre Kammer. An der geöffneten Küchentür blieb sie stehen. »Ich bin dann mal weg«, rief sie. »Einen schönen Tag wünsche ich.«
»Ebenso«, erwiderte Magda Brückner. »Darauf, dass heute viele gesunde Kinderchen geboren werden.«
Luise brachte der Satz zum Lächeln. Diesen sagte Magda Brückner jedes Mal, wenn sie und ihre Freundinnen das Haus verließen. Sie wusste, wie stolz ihre Hauswirtin darauf war, drei Hebammen bei sich zu beherbergen.
Luise musste sich sputen, sonst käme sie als Dozentin zu dem Vortrag zu spät, und das machte bei den Schülerinnen keinen guten Eindruck. Sie lief rasch in den Hinterhof und holte ihr Fahrrad aus einem Verschlag. Auf der Straße empfing sie der übliche städtische Trubel. In der Cannerstraße musste sie vom Fahrrad absteigen und es ein Stück schieben, denn hier wurde die Straße mit einer der neuartigen Straßenbaumaschinen saniert. Viele Passanten blieben stehen, um die Arbeiten zu beobachten. Ein findiger Verkäufer nutzte die Gunst der Stunde und hatte zwischen den Schaulustigen einen Klapptisch aufgebaut, an dem er Spielzeug zum Verkauf anbot. Am Ende der Baustelle stieg Luise wieder auf ihr Fahrrad und fädelte sich in den dichten Verkehr ein. Besonders als Fahrradfahrer galt es, auf der Hut zu sein. Nur wenige Autofahrer nahmen auf die Zweiräder Rücksicht, geschweige denn die Straßenbahnen. Da konnte man schnell unter die Räder kommen.
Endlich hatte sie das Klinikgelände erreicht. Die Brandenburgische Hebammenlehranstalt und Frauenklinik war eine große Anlage mit mehreren Gebäuden. Es gab das Verwaltungsgebäude, in dem sich die Schlafsäle für die Hebammenschülerinnen und der Speisesaal befanden. Auch eine Poliklinik war hier direkt neben dem Haupteingang untergebracht. Der mittlere und größte Bau der Anlage war das Entbindungshaus mit den Entbindungs- und Operationssälen sowie den Wöchnerinnen- und Säuglingszimmern. Hinzu kam noch das Wäschereigebäude mit dem Kesselhaus und das Direktorenwohnhaus, in dem Professor Hammerschlag mit seiner Familie wohnte. Das Entbindungshaus war in den letzten Jahren um einen Anbau erweitert worden, denn in den Nachkriegsjahren hatten die Fälle von ansteckenden Infektionskrankheiten und Fehlgeburten wegen Geschlechtskrankheiten rapide zugenommen. Es galt, zu verhindern, dass sich diese in den anderen Räumlichkeiten der Klinik ausbreiteten. So wurden infektiöse Patientinnen direkt von der Straße in das hufeisenförmige Gebäude dieser Abteilung gebracht. Der Hörsaal, in dem sie die Vorlesung halten sollte, befand sich im obersten Stockwerk und war in der Form eines Amphitheaters angelegt. Luise konnte sich noch gut daran erinnern, wie beeindruckend sie diesen Raum gefunden hatte, als sie ihn das erste Mal betreten hatte. Ganz Berlin und auch Neukölln waren damals für sie, das Landkind aus Ostpreußen, eine Herausforderung gewesen.
Auguste Marquard, die, obwohl sie bald siebzig Jahre alt war, immer noch als Oberhebamme arbeitete, war schon da. »Luise, meine Liebe. Da bist du ja endlich. Bei Ursula Kohlgruber haben die Wehen eingesetzt. Sie hat öfter nach dir gefragt. Ich dachte, du möchtest vielleicht bei der Geburt dabei sein. Den Vortrag für die Schülerinnen kann ich übernehmen.«
»Dann ist es also endlich so weit. Wir dachten schon, das Kind will gar nicht mehr rauskommen. Danke, dass du für mich übernimmst.« Luise verließ den Raum und eilte zum Entbindungshaus. Ursula Kohlgruber war eine von vierzig Hausschwangeren, die im Moment in der Klinik untergebracht waren. Die Station für die Hausschwangeren war aus sozialen Gesichtspunkten in der Klinik eingerichtet worden. Zumeist waren es unverheiratete Frauen; viele von ihnen waren von den Eltern verstoßen worden oder besaßen keine eigene Wohnung. Die Schwangeren meldeten sich in der Regel sechs Wochen vor dem geplanten Entbindungstermin in der Klinik und halfen, soweit es ihr Gesundheitszustand zuließ, im Klinikdienst mit. Ursula war gerade mal fünfzehn Jahre alt. Der Vater war ein Junge aus der Nachbarschaft, der nichts von dem Kind wissen wollte. Luise hatte während eines Gesprächs herausgefunden, dass der Geschlechtsverkehr wohl nicht ganz freiwillig gewesen war. Als ihre Schwangerschaft bekannt geworden war, hatte Ursula ihre Stellung als Näherin in einer Schneiderei verloren und ihre Mutter hatte sie rausgeworfen. Luise hatte das Aufnahmegespräch geführt. Das Mädchen war ein Häufchen Elend gewesen, und heute war es nicht viel besser. Den Gedanken, das Kind zu behalten, hatte sie von Anfang an nicht zulassen wollen. Nachdem sie in der Klinik aufgenommen worden war, hatte sich die Provinzialfürsorgerin dafür eingesetzt, eine Versöhnung mit der Mutter herbeizuführen. Doch die Mutter war hart geblieben. Sie wollte ihre schandhafte Tochter nicht mehr im Haus haben. Wie es nun weitergehen würde, wusste niemand so recht. Eines stand jedoch fest: Ursula würde die Klinik nicht verlassen, solange keine adäquate Lösung für sie und das Kind gefunden worden war.
Luise betrat den Entbindungssaal. Es waren beinahe alle Betten belegt. Vier Hebammen, drei Krankenschwestern und ein Arzt waren anwesend. Dieser Mittwoch schien ein gebärfreudiger Tag zu sein. Musste am Wetter liegen. Seit Tagen lag eine unerträgliche Schwüle über der Stadt, die die hin und wieder niedergehenden Gewittergüsse nicht vertreiben konnte.
Ursula lag in dem Bett gleich neben dem Eingang. Sie sah mitgenommen aus; ihr blondes, vom Schweiß nasses Haar klebte an ihrer Stirn.
Luise trat mit einem aufmunternden Lächeln näher. »Grüß dich, Ursula. Und wir dachten schon, es will für immer drinbleiben, was?«
Ursula bedachte sie mit einem gequälten Lächeln. »Es tut so schrecklich weh. Ich glaub, ich schaff das nicht. Ich kann das nicht.«
»Natürlich kannst du das«, antwortete Luise. »Wir machen das gemeinsam. Ich werde diesen Raum erst wieder verlassen, wenn du dein Baby im Arm hältst. Das verspreche ich dir.«
Ursula nickte.
Luise entging nicht, dass ihre letzten Worte Ursulas Miene eine Spur verfinstert hatte. »Ich weiß, du willst es nicht behalten. Aber gib dem Kleinen eine Chance. Du bist seine Mutter. Euch verbindet etwas Einzigartiges. Und wir haben schon viele Mütter mit Kindern in eine gute Anstellung vermittelt. Weshalb sollten wir das denn nicht auch mit dir hinbekommen?«
Ursula nickte erneut, in ihre Augen traten Tränen.
Luise wusste, dass sie es nur schwer verkraftete, dass ihre Mutter sie im Stich gelassen hatte. Sie hatte ihr alles erzählt. Nach dem Tod ihres Vaters, er war im Krieg gefallen, hatte sich Ursula aufopferungsvoll um ihren kleinen Bruder gekümmert, während ihre Mutter in der Fabrik gearbeitet hatte. Doch dann war ihr Bruder an Scharlach erkrankt und daran verstorben. Das hatte alles verändert. Ihre Mutter war in ihrer Trauer gefangen und hatte sich von Ursula abgeschottet, der sie unterschwellig das Gefühl gegeben hatte, für den Tod des Jungen verantwortlich gewesen zu sein. Bald schon waren sie wie zwei Schatten gewesen, die gemeinsam in der kleinen Dachgeschosswohnung im dritten Hinterhof ihr Leben gefristet hatten.
Eine erneute Wehe kam, und Ursula begann zu stöhnen. Luise nahm ihre Hand und sprach beruhigend auf sie ein, bis die Wehe vorüber war. Dann fragte sie: »Wann wurde zuletzt geprüft, wie weit du schon bist, und wie war der Befund?«
»Vor einer Weile, ich weiß nicht mehr genau«, presste Ursula hervor. »Die Hebamme hat etwas von zwei Zentimetern gesagt.«
»Gut«, erwiderte Luise und nickte. »Dann werde ich mal nachsehen.« Nachdem sie den Vorhang vors Bett gezogen hatte, untersuchte sie Ursula. »Viel ist nicht passiert«, sagte sie. »Es geht wohl eher langsam voran. Wollen wir ein wenig den Flur auf und ab laufen? Das könnte es beschleunigen.«
Heute waren noch zwei weitere Frauen in Begleitung von zwei Hebammenschülerinnen auf dem Flur unterwegs. Eine von ihnen war Anita Maluck, eine Revue-Tänzerin Anfang zwanzig. Ihre Haut war weiß wie Schnee, ihr dunkles Haar voll. Sie hatte äußerst lange Wimpern und leuchtend blaue Augen. Trotz der Schwangerschaft wirkte sie noch immer zierlich. Hätte Luise es nicht besser gewusst, sie hätte geglaubt, Anita wäre erst im sechsten Monat. Neben ihr wirkte das Zimmermädchen Wilma Klaffke riesig. Sie überragte Anita um einen Kopf und war von kräftiger Statur. Schon am Tag ihrer Ankunft vor sechs Wochen hatte sie ausgesehen, als würde sie gleich platzen. Im Gegensatz zu Ursula hatte Wilma jedoch das Glück, dass ihr Arbeitgeber sie weiterbeschäftigte. Für eine Unterbringung von Mutter und Kind war die Heimatbehörde zuständig. Für Wilma würde es einen Platz in einem Wohnheim geben. Das Kleine konnte, während sie arbeitete, in der Krippe untergebracht werden. Für Anita sah es hingegen noch schlechter aus als für Ursula. Das Einzige, was die junge Frau beherrschte, war Tanzen. Sie konnte weder Schreibmaschinenschreiben noch Stenografie. Vielleicht könnte Elfi weiterhelfen. Sie war stets auf der Suche nach neuen und vor allen Dingen hübschen Tänzerinnen mit dem gewissen Etwas. Erst gestern Abend hatte sie geklagt, sie bräuchte mal wieder eine mit Pfiff, eine, die den Männern anständig den Kopf verdrehte. Anita war so jemand.
»Was ist das denn?«, riss Ursula sie aus ihren Gedanken. Zwischen ihren Beinen hatte sich eine Pfütze gebildet.
»Dir ist gerade die Fruchtblase geplatzt. Jetzt geht es bedeutend schneller.«
Im nächsten Moment begann Ursula zu stöhnen, und Luise massierte ihr den Rücken.
»Ist gleich vorüber«, sagte sie tröstend. »Schön tief ein- und ausatmen. So ist es gut. Ruhig atmen, gleich ist es vorbei.«
Die Wehe ebbte ab, und Ursula entspannte sich.
»Wir gehen jetzt lieber wieder in den Entbindungssaal zurück«, sagte Luise. »Es ist besser, wenn du liegst.«
Im Entbindungssaal wurden sie von kräftigem Babygeschrei begrüßt. Dora Albrecht hatte eben einen Jungen zur Welt gebracht.
Die nächste Wehe kam, Luise sah auf ihre Armbanduhr. »Die Abstände werden kürzer. So soll es sein.«
»Es tut so schrecklich weh«, jammerte Ursula. »Es soll aufhören. Bitte, macht doch was.«
»Es hört erst auf, wenn das Kind da ist«, antwortete Luise und tupfte mit einem Tuch Ursula den Schweiß von der Stirn. Ursulas Körper ließ ihr nur wenig Zeit zum Durchatmen. Die nächste Wehe setzte ein, und sie begann instinktiv zu pressen. »Ich kann das Köpfchen schon sehen. Fest pressen, meine Liebe. Es ist gleich geschafft.« Luise war überrascht, wie schnell es nun ging.
»Ich kann das nicht«, brachte Ursula zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor, während sie sich nach vorn beugte.
»Doch, du kannst das«, antwortete Luise. »Wenn die nächste Wehe kommt, dann drückst du, so fest du kannst. Nicht schreien, hörst du? Steck all deine Kraft ins Pressen.«
Ursula nickte. Ihr Gesicht war rot angelaufen, der Schweiß rann ihre Schläfen herunter. Die Wehe kam, und sie presste mit aller Macht. Ein Schrei entfuhr ihr. Dann überkam sie die nächste Wehe.
Wenige Minuten später hielt Luise ihr Baby in den Armen. »Es ist ein kleiner Junge«, sagte sie. »Oh, er ist so bezaubernd.« Sie wollte ihn Ursula reichen. Doch diese wandte den Kopf ab.
»Ich will ihn nicht sehen«, sagte sie mit bebender Stimme. Tränen schwammen plötzlich in ihren Augen. »Bring ihn fort.«
»Das glaub ich nicht«, antwortete Luise. Sie hatte schon viele Mütter in dieser Situation erlebt und kannte den Unterschied zwischen wahrer Ablehnung und Verzweiflung. Ursula liebte dieses Kind. So oft hatte sie sie in den letzten Wochen dabei beobachtet, wie sie lächelnd über ihren Bauch gestreichelt hatte. Sie würde sein Weggeben ihr ganzes Leben lang bereuen. »Sieh ihn dir wenigstens mal an«, sagte Luise und verlieh ihrer Stimme einen milden Unterton. »Er ist so hübsch. Ich möchte nicht, dass du es später bereust.« Sie betrachtete den Säugling. »Er hat eindeutig deine Nase und süße Grübchen um die Mundwinkel.«
»Aber ich kann ihn nicht behalten. Mama sagt, es ist eine Schande. Wo sollen wir denn hin? Niemand will uns haben.«
»Wir finden einen Weg«, antwortete Luise. »Für euch beide. Und solange sich keine Lösung gefunden hat, wirst du dieses Haus nicht verlassen. Das verspreche ich dir.« Sie nahm Ursulas Hand und drückte sie fest.
Ursula nickte, noch immer liefen Tränen über ihre Wangen.
Luise atmete erleichtert auf und legte den Kleinen seiner Mutter in die Arme. Es passierte das, was sich Luise gewünscht hatte: Ursulas Augen begannen auf diese ganz besondere Art und Weise zu strahlen, wie sie es nur in diesem speziellen Moment taten. Ein seliges Lächeln umspielte ihre Lippen.
»Hallo, mein Kleiner. Ich bin es, deine Mama.«
— 2 —
Margot stand vor dem Spiegel in der Umkleidekabine und drehte sich nach links, dann wieder nach rechts. Nach längerer Überlegung hatte sie sich dazu entschlossen, das türkise Kleid anzuprobieren, obwohl es, trotz des Ausverkaufspreises, zu teuer für sie war. Aber es gefiel ihr so gut, dass sie nicht hatte widerstehen können. Ein Abendkleid mit hübschen Volants an der Seite. Die Taille war bei diesem aus Georgette gefertigten Modell durch eine Raffung leicht betont. Ansonsten war es gerade geschnitten, wies aber einen tiefen Rückenausschnitt auf.
»Und, wie sieht es aus?«, fragte Edith, die vor der Umkleide auf sie wartete. »Komm doch raus, damit ich es sehen kann.«
Margot trat aus der Kabine und stellte sich Ediths prüfendem Blick.
»Dreh dich mal«, sagte Edith. »Hui, der Rückenausschnitt ist gewagt.«
»Findest du?«, fragte Margot und drehte sich zur Seite, um im Spiegel einen Blick auf ihre Rückseite zu erhaschen.
»Schon«, meinte Edith. »Aber dafür geht der Rock bis übers Knie. Das gleicht es wieder aus. Und die Farbe steht dir richtig gut.«
Margot betrachtete ihr Spiegelbild unschlüssig. »Macht sie mich nicht blass?«
Da war sie wieder, ihre Unsicherheit. Besonders in Ediths Nähe holte sie sie immer noch häufig ein. Für Margot war die blonde Edith eine der hübschesten Frauen, die sie je im Leben gesehen hatte. Selbst in ihrer Schwesternuniform wirkte sie elegant. Dreizehn Jahre waren seit ihrer ersten Begegnung vergangen, und Edith wirkte noch immer wie ein junges Mädchen. Sie trug ihr Haar inzwischen, der Mode entsprechend, kurz und in Wellen gelegt. Ihr stand dieser Haarschnitt hervorragend. Margot hingegen haderte immer noch jeden Tag mit ihrer Kurzhaarfrisur. Ihre störrischen Haare waren schwer zu bändigen und oftmals gelangen ihr die angesagten Wasserwellen nur leidig. Dazu kamen die lästigen Sommersprossen auf ihrer Nase, die sich nur schwer abdecken ließen. Erst neulich hatte sie versucht, sie mit einer Tinktur aus der Drogerie wegzubekommen. Leider hatte das sonderbar riechende Zeug einen scheußlichen Ausschlag verursacht, und es hatte Tage gedauert, bis er wieder abgeklungen war.
»Nein, ganz und gar nicht«, antwortete Edith. »Dazu noch eine hübsche Frisur und die passenden Schuhe. Ich leih dir gern meine beigefarbenen Riemchenschuhe, die passen perfekt dazu. Du wirst heute Abend der Blickfang im Kino sein. Georg wird Augen machen.«
Margot nickte zögerlich. Georg. Schon wenn sie an ihn dachte, verspürte sie dieses herrliche Kribbeln in ihrem Inneren. Sie wusste, dass das alles nicht richtig war, schließlich war Georg verheiratet. Doch sie konnte nicht anders. Vom ersten Moment an hatte der blonde Arzt eine besondere Anziehung auf sie ausgeübt, die, wie sie rasch festgestellt hatte, auf Gegenseitigkeit beruhte. Seine Ehe war unglücklich, Kinder gab es keine, seine Frau hatte bereits mehrere Fehlgeburten erlitten und war dadurch depressiv geworden. Sie nahm kaum am Leben teil und verkroch sich die meiste Zeit in ihrer Wohnung im Stadtteil Wedding. Doch konnte man ihren Zustand wirklich als Rechtfertigung für diese Affäre nehmen? Früher war Annegret, wie Georgs Frau hieß, ein lebensfroher Mensch gewesen. Sie kam aus geordneten Verhältnissen, war Arzttochter. Was auch sonst? Georg und sie kannten sich schon seit Kindertagen. Scherzhaft hatte er einmal gesagt, sie wären einander von den Vätern schon im Kleinkindalter versprochen worden. Es war Vertrautheit, eine Ehe mehr aus Pflichtgefühl denn aus Liebe. So hatte es Georg einmal zu ihr gesagt. Weder ihr Vater, der jahrelang in der Frauenheilkunde an der Charité tätig gewesen war, noch Georg hatten Annegret ihren größten Wunsch, ein eigenes Kind, erfüllen können. Sie hatte keines ihrer Kinder behalten. Die letzte Fehlgeburt war vor einem Jahr im vierten Monat gewesen. Dabei wäre sie fast gestorben. Eine gebrochene Frau verlässt man nicht so einfach, hatte Margot Georgs Verhalten erst neulich gegenüber Luise gerechtfertigt. Oder machte sie sich etwas vor? Seitdem sie Georg zum ersten Mal geküsst hatte, haderte sie mit sich. Sie war die Geliebte, die andere Frau. Diejenige, die den Ehemann verführte. Diejenige, die keine Rücksicht auf die leidende Ehefrau nahm. Aber ihre Gefühle ließen sich nicht betäuben. Vernunft kennt das Herz nicht, hatte Edith sie neulich getröstet.
Margot blickte ein letztes Mal in den Spiegel. Edith hatte recht. Das Kleid stand ihr. Sie drehte sich noch einmal von links nach rechts. Dann blieb ihr Blick an dem an der Seite befestigten Preisschild hängen. Auch der reduzierte Preis lag noch gute zehn Mark über ihrem Budget, das, wenn sie es genau nahm, nicht für ein Kleid vorgesehen war. Eigentlich hatte sie nach Wäsche Ausschau halten wollen, die sie dringender benötigte als ein neues Ausgehkleid.
Edith erriet Margots Gedanken. »Es ist zu teuer.«
Margot nickte. »Ich hätte es nicht anprobieren sollen.«
»Ich leih dir das Geld«, sagte Edith. »Du kannst es mir irgendwann wiedergeben.«
»Aber das geht doch …«
»Doch, das geht«, unterbrach Edith sie. »Du siehst so wunderhübsch in dem Kleid aus. Und es ist wirklich ein Schnäppchen. Diese Qualität bekommt man nicht jeden Tag zu solch einem günstigen Preis.«
Günstiger Preis, dachte Margot.
Edith, die aus einer wohlhabenden Familie stammte, ihr Vater besaß ein großes Kaufhaus in Potsdam, hatte leicht reden. Geldprobleme kannte sie nicht. Trotzdem würde sie sich niemals ein solches Kleid kaufen. Sie ging auch nur selten aus. Margot kannte den Grund dafür. Edith hatte Angst. Vor einigen Jahren war sie mit einem jungen Medizinstudenten im Theater gewesen. Auf den ersten Blick ein netter Bursche, der jedoch bereits am ersten Abend zudringlich geworden war. Ein Obdachloser hatte durch sein mutiges Eingreifen das Schlimmste verhindert. Seit diesem schrecklichen Vorfall, Edith war verheult und mit zerrissener Kleidung nach Hause gekommen, hatte sie keinen Mann mehr angesehen. Obwohl sie, wenn sie einmal zu dritt ausgingen, durchaus umschwärmt wurde.
»Also gut, ich nehme es.«
»Hervorragende Entscheidung«, antwortete Edith lächelnd und sah auf die Uhr. »Wollen wir noch einen Kaffee auf der Dachterrasse trinken? Bestimmt spielt eine Kapelle. Ich lade dich ein.«
»Gute Idee.« Margot huschte zurück in die Umkleide.
Sie fuhren mit einer der vielen Rolltreppen in das obere Stockwerk. Margot ließ ihren Blick durch das weitläufige Vestibül des Kaufhauses schweifen. Der Karstadt am Hermannplatz war erst vor wenigen Wochen eröffnet worden und galt als das modernste Kaufhaus Europas. Einundzwanzig Rolltreppen verbanden die sechs Etagen miteinander, in denen es alles zu kaufen gab, was das Herz begehrte. Zwei der Etagen lagen unterirdisch. Von dem neu gebauten U-Bahnhof gelangte man direkt in das Gebäude. Besonders beliebt war das reichhaltige Freizeitangebot. Es gab mehrere Frisiersalons für Damen und Herren, eine Badeanstalt mit Wannen-, Dusch- und Massageräumen, einen Kinderspielplatz mit Karussell und unzählige Gaststätten. Die Hauptattraktion stellte jedoch der Dachgarten dar. Jeden Nachmittag spielten dort Kapellen und boten zusammen mit dem Blick über Neukölln und Kreuzberg ein einmaliges Ambiente.
Edith und Margot ergatterten einen freien Tisch, der etwas abseits der Bühne direkt neben einem Blumenbeet lag, in dem rosafarbene Rosen in Hülle und Fülle blühten. Ein Sonnenschirm sorgte für Schatten.
»Ist es nicht herrlich hier?«, fragte Edith lächelnd, nachdem sie bei der Bedienung zwei Tassen Kaffee mit Milch bestellt hatte. »So lässt es sich seinen freien Nachmittag verbringen. Wenn Papa allerdings wüsste, dass ich hier bin, würde er mich ausschimpfen. Erst neulich hat er bei einem meiner Besuche mal wieder über die Karstadthäuser geschimpft. Sie seien zu groß und zu teuer, das würde sich nicht rechnen. Mama ist der Meinung, dass er nur neidisch ist. Er hätte nämlich gern das Kaufhaus in Potsdam weiter ausgebaut, aber die Besitzer der angrenzenden Häuser haben ihm da einen Strich durch die Rechnung gemacht.«
Die junge Bedienung, die den Kaffee brachte, kam Edith bekannt vor. Und tatsächlich: Das Mädchen errötete leicht, als sie die Tabletts mit den Kännchen und Tassen auf dem Tisch abstellte. Ihre Hände zitterten. Edith bemühte sich, sie nicht anzusehen.
Auch Margot war ihre Nervosität aufgefallen. »Ich nehme an, sie ist regelmäßiger Gast in der Beratungsstelle?«
Edith nickte. »Alle zwei Wochen kommt sie und holt sich Kondome. Seitdem es die umsonst bei uns gibt, kommen viele junge Mädchen. Auch das Interesse an den Pessaren ist größer geworden.«
Margot bemerkte, wie die älteren Damen am Nachbartisch ihr Gespräch einstellten. »Du solltest leiser sprechen«, ermahnte sie Edith belustigt und fügte im Flüsterton hinzu: »Der Feind hört mit.«
Eine der Damen warf ihr einen abschätzigen Blick zu. Mit einem lasterhaften Weib, das in aller Öffentlichkeit von solch schlüpfrigen Dingen sprach, wollte sie gewiss nichts zu tun haben. Vermutlich vergnügte auch ihre Tischnachbarin sich in den vielen Kinos und Theatern der Stadt und bewunderte die Tänzer- und Schauspielerinnen. Wie es hinter den Kulissen der bunten Glitzerwelt aussah, interessierte allerdings nur die wenigsten.
Edith schenkte der Dame ihr schönstes Lächeln, dann wandte sie sich wieder Margot zu. »In welchen Film geht ihr denn heute?«
»Er heißt ›Großstadtschmetterling‹«, antwortete Margot. »Und spielt wohl in Paris. Die Hauptdarstellerin ist diese amerikanische Schauspielerin. Ihr Name fällt mir gerade nicht ein. Du kennst sie bestimmt. Sie ist chinesischer Abstammung.«
»Anna May Wong«, half Edith Margot auf die Sprünge.
»Richtig. Die meine ich. Erst letztens haben wir doch einen Film mit ihr gesehen, oder? Wie hieß er noch gleich?«
»›Piccadilly‹«, antwortete Edith. »Er lief letztes Jahr im Passagenkino. Ich fand ihn ziemlich gut. In welches Kino geht ihr denn?«
»Sicher in keines in Neukölln. Dort könnten wir leicht erkannt werden«, antwortete Margot. »Wir wollten in eines der Kinos am Kurfürstendamm gehen.«
»Ist bestimmt besser so«, antwortete Edith. »Aber meine Meinung zu dem Thema kennst du ja bereits.« Sie nippte an ihrem Kaffee.
»Ich weiß«, antwortete Margot und seufzte. »Es scheint ihr in den letzten Tagen wieder schlechter zu gehen. Georg hat Sorge, dass sie sich umbringt, wenn er sie verlässt.« Margot hatte ihre Stimme gesenkt. »Sie muss ihm neulich eine fürchterliche Szene gemacht haben. Er solle sie nicht so oft allein lassen, sie sei einsam. Sie war mal wieder betrunken. Wenn das so weitergehe, hat er gemeint, müsse man überlegen, sie in eine Anstalt einzuweisen. Doch dann wird es noch schwerer mit unserer Eheschließung.«
Edith nickte, sagte jedoch nichts. Ihrer Meinung nach würde es eine Ehe zwischen Margot und Georg niemals geben. Obwohl sie Margot dieses Glück wie keiner anderen auf der Welt gönnte. Sie wusste, wie sehr sie in Georg verliebt war. Doch das Schicksal verfolgte seinen eigenen Plan. Und in diesem sah es für Margot anscheinend schlecht aus. Aber vielleicht sah sie zu schwarz und die Dinge wendeten sich irgendwann doch noch zum Guten. Für Georg, den Edith als offenen und warmherzigen Mann und Kollegen kennengelernt hatte, musste seine Ehe wie ein wahr gewordener Albtraum sein. Über die Gefühle seiner Frau wollte Edith gar nicht erst nachdenken. Sie war zu bedauern. Ihr größter Wunsch im Leben, das eigene Kind, wurde ihr verwehrt. Und andere Frauen wussten nicht, wie sie die vielen Kinder durchbringen sollten, die sie in die Welt setzten.
»Na, wen haben wir denn hier?«, ertönte plötzlich eine ihnen bekannte Stimme.
Beide blickten auf.
Elfi stand, mit etlichen Einkaufstüten bepackt, vor ihnen. »Meine Hebammen. Haben sie euch zwei Hübschen mal aus dem Klinikgefängnis rausgelassen?«
»Elfi, meine Liebe«, sagte Edith erfreut und umarmte ihre Freundin.
»Macht es euch was aus, wenn ich mich zu euch setze?«, fragte Elfi. »Liebe Güte, was ist das nur für ein großes Kaufhaus? Seit drei Stunden bin ich nun schon in den unterschiedlichsten Abteilungen unterwegs und langsam tun mir die Füße weh.« Sie setzte sich, ohne eine Antwort der beiden abzuwarten, und plapperte munter weiter. »Obwohl diese Rolltreppen ja schon eine feine Sache sind. Allerdings ist es ungeschickt, dass sie nur nach oben fahren. Will man wieder runter, muss man an einem der Aufzüge anstehen oder die Treppe nehmen. Eine Verkäuferin meinte, dass die Rolltreppen erst eine Stunde vor Feierabend die Richtung wechseln würden. Das ist dann quasi der Rausschmiss. Da geht’s dann nur noch abwärts Richtung Ausgang.« Sie grinste und bestellte bei einer der vorbeilaufenden Bedienungen einen Eiskaffee. »Und, was habt ihr gekauft?«, fragte Elfi und linste in Margots Einkaufstüte.
»Ein Ausgehkleid«, antwortete Margot.
»Oh wie schön«, erwiderte Elfi. »Wann kann ich es sehen? Ihr beiden wart ewig nicht mehr bei mir. Nur Luise lässt sich ab und an blicken. Besonders du«, sie sah Edith an, »bist ein seltener Gast in meinen heiligen Hallen.«
Edith wollte etwas erwidern, doch Elfi ließ sie nicht zu Wort kommen.
»Ich weiß, ich weiß. Die Sache von damals. Aber das Leben geht weiter, meine Liebe. Und du willst doch nicht als alte Jungfer enden.«
Edith sah zu Margot, die ein Grinsen nicht unterdrücken konnte.
Elfi redete mit Edith, als wäre sie eine ihrer Tänzerinnen. »Aber wo ich euch gerade hier habe, ich bräuchte mal wieder eure Hilfe. Ihr wisst schon wegen was. Du sitzt doch neuerdings an der Quelle«, wandte sie sich an Edith. »Könntest du da nicht …?«
Edith wusste, was Elfi meinte, und ihre Miene wurde ernst. »Du weißt, dass es besser wäre, wenn die Mädchen zu uns in die Beratungsstelle kämen«, antwortete sie mit gesenkter Stimme und einem Blick zum Nachbartisch. Gottlob saß an diesem nun ein älterer Herr, der seine Nase in eine Zeitung steckte. »Ich kann nicht einfach die Kondome irgendwohin tragen.«
»Ach, jetzt hab dich doch nicht so«, antwortete Elfi. »Ist ja auch für eine gute Sache. Wir sind kein Bordell, das verbitte ich mir, wie ihr wisst. Aber bei dem einen oder anderen Mädchen lässt sich ein Techtelmechtel nicht verhindern. Ist ja auch nur menschlich. Und eine Hand wäscht die andere. Neulich war Luise mit einer eurer Hausschwangeren bei mir, einer jungen Tänzerin. Niedlich, mal was anderes. Ich habe sie und ihr Kindchen bei mir aufgenommen. Weiß ja nicht, wo sie hinsoll, das arme Ding. Und es ist nicht das erste Mädchen. Ich erinnere mich an Inge, ein wahres Talent. Und sie hat mich sitzen lassen. Mitten während der Saison ist sie abgehauen, obwohl sie eine Hauptrolle hatte. Da bin ich ordentlich ins Schwimmen gekommen, das kann ich euch sagen. Manche Leute danken einem die Gutmütigkeit gar nicht. Hast du die Kleine nicht damals angeschleppt?« Sie sah Edith fragend an.
»Also gut«, ergab sich Edith in ihr Schicksal. »Ich werde sehen, was sich machen lässt.«
»Das wollte ich hören«, erwiderte Elfi freudig. »Soll meinen Mädchen ja gut gehen. Und? Wie läuft es sonst so? Was macht die Klinik?«
»Alles wie immer«, antwortete Margot.
»Ich habe gehört, ihr habt eine Abteilung für Geschlechtskrankheiten aufgemacht. Ist ja auch kein Wunder, was? Also bei mir hatten wir noch keinen Fall von solchen Krankheiten, ihr wisst schon. Aber es grassiert ja überall. Scheußlich ist das. Berlin, der reinste Sündenpfuhl.« Sie winkte ab.
»Was hast du denn gekauft?«, fragte Edith, um das Gespräch in eine andere Richtung zu lenken.
»Ach, nichts Besonderes«, antwortete Elfi. »Oder vielleicht doch. Ein Paar neue Schuhe. Recht schicke, mit Riemchen. Wollt ihr sie sehen?«
Edith und Margot nickten, und Elfi präsentierte stolz die dunkelblauen Schuhe. »Da habe ich ein richtiges Schnäppchen gemacht«, sagte Elfi mit strahlenden Augen, während sie sie zurück in die Schachtel packte. »Vielleicht zieh ich sie heute Abend gleich an. Wollt ihr nicht zu mir kommen? Wir führen seit einer Woche ein neues Stück auf. Eine Komödie, so was habt ihr doch gern.«
»Wäre nett«, antwortete Edith, »aber ich habe Nachtdienst.«
Elfi sah zu Margot, die ebenfalls abwinkte. »Bereits verabredet.«
»Verstehe. Mit dem netten Arzt, oder?«
Margot sah Elfi verdattert an. Woher wusste sie das nun schon wieder?
»Ach, Schätzchen. Neukölln ist doch ein Dorf. Oder sagen wir mal: Eine eurer Pflegerinnen ist ein recht geschwätziges Ding. Sie kommt öfter mit einer Freundin zu mir ins Theater. Wie war doch gleich ihr Name?«
»Irma.« Margot wusste sofort, von wem die Rede war.
»Richtig.« Elfi grinste. »Ein recht einfaches Mädchen, breite Nase, als wäre sie eine dieser Boxerinnen und hätte ordentlich eins draufbekommen. Erst neulich habe ich wieder eine Gruppe Mädchen im Park trainieren sehen. Also, wenn ihr mich fragt, ist das kein Sport für Frauen. Eine von denen hat doch glatt ihrer Mitstreiterin eine blutige Lippe geschlagen. Am Ende muss das noch genäht werden und gibt hässliche Narben. Dieser Sport sollte meiner Meinung nach den Männern vorbehalten bleiben. Da macht es ja nichts, wenn das Gesicht ein paar Ecken und Kanten hat. Neulich habe ich mal wieder ein Bild von Max Schmeling in der Zeitung gesehen. Also den würde ich nicht von der Bettkante stoßen.« Sie blickte auf ihre Armbanduhr. »Kinder, wie die Zeit vergeht. Ich muss dann auch. In zwei Stündchen mach ich den Laden auf und bis dahin muss doch alles schick sein.« Sie sprang auf, beugte sich über den Tisch und hauchte rasch Edith, dann Margot ein Küsschen auf die Wange. Dann nahm sie ihre Tüten und weg war sie.
»Unsere Elfi«, sagte Margot kopfschüttelnd. »Immer wieder ein Erlebnis.«
Edith stimmte ihr lachend zu. »Wir sollten ebenfalls gehen«, meinte sie. »Du musst dich noch zurechtmachen, und meine Schicht fängt auch bald an.«
Als sie wenig später zu Hause ankamen, saßen mal wieder die vier kleinen Mädchen aus dem Hinterhaus mit ihren Stühlchen im Kreis auf dem Gehweg vor dem Hofeingang. Es war den Mädchen in den letzten Wochen zur Gewohnheit geworden, ihre Kaffeekränzchen, wie sie ihre Zusammentreffen nannten, hier draußen abzuhalten, wo es so herrlich hell und lebendig war. Alle vier trugen adrette Kleidchen. Die kleine Hanne, sie war vier Jahre alt, Edith hatte sie auf die Welt geholt, hatte eine rosa Schleife in ihrem blonden Haar. Eine von ihnen, ihr Name war Gabi, hatte ein aufgeschlagenes Bilderbuch auf dem Schoß liegen.
»Die Damen«, grüßte Edith lächelnd. »Was wird heute gelesen?«
Die Mädchen grüßten höflich, und Gabi zeigte ihnen das bunte Titelbild des Kinderbuches.
»Lustige Gaben für Mädel und Knaben«, las Margot laut vor. »Na, das hört sich doch vielversprechend an«, sagte sie lächelnd.
»Es sind auch hübsche Gedichte drin. Soll ich eines vorlesen?«, fragte Gabi.
»Leider fehlt uns heute die Zeit«, antwortete Edith. »Aber beim nächsten Mal gern.«
Gabis Miene trübte sich.
Edith kam sich schäbig vor. Sie wollte schon zurückrudern, kam jedoch nicht dazu, denn lautes Geschrei, das aus dem Haus kam, hielt sie davon ab.
»Da stimmt etwas nicht«, sagte Margot. »Los, Edith, wir schauen mal nach.«
Im Treppenhaus hörten sie die Stimme eines Mannes. Beide wussten, wer es war. Harald Jeschke, ein unangenehmer Zeitgenosse, der dem Alkohol verfallen war, deshalb seine Arbeitsstelle verloren hatte und immer häufiger aggressiv wurde.
»Du gottverdammtes Miststück! Wo warst du? Raus mit der Sprache! Du betrügst mich, oder? Du Schlampe! Willst mir das Kind am Ende noch unterschieben!«
Edith und Margot eilten die Stufen nach oben. Die Wohnungstür von Magda Brückner öffnete sich und sie trat nach draußen. Alarmiert sah sie nach oben.
»Harald, bitte. So hör doch. Harald, hör auf. Harald, nein«, war Gittes Stimme zu hören.
»Was ist denn da los?«, rief Magda und trat entschlossen auf die erste Stufe. Im nächsten Moment polterte es, Gitte fiel die Stufen nach unten, landete auf dem Treppenabsatz und schlug hart mit dem Kopf gegen die Wand.
Sofort eilten die drei zu ihr. Gitte war benommen, jedoch bei Bewusstsein. Sie blutete aus einer Platzwunde an der Augenbraue und ihre Lippe war geschwollen.
Ediths Blick wanderte zu Harald. Er stand einen Moment einfach nur da und starrte sie an. Dann rannte er in die Wohnung und schlug die Tür zu. Margot zuckte zusammen.
»Gitte, meine Liebe«, sagte Magda. »Hat er wieder getrunken?«
»Wieder ist gut«, entgegnete Gitte. »Frag lieber, wann er zuletzt nüchtern war.« Sie versuchte, sich aufzurappeln, kam jedoch nicht weit, sondern stöhnte auf, legte ihre Hand auf ihren Unterleib und sackte in sich zusammen. »Das Kind«, brachte sie heraus. »Er hat mich getreten.«
Margot sah zu Edith, die sofort prüfend die Hand unter Gittes Rock schob. Als sie diese wieder herauszog, war sie voller Blut.
Magdas Augen weiteten sich.
»Wir brauchen sofort einen Krankenwagen«, sagte Edith.
Magda nickte. Sie richtete sich auf und eilte zurück in die Wohnung, wo sie den Notruf wählte.
»Es wird alles wieder gut werden«, versuchte Margot Gitte zu trösten. »Wir sind jetzt bei Ihnen. Sie wissen doch, wir kennen uns aus. Wir bringen Sie jetzt erst einmal in unsere Wohnung und dort warten wir auf den Krankenwagen. Schaffen Sie das? Es sind nur wenige Stufen.«
Gitte nickte. Edith und Margot stützten sie, während sie aufstand. Langsam ging es die Treppe nach unten. Blut tropfte auf die Stufen. Als sie an der Wohnungstür ankamen, krümmte sich Gitte und schrie erbärmlich auf. »Ich sterbe«, jammerte sie. »Es tut so weh. Himmelherrgott. Elender Mistkerl, verdammter Säufer.«
»Der Krankenwagen kommt gleich«, sagte Magda. »Bringt sie hier rein.« Sie bedeutete Margot und Edith, Gitte in die Wohnstube zu bringen. Dort breitete sie rasch eine Decke auf dem Sofa aus.
»Im wievielten Monat sind Sie?«, fragte Margot, nachdem sie Gitte auf das Sofa gelegt hatten.
»Vierten«, brachte Gitte heraus. Sie verzog das Gesicht und krümmte sich erneut zusammen. Dieses Mal fluchte sie nicht mehr, sondern schrie regelrecht. Schweißperlen standen auf ihrer Stirn.
Magda brachte Tücher, mit denen Margot ihr das Gesicht abtupfte. Die Wunde an der Augenbraue würde genäht werden müssen.
Magda öffnete das Fenster, um nach dem Krankenwagen Ausschau zu halten. »Hoffentlich kommen sie bald«, sagte sie.
Es dauerte noch quälend lange Minuten, bis endlich das Sanitätsfahrzeug in Sicht kam. Gitte wurde immer schwächer.
»Sie verliert zu viel Blut«, sagte Margot. »Gitte«, rief sie. »Gitte, hören Sie mich? Nicht einschlafen. Hören Sie? Schön wach bleiben.« Sie begann Gitte zu schütteln. »Bitte, Gitte. Es ist gleich geschafft. Schön bei mir bleiben.«
Als die Sanitäter endlich eintrafen, schilderte ihnen Edith hastig, was passiert war. »Sie muss sofort in die Frauenklinik am Mariendorfer Weg gebracht werden«, sagte sie.
Die beiden Männer legten Gitte auf eine mitgebrachte Trage. Als sie sie hochhoben, griff sie nach Margots Hand.
»Wir kommen mit Ihnen«, sagte Margot. »Wir lassen Sie nicht allein. Es wird alles wieder gut.«
Sie verließen das Wohnzimmer.
Die Fahrt zur Klinik dauerte nicht sonderlich lange.
»Vom Ehemann verprügelt?«, fragte der Fahrer, während sie an einer roten Ampel warten mussten.
Edith nickte. »Gibt öfter Streit. Er säuft.«
Der Fahrer nickte mit betretener Miene. Der Wagen setzte sich wieder in Bewegung. »Ich kann so was nicht verstehen«, sagte er. »Ich würde niemals mein Klärchen verkloppen. Auch wenn sie manchmal nervt, oder wir Streit haben. Solch einer hat keine Frau verdient.« Er schüttelte den Kopf. »Hoffentlich kommt sie durch.«
Edith nickte, ohne eine Antwort zu geben. Was sollte sie auch sagen? Es war nicht der erste Fall dieser Art, und nicht zum ersten Mal ging es um Leben und Tod. Erst vor einigen Wochen hatte sich eine werdende Mutter noch bis in die Klinik geschleppt, dann war sie zusammengebrochen. Ihr Leben hatten sie nicht mehr retten können.
Im Untersuchungsraum erwarteten Georg Lingau und eine Krankenschwester sie.
»Was ist passiert?«, fragte er.
»Sie ist von ihrem Ehemann die Treppe hinuntergestoßen worden«, antwortete Margot. »Vierter Monat, starke Blutungen. Sie muss sofort operiert werden.«
Er nickte.
»Informieren Sie Professor Hammerschlag. Wir haben einen Notfall. Sehen Sie zu, dass alles so weit vorbereitet wird.«
Nachdem sich die Metalltür des Operationssaals wenige Minuten später hinter Professor Hammerschlag geschlossen hatte, blickte Margot auf ihre blutverschmierten Hände und das Gefühl von Schuld breitete sich plötzlich in ihr aus. »Ich hätte etwas tun sollen«, sagte sie. »Doch ich habe einfach weggesehen. Neulich kam ich spät abends von einem Kinobesuch nach Hause. Da saß sie weinend im Hausflur auf der Treppe. Ihr linkes Auge war zugeschwollen. Ich habe mich neben sie gesetzt und sie getröstet. Sie hat gesagt, sie sei gefallen. Zu dumm zum Treppensteigen.«
»Wir wissen beide, dass sie selbst diejenige sein muss, die etwas tun muss. Auch wenn es schwerfällt. Als Außenstehender ist es immer schwer.«
Margot nickte. »Ich weiß. Es ist so verdammt ungerecht.«
»Komm«, sagte Edith. »Lass uns Hände waschen gehen.«
Margot nickte.
Bald darauf saßen sie in einer der Teeküchen neben Luise, die gerade ihre Schicht beendet und sich zu ihnen gesellt hatte. Es herrschte eine gedrückte Stimmung. Immer wieder wanderte Margots Blick zum Flur.
»Es dauert lange«, sagte Edith.
»Kein gutes Zeichen«, antwortete Margot.
Luise nickte. Sie hatte heute zwei Frauen von ihrem jeweils fünften Kind entbunden. Beide hatten nicht sonderlich glücklich gewirkt, als sie ihnen das Neugeborene in die Arme gelegt hatte. Neukölln war und blieb ein Arbeiterviertel, viele Familien lebten am Existenzminimum. Da stellte jedes zusätzliche Kind eine Belastung dar. »Denkst du, sie wird sich von ihm scheiden lassen, wenn sie durchkommt? Sie haben keine Kinder, oder?«, fragte Luise.
»Nein, haben sie nicht. Es gab wohl mal eine Tochter, aber sie hatte Kinderlähmung und ist gestorben. Magda hat es irgendwann erzählt. Er hat nach seiner Heimkehr von der Front in einer der Fabriken gearbeitet, ist dort aber entlassen worden, weil er ein Zitterer ist. Dann hat er zu saufen angefangen.«
»Es wäre also einfach. In diesem Fall hätte sie gute Chancen, die Scheidung durchzubringen. Den heutigen Vorfall kann man wohl durchaus als schwere Eheverfehlung bezeichnen. Und er ist Alkoholiker.«
Margot nickte, erwiderte jedoch nichts. Eine Scheidung war nie einfach. Die misshandelten Frauen mussten es aktiv wollen und viele von ihnen waren nicht bereit dazu, diesen Schritt zu gehen. Oftmals suchten sie die Schuld bei sich.
Eine Weile sagte keine von ihnen etwas. Edith stand irgendwann auf, öffnete das Fenster und zündete sich eine Zigarette an. »Das mit dem Kino wird heute wohl nichts mehr«, stellte sie fest und blies den Rauch aus dem Fenster.
Margot nickte. Angesicht dessen, was gerade passiert war, war alles andere zweitrangig.
»Du wolltest ins Kino?«, fragte Luise.
»Ich habe mir sogar ein neues Kleid gekauft«, antwortete Margot.
Schritte auf dem Flur ließen sie aufhorchen. Georg betrat den Raum, seine Miene war ernst. »Sie hat es überstanden«, sagte er. »Aber die nächsten Stunden sind kritisch, sie hat sehr viel Blut verloren.«
»Gott sei Dank«, sagte Margot erleichtert. »Ich gehe zu ihr.« Sie hielt Georgs Blick für einen Moment fest. Er verstand und nickte. Kino würde es nach diesem Vorfall heute Abend nicht mehr geben.
— 3 —
BERLIN, 10.AUGUST 1929
Edith musterte das junge, braunhaarige Mädchen genauer, das vor ihrem Schreibtisch unsicher auf dem Stuhl hin- und herrutschte. Wie alt sie wohl sein mochte? Vierzehn, vielleicht fünfzehn. Eigentlich viel zu jung, um in einer Sexualberatungsstelle nach Verhütungsmitteln zu fragen. Andererseits hatten bei ihnen in der Klinik Mädchen dieses Alters bereits entbunden. Die Kleine, die sich als Sonja Federau vorgestellt hatte, schien bemüht, älter auszusehen, als sie war. Sie hatte ihre Haare in Wellen gelegt und trug ein schmal geschnittenes Kleid mit einem tiefen Ausschnitt. Ihre Lippen hatte sie rot geschminkt. Mit dem Rouge hatte sie es nach Ediths Meinung etwas übertrieben. »Du bist also wegen der Kondome gekommen?«, fragte Edith.
Das Mädchen senkte errötend den Blick und nickte.
»Wie alt bist du?«, fragte Edith.
»Achtzehn.«
Edith zog eine Augenbraue hoch.
Der Blick des Mädchens wurde unsicher. »Gut, sechzehn«, gestand sie. »Es ist wichtig, dass ich die Dinger kriege. Obwohl nicht jeder Kerl …« Sie biss sich auf die Lippen.
Edith seufzte innerlich.
Nicht doch, dachte sie.
Es entstand eine kurze Pause, dann brach Sonja in Tränen aus. Edith kannte diese Form von Gefühlsausbruch und wartete geduldig ab, bis sich das Mädchen wieder beruhigt hatte.
»Es ist nicht, wie Sie denken. Wirklich«, sagte Sonja und wischte sich die Tränen mit einem Taschentuch von den Wangen. »Ich besuche eine Sekretärinnenschule, aber das Geld reicht hinten und vorne nicht. Meine Mama ist Witwe und seit einigen Wochen schwer krank. Ich habe fünf kleinere Geschwister. Ich tanze auch, nur hin und wieder tu ich einem den Gefallen. Gibt dafür Zimmer im ersten Stock. Es ist nur für eine Weile, bis ich eine Anstellung habe.«
Edith nickte. Mädchen wie Sonja schlugen immer wieder bei ihnen auf. Halbe Kinder, die sich aus der Not heraus prostituierten. Aber immerhin war sie so vernünftig und kam zu ihnen, um nach Verhütungsmitteln zu fragen. »Du weißt, dass ich dein Tun nicht gutheißen kann«, sagte sie und sah Sonja ernst an. »Prostitution ist eine Straftat, und du bist noch sehr jung. Normalerweise müsste ich es melden.«
Abrupt stand das Mädchen auf. Ihr Gesichtsausdruck wurde abweisend. »Ich hätte nicht herkommen sollen«, sagte sie. »Meine Freundin hat mich gewarnt. Ich krieg die Dinger auch woanders.« Sie wollte gehen, doch Edith hielt sie auf.
»Warte«, rief sie. »Bleib bitte. Ich werde es nicht melden, versprochen.«
Sonja wandte sich um.
»Es tut mir leid«, entschuldige sich Edith. »Ich wollte dich nicht angreifen. Du bekommst die Kondome von mir. Aber nur unter der Bedingung, dass ich dich kurz untersuchen darf. Und du musst mir versprechen, dass du dich von keinem Freier dazu drängen lässt, es ohne Verhütung zu tun. Es schützt nicht nur vor einer Schwangerschaft, sondern auch vor Krankheiten.«
Sonja hielt Ediths Blick für einen Moment fest, dann nickte sie.
»Gut«, sagte Edith. »Dann mach dich bitte kurz frei.«
Sie wirkte schüchtern, als sie barfuß hinter dem Vorhang hervortrat und sich dem gynäkologischen Stuhl näherte. »Ich habe so was noch nie gemacht«, sagte sie leise.
Edith nickte. »Es ist nicht schlimm. Komm. Ich helfe dir.« Auch das war nicht neu für Edith. Viele der Prostituierten ihres Alters kannten ärztliche Untersuchungen dieser Art nicht. »Du setzt dich jetzt einfach hierhin, legst dich zurück und tust die Beine in die Halterungen.«
Sonja tat wie geheißen.
»Ja, so ist es gut. Das machst du richtig. Und jetzt lass mich nur kurz nachsehen, ob alles seine Richtigkeit hat. Dann ist es auch schon geschafft.« Edith sah auf den ersten Blick, dass hier gar nichts seine Richtigkeit hatte. Es könnte nur eine Infektion sein, aber auch Schlimmeres. Besonders Tripper war nicht immer leicht zu erkennen. Sonja musste von einer Ärztin begutachtet werden.
Sie ahnte, dass etwas nicht stimmte, und begann erneut zu weinen. »Es tut mir leid«, sagte sie. »Ich schäme mich so. Sagen Sie es bitte nicht meiner Mutter. Sie schlägt mich tot.«
Edith tätschelte ihr tröstend die Schulter. »Es wird alles gut werden. Niemand wird es deiner Mutter sagen. Fest versprochen«, versuchte sie Sonja zu trösten. »Es sieht nicht nach dem Schlimmsten aus, wenn dich das tröstet. Aber es muss abgeklärt und behandelt werden. Und das kann nur die Ärztin machen. Ich gehe sie rasch holen. Du kannst dich derweil ruhig aufsetzen.«
Im Flur atmete Edith tief durch. Beinahe täglich begegneten ihr solche Fälle, doch sie hatte es bisher noch nicht geschafft, sich ein dickes Fell zuzulegen. Besonders bei den jungen Mädchen wie Sonja traf es sie jedes Mal tief. Sie wusste, dass die Sekretärinnenschule vermutlich eine Lüge war. Berlins Nachtleben war verführerisch, es versprach schnelles Geld, doch es barg so viele Gefahren. Edith spürte ihren schneller werdenden Herzschlag. Nein, sie würde jetzt nicht die Angst zulassen, nicht daran denken, was damals geschehen war. Das Gefühl der Scham und die Hilflosigkeit, die sie empfunden hatte. Sie waren geblieben und hatten sie gelehrt, den Leuchtreklamen und den süßen Verführungen des nächtlichen Berlins aus dem Weg zu gehen. Vielleicht war das damals Geschehene, das knappe Entkommen einer Vergewaltigung, auch der Grund dafür, weshalb sie ehrenamtlich in der Sexualberatungsstelle arbeitete, die vor einigen Jahren von Dr. Kollwitz eröffnet worden war. Es war ihr ein großes Anliegen, die Frauen zu schützen und ihnen beizustehen. Die funkelnden Lichter der Stadt hatten ihre eigenen, sündigen Gesetze. Doch hin und wieder half es, den jungen Frauen Hilfsmittel an die Hand zu geben, damit das Schlimmste verhindert werden konnte. Manchmal jedoch, wie in Sonjas Fall, kamen sie zu spät.
Edith klopfte an die Tür des Nebenzimmers.
Lore Heimbach, die diensthabende Ärztin, saß hinter ihrem Schreibtisch. Edith hatte die blonde Frau, die nur zwei Jahre älter war als sie, vom ersten Moment an sympathisch gefunden. Lore war vor einigen Jahren von Hamburg nach Berlin übergesiedelt. Sie hatte ebenfalls jüdische Wurzeln, ihr Vater betrieb ein Handelskontor in der Hansestadt. Doch in den Familienbetrieb hatte sie nicht einsteigen wollen. Bereits als Kind war Medizin ihre Leidenschaft, und ihre Eltern hatten sie zu dem Studium ermutigt, wofür sie ihnen noch heute dankbar war.
»Was gibt es?«, fragte die Ärztin.
»Ein junges Mädchen, fünfzehn vielleicht. Kam wegen Kondomen. Sie hat sich bereits prostituiert. Ich habe sie untersucht und kann eine Geschlechtskrankheit nicht ausschließen.«
»Wieder eine«, antwortete Lore und stand seufzend auf. »Sie werden immer jünger. Ich nehme an, es ist nur für kurze Zeit. Sie besucht die Sekretärinnenschule?«
»Ja, genau.«
»Ich seh sie mir an.«
»Danke«, antwortete Edith. »Ist es in Ordnung, wenn ich nicht mehr dabei bin? Meine Schicht in der Klinik fängt bald an.«
Lore Heimbach nickte. Edith wollte gehen, doch die Ärztin hielt sie zurück. »Warte. Hast du über das, was wir neulich besprochen haben, nachgedacht?«
»Ich denke ständig darüber nach«, antwortete Edith. »Sagen wir mal so: Du hast mir einen Floh ins Ohr gesetzt. Es wäre verlockend, Ärztin zu sein. Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das wirklich will. Mir gefällt meine Arbeit als Hebamme.«
Lore Heimbach nickte. »Entschuldige bitte. Es war unpassend von mir, dich zwischen Tür und Angel darauf anzusprechen. Ich finde nur, dass du eine hervorragende Ärztin wärst.«
Edith lächelte. Lores Lob schmeichelte ihr, sie bewunderte sie und ihre Arbeit, seitdem sie in der Beratungsstelle angefangen hatte. Lore Heimbach setzte sich sehr für die Frauen und ihre Belange ein und sie kämpfte sogar politisch für eine Verbesserung der Gesetze. Sie war Mitglied der KPD und vertrat die Meinung des bekannten Arztes Fritz Brupbacher aus der Schweiz, der gegen die Bestrafung der Abtreibung war. Lores Anliegen war es, die Kenntnis über Verhütungsmittel zu fördern, um so möglichst viele ungewollte Schwangerschaften zu verhindern. Edith wusste, wie viel Leid durch diese Maßnahmen verhindert werden konnte. Jedes junge Mädchen, jede Frau, die zu ihnen in die Beratungsstelle kam und nach Verhütungsmitteln fragte, stellte einen Gewinn für ihre Sache dar. Lore Heimbach hatte für Vorwärts zu diesem Thema einen Artikel verfasst, dafür viel Lob, aber auch Kritik erhalten. Edith bewunderte ihren Mut, mit einem solch intimen Thema an die Öffentlichkeit zu gehen.
»Lass uns ein andermal darüber reden. Das Mädchen wartet auf dich, und auf mich warten eine Menge Frauen in der Säuglingssprechstunde.«
»Na, dann viel Freude mit den Babys«, antwortete die Ärztin mit einem Augenzwinkern.
Edith verabschiedete sich endgültig.
Als sie kurz darauf auf die Straße trat, empfing sie Donnergrollen. Sie richtete den Blick gen Westen. Dort hing eine bedrohlich dunkel aussehende Wolkenwand. »Das auch noch«, murmelte Edith und holte ihr Fahrrad. Sie radelte rasch die Berliner Straße runter. Heute herrschte auf den Straßen besondere Betriebsamkeit, denn morgen würde das Fest der Republik mit vielen Umzügen und Feierlichkeiten in ganz Berlin gefeiert werden. Über einem Baugerüst brachten gerade einige Männer ein großes Plakat an, das die gesamte Front des Hauses überspannte. Nur die Demokratie sichert sozialen Aufstieg. Republikaner, willkommen in Neukölln!, stand darauf geschrieben. Überall an den Bäumen wurden schwarz-rot-goldene Schärpen angebracht. Bereits am Vortag hatte das Bezirksamt Neukölln am Hermannplatz einen mit Tannengrün geschmückten Bogen errichtet, der ein zehn Meter langes Banner mit der Aufschrift Die Republik ist der beste Hort des Friedens! trug. Der Hermannplatz stellte einen wichtigen Knoten- und Sammelpunkt für den Aufmarsch der Umzüge dar und deshalb war man bemüht, ihn besonders herauszuputzen. Edith hatte im letzten Jahr Feiertagsdienst gehabt und nur wenig von den Umzügen und Feierlichkeiten in der Stadt mitbekommen. Dieses Jahr würde es wohl nicht viel anders sein.
Sie fuhr an dem ebenfalls mit Fahnen beschmückten Ringbahnhof vorbei, vor dem, wie immer, die alte Anna Deckner mit ihrem Blumenstand war. Edith winkte ihr im Vorbeifahren zu. Am liebsten wäre sie stehen geblieben, um der alten Dame ein Sträußchen abzukaufen, doch dafür fehlte die Zeit. Anna Deckner war bereits achtundachtzig Jahre alt und stand jeden Morgen um Punkt sieben Uhr mit ihren Blumen an ihrem Platz. Vermutlich war sie die älteste Blumenverkäuferin von ganz Berlin. Anfangs hatte Edith nur Blumen bei ihr gekauft, wenn sie ihre Eltern besuchte. Doch inzwischen kaufte sie ihr öfter einen Strauß ab und plauderte ein bisschen mit ihr. Die alte Frau mit dem Kopftuch und der schäbigen braunen Strickjacke war über sämtliche Vorkommnisse Neuköllns besser informiert als jede Zeitung oder Gazette. Neueste Schlagzeilen galten für sie meist als alter Hut.
Als Edith in den Mariendorfer Weg einbog, fielen die ersten Regentropfen vom Himmel. Rasch stellte sie ihr Fahrrad ab und eilte zur Tagesklinik, wo in wenigen Minuten die Mutter-Kind-Sprechstunde beginnen würde.
Im Wartebereich und auf dem Flur drängten sich bereits einige Mütter mit ihren Kindern. Edith grüßte freundlich und betrat das Sprechzimmer. Sie wurde von Luise und drei Hebammenschülerinnen begrüßt.
»Da bist du ja endlich«, sagte Luise, die gerade die Einstellung einer Waage kontrollierte. »Ist heute eine Menge los.«
»Wann nicht?«, antwortete Edith und wusch sich rasch die Hände.
»Wir sollten heute ganz besonders auf Hygiene achten«, sagte eine der Hebammenschülerinnen, ihr Name war Christa Krause. »Es geht wohl ein Magen-Darm-Infekt um.«
»Gewöhn dich dran«, antwortete Edith und rückte eine der Trennwände zwischen den Untersuchungsliegen gerade. »Ist ein typisches Sommerproblem.«
Dr. Eberhard Tescher trat ein. Er hatte die Fünfzig bereits überschritten, kam aus Köln und arbeitete erst seit einigen Monaten in der Klinik. Von Beginn an hatte er durchblicken lassen, dass er lieber an der Charité tätig wäre. Doch dort hatte sich keine adäquate Anstellung für ihn gefunden. Luise machte keinen Hehl daraus, dass sie ihn nicht mochte. Auch Edith verstand bis heute nicht, weshalb Professor Hammerschlag ihn eingestellt hatte. Gute Ärzte, und vor allen Dingen Ärztinnen, besonders in der Frauenheilkunde, fanden sich im Moment genügend. Es musste also niemand eingestellt werden, für den die Frauenklinik in Neukölln nur die zweite Wahl darstellte.
Die Tür zum Behandlungsraum wurde geöffnet, und die ersten Frauen kamen herein.
Ein Säugling übergab sich, seine Mutter entschuldigte sich. »Das geht jetzt schon seit drei Tagen so mit dem armen Wurm.«
»Kein Problem«, antwortete Edith mit einem gequälten Lächeln. »Wir hörten bereits von dem Ausbruch des Magen-Darm-Infekts.« Sie wies eine der Hebammenschülerinnen an, den Boden zu säubern, und bedeutete der Frau, ihr in eine der Untersuchungskabine zu folgen. Dort angekommen, begann der Kleine zu weinen.
»Das macht er ständig. Heult oft über Stunden, und ich kriege ihn gar nicht mehr beruhigt. Und den Tee mag er nicht haben. Würde ich an seiner Stelle auch nicht trinken. Kamille, scheußlich.«
Edith nickte und bat die Mutter, das Kind auf die Untersuchungsliege zu legen und auszuziehen. »Durchfall?«, fragte sie, während sie die Windel öffnete.
»Nein, Gott sei Dank nicht. Mir reicht schon die Kotzerei. Deshalb nimmt ihn meine Nachbarin, die Trude, nicht. Wissen Sie, die passt immer vormittags drei Stunden auf ihn auf, damit ich zur Arbeit in die Wäscherei gehen kann. Aber krank will sie ihn nicht haben. Ist nicht wegen ihr, hat sie gesagt. Ist wegen ihrer kranken Mutter. Die alte Else ist halb blind, taub und redet nur noch wirres Zeug. Die soll sich nicht anstecken, hat die Trude gemeint.«
Edith tastete den Bauch des Kleinen ab und legte ihn danach auf die Waage. Ihr Blick fiel auf die von der Mutter mitgebrachte Wiegekarte. »Er hat abgenommen«, stellte sie fest. »Stillen Sie oder füttern Sie Kindermilch?«
»Kindermilch«, antwortete die Mutter. »Der Kleine ist nie richtig satt geworden. Es heißt ja immer, wir Mütter sollen für zwei essen. Aber woher das Essen nehmen, wenn nicht stehlen? Wir haben ja noch fünf weitere Mäuler zu stopfen, und mein Wilfried ist einer von den Kriegsversehrten. Er hat eine Anstellung als Aushilfe bei Karstadt ergattert. Fährt den ganzen Tag mit so einem kleinen Wägelchen Waren durch die Gegend. Aber viel verdienen tut er da nicht. Und unter uns gesagt«, sie senkte ihre Stimme und rückte näher an Edith heran, »das nächste Kind scheint unterwegs. Ich bin schon wieder überfällig. Wo wir die ganzen Blagen noch unterbringen sollen, weiß auch keiner. Wir haben ja nur die zwei Zimmer. Aber irgendwie wird es schon gehen. Ich habe dem Wilfried jetzt noch nix von dem nächsten Kindchen gesagt. Vielleicht geht’s ja noch ab. Ist schon mal passiert.«
»Waren Sie schon beim Arzt?«, fragte Edith.
»Ach wo«, antwortete die Frau und winkte ab. »Der sagt mir nix, was ich nicht längst weiß.«
Edith nickte, dann wandte sie ihre Aufmerksamkeit wieder dem Baby zu. »Er wirkt nicht krank«, sagte sie. »Es könnte auch eine Unverträglichkeit gegenüber der Milch sein. Welche Milch füttern Sie zu?«
Die Frau zögerte mit der Antwort. Edith ahnte, dass etwas im Argen lag. »Seit einer Weile verdünnte Kondensmilch«, gestand die Frau. »Die ist billiger zu haben als die frische Milch. Ich habe den Tipp von einer Nachbarin. Bei ihrem Kind gibt es damit keine Probleme.«
Edith schüttelte innerlich den Kopf. Einer erfahrenen Mutter hätte sie ein solches Handeln nicht zugetraut.