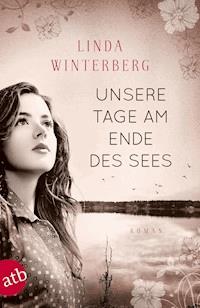3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Winzerhof-Saga
- Sprache: Deutsch
Drei ungleiche Schwestern gegen alle Widerstände. Wiesbaden, 1945: Henni steht vor den Trümmern ihres Lebens. Der Krieg hat die Sektkellerei der Familie schwer beschädigt, und Hennis Mann wird in Russland vermisst. Zudem wartet sie verzweifelt auf ein Lebenszeichen ihrer jüngsten Schwester Bille, die als Krankenschwester an die Front gegangen ist. Hennis Schwester Lisbeth reist aus Berlin an, das Verhältnis der beiden ist allerdings ziemlich zerrüttet. Als Bille unverhofft zurückkehrt, tief verstört und hochschwanger, fasst Henni neuen Mut: Sie wird die Sektkellerei retten. Doch als dort ein Feuer ausbricht, steht die Zukunft des Familienunternehmens endgültig auf dem Spiel ... Der Auftakt der großen Winzerhof-Saga von Bestsellerautorin Linda Winterberg – berührend und authentisch!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 435
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über das Buch
Rheingau, 1945: Der Krieg ist vorbei, aber die Sektkellerei Herzberg wurde schwer beschädigt. Henni steht vor den Trümmern ihres Lebens. Ihr Mann wird seit Jahren vermisst, und hinzu kommt nun die Trauer um den verstorbenen Vater. Zur Beerdigung reist Hennis Schwester Lisbeth an, deren Vergangenheit schwer auf den beiden Frauen lastet. Nur die Sorge um ihre jüngste Schwester Bille eint sie. Sie war als Krankenschwester an der Front, doch seit Wochen gibt es kein Lebenszeichen. So liegt die Verantwortung für die Sektkellerei in Hennis Händen. Und eins steht fest: Sie wird nicht zulassen, dass das Familienunternehmen zugrunde geht. Doch Henni hat nur eine Chance, die Kellerei wiederaufzubauen, und dafür muss sie viel aufs Spiel setzen – auch ihre Hoffnung auf eine neue Liebe.
Über Linda Winterberg
Hinter Linda Winterberg verbirgt sich Nicole Steyer, eine erfolgreiche Autorin historischer Romane. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Töchtern im Taunus.
Im Aufbau Taschenbuch und bei Rütten & Loening liegen von ihr die Romane »Das Haus der verlorenen Kinder«, »Solange die Hoffnung uns gehört«, »Unsere Tage am Ende des Sees«, »Die verlorene Schwester«, »Für immer Weihnachten«, »Die Kinder des Nordlichts« sowie die große Hebammen-Saga »Aufbruch in ein neues Leben«, »Jahre der Veränderung«, »Schicksalhafte Zeiten« sowie »Ein neuer Anfang« vor.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Linda Winterberg
Der Winzerhof – Das Prickeln einer neuen Zeit
Roman
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
1. Kapitel — Wiesbaden, 12. September 1945
2. Kapitel — Wiesbaden, 20. September 1945
3. Kapitel — Wiesbaden, 2. Oktober 1945
4. Kapitel — Martinsthal, 5. Oktober 1945
5. Kapitel — Wiesbaden, 20. Oktober 1945
6. Kapitel — Wiesbaden, 2. November 1945
7. Kapitel — Frankfurt, 5. November 1945
8. Kapitel — Wiesbaden, 5. Dezember 1945
9. Kapitel — Wiesbaden, 29. November 1945
10. Kapitel — Wiesbaden, 2. Dezember 1945
11. Kapitel — Wiesbaden, 15. Dezember 1945
12. Kapitel — Wiesbaden, 5. Januar 1946
13. Kapitel — Wiesbaden, 20. Januar 1946
14. Kapitel — Wiesbaden, 3. Februar 1946
15. Kapitel — Wiesbaden, 5. Februar 1946
16. Kapitel — Wiesbaden, 20. Februar 1946
17. Kapitel — Frankfurt, 25. Februar 1946
18. Kapitel — Wiesbaden, 1. März 1946
19. Kapitel — Wiesbaden, 5. März 1946
20. Kapitel — Wiesbaden, 15. März 1946
21. Kapitel — Rüdesheim, 10. April 1946
22. Kapitel — Wiesbaden, 24. April
23. Kapitel — Wiesbaden, 5. Mai 1946
24. Kapitel — Wiesbaden, 10. Mai 1946
25. Kapitel — Wiesbaden, 22. Mai 1946
26. Kapitel — Wiesbaden, 12. Juni 1946
27. Kapitel — Wiesbaden, 30. Juni 1946
28. Kapitel — Wiesbaden, 12. Juli 1946
29. Kapitel — Wiesbaden, 15. Juli 1946
30. Kapitel — Wiesbaden, 29. Juli 1946
31. Kapitel — Wiesbaden, 29. Juli 1946
32. Kapitel — Frankfurt, 2. August 1946
33. Kapitel — Wiesbaden, 10. August 1946
34. Kapitel — Eltville, 5. Oktober 1946
Nachwort
Impressum
Wer von dieser Saga begeistert ist, liest auch ...
1. Kapitel
Wiesbaden, 12. September 1945
Es war einer dieser Tage, an denen Henni am liebsten für immer auf dem Balkon ihrer direkt am Rhein gelegenen Villa stehen würde, um das funkelnde Wasser des Flusses zu betrachten. In einem anderen Leben hatte ihr der Rhein stets das Gefühl einer heilen Welt vermittelt. Doch heute tat er das nicht mehr. Die letzten Monate waren schwer gewesen, unerträglich und bedrückend. Der Krieg hatte Wiesbaden lange Zeit verschont. Doch im Februar war auch die Kurstadt am Rhein in das Visier der Alliierten geraten und stark beschädigt worden, Hunderte Menschen hatten in den Bombennächten den Tod gefunden. Im März war der Krieg für die Stadt endlich vorbei gewesen. Geblieben waren Trümmer, zerstörte Leben und Träume, tiefe Wunden und Risse in den Seelen der Menschen.
Henni umschloss mit ihrer rechten Hand den silbernen Anhänger an ihrem Hals, der eine Fotografie ihrer Mutter enthielt, die sie viel zu früh verlassen hatte. In der letzten Zeit hatte sie sich oft gewünscht, sie wäre noch bei ihr, um ihr Halt zu geben. Sie war bei der Geburt von Hennis jüngster Schwester Bille gestorben, da war Henni gerade mal sieben Jahre alt gewesen.
Sie öffnete den Anhänger und betrachtete das Bild ihrer Mutter, das in einer Zeit entstanden war, in der niemand geahnt hatte, dass zwei Weltkriege das Gesicht Deutschlands für immer verändern würden. Ihr helles Haar wellte sich sanft auf ihre Schultern herab, sie trug eine hochgeschlossene Bluse mit Spitze am Kragen. Ihr Lächeln war mild, die großen Augen zogen den Betrachter sogleich in ihren Bann. Henni hatte als Einzige ihrer Töchter ihr strohblondes Haar und ihre Augen geerbt.
»Vielleicht ist es doch besser, dass du den heutigen Tag nicht erleben musst«, sagte sie leise. »Obwohl ich dich im Moment wirklich gut gebrauchen könnte. Du wüsstest gewiss Antworten auf all meine Fragen. Immerhin musstest du seinen Tod nicht miterleben.«
Die Worte auszusprechen, fühlte sich wie ein Stich ins Herz an. Ihr Vater, Heinrich Herzberg, war vor wenigen Tagen von einem Schlaganfall aus dem Leben gerissen worden. Er war seit Kriegsende voller Euphorie gewesen, voller Tatendrang. »Er hat gesagt, dass es nun wieder bergauf gehe«, sagte Henni, und in ihre Augen traten Tränen. »Er hat so viele Pläne geschmiedet. Du hättest seine wiedergefundene Begeisterung geliebt.«
»Fräulein Henni«, wurde sie angesprochen. Henni fühlte sich bei ihrem Selbstgespräch ertappt, wischte sich rasch über die Augen und wandte sich um.
Ihre Hausdame Trude stand vor ihr. Die gute Seele, die bereits seit über einem Vierteljahrhundert auf das Haus und seine Bewohner achtete und Henni seit ihrer Geburt kannte.
»Ihre Schwester ist eingetroffen und fragt nach Ihnen.«
Henni folgte Trude in die Familienvilla, die mit ihren vielen Erkern und Winkeln wie ein kleines Schloss anmutete und Ende des neunzehnten Jahrhunderts von ihrem Großvater erbaut worden war. Wie durch ein Wunder hatte sie die Bombenangriffe größtenteils heil überstanden. Nur einige Fenster waren zu Bruch gegangen, inzwischen aber wieder repariert worden.
Im Salon empfing sie die gediegene Einrichtung. Sonnenlicht fiel durch die hohen Sprossenfenster auf den blank polierten Parkettboden aus Buchenholz. In einem der Erker befand sich ein weißer Flügel, auf dem ein silberner Kerzenständer stand. Es gab eine mit weinrotem Stoff bezogene und gepolsterte Sitzgruppe, Bücherregale säumten die hellgelb gestrichenen Wände, und durch eine geöffnete weiß gestrichene Flügeltür gelangte man in den Essbereich. Auf dem von acht Stühlen umgebenen Esstisch stand ein Strauß gelber Rosen. Eine der Blumen ließ bereits den Kopf hängen, und erste Blütenblätter waren herabgefallen. Es erschien wie das perfekte Stillleben.
Hennis Mutter war diejenige gewesen, die die Räume in hellen Tönen hatte ausstatten lassen. Zuvor musste es recht düster gewesen sein, mit holzvertäfelten Wänden und dunkel gebeiztem Mobiliar. Wie durch ein Wunder waren sie bisher der Beschlagnahmung der Villa durch die Amerikaner entgangen. Diese hatten inzwischen ganze Häuserblocks besetzt, jede Woche schienen es mehr Familien zu sein, die auf diese Weise ihr Obdach verloren. Henni bewohnte aus diesem Grund die Villa nicht mehr nur mit ihrer Großmutter und den wenigen noch verbliebenen Dienstboten. Im Untergeschoss lebte seit einigen Tagen die Kriegerwitwe Annemarie Köhler mit ihren beiden Kindern, einem Mädchen und einem Jungen, sieben und zehn Jahre alt. Die Familie hatte durch die Beschlagnahmung ihrer Wohnung in der Luisenstraße von einem Tag auf den anderen auf der Straße gestanden und nicht gewusst, wohin sie sollte. Annemarie hatte früher als Wäscherin bei ihnen im Haus gearbeitet, und als sie weinend mitsamt den Kindern und einigen rasch zusammengerafften Habseligkeiten vor der Tür gestanden hatte, so ausgemergelt und müde, wie Henni sich fühlte, da hatte Henni sie eingelassen. Das Haus war groß genug.
Hennis Schwester Lisbeth trat ein. Sie trug, dem traurigen Anlass ihres Besuches entsprechend, ein schwarzes Kostüm. Den kleinen Hut mit einem Netzschleier vor ihrem Gesicht empfand Henni als etwas übertrieben. Ihr gewelltes rotblondes Haar trug Lisbeth kinnlang. Die Schwestern umarmten sich nur kurz zur Begrüßung. Lisbeth verströmte den gewohnten Duft des Parfüms Tosca, den Henni noch nie hatte leiden können.
»Es tut mir so leid, dass ich erst heute eintreffe, meine Liebe«, sagte Lisbeth. »Die Anreise aus Berlin war das reinste Abenteuer. Zwischenzeitlich dachte ich, ich würde es gar nicht mehr zur Beerdigung schaffen. Aber durch einen Zufall – ein alter Bekannter von mir musste geschäftlich nach Wiesbaden – hat es doch geklappt.« Sie zog ihre schwarzen Handschuhe aus, warf sie auf den Esstisch und bat Trude um ein Glas Sherry. »Wann soll der alte Knabe denn nun eingebuddelt werden?«
»Du redest von unserem Vater!«, entgegnete Henni in harschem Tonfall.
»Nur weil er tot ist, muss ich ihn nicht gleich lobpreisen«, erwiderte Lisbeth und verzog das Gesicht. »Du weißt, wie er mich stets behandelt hat. Ich habe ihm, im Gegensatz zu dir, nie etwas recht machen können. Obwohl wir durch Johannes’ Kontakte in höchste Regierungskreise durchaus Vorteile hätten haben können.«
»Du weißt, dass Papa von Johannes’ ›höchsten Regierungskreisen‹ nie viel gehalten hat«, entgegnete Henni spitz.
Ihr hatte Trude anstatt des Sherrys ein Glas Sprudelwasser gebracht, das sie dankend annahm. Henni war die Tochter eines Sektkellerei-Inhabers, was jedoch nicht bedeutete, dass sie dem Alkohol zugetan war. Ihr war es wichtig, stets einen klaren Kopf zu behalten.
»Rede du ihn dir nur schön«, erwiderte Lisbeth. »Er hat, wie all die andern Industriellen auch, Zwangsarbeiter beschäftigt und war Parteimitglied. Wenn es um den eigenen Vorteil ging, war es vorbei mit der sauberen Weste.«
»Wir wissen beide, was mit der Kellerei und mit Papa passiert wäre, wenn er sich anders verhalten hätte«, entgegnete Henni. »Er hat Hitler verabscheut.«
Sie fühlte, wie Lisbeths Anwesenheit nach nur wenigen Minuten zu einer Belastung wurde. Lisbeth, die Zweitgeborene, die stets unangepasst gewesen war und früh gegen den Vater aufbegehrt hatte. Er hatte ihr ihre Freiheiten gelassen und versucht, mit ihren Allüren klarzukommen. Sie hatte zu ihrer Tante nach Berlin reisen und dort ihr Kunststudium vorantreiben dürfen. Nur wenige Wochen nach ihrer Ankunft hatte sie Johannes Glauber kennengelernt, ein hochrangiges Mitglied der SS. Nach nur drei Monaten hatten die beiden überstürzt in Berlin ohne die Anwesenheit der Familie im kleinen Kreis geheiratet. Ihren Verwandten vom Rhein hatte sie Johannes dann bereits als ihren Ehemann vorgestellt. Ihr Vater, dem seine Töchter die Welt bedeutet hatten und der stets ein Gegner des Nationalsozialismus gewesen war, hatte ihr das nie verziehen. Zwischen ihm und Lisbeth war es zu einem großen Zerwürfnis gekommen, ausgesöhnt hatten sie sich bis zuletzt nicht mehr. Henni hätte Lisbeth am liebsten gar nichts vom Tod ihres Vaters erzählt, hatte es dann aber doch nicht fertiggebracht und ihr telegrafiert. Innerhalb kürzester Zeit waren die beiden Patriarchen der Familie Herzberg von ihnen gegangen. Martin Herzberg, ihr Großvater, war während des großen Bombenangriffs im Februar in der Kellerei ums Leben gekommen. Henni hatte nach einigen schlaflosen und tränenreichen Nächten beschlossen, sich nicht unterkriegen zu lassen. Der Krieg war vorbei, der Rhein funkelte wie eh und je im Licht der Sonne, und die Trümmer wurden beseitigt. Sie als Älteste hatte nun die Verantwortung für den in Scherben liegenden Familienbetrieb. Sie hatte sich zu kümmern und musste stark sein, auch wenn ihr das nicht leichtfiel. Denn die Liebe ihres Lebens, ihr Conrad, war nicht an ihrer Seite. Noch immer wartete sie sehnsüchtig auf eine Nachricht von ihm. Er hatte zuletzt an der Ostfront gedient, doch seit Jahresbeginn war kein Brief mehr eingetroffen. Ihr Vater hatte kurz vor seinem Tod bereits das Schlimmste prophezeit. Doch Henni hatte es nicht hören wollen. Conrad, der Sohn eines Winzers aus Martinsthal, war stark. Er würde heimkehren, daran galt es festzuhalten.
»Wo steckt eigentlich Bille?«, fragte Lisbeth. »Unser entzückendes Nesthäkchen ist dir doch früher nie von der Seite gewichen.«
»Sie ist schon zwei Jahre fort«, antwortete Henni, »arbeitete als Schwester in Lazaretten. Ihr letzter Brief kam vor Monaten aus der Nähe von Königsberg.«
Eine weitere Sorge, die Hennis Gedankenkarussell nachts nicht zur Ruhe kommen ließ. Bille hatte sich von einer Freundin zum Lazarettdienst überreden lassen und war, trotz allen Flehens von Henni, nicht fortzugehen, von einem auf den anderen Tag verschwunden. Sie wollte ihren Beitrag leisten und helfen, nicht tatenlos zusehen. So war Bille schon immer gewesen. Ein Mensch, der stets das Wohl der anderen im Sinn hatte. Sie hatte Ärztin werden wollen.
Henni wünschte sich, sie würde endlich zurückkommen, mit ihrem braunen Lederkoffer einfach vor der Tür stehen und sie mit dem verschmitzten Blick ansehen, den sie an ihr so sehr liebte. Doch vielleicht war sie längst tot, im Osten gestorben. Henni wagte es kaum, diesen Gedanken überhaupt zuzulassen. Aus dem Osten flüchteten dieser Tage Zehntausende; vertrieben aus der Heimat, suchten sie Schutz in einem zerstörten und zerrissenen Land. Die Frau ihres Hausmeisters Gustav in der Sektkellerei hatte ihr neulich erzählt, dass die Vertriebenen auf ihrer Flucht auf den Straßen erfroren, dass Kinder und Mütter vor Erschöpfung starben. Henni hatte diese Geschichten nicht hören wollen. Alpträume hatten sie danach geplagt, Bilder von Bille, tot im Schnee am Wegesrand, Bille, wie sie vor Erschöpfung zusammenbrach. Bille, die mit flehendem Blick die Hand nach ihr ausstreckte, die als kleines Mädchen mit nackten Füßen auf der Schaukel im Garten saß und so wunderbar lautstark lachte, wie nur sie es konnte.
Henni trat ans Fenster und blickte nach draußen. Der Rhein schaffte es mit seiner funkelnden Wasseroberfläche in diesem Moment nicht, die Bitterkeit in ihrem Inneren zu vertreiben.
Einen Moment sagte keine der Schwestern etwas. Lisbeth trat irgendwann neben Henni und legte ihr die Hand auf den Arm.
»Das mit Bille tut mir leid«, lenkte sie ein, und ihre Stimme klang plötzlich milder. »Sie wird bestimmt zurückkehren. Du kennst doch unsere Bille. Sie war schon immer eine Kämpferin. Diese Zeiten sind für uns alle nicht einfach. Was ist mit Conrad?«
Diese Frage ließ Henni erneut Tränen in die Augen steigen, und in ihrem Hals fühlte sie einen dicken Kloß. Sie blinzelte, schluckte und senkte den Blick.
»Ich weiß es nicht«, antwortete sie. »Er ist irgendwo im Osten.«
»Vielleicht ist er in Kriegsgefangenschaft geraten«, mutmaßte Lisbeth.
»Wäre dann nicht ein Brief gekommen?«, fragte Henni. »Es gibt Briefe. Ich weiß das.«
»Vielleicht kommt er noch«, meinte Lisbeth. »Du darfst die Hoffnung nicht aufgeben.«
Henni atmete tief durch und nickte. Sie wollte dieses Gespräch nicht mit Lisbeth führen. Der Schwester, die ihr fremd geworden war. Sie hatte jahrelang an der Seite eines Mannes gestanden, der heute als Kriegsverbrecher galt. Wie viel Nazi steckte in ihr?
»Wie steht es um Johannes?«, fragte sie.
»Er sitzt nach wie vor im Entnazifizierungslager fest. Wann ihm der Prozess gemacht wird, wissen wir noch nicht«, antwortete Lisbeth mit einem kühlen Unterton in der Stimme und trat vom Fenster weg. Sie schien bewusst auf Abstand gehen zu wollen. Hennis Erkundigung nach Johannes gefiel ihr anscheinend nicht.
»Was denkst du, wie es für ihn ausgehen wird?«, fragte Henni. Sie wusste, dass es eng werden könnte.
»Ich weiß es ehrlich gesagt nicht«, antwortete Lisbeth. »Als Mitläufer wird er sich nicht bezeichnen können. Ich hatte Glück, dass wir bereits seit einigen Monaten getrennt lebten. Somit bin ich einer Befragung entgangen.«
»Ihr habt getrennt gelebt?«, hakte Henni erstaunt nach.
»Ja, das haben wir«, erwiderte Lisbeth, ging zur Hausbar und füllte ihr Glas erneut mit Sherry. »Er hat mich mit seiner Sekretärin betrogen. Das Flittchen hat sogar ein Kind von ihm erwartet.« Ihre Stimme klang nun bitter. Sie trank von ihrem Glas.
Maria Herzberg trat ein und unterbrach das Gespräch der beiden. Die alte Dame trug ein schwarzes Kostüm mit einem wadenlangen Rock und stützte sich auf einen Stock. Ihr graues Haar reichte ihr bis zum Kinn und war ordentlich frisiert. Sie sah von Henni zu Lisbeth, und in ihrem Blick lag der Ausdruck von Verwirrtheit, den Henni so sehr verabscheute.
»Die Damen«, sagte Maria in schroffem Tonfall. »Können Sie mir sagen, was Sie in meinem Haus zu suchen haben?«
Lisbeth sah von ihrer Großmutter verdutzt zu Henni.
Eine Frau in einer Schwesternuniform erschien in der Tür und kümmerte sich sogleich um Maria.
»Frau Herzberg«, sagte sie und legte den Arm um sie. »Sie sollen mir doch nicht fortlaufen. Kommen Sie, wir wollten uns doch fertig machen. Wir haben doch darüber gesprochen. Es steht die Beerdigung Ihres Sohnes an.«
Maria sah die Dame erstaunt an. »Ich habe einen Sohn?«
»Darüber haben wir doch heute Morgen beim Tee gesprochen.« Behutsam führte sie Maria aus dem Raum.
»Alzheimer«, erklärte Henni. »Nach Großvaters Tod ist es mit jedem Tag schlimmer geworden. Zusätzliche Aufregung wie die heutige Beerdigung verwirrt sie zusätzlich.«
Noch eine Sorge, die zu all dem Kummer hinzukam. Maria Herzberg, einst die Seele der Familie, die liebevolle Großmutter, die ihnen die Mutter ersetzt hatte, begann, die Welt um sich herum zu vergessen.
Lisbeth wusste nicht, was sie antworten sollte. Die Situation überforderte sie sichtlich.
»Es ist nun mal, wie es ist«, fuhr Henni fort. »In eine Einrichtung wollten wir sie nicht geben. Papa hat Frau Mertens als Betreuerin eingestellt. Sie kümmert sich rührend um sie.«
Lisbeth nickte und fragte: »Denkst du, es ist gut, wenn sie in diesem Zustand zur Beerdigung mitkommt? Sie könnte uns blamieren.«
»Er war ihr Sohn«, entgegnete Henni. Lisbeths herzlose Rede verwunderte sie nicht. Ihr Verhältnis zu Oma Maria, wie sie sie nannten, war nie gut gewesen. »Sie hat ein Recht darauf.« In Gedanken fügte sie weitere Sätze hinzu. Du blamierst die Familie mit deiner Anwesenheit bedeutend mehr. Die Frau eines Nazis kehrt heim. Die Tochter, von der jeder weiß, dass der Vater mit ihr über Jahre keinen Kontakt hatte. An sein Grab traut sie sich nun. Doch Henni behielt ihre Worte für sich. Ein Streit lohnte nicht und würde sie Kraft kosten, die sie nicht hatte.
Trude trat erneut näher. »Es wäre dann an der Zeit«, erinnerte sie an die bevorstehende Beerdigung. »Herbert wartet bereits mit dem Wagen.«
Henni war dankbar für die Unterbrechung. Lisbeth erschien ihr nicht als die richtige Gesprächspartnerin für solch schwierige und belastende Themen. Plötzlich sah sie ihren Großvater vor sich. Wie er mit traurigen Augen die Männer an den Bändern beobachtet hatte. Noch heute hatte sie seine leise gemurmelten Worte im Ohr: »Wir sollten sie nach Hause schicken.« Er hatte im Ersten Weltkrieg gedient, an der Somme im Schützengraben gelegen und seinen besten Freund verloren. »Krieg bringt nie was Gutes«, hatte er kurz nach der Kriegserklärung der Engländer 1939 mit sorgenvoller Miene gesagt. »Er bringt nie was Gutes.« Wie recht er doch gehabt hatte. Ein Teil der französischen Zwangsarbeiter in Wiesbaden hatte den Bombenangriff im Februar nicht überlebt. Sie hatten niemals wieder heimgehen dürfen.
»Danke dir, Trude«, antwortete Henni und sah zu Lisbeth, die eben den Rest ihres Sherrys getrunken hatte und das Glas auf dem Tisch abstellte. »Dann lass uns gehen und unserem Vater die letzte Ehre erweisen.«
Sie griff nach ihren schwarzen Handschuhen auf dem Tisch, und die beiden verließen den Raum.
2. Kapitel
Wiesbaden, 20. September 1945
Lisbeth lehnte sich auf dem mit grünem Stoff bezogenen Sofa nach vorne und schenkte dem jungen Mann, der ihr gerade eine Zigarette anzündete, ein charmantes Lächeln. Sie befand sich in der luxuriösen Villa Dyckerhoff, in der ihre beste Freundin seit Kindertagen, Ella Dyckerhoff, heute ihren achtundzwanzigsten Geburtstag feierte. In einem anderen Leben war Lisbeth in ihren älteren Bruder Heinz verliebt gewesen, einen charismatischen und ehrgeizigen jungen Mann, der sie durch seine Attraktivität beeindruckt hatte. Eine Verbindung zwischen einem Dyckerhoff und einer Herzberg-Tochter hätte in Wiesbaden gewiss hohe Wellen geschlagen. Doch Heinz hatte ihre Zuneigung leider nicht erwidert und sich in eine andere Frau verliebt. Mit ihr zusammen war er noch vor Kriegsbeginn nach Amerika ausgewandert, wo er jetzt einen der dortigen Firmensitze des Unternehmens leitete. Die Dyckerhoff Zementwerke zählten zu den Kriegsgewinnern, auch wenn ein Großteil ihrer Werke im Bombenhagel zerstört worden war. Die Beschäftigung von Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern hatte dem Unternehmen während der Kriegsjahre zu einem großen Aufschwung verholfen. Der bisherige Geschäftsführer war nach Kriegsende zuerst in die Schweiz emigriert und weilte nun, wie Ella zu berichten wusste, in Argentinien. Seinen Posten hatte nun ihr Schwager Anton inne, und er gab sich alle Mühe, das Unternehmen möglichst rasch wieder aufzubauen. An finanziellen Mitteln und den richtigen Kontakten mangelte es der international tätigen Firma nicht.
Auch in der direkt am Rheinufer gelegenen Villa herrschte an diesem Abend kein Mangel. Es gab kalte Platten mit Käse, Wurst und feinstem Lachs, auch Krabben wurden serviert. Zusätzlich war ein süßes Büfett errichtet worden. Ellas Geburtstagstorte, ein Machwerk aus Biskuit und Sahne, wies sogar zwei Stockwerke auf und war mit Marzipanrosen verziert. Selbstverständlich war mit Champagner auf das Geburtstagskind angestoßen worden. Es gab Kaffee und ausreichend Zigaretten für alle. Die begehrte Währung, mit der man auf dem Schwarzmarkt jedes Lebensmittel problemlos erwerben konnte, wurde hier massenweise in den Raum gepustet.
Lisbeth sah die zahlreichen Partygäste in dem weitläufigen Salon nur durch eine neblige Wand aus waberndem Zigarettenrauch.
»Darf ich fragen, mit wem ich es zu tun habe?«, erkundigte sich der junge Mann, nachdem er Lisbeth die Zigarette angezündet hatte. Sie wollte Antwort geben, wurde aber von Ella unterbrochen, die ihren Verehrer – Lisbeth schätzte ihn auf Anfang zwanzig – brüsk zur Seite schob.
»Geh dir ein Kaliber suchen, das zu dir passt, Jürgen. Lisbeth ist eine Nummer zu groß für dich.«
Er verzog beleidigt das Gesicht, gehorchte jedoch und ging. Ella ließ sich neben Lisbeth auf das Sofa fallen, nahm ihr die Zigarette aus der Hand und inhalierte kräftig den Rauch.
»Das ist mein Cousin dritten Grades aus Münster. Noch total grün hinter den Ohren. Mit einem wie ihm würdest du dich nur langweilen, meine Liebe.«
»Ich muss ihn ja nicht gleich heiraten«, antwortete Lisbeth und nahm Ella die Zigarette wieder weg. »Für eine Nacht wäre es bestimmt ganz nett mit ihm gewesen.« Sie zog an der Zigarette und blies den Rauch in die Luft. »Ich weiß schon gar nicht mehr, wie es sich anfühlt, leidenschaftlich geliebt zu werden.«
»Nun komm schon«, entgegnete Ella und stieß Lisbeth in die Seite. »Johannes hatte den Ruf, ein hervorragender Liebhaber zu sein. Du bist bestimmt auf deine Kosten gekommen.«
»Das war er wohl«, erwiderte Lisbeth. »Nur leider kam das im letzten Jahr seiner Sekretärin zugute, diesem Biest. Und mir hat sie immer nett ins Gesicht getan. Jetzt ist sie von ihm schwanger, wie man hört.«
»Oh, das wusste ich nicht«, erwiderte Ella. »Männer. Was soll man da sagen. Betrogen zu werden ist fast so grausam wie verschmähte Liebe.« Ihr Blick wanderte durch den Raum und blieb an Eberhard Hoesch hängen. Er war der jüngste Spross der einflussreichen Unternehmerfamilie Hoesch, die in der Stahlindustrie tätig war und im Zweiten Weltkrieg als Rüstungskonzern gedient hatte.
»Du wirst mir doch nicht etwa sagen, dass du noch immer nicht begriffen hast, dass er es mit dem anderen Geschlecht hat?«, sagte Lisbeth, die Ellas Blick bemerkt hatte, und sah sie fragend an.
»Natürlich habe ich das«, verteidigte sich Ella entrüstet. »Ich bin ja nicht dumm. Aber erklär das mal meinem bescheuerten Herz.« Sie seufzte, stützte die Hand aufs Kinn und blickte sehnsuchtsvoll in Eberhards Richtung. »Es ist ein Jammer. Irgendein Problem scheint es bei gutaussehenden Männern doch immer zu geben. Weißt du noch, wie sehr ich wegen Martin damals enttäuscht war? Mich hätte sein jüdischer Hintergrund weiß Gott nicht gestört. Immerhin hat es seine Familie noch in die USA geschafft. Die Seelgrubers von gegenüber hatten bedauerlicherweise nicht so viel Glück.« Ellas Miene zeigte Betroffenheit.
»Hm«, gab Lisbeth zur Antwort.
Über Freunde und Bekannte, die in Konzentrationslagern ermordet worden waren, redete sie nicht gerne. Sie hatte stets hinter Johannes gestanden, doch die Verfolgung der Juden konnte sie nicht gutheißen. Dafür hatte sie in Kindertagen zu viele jüdische Freunde gehabt. Die Tatsache, dass viele von ihnen in diesen abscheulichen Lagern den Tod gefunden hatten, machte sie tieftraurig.
»Wie steht es denn um Johannes?«, fragte Ella. »Ist er noch im Gefängnis?«
»Ja, ist er«, antwortete Lisbeth. »Er schreibt mir Briefe und hofft, dass er bald rauskommt.«
»Na, das hört sich doch gut an«, antwortete Ella. »Er schreibt also dir und nicht seiner Sekretärin. Findest du nicht, dass das etwas zu bedeuten hat? Du liebst ihn noch immer, oder?«
Ellas Worte trafen Lisbeth, denn sie hatte recht. Sie liebte diesen Mann, obwohl er sie hintergangen und belogen hatte. Die Worte in seinen Briefen waren schmeichelnd und klangen so wie in den Zeiten, als sie einander kennengelernt hatten. Er schrieb von einem Neubeginn, davon, dass er sie niemals wieder belügen werde, dass er sie doch liebe. Doch wie würde ihr Leben aussehen, wenn er tatsächlich freikäme? Schließlich wog seine Vergangenheit schwer. Würden sie überhaupt wieder ein normales Leben führen können? Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. An dem Spruch war etwas Wahres dran. Doch Gefühle schalteten den Verstand gerne mal aus, und vielleicht würde es tatsächlich gut gehen. Sie hatte ihm vor dem Altar die Treue in guten wie in schlechten Zeiten geschworen. Da lief man doch nicht einfach fort. Allerdings gab es da noch die schwangere Sekretärin. Der Gedanke, dass Lisbeth für sein Kind die Stiefmutter werden könnte, behagte ihr so gar nicht. Allerdings könnte er es auch einfach bei Unterhaltszahlungen belassen und jeden Kontakt unterbinden. Er wäre nicht der erste Mann, der so verfuhr.
»Du tust es«, meinte Ella, ohne eine Antwort von Lisbeth abzuwarten, und riss sie aus ihren Überlegungen.
»Vielleicht ja«, antwortete Lisbeth. »Aber ich weiß nicht, ob ich nicht nur eine Wunschvorstellung liebe. Ich habe geglaubt, ihn zu kennen. Doch nun bin ich mir nicht mehr sicher. Vielleicht wäre es besser, wenn ich ihn endgültig hinter mir lasse.« Sie sprach diesen Gedanken zum ersten Mal laut aus, und er schmerzte. Johannes war ihre erste große Liebe gewesen. Er hatte ihr, gerade am Anfang ihrer Beziehung, das Gefühl vermittelt, der wichtigste Mensch auf der Welt zu sein. Er war romantisch und fürsorglich gewesen, hatte ihr Rosen geschenkt, sich um sie gekümmert, als sie eine schlimme Erkältung gehabt hatte. An seiner Seite konnte sie strahlen, das hatte sie zu Hause in Hennis Schatten niemals getan. Hatte sie sich von ihm blenden lassen? Von seinen Geschäften in den Ministerien hatte sie nur wenig mitbekommen. Sie hatte sich selbst engagiert, in Frauenvereinen, hatte den Bund deutscher Mädchen unterstützt, sogar Auszeichnungen erhalten, für die er sie gelobt hatte. Vielleicht hätte sie mehr Interesse an seinem Tun zeigen sollen. Doch hätte er ihre Fragen beantwortet? Vermutlich nicht. Privates und Berufliches traf nur in sorgsam abgesteckten Rahmen aufeinander. Sie spielte ihre Rolle, er die seine. Doch trotz all der Zweifel und der Tatsache, dass er sie betrogen hatte, empfand sie noch immer etwas für ihn. Gefühle ließen sich nicht einfach so abschütteln.
Eine dunkelhaarige Frau Anfang dreißig gesellte sich zu ihnen. Marina Roland. Ihre Eltern hatten ein halbes Vermögen in der Textilindustrie verdient, die Firma war in Augsburg ansässig und hatte weltweit agiert. Marina war die Alleinerbin, da ihre beiden Brüder im Krieg gefallen waren. Allerdings hielt sie nicht viel von geschäftlichen Dingen. Das Leben war ihrer Meinung nach viel zu kurz, um sich mit trockenem Geschäftskram abzugeben.
»Die Damen«, grüßte sie mit dem üblichen leicht arrogant wirkenden Lächeln auf den Lippen, das Lisbeth schon immer gehasst hatte. Marina mit ihrem perfekten Puppengesicht, der schmalen Figur, dem glänzenden Haar. Sie trug am liebsten Chanel. Heute war es ein dunkelblaues, an der Taille gerafftes Cocktailkleid, dazu trug sie schwindelerregend hohe Schuhe, mit denen Lisbeth vermutlich keinen Schritt laufen konnte.
Sie stellte ihr Whiskeyglas auf dem Tisch ab, setzte sich in einen Sessel und schlug elegant die Beine übereinander.
»Ich habe dir noch gar nicht mein Beileid zum Tod deines Vaters ausgesprochen«, wandte sie sich an Lisbeth. »Es ist eine Tragödie. Und es kam ja so plötzlich.«
»Ja, das kam es«, antwortete Lisbeth und zwang sich zu lächeln. Sie wusste nicht, was es war, was sie an Marina nicht leiden konnte. Vielleicht war es der Umstand, dass sie von ihrem Vater vergöttert worden war und er ihr stets jeden Wunsch von den Augen abgelesen hatte. Lisbeth hingegen hatte sich jedes freundliche Wort von ihrem Vater oder Großvater stets erkämpfen müssen. Sie war die mittlere der Schwestern und hatte sich oftmals gefühlt, als wäre sie weder Fisch noch Fleisch. Henni war die Älteste, die Vernünftige, die immer alles richtig gemacht hatte im Leben. Sie hatte die richtigen Ansichten, zeigte Interesse an der Sektherstellung, hatte den perfekten Schwiegersohn an Land gezogen. Bille war das Nesthäkchen, dem keiner so recht etwas hatte abschlagen können. Doch wer war sie in diesem Konstrukt gewesen? Die Mutter hatte gefehlt, der Vater hatte sie kaum wahrgenommen, und wenn, dann hatte es stets Ermahnungen gegeben. Nimm dir ein Beispiel an deiner großen Schwester. Wie sehr sie diesen Satz doch gehasst hatte. Vielleicht war sie deshalb ausgebrochen und nach Berlin gegangen, um sich selbst zu finden, um sich von der Familie abzugrenzen.
Doch was würde nun werden? Ihr Leben lag in Trümmern. Ihr Mann saß im Gefängnis, sie musste zurück in den Schoß der Familie, von der nur noch die verhasste große Schwester geblieben war. Das Vorbild, von dem inzwischen jedoch auch der Lack abblätterte.
»Wie ich hörte, wird Henni nun die Kellerei leiten. Sie ist die Hauptanteilseignerin, nicht wahr? Ihr Ehemann ist noch in Russland, oder? Ehrlich gesagt habe ich nie verstanden, wieso sie diesen armen Schlucker zum Mann genommen hat. Das Weingut seiner Familie ist wahrlich überschaubar. Für die Erstgeborene der Familie Herzberg hätte es durchaus eine bessere Partie sein können. Dann würde die Kellerei jetzt vermutlich nicht mit dem Rücken zur Wand stehen. Mir hat ein Vögelchen gezwitschert, dass es finanziell nicht gerade zum Besten steht. Am Ende wird die renommierte Sektmarke Herzberg aus unserem Leben verschwinden. Das wäre ein Jammer. Obwohl ich persönlich sowieso französischen Champagner bevorzuge.«
»Was dir die Vögelchen so zwitschern«, entgegnete Lisbeth trocken und nahm einen Schluck von ihrem Sekt, der inzwischen leider warm geworden war. Sie verzog das Gesicht.
»Ich weiß nicht, wer solchen Unsinn erzählt hat«, sagte Lisbeth. »Wie alle Unternehmer hat auch mein Vater genügend Vermögenswerte ins Ausland verbracht. Du musst keine Sorge haben. Die Kellerei wird selbstverständlich auch weiterhin existieren.«
Sie log, ohne rot zu werden. Von einer finanziellen Misere hörte sie heute zum ersten Mal. Marina mochte eine eingebildete Zicke sein, aber sie war stets hervorragend informiert, also stimmte ihre Aussage vermutlich. Wieso hatte Henni nicht mit ihr darüber geredet? Immerhin hielt Lisbeth zehn Prozent der Firma. Allerdings hatte ihr an geschäftlichen Dingen nie etwas gelegen, und sie war Henni seit dem Tag der Beerdigung stets aus dem Weg gegangen.
»Wenn das so ist«, sagte Marina und erhob sich wieder. »Es wäre ja auch ein Jammer gewesen. Viktor ist eingetroffen. Endlich! Er ist gestern aus Amerika zurückgekehrt. Wir wollen morgen gemeinsam zu unserem Domizil nach Südfrankreich aufbrechen, es wird ein längerer Aufenthalt. In dieser Trümmerwelt hält es ja niemand aus. Habt ihr nicht auch ein Haus in Nizza?« Sie sah Ella fragend an. »Dort ist es zu dieser Jahreszeit gewiss herrlich. Sag Bescheid, wenn du dort bist. Dann können wir uns gerne auf ein Glas Champagner treffen.«
Sie erhob sich und ging zu Victor von Stremberg, ihrem zehn Jahre älteren Verlobten, einem Baron aus der Nähe von Hannover.
»An Nizza dachte ich noch gar nicht«, meinte Ella. »Wo sie recht hat. Hier in Wiesbaden wird es gewiss noch für lange Zeit düster bleiben. Was meinst du, Lisbeth? Würdest du mitkommen? Habt ihr nicht auch ein Anwesen in der Provence? Ein Weingut, oder?«
Vor Lisbeths innerem Auge stieg eine Kindheitserinnerung auf. Das alte, aus hellem Sandstein gemauerte und urig gemütliche Haus, umgeben von dem hübschen, weitläufigen Garten mit Pool, Weinbergen und Olivenhainen, der laute Gesang der Zikaden an heißen Julitagen. Sie war ewig nicht mehr dort gewesen. Der Gedanke, Wiesbaden zu entfliehen, gefiel ihr. Allerdings benötigte sie dafür finanzielle Mittel, denn ihre wenigen Rücklagen waren beinahe verbraucht. Vielleicht war es nun endgültig an der Zeit, einen Schlussstrich zu ziehen. Sie würde Henni darum bitten, ihr ihren Anteil an der Kellerei auszubezahlen. Dann könnte ihr neues Leben unter südlicher Sonne beginnen, und sie würde Wiesbaden und vielleicht auch Johannes endgültig hinter sich lassen.
3. Kapitel
Wiesbaden, 2. Oktober 1945
Henni blieb am Pförtnerhaus der Kellerei stehen, um den üblichen kurzen Schwatz mit Gustav Stellmann zu halten, der – als wäre es ein ganz normaler Arbeitstag im Werk – an seinem Platz hinter der Glasscheibe saß. Gustav grüßte wie immer in hessischer Mundart.
»Ei gude, Chefin«, sagte er und lächelte. »Alles läuft wie gewohnt.«
An den Begriff »Chefin«, den er neuerdings gebrauchte, musste sie sich erst noch gewöhnen. Früher hatte er sie stets Fräulein Henni genannt, auch nach ihrer Eheschließung noch, was Henni ihm nicht krummnahm. Gustav Stellmann und seine Frau Margot galten als die guten Seelen der Kellerei. Das Hausmeisterehepaar stand bereits seit über vierzig Jahren in den Diensten der Herzbergs und bewohnte ein kleines Häuschen am Ende des Geländes. Zwei Söhne hatten sie in all den Jahren großgezogen; aus einem von ihnen, Clemens, wäre vermutlich ein guter Kellermeister geworden, doch er war wie sein Bruder im Krieg gefallen. Gustav war in die Jahre gekommen, sein ergrautes Haar war schütter geworden, doch trotz des allgegenwärtigen Mangels an Lebensmitteln wirkte er noch immer gut genährt. Seine runden Wangen unter den buschigen Augenbrauen waren stets leicht gerötet.
»Wir wissen beide, dass nichts wie gewohnt läuft«, antwortete Henni mit einem müden Lächeln auf den Lippen. Sie hatte die letzte Nacht über den Geschäftsbüchern zugebracht und war erst in den frühen Morgenstunden zu Bett gegangen. »Nichts ist mehr wie früher, als mein Großvater noch die Leitung der Kellerei innehatte und sämtliche Mitarbeiter gut zu tun hatten. Heute ist es hier still, und ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie es weitergehen soll.« Sie ließ die Schultern sinken und blickte zu dem altehrwürdigen Kellereigebäude, das wie ein herrschaftliches Schloss anmutete. Ihr Großvater, der das zweistöckige, mit hellem Kalkstein verkleidete Gebäude errichtet hatte, war gut darin gewesen, Eindruck zu hinterlassen. Auf dem Dach des Hauptgebäudes prangte in großen Lettern der Familienname, der auch der Markenname ihres Sektes war. Herzberg. Das G war nur leider verschwunden, und das Gebäude war an der rechten Flanke stark beschädigt worden. An dieser Stelle lag auch der mit einem grünen Dach überspannte halbrunde Säulengang in Trümmern, den ihr Vater besonders gerngehabt hatte. Zum Nachdenken war er ihn stets auf und ab gelaufen. Der vertraute Anblick, wie er mit seiner Zigarette im Mund langsamen Schrittes an den Säulen vorüberlief und hin und wieder stehen blieb, würde ebenso fehlen wie die oftmals ruppig klingende Stimme ihres Großvaters in den Verwaltungsräumen. Im privaten Umfeld war er ein herzlicher und liebevoller Mann gewesen, der seine Enkeltöchter vergöttert hatte. Doch in der Kellerei galt es, sich vor ihm und seinen Wutausbrüchen in Acht zu nehmen. Er fehlte, wie so viele fehlten.
Auf dem Innenhof standen der Wagen eines Glasereibetriebs, und zwei junge Männer beschäftigten sich damit, ein Gerüst aufzustellen. In zahlreichen Fenstern des Anwesens waren die Scheiben zu Bruch gegangen und noch nicht ersetzt worden. Pappe hatte bisher, wie in vielen Häusern der Stadt, für eine notdürftige Abdichtung gesorgt. Protz und Prunk hatten unübersehbare Risse in den Hausmauern bekommen.
»Das geht doch immer irgendwie weiter«, antwortete Gustav. »Endlich werden die Fenster repariert, und heute hast du doch den Termin mit diesem Herrn von der Bank. Und ein alter Bekannter ist eingetroffen und wartet auf dich im Büro.« Er zwinkerte ihr zu.
»Ein alter Bekannter?«, hakte Henni verwundert nach. »Wer soll das denn sein?«
»Geh ruhig gucken«, erwiderte Gustav und scheuchte sie mit den Armen weiter. »Du wirst dich darüber freuen. Da bin ich mir sicher.«
Henni tat wie geheißen. Sie lief hastigen Schrittes über den Innenhof, denn es hatte zu regnen begonnen. In der Eingangshalle des Hauptgebäudes empfing sie die vertraute barocke Pracht. Der mit Marmor geflieste hellgraue Boden, die ebenfalls mit Marmor verkleideten Säulen, die sich bis zu der offenen Galerie im oberen Bereich zogen. Die Halle überspannte eine gewölbte, in hellem Grün gestrichene und mit Stuck verzierte Decke. Das ovale Kuppelfenster hatte wie durch ein Wunder die abscheulichen Bombennächte heil überstanden. Inzwischen hing auch der Kronleuchter wieder an seinem Platz. Über zwei Treppen mit geschwungenen Metallgeländern gelangte man zu den Verwaltungsräumen. Die Kellereigewölbe – das Heiligtum des Hauses, wie ihr Vater nie müde geworden war zu betonen – erreichte man ebenfalls direkt von der Eingangshalle, die früher auch für Feste genutzt worden war. Es hatte rauschende Ballnächte gegeben. Auch Hennis Hochzeit mit Conrad hatten sie hier gefeiert, und sie war in ihrem weißen Kleid über den Marmorboden geschwebt. Ewig hätte sie mit ihm, dem Mann, den sie seit frühster Kindheit kannte, weitertanzen können. Er war ihr Vertrauter gewesen, ein leidenschaftlicher Liebhaber, ihr bester Freund, wie ein Seelenverwandter. Der Sohn eines Winzers, die perfekte Partie für die älteste Tochter einer Sektkellerei-Familie, der bereit dazu war, in der Geschäftsführung des Hauses mitzuarbeiten. Drei Monate nach der Hochzeit war er zu seinem Regiment nach Frankreich aufgebrochen.
Der Verwaltungsbereich grenzte im ersten Obergeschoss an das Ende der Galerie. Es gab mehrere Büroräume, die von einem von Sprossenfenstern gesäumten und mit Fischgrätenparkett ausgelegten Flur abgingen, auf den die Strahlen der eben hinter den Wolken hervorgekommenen Sonne fielen. Am Ende des Flurs lag ihr neues Reich. Das Büro ihres Großvaters, das er sich in den letzten Jahren bereits mit ihrem Vater geteilt hatte.
Sie staunte nicht schlecht, als sie es betrat und sah, wer am Fenster stand. Es war Georg Winkler, ihr ehemaliger Kellermeister, der von einem auf den anderen Tag kurz vor Kriegsbeginn, ohne eine Erklärung oder Kündigung zu hinterlassen, verschwunden war.
»Georg«, sagte sie verdutzt. »Du hier?«
Er lächelte und trat vom Fenster weg. Der Raum hatte drei Sprossenfenster und einen dunklen Parkettboden, auf dem mehrere Perserteppiche lagen. Der aus Nussbaumholz gefertigte und klobig wirkende Schreibtisch ihres Großvaters stand vor einer Bücherwand, die die gesamte Nordseite des Raumes ausfüllte. Der gegenüberliegende Schreibtisch ihres Vaters fiel etwas kleiner und moderner aus. Hinter ihm standen Aktenschränke aus Metall, die so gar nicht zu dem restlichen Interieur des Raumes, von dessen mit Stuck verzierter Decke ein Kronleuchter hing, passen wollten. Hinzu kam eine kleine Hausbar, die natürlich Champagner und Sekt der Herzbergs, aber auch einen Vorrat an gesalzenen Erdnüssen enthielt, die Martin Herzberg stets gern gegessen hatte. Daneben standen auf einem Tisch eine Thermoskanne mit Ersatzkaffee, dazu Milch, Zucker und Kaffeetassen.
»Henni Herzberg«, sagte Georg und nahm die Hände aus seinen Hosentaschen. »Ich habe bereits gehört, dass du nun diejenige bist, die hier etwas zu sagen hat. Mein Beileid zum Tod deines Großvaters und Vaters. Ich weiß, dass die beiden sich nicht von den Nazischergen haben einwickeln lassen. Ihr Ableben ist ein großer Verlust. Ich hätte sie gerne wiedergesehen und ihnen persönlich erklärt, was mich damals zu meiner überstürzten Flucht getrieben hat.«
»Vater hättest du gewiss problemlos unter die Augen treten können«, antwortete Henni und musterte Georg näher. Wie alt war er jetzt?, fragte sie sich. Ende dreißig vielleicht. Sein braunes Haar war noch immer dicht, jedoch lagen um seine grünen Augen eindeutig mehr Fältchen. Er war ein ganzes Stück größer als Henni und hatte breite Schultern. Vor seinem Weggang hatte es nur wenige weibliche Angestellte in der Kellerei gegeben, die nicht für ihn geschwärmt hatten. »Aber ich glaube, mein Großvater hätte dir den Kopf abgerissen. Er war damals äußerst wütend und tagelang schlechter Laune. Gute Kellermeister fallen nicht gerade vom Himmel.«
»Ich weiß«, antwortete Georg. »Aber es ging nicht anders. Ich habe ganz plötzlich von familiären Problemen erfahren, die mich zu diesem Schritt gezwungen haben.«
Henni ahnte, woher der Wind wehte, und sprach ihre Vermutung unumwunden aus: »Ich nehme an, es gibt einen jüdischen Hintergrund?«
»Gut geraten«, antwortete Georg. »Mein Urgroßvater war Jude und konvertierte im Alter von dreißig zum evangelischen Glauben. Mein Bruder und ich flohen in die Schweiz und arbeiteten in den letzten Jahren auf einem Weingut im Tessin. Günter ist dortgeblieben, ihn zieht nichts mehr zurück. Aber mich plagte stets das Heimweh. Hier bin ich also wieder und wollte fragen, ob ihr einen erfahrenen Kellermeister gebrauchen könntet?«
Henni gefiel seine Ehrlichkeit. Sie füllte sich eine Tasse mit dem heißen Kaffee-Ersatz, gab etwas Kondensmilch und etwas Zucker dazu.
»Tessin also. Die Gegend soll sehr hübsch sein«, sagte sie. »Mediterranes Klima, ein hervorragender Ort für den Weinanbau. Ich kann deinen Bruder verstehen. Kaffee? Ist Muckefuck, aber man gewöhnt sich daran.«
Er stimmte zu, und sie füllte ihm eine Tasse. Ihre Hände zitterten leicht, beinahe hätte sie etwas verschüttet. Was war nur los? Es war Georg. Wieso machte er sie plötzlich nervös? Henni reichte ihm die Tasse, und sie nahmen an dem runden Tisch am Fenster Platz, der stets für Besucher genutzt wurde und der durch seinen schlichten Bauhausstil seltsam deplatziert wirkte.
»Wie ist es dir und der Familie in all den Jahren ergangen?«, fragte Georg.
Henni wusste nicht so recht, wo sie anfangen sollte. Er war so vertraut, kannte sie seit Kindertagen. Sie konnte sich noch gut daran erinnern, wie sie im Weinkeller gemeinsam an den Rüttelplatten gestanden und die Flaschen bewegt hatten, damit sich die Hefe absetzte. Er hatte ihr so viele Dinge über die Sektherstellung beigebracht. Entstehungsprozesse erklärt, über die die Tochter einer Sektkellerei-Familie Bescheid wissen sollte. Ihr Vater hätte das niemals getan. Ihm war es stets darum gegangen, dass seine Töchter eine gute Partie machten. Ein anständiger Schwiegersohn musste her, der die Leitung des Betriebs übernehmen konnte. Oftmals hatten die drei Schwestern den unterschwelligen Vorwurf gespürt, als Frauen nicht gut genug zu sein. Georg hatte ihr nie dieses Gefühl vermittelt. Die Vertrautheit zwischen ihnen war auch nach all den Jahren noch da. Doch die Zeit hatte ihren Umgang miteinander verändert. Henni war erwachsen geworden, Georg reifer.
Sie begann zu erzählen. Zu Beginn stockend, sie wog die Worte ab. Doch mit jedem Satz wurde sie offener. Sie erzählte, wie schmerzhaft es sei, nicht zu wissen, wo Bille sich aufhalte und ob es ihr gutgehe. Nur kurz erwähnte sie Lisbeth und ihren Weggang nach Berlin. Die unrühmliche Passage mit der überstürzten Heirat ließ sie aus. Sie erzählte von ihrer Eheschließung mit Conrad und davon, dass er zuletzt im Osten im Einsatz gewesen sei und sie seit einer gefühlten Ewigkeit keine Nachricht von ihm erhalten habe.
»Anfangs hat es noch die Hoffnung gegeben, dass er in Kriegsgefangenschaft geraten ist«, erklärte sie. »Aber sie schwindet mit jedem Tag ohne eine Nachricht von ihm. Auch Kriegsgefangene senden Lebenszeichen. Ich werde mich wohl an den Gedanken gewöhnen müssen, ihn niemals wiederzusehen.« Sie spürte die aufsteigenden Tränen, senkte den Kopf und begann, in ihrem Kaffee zu rühren. Georg erwiderte nichts. Seine Miene war ernst. Einen Moment herrschte eine bedrückende Stille im Raum. Henni war dankbar für sein Schweigen. Sie konnte auf die ewig gleichen, lieb gemeinten Floskeln von Anteilnehmenden gern verzichten. Es war nun einmal, wie es war. Sie wusste, dass sie es um einiges besser getroffen hatte als viele andere Soldatenwitwen, die eine Schar Kinder hatten, kein Dach über dem Kopf und nicht wussten, wie sie alle satt bekommen sollten. Zusätzlich zu dem Verlust des Ehemanns kamen Existenzängste, Angst vor beißendem Hunger und der Kälte des nahenden Winters. Im Gegensatz zu diesen Frauen lebte Henni privilegiert. Was zählte im Angesicht von Millionen tragischen Schicksalen schon ihr Kummer?
»Wie steht es denn um den Betrieb?«, kam Georg wieder auf das Geschäftliche zu sprechen.
»Nicht gut«, antwortete Henni ehrlich. »Du weißt, wie mein Vater und mein Großvater gedacht und gehandelt haben. Wir Töchter wurden in keine Abläufe involviert. Wir sollten möglichst rasch patente Schwiegersöhne beibringen, die vom Geschäft Ahnung hatten.« In ihrer Stimme schwang Bitterkeit mit. »Und jetzt sitze ich hier und weiß nicht so recht, wie es weitergehen soll. Unser Anwesen diente während der Kriegsjahre als Stab der Luftwaffe; als die Amerikaner nach Wiesbaden kamen, haben sie es als eines der ersten Gebäude besetzt. Großvater hat kurz nach Kriegsbeginn noch die Produktion erweitert, neue Hallen bauen lassen, den Fuhrpark erneuert. Er hat dafür einen Großteil unserer Rücklagen verwendet im Vertrauen darauf, dass das Geschäft weiterhin steil bergauf gehen würde. Die Produktionshallen sind schwer beschädigt worden und müssen komplett instand gesetzt werden. Wie du gesehen hast, ist auch der Firmenhauptsitz in Mitleidenschaft gezogen worden. Unser übrig gebliebener Fuhrpark wurde von den Amerikanern beinahe komplett konfisziert. Ich kann von Glück reden, dass wir in der Villa bleiben durften. Mit unseren restlichen Rücklagen können wir den Neubeginn auf keinen Fall stemmen. Mein Vater hat vor seinem Tod seinen alten Freund Philip Malzer um einen Kredit gebeten. Er ist Inhaber eines einflussreichen Bankhauses in Frankfurt. Begeistert war er nicht darüber, ausgerechnet Philip zu fragen, denn er war an der Arisierung jüdischer Bankhäuser beteiligt. Aber Philip zeigte sich ihm gegenüber geläutert. Wie ehrlich diese Reue ist, wusste er natürlich nicht. Aber das Angebot von Philip ist ausgezeichnet. Gute Kredite anderswo zu bekommen, gestaltet sich im Moment schwierig. Es wäre dumm, das Angebot auszuschlagen. Sein Sohn Adam kommt in einer halben Stunde zu einer Besprechung. Sollte ich den Kredit bekommen, könnte der Betrieb wieder aufgenommen werden. Anfangs natürlich nur im kleinen Rahmen, aber immerhin wäre es ein Neubeginn. Die Genehmigung der Amerikaner habe ich bereits. Einige ehemalige Mitarbeiter haben schon angefragt.«
»Das hört sich für mich nach einem Plan an«, antwortete Georg. »Könnte es sein, dass du dann einen erfahrenen Kellermeister brauchst? Ich nehme an, die Grundweine für die Cuvée werden noch immer von den üblichen Rheingauer Weinbauern geliefert?«
»Selbstverständlich«, antwortete Henni. »Etwas anderes kommt nicht in die Flasche eines Herzbergsekts. Es hängt alles vom Bankkredit ab.«
»Ich könnte dir bei vielen Dingen zur Hand gehen«, schlug Georg vor. »Gesetzt den Fall, du stellst mich ein.«
Er trat näher an sie heran und sah sie mit diesem besonderen Blick an, den sie schon von früher kannte. Leicht von unten, auf seinen vollen Lippen lag ein sanftes Lächeln. Er war ein attraktiver Mann, kam es Henni in den Sinn. Schnell schob sie den Gedanken zur Seite. Sie war eine verheiratete Frau, so sollte sie nicht denken.
»Natürlich würde ich das tun«, antwortete sie. »Ich wäre dumm, wenn nicht. Auch Conrad würde dir sofort eine Anstellung geben.«
»Ja, das würde er«, antwortete Georg. »Ich weiß nicht, ob Conrad es dir jemals erzählt hat, aber er war derjenige, der uns damals mit Nachdruck dazu geraten hat, das Land zu verlassen. Er hat uns sogar finanziell bei der Flucht unterstützt. Ich wäre aus Loyalität zum Betrieb geblieben. Er hat mir und meinem Bruder das Leben gerettet. Das werde ich ihm nie vergessen. Ich hoffe, er kommt wieder.«
»Das wusste ich nicht«, antwortete Henni. Georgs Worte rührten sie. »Ich hoffe so sehr, dass ich bald ein Lebenszeichen von ihm erhalte, dass er bald nach Hause kommen wird. Er fehlt mir so sehr.« In ihre Augen traten Tränen. Sie wandte sich rasch ab und wischte sie fort. Doch Georg hatte sie gesehen.
»Du musst keine Stärke beweisen. Es ist in Ordnung, dass du traurig bist. Ich bin es auch.«
Hennis Stimme klang bitter, als sie sagte: »Großvater hat es kommen sehen. Wir haben ihn oft besänftigen müssen, sonst hätte er sich um Kopf und Kragen geredet und wäre in einem dieser abscheulichen Lager gelandet.«
Plötzlich öffnete sich die Tür, und Lisbeth rauschte herein. Der Geruch ihres blumigen Parfüms erfüllte den Raum. Sie trug ein braunes Hemdblusenkleid, das mit einem schmalen schwarzen Gürtel tailliert wurde.
»Hat unsere Trude also doch recht gehabt, und dich hat es in die Firma verschlagen«, plapperte sie sogleich los. »Oder besser gesagt: das, was davon noch übrig ist.« Ihr Blick blieb an Georg hängen und bekam etwas Abfälliges. »Da sieh mal einer an, wer wieder im Lande ist. Wo hast du dich denn all die Jahre herumgetrieben?«
»Was willst du hier?«, fragte Henni in harschem Tonfall. Das Auftauchen ihrer Schwester passte ihr so gar nicht.
»Mit dir reden. Wie ich mir vorstellen kann, wärst du nicht sonderlich erpicht darauf, wenn ich länger bliebe. Oder wenn ich mich in die Belange der Firma einmischte. Obwohl ich das durchaus könnte, immerhin bin ich eine der Anteilseignerinnen.«
»Vater hat dir zehn Prozent hinterlassen«, antwortete Henni. »Bille die anderen zehn, den Rest mir. Viel einzumischen gibt es da nicht. Ich entscheide als Hauptanteilseignerin allein.«
»Weil du dich ja mit allem so hervorragend auskennst, meine Liebe«, gab Lisbeth zurück. »Wir Herzberg-Frauen sind doch unser Leben lang darauf getrimmt worden, die hübsche Ehefrau an der Seite eines reichen Mannes zu geben, die nett lächelt, entzückende Nachkommen in die Welt setzt und den Mund hält. Kennst du dich überhaupt mit Buchhaltung aus? Aber egal. Mir geht es nicht darum, mitreden zu wollen. Ich will nur, was mir zusteht. Dann bin ich auch schon wieder weg.«
»Du willst was?«
»Was mir zusteht. Meine zehn Prozent Unternehmensanteile. Ich will mich in unser altes Weingut nach Südfrankreich zurückziehen. Da ist das Klima freundlicher, und die Welt ist nicht so trostlos.«
Henni sah ihre Schwester fassungslos an. »Ich kann dir deinen Anteil jetzt nicht ausbezahlen«, antwortete sie und trat hinter den Schreibtisch ihres Großvaters. »Die Kellerei liegt am Boden, und vielleicht verlieren wir sie ganz. Wie kannst du so egoistisch sein? Es geht um den Familienbetrieb, das Lebenswerk unserer Vorfahren. Es gilt nun zusammenzuhalten und sämtliche Anstrengungen in den Wiederaufbau des Betriebs zu stecken. Und das Weingut in Südfrankreich gibt es nicht mehr. Das Anwesen ist vor drei Jahren vollkommen niedergebrannt, man vermutete Brandstiftung. Papa hat das Grundstück danach veräußert. Wie kannst du an so etwas in diesen Zeiten überhaupt nur denken?«
Lisbeth wollte Antwort geben, doch sie wurde von einem Klopfen an der Tür unterbrochen. Es war Wilhelmine Gabler, eine der wenigen kaufmännischen Angestellten, die noch im Betrieb waren. Die Mittfünfzigerin mit einer Lesebrille im grauen Haar trug ihr adrettes Kostüm. Sie hatte vor über dreißig Jahren in der Sektkellerei als Schreibkraft begonnen und nun den Posten der leitenden Sekretärin inne.
»Guten Morgen«, grüßte sie mit dem vertrauten herrschaftlich wirkenden Blick in die Runde. Sie hielt ein silbernes Tablett in Händen, auf dem die Tagespost lag.
»Die Post, Frau Mahl. Die obenauf liegende Mitteilung könnte sie besonders interessieren. Ihr Termin lässt sich für heute entschuldigen und fragt nach, ob es Ihnen morgen zur selben Zeit recht wäre.« Sie stellte das Tablett auf dem Schreibtisch ab.
Henni starrte auf die Briefe. Obenauf lag eine offiziell aussehende Postkarte. Henni las den Text auf der rechten Seite, und ihre Knie wurden weich.
Deutsche Dienststelle
für die Benachrichtigung der nächsten
Angehörigen von Gefallenen
der ehemaligen deutschen Wehrmacht.
4. Kapitel
Martinsthal, 5. Oktober 1945
Henni saß auf einer von Weinreben umgebenen Bank in der hellen Nachmittagssonne und hielt die amtlich und unpersönlich erscheinende Karte in Händen, die sie am liebsten weggeworfen hätte, damit die Hoffnung blieb. Name, Geburtsdatum, Dienstgrad und Truppenteil waren darauf vermerkt. Angeblich war Conrad bereits seit Jahresbeginn tot. Ansonsten enthielt die Karte nicht viele Informationen. Er war am 23. Januar gestorben. Nur das Wort Gefallen stand neben dem Datum, nichts weiter. Vielleicht war es besser, nicht zu wissen, was genau geschehen war.