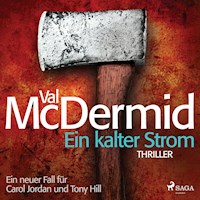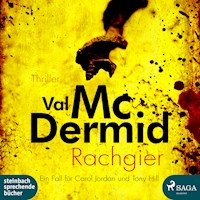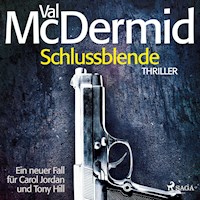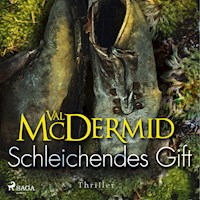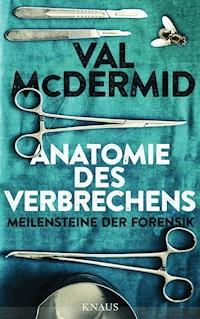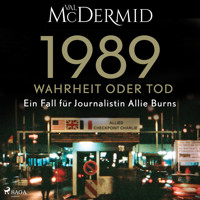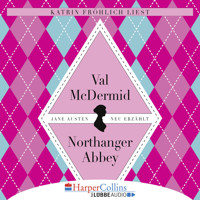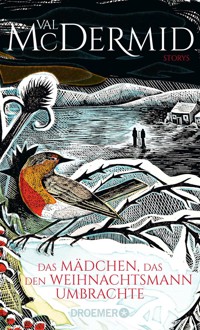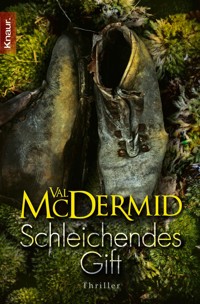
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Carol Jordan und Tony Hill
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Im neuen Kriminalroman von Crime-Queen Val McDermid warten gleich zwei schwierige Fälle auf Detective Chief Inspector Carol Jordan und Profiler Tony Hill. Der beliebte Profifußballer Robbie Bishop wird mit grippeähnlichen Symptomen in die Klinik eingeliefert. Bis die Ärzte eine Diagnose stellen und ihm helfen können, ist es allerdings zu spät. Der Profifußballer stirbt an einer Rizinvergiftung. Kurz darauf kommen bei einem Bombenanschlag während eines Fußballspiels der Premier League in Bradfield Dutzende Menschen ums Leben. Die Stadt steht unter Schock. War das die Wahnsinnstat eines Terroristen? Und wer hat es auf den Profifußballer abgesehen? Die zwei unterschiedlichen Fälle des Kriminalromans scheinen zunächst nichts miteinander zu tun haben. Die toughe Carol Jordan und der sympathisch-verschrobene Profiler Tony Hill ermitteln parallel, doch der Druck wächst, als die Boulevardpresse die Stimmung mit immer neuen Spekulationen um den Profifußballer aufheizt. Zudem liegt Tony nach der Attacke eines Psychopathen noch schwer verletzt im Krankenhaus. Als ein zweiter Giftmord geschieht und weitere Profifußballer in Gefahr geraten, muss das Ermittlerduo alles daransetzen, einen Killer zu stellen, über den es so gut wie nichts weiß... Der Kriminalroman "Schleichendes Gift" entpuppt sich als virtuose Inszenierung raffinierter Spannung – und setzt die nicht ungefährliche Profifußballer-Szene in ein neues Licht. Nicht oft wird man so elegant getäuscht und nachhaltig gefesselt, ohne das immer wieder Blut fließen muss. Krimi-couch.de Gekonnt wie immer baut Val McDermid die Spannung in diesem Kriminalroman auf. Literaturschock.de Mehr Kriminalromane der Ermittler-Serie um Carol Jordan und Profiler Tony Hill: Bd. 1: Das Lied der Sirenen Bd. 2: Schlussblende Bd. 3: Ein kalter Strom Bd. 4: Tödliche Worte Bd. 5: Schleichendes Gift Bd. 6: Vatermord Bd. 7: Vergeltung Bd. 8: Eiszeit Bd. 9: Schwarzes Netz Bd. 10: Rachgier Bd. 11: Der Knochengarten
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 686
Ähnliche
Val McDermid
Schleichendes Gift
Thriller
Aus dem Englischen von Doris Styron
Knaur e-books
Inhaltsübersicht
Für alle, die auf der Hochzeit waren und halfen, sie zu einer der wunderbarsten Erinnerungen zu machen.
Wir fühlen, wie unter der blutenden Hand
Der Heilkunst scharfes Mitleid bannt,
Des Fiebers Rätsel lösend, alle Qual.
T.S. Eliot, »East Coker« aus: Vier Quartette
Freitag
Die Mondphasen haben eine unerklärliche, aber unbestreitbare Wirkung auf Geisteskranke. Alle Pfleger psychiatrischer Anstalten bestätigen das. Es gilt unter ihnen als allgemein anerkannte Wahrheit. Bei Vollmond macht keiner freiwillig Überstunden. Es sei denn, er wäre in einer absolut verzweifelten Lage. Auch Verhaltensforschern verursacht diese Wahrheit Unbehagen, denn es geht hier nicht um etwas, das sich einer unglücklichen Kindheit oder der Unfähigkeit zu sozialem Verhalten zuschreiben ließe. Es ist ein von außen einwirkender Rhythmus, der sich durch keinerlei Behandlung überwinden lässt. Diese Kraft lässt die Fluten steigen und reißt die Irren aus ihren gestörten Bahnen.
Die innere Dynamik des Bradfield Moor Secure Hospital unterlag dem Sog des Vollmonds genauso, wie sein Name vermuten ließ. Manche der dort Beschäftigten waren der Meinung, dass Bradfield Moor ein Aufbewahrungsort für jene Geisteskranken sei, die zu gefährlich waren, um frei herumzulaufen. Andere sahen darin einen Zufluchtsort für Wesen, die für das erbarmungslose Chaos des Lebens draußen zu zerbrechlich sind. Und für den Rest war es ein vorübergehender Unterschlupf, der die Hoffnung bot, in eine nicht allzu streng definierte Normalität zurückkehren zu können. Die dritte Gruppe war, was kaum überraschen wird, in der Minderzahl und wurde von den beiden anderen zutiefst verachtet.
In jener Nacht war nicht nur Vollmond, sondern auch eine partielle Mondfinsternis. Als die Erde zwischen ihrem Satelliten und der Sonne vorbeizog, nahmen die fahlen Schatten der Mondoberfläche nach einem kränklichen Gelb- allmählich einen dunklen Orangeton an. Für die meisten Beobachter besaß die Mondfinsternis eine geheimnisvolle Schönheit und rief Staunen und Bewunderung hervor. Lloyd Allen hingegen, einer der Patienten des Bradfield Moor Hospital, die sich relativ frei bewegen konnten, sah darin den schlüssigen Beweis für seine Überzeugung, dass die letzten Tage der Menschheit bevorstanden und es seine Pflicht sei, so viele Menschen wie möglich vor ihren Schöpfer treten zu lassen. Man hatte ihn in die Anstalt gesperrt, bevor er sein Ziel erreichen konnte, möglichst viel Blut zu vergießen, damit bei der unmittelbar bevorstehenden Wiederkunft Christi die Seelen leichter gen Himmel aufsteigen konnten. Da er an der Ausführung seiner Mission gehindert worden war, brannte diese nun umso stärker in ihm.
Lloyd Allen war nicht dumm, was die Arbeit seiner Bewacher umso schwieriger machte. Die Pfleger in der Psychiatrie waren mit unbedarften Täuschungsmanövern vertraut und konnten sie relativ leicht durchkreuzen. Viel schwieriger war es, die Pläne derer vorauszusehen, die verrückt, aber intelligent agierten. In letzter Zeit hatte Allen eine Methode entwickelt, die ihm erlaubte, seine Medikamente nicht mehr einnehmen zu müssen. Die erfahrenen Pfleger kannten solche Tricks und wussten, wie man sie abwenden konnte, aber Neulingen wie Khalid Khan fehlte noch die nötige Gewieftheit.
Allen hatte es am Abend vor der Vollmondnacht geschafft, zweimal der Chemiekeule zu entgehen, die Khan ihm verabreicht zu haben glaubte. Als die Verfinsterung sichtbar wurde, tönte in Allens Kopf ein leise trommelnder, ständig wiederkehrender Satz. »Bring sie zu mir, bring sie zu mir, bring sie zu mir«, dröhnte es ohne Unterlass in seinem Inneren. Von seinem Zimmer aus konnte er ein Stück des Mondes sehen, auf dessen Gesicht sich die prophezeite blutige Flut ausbreitete. Die Zeit war gekommen. Die Zeit war tatsächlich gekommen. Aufgeregt ballte er die Fäuste, stieß wie ein verrückter Boxer vor einem Angriff die Unterarme alle zwei Sekunden ruckartig nach oben und ging dann wieder in Deckung.
Er drehte sich um und stolperte ungeschickt auf die Tür zu. Er musste hinaus, um seine Mission zu erfüllen. Der Pfleger würde bald mit den Medikamenten für die Nacht da sein. Dann würde ihm Gott die Kraft geben, die er brauchte. Gott würde ihn hinausführen, Gott würde ihm den Weg zeigen. Gott wusste, was er tun musste. Er würde sie zu Ihm bringen. Die Zeit war reif, der Mond verströmte Blut. Die Zeichen mehrten sich, und er musste seine Aufgabe vollenden. Er war erwählt, er war der Weg zur Rettung der Sünder. Er würde sie zu Gott bringen.
Der Lichtkegel erhellte ein kleines Stück der Schreibfläche auf einem schäbigen Kliniktisch. Eine Akte lag offen da, und eine Hand mit einem Kugelschreiber schwebte über dem Rand der Seite. Im Hintergrund erklang klagend Mobys Song »Spiders«. Die CD war Dr. Tony Hill geschenkt worden, er hätte sie sich niemals selbst gekauft. Aber irgendwie war sie zum festen Bestandteil seines Arbeitsrituals am späten Abend geworden.
Tony rieb sich die brennenden Augen und vergaß dabei, an seine neue Lesebrille zu denken. »Autsch«, jammerte er, als das Gestell sich in seinen Nasenrücken drückte. Mit dem kleinen Finger erwischte er das Glas der randlosen Brille, und sie flog aus seinem Gesicht direkt auf die Akte, die er gerade las. Er konnte sich den nachsichtig amüsierten Blick von Detective Chief Inspector Carol Jordan vorstellen, die ihm die Moby-CD geschenkt hatte. Seine Zerstreutheit und Ungeschicklichkeit waren schon lange Gegenstand ständiger Witze zwischen ihnen.
Aber über eine Tatsache konnte sie sich weder lustig noch ihm daraus einen Vorwurf machen: dass er freitagabends noch um halb neun an seinem Schreibtisch saß. Ihr Widerstreben, das Büro zu verlassen, bevor auch wirklich alles erledigt war, war mindestens genauso stark wie seines. Wäre sie hier gewesen, hätte sie verstanden, wieso er geblieben war und noch einmal den Bericht durchging, den er so akribisch für die Haftentlassungskommission vorbereitet hatte. Einen Bericht, den man dort munter ignoriert hatte, als man die Entscheidung traf, Bernard Sharples der Bewährungshilfe zu übergeben. Sein Anwalt hatte die Kommission überzeugt, dass er keine Gefahr mehr für die Öffentlichkeit darstelle. Ein vorbildlicher Häftling, der mit den Behörden bei allem, was von ihm verlangt wurde, zusammengearbeitet und geradezu ein Musterbeispiel für Reue geboten hatte.
Na ja, dachte Tony bitter, natürlich war Sharples ein vorbildlicher Gefangener gewesen. Es war leicht, gutes Benehmen zu zeigen, wenn die Objekte der Begierde so unerreichbar waren, dass sich selbst der besessenste Phantast nur schwer etwas ausdenken konnte, was auch nur im Entferntesten einer Versuchung glich. Sharples würde rückfällig werden, er spürte es in seinen Knochen. Und teilweise würde es seine Schuld sein, weil er seine Sicht der Dinge nicht überzeugend genug hatte darlegen können.
Er setzte die Brille wieder auf und markierte zwei Absätze mit seinem Stift. Er hätte seine Argumente entschiedener vertreten können und sollen, ohne Lücken, die der Verteidigung Angriffspunkte liefern konnten. Er hätte als Tatsache geltend machen müssen, was nach seiner jahrelangen Erfahrung mit Serientätern doch nur auf Mutmaßungen gründete; dazu kam dann noch sein Instinkt, der sich bei den Gesprächen mit Sharples auf das stützte, was sich zwischen den Zeilen lesen ließ. Doch in der schwarzweißen Welt des Bewährungsausschusses gab es keine Grautöne. Tony schien immer noch nicht gelernt zu haben, dass Aufrichtigkeit selten die beste Vorgehensweise war, wenn man es mit der Strafjustiz zu tun hatte.
Er zog ein Blöckchen mit Klebezetteln heran, aber bevor er etwas daraufkritzeln konnte, drang von draußen Lärm in sein Büro.
Normalerweise ließ er sich von den verschiedenen Hintergrundgeräuschen nicht stören, die zum Leben im Bradfield Moor Hospital dazugehörten. Der Lärmschutz war erstaunlich wirksam, und außerdem spielten sich die schlimmsten Szenen von Qual und Pein meistens weit entfernt von den Büros ab, wo Akademiker mit einem gewissen Ansehen arbeiteten.
Mehr Lärm. Es klang wie ein Fußballspiel oder eine gewalttätige Demonstration und war jedenfalls so geräuschvoll, dass es unvernünftig gewesen wäre, es zu ignorieren. Seufzend stand Tony auf, ließ die Brille auf den Schreibtisch fallen und ging zur Tür.
Alles andere war besser als das hier.
Nicht viele Menschen hätten eine Stelle am Bradfield Moor Hospital wohl als die Erfüllung eines Traums betrachtet. Aber für Jerzy Golabeck war sie mehr, als er sich nach seiner Kindheit und Jugend in Plotzk jemals erträumt hätte. Seit die polnischen Könige sich 1138 aus dem Staub gemacht hatten, war in Plotzk nicht mehr viel passiert. Arbeitsplätze waren heutzutage nur in den Erdölraffinerien zu haben, wo die Löhne erbärmlich und Berufskrankheiten alltäglich waren. Jerzys enger Horizont hatte sich durch Polens Beitritt zur Europäischen Gemeinschaft mit einem Schlag überwältigend erweitert. Er hatte als einer der ersten mit einem Billigflug von Krakau nach Leeds/Bradford Airport auch die Aussicht auf ein neues Leben gebucht. Aus seiner Perspektive kam sein Mindestlohn einer Riesensumme gleich. Und mit den Insassen des Bradfield Moor Hospital zu arbeiten war nicht so viel anders, als sich mit einem senilen Großvater abzugeben, der Lech Walesa immer noch für den Mann der Zukunft hielt.
So hatte Jerzy also der Wahrheit ein wenig nachgeholfen und sich etwas Erfahrung im Umgang mit psychisch Kranken zusammengebastelt, die wenig Ähnlichkeit mit seiner tatsächlichen Vergangenheit am Fließband einer Essiggurkenfabrik hatte.
Bis jetzt war das kein Problem gewesen. Die Pfleger und Helfer waren mehr damit beschäftigt, die Patienten in Schach zu halten als sie zu therapieren. Sie verabreichten Medikamente und beseitigten Schmutz und Unordnung. Alle Versuche einer Heilung oder Linderung blieben den Ärzten, Psychiatern, Therapeuten verschiedener Schulen und klinischen Psychologen überlassen. Es schien, dass niemand viel mehr von Jerzy erwartete, als dass er pünktlich zur Arbeit erschien und sich nicht vor körperlich unangenehmen Anstrengungen drückte, die in jeder Schicht vorkamen. Das alles konnte er mühelos bewältigen.
Nebenbei hatte er einen genauen Blick für das entwickelt, was sich um ihn herum abspielte, und niemanden überraschte das mehr als ihn selbst. Aber es war unbestreitbar, dass Jerzy instinktiv erkannte, wenn Patienten die Ausgeglichenheit abhanden kam, die das Funktionieren des Bradfield Moor Hospital überhaupt möglich machte. Er war einer der wenigen Angestellten der Anstalt, die jemals bemerkt hatten, dass etwas mit Lloyd Allen nicht stimmte. Das Problem war nur, dass er sich inzwischen schon zutraute, selbst mit der Sache fertig zu werden. Er war nicht der erste Vierundzwanzigjährige, der eine übertriebene Vorstellung von seinen Fähigkeiten hatte. Allerdings einer der wenigen, die wegen dieses Irrtums zu Tode kamen.
Sobald er Lloyd Allens Zimmer betreten hatte, sträubten sich die Haare auf seinen Armen. Allen stand, die breiten Schultern verkrampft, mitten in dem engen Raum. Die schnellen Bewegungen seiner Augen verrieten Jerzy, dass die Medikamente entweder auf spektakuläre Weise plötzlich ihre Wirkung verloren hatten oder dass es Allen irgendwie gelungen war, sie gar nicht einzunehmen. Jedenfalls schien er sich nur auf die Stimmen in seinem Kopf zu konzentrieren. »Zeit für deine Pillen, Lloyd«, sagte Jerzy betont beiläufig.
»Kann ich nicht.« Allens Stimme klang wie ein angespanntes Ächzen.
Er wippte leicht auf den Fußballen und rieb sich die Hände wie beim Waschen. Die Muskeln seiner Unterarme zitterten und zuckten.
»Du weißt doch, dass du sie brauchst.«
Allen schüttelte den Kopf.
Jerzy tat dasselbe. »Wenn du deine Pillen nicht nimmst, muss ich es melden. Dann wird es schwierig für dich, Lloyd. Das wollen wir doch nicht, oder?«
Allen stürzte sich auf Jerzy und erwischte ihn mit dem rechten Ellbogen unterhalb des Brustbeins, so dass dem Pfleger die Luft wegblieb. Als Jerzy sich vorwärtsbeugte, würgte und nach Luft schnappte, stürmte Allen an ihm vorbei und stieß ihn auf dem Weg zur Tür zu Boden. An der Tür blieb Allen plötzlich stehen und drehte sich um.
Jerzy bemühte sich, klein und ungefährlich auszusehen, aber Allen kam trotzdem zurück zu ihn. Er hob den Fuß und trat Jerzy so fest in den Magen, dass die Luft aus dessen Lunge entwich und ihm vor tobendem Schmerz schwindlig wurde. Während Jerzy sich den Leib hielt, griff Allen ruhig nach unten und riss die Schlüsselkarte von seinem Gürtel. »Ich muss sie zu Ihm bringen«, knurrte er und ging wieder auf die Tür zu.
Jerzy konnte ein schreckliches, krampfhaftes Ächzen nicht unterdrücken, als sein Körper nach Sauerstoff rang. Aber sein Gehirn funktionierte einwandfrei. Er wusste, dass er es zum Alarmknopf im Flur schaffen musste. Allen konnte sich mit Jerzys Schlüssel fast überall im Haus Zutritt verschaffen. Er konnte die Zimmer der anderen Insassen öffnen. Es würde nicht lange dauern, so viele seiner Genossen zu befreien, bis sie dem Personal zu dieser Zeit des Abenddienstes zahlenmäßig deutlich überlegen sein würden.
Hustend, keuchend und mit Spucke am Kinn zwang sich Jerzy auf die Knie und rutschte näher zum Bett. Er klammerte sich am Rahmen fest, und es gelang ihm, sich auf die Füße hochzuziehen. Die Hände auf den Bauch gepresst, stolperte er in den Flur hinaus. Weiter vorn sah er Allen, der die Schlüsselkarte durch das Lesegerät an der Tür zu führen versuchte, von wo er in den Hauptteil des Gebäudes gelangen würde. Man musste die Karte mit der genau richtigen Geschwindigkeit durchziehen. Jerzy wusste das, Allen aber Gott sei Dank nicht. Er schlug auf das Lesegerät ein und versuchte es noch einmal. Schwankend versuchte Jerzy, so leise wie möglich an den Alarmknopf heranzukommen.
Aber er war nicht leise genug. Irgendetwas machte Allen aufmerksam, und er fuhr herum. »Bring sie zu Ihm«, brüllte er und rannte los. Sein Gewicht allein genügte, um Jerzys geschwächten Körper wieder auf den Boden zu werfen. Jerzy bedeckte den Kopf mit den Armen, aber das half nichts. Das Letzte, was er spürte, war ein furchtbarer Druck hinter den Augen, als Allen ihm mit voller Wucht auf den Kopf trat.
Als Tony die Tür öffnete, brandete ihm das Getöse in voller Lautstärke entgegen. Rufe, Flüche und Schreie drangen durchs Treppenhaus herauf. Das Erschreckendste daran war, dass niemand den Notalarm ausgelöst hatte. Das hieß, etwas war so plötzlich und auf so brutale Weise passiert, dass niemand die Chance gehabt hatte, die Vorschriften zu befolgen, die ihnen vermutlich vom ersten Tag ihrer Ausbildung an eingetrichtert worden waren. Das Pflegepersonal musste vollauf damit beschäftigt sein, das, was da geschah, irgendwie unter Kontrolle zu bekommen. Tony lief eilig den Flur entlang auf die Treppe zu und drückte im Vorbeigehen den Alarmknopf. Eine laute Sirene heulte sofort los. Mein Gott, wenn man sowieso schon verrückt war, wie musste sich das auf einen auswirken? Er erreichte die Treppe, verlangsamte aber sein Tempo, damit er einen Blick ins Treppenhaus werfen konnte, ob dort unten etwas zu sehen war.
Die Antwort war einfach: nichts. Die lauten Stimmen schienen von rechts aus dem Flur zu kommen, wurden aber durch Akustik und Entfernung verzerrt. Plötzlich das helle Klirren und Scheppern von splitterndem Glas. Dann eine schockierende, kurze Stille.
»Oh, verflucht«, sagte jemand offenbar angewidert. Dann ging das Rufen weiter, die Panik war unverkennbar. Ein Schrei, dann das Geräusch eines Handgemenges. Ohne nachzudenken, begann Tony, die Treppe hinunterzulaufen, um zu sehen, was sich da tat.
Nach der letzten Treppenbiegung stürzten ihm aus dem Flur, aus dem die Geräusche gekommen waren, mehrere Körper entgegen. Zwei Pfleger näherten sich ihm rückwärts und hielten einen dritten Mann. Es war ein Helfer, wie aus den wenigen noch nicht blutigen Stellen seiner hellgrünen Schutzbekleidung zu schließen war. Sie hinterließen eine rote Blutspur, als sie ihn so schnell wie möglich zurückschleppten.
Ein Blutbad, dachte Tony, als eine stämmige Gestalt aus dem Flur auftauchte, die eine Feuerwehraxt schwang wie der grimmige Schnitter seine Sense. Seine Jeans und sein Polohemd waren blutbespritzt, und kleine Tropfen fielen bei jedem Schwung von der Klinge der Axt. Voll konzentriert verfolgte der kräftige Mann seine Beute auf ihrer Flucht. »Bring sie zu Ihm. Ihr könnt euch nicht verstecken«, murmelte er monoton mit leiser Stimme. »Bring sie zu Ihm. Ihr könnt euch nicht verstecken.« Er holte auf, noch zwei Schritte, und die Axt würde wieder Haut und Gewebe durchtrennen.
Obwohl der Mann mit der Axt nicht zu seinen Patienten gehörte, wusste Tony, wer es war. Er hatte sich extra Zeit genommen, um sich mit den Akten der Patienten vertraut zu machen, die als potenziell gewalttätig galten. Einerseits weil er sich dafür interessierte, andererseits aber auch, weil er das Gefühl hatte, sich dadurch eine Art Versicherung zu schaffen. Es sah aber so aus, als würde er heute Abend seinen Schadenfreiheitsrabatt verlieren.
Tony blieb ein paar Stufen vor dem Ende der Treppe stehen. »Lloyd«, rief er leise.
Allen hielt nicht inne, sondern schwang die Axt im Takt seines Mantras. »Bring sie zu Ihm. Ihr könnt euch nicht verstecken«, wiederholte er und fuhr mit der Schneide nur wenige Zentimeter von den Pflegern entfernt durch die Luft.
Tony holte tief Luft und nahm die Schultern zurück. »So bringen Sie sie nicht zu Ihm«, sagte er laut mit der ganzen Autorität, die er aufbieten konnte. »Das verlangt Er nicht von Ihnen, Lloyd. Das haben Sie falsch verstanden.«
Allen blieb stehen und drehte Tony das Gesicht zu. Er runzelte die Stirn wie ein Hund, der verwirrt eine Wespe betrachtet. »Es ist Zeit«, stieß er wütend hervor.
»Da haben Sie recht«, stimmte Tony zu und kam eine Stufe weiter herunter. »Es ist Zeit. Aber Sie gehen die Sache falsch an. Legen Sie Ihre Axt hin, und dann überlegen wir uns etwas Besseres.« Er bemühte sich, streng auszusehen und sich die Angst nicht anmerken zu lassen, die seinen Magen verkrampfte. Wo zum Teufel war nur das Bereitschaftsteam? Er machte sich keine Illusionen darüber, was er hier ausrichten konnte. Vielleicht würde es ihm gelingen, Allen so lange aufzuhalten, bis die Pfleger und der verwundete Helfer sich entfernt hatten. Aber so gut er auch mit Gestörten und Geisteskranken umgehen konnte, wusste er doch, dass es nicht ausreichen würde, um bei Lloyd Allen wieder so etwas wie ein seelisches Gleichgewicht herzustellen. Er hatte sogar Zweifel, ob er ihn auch nur dazu bringen konnte, seine Waffe niederzulegen. Aber er musste es versuchen, das war ihm klar. Verdammt – wo blieb bloß die Nottruppe?
Allen schwang die Axt jetzt nicht mehr in weiten Bögen, sondern hob sie schräg nach oben wie ein Baseballspieler, der zum Schlag ausholt. »Es ist Zeit«, sagte er wieder. »Und du bist nicht Er.« Und er überwand den Abstand zwischen ihnen beiden mit einem Sprung.
Er war so schnell, dass Tony nur einen roten Spalt und glattes Metall aufglänzen sah. Dann loderte der Schmerz in der Mitte seines Beins auf. Tony fiel um wie ein gefällter Baum, viel zu überrascht, um auch nur zu schreien. In seinem Kopf explodierte ein helles Licht. Dann war da nur noch Dunkelheit.
Liste 2
Belladonna
Rizin
Oleander
Strychnin
Kokain
Eibe
Sonntag
Thomas Denby studierte noch einmal das Krankenblatt. Er war ratlos. Bei Robbie Bishops erster Untersuchung hatte er eine schwere Infektion des Brustraums festgestellt und keinen Grund gehabt, diese Diagnose anzuzweifeln. In den zwanzig Jahren seit seiner Ausbildung und der Entscheidung, sich auf Krankheiten der Atemwege zu spezialisieren, hatte er genug Brustkorbinfektionen gesehen. In den zwölf Stunden seit der Einlieferung des Fußballspielers hatte Denbys Team seinen Anweisungen entsprechend Antibiotika und Steroide verabreicht. Aber Bishops Zustand hatte sich nicht gebessert, sondern sogar so sehr verschlechtert, dass die diensthabende Assistenzärztin das Risiko eingegangen war, sich Denbys Zorn zuzuziehen, indem sie seine Nachtruhe störte. Einfache Assistenzärzte machten so etwas nicht mit den Chefärzten, außer wenn sie sehr, sehr nervös waren.
Denby legte das Krankenblatt wieder beiseite und warf dem jungen Mann auf dem Bett nebenbei ein strahlendes, oberflächliches Lächeln zu. Seine Augen aber lächelten nicht, sondern unterzogen Bishops Gesicht und Oberkörper einer genauen Prüfung. Unter dem vom Fieberschweiß verklebten Klinikhemd zeichneten sich die Umrisse seiner starken Muskeln ab, die jetzt angestrengt arbeiteten, um Luft in seine Lungen zu pumpen. Als Denby ihn bei der Einlieferung untersucht hatte, klagte Bishop neben offensichtlichen Schwierigkeiten beim Atmen über Schwächegefühl, Übelkeit und Gelenkschmerzen. Er krümmte sich bei den Hustenanfällen zusammen, die so heftig waren, dass sein blasses Gesicht wieder Farbe annahm. Die Röntgenaufnahmen zeigten Flüssigkeit in der Lunge, und Denby hatte daraus die naheliegenden Schlüsse gezogen.
Aber jetzt begann das, was Robbie Bishop plagte, nicht mehr wie eine normale Infektion des Brustraums auszusehen. Seine Herzfrequenz war sehr ungleichmäßig, die Temperatur noch um anderthalb Grad gestiegen. Seine Lunge schaffte es nicht mehr, die Sauerstoffversorgung des Blutes stabil zu halten, nicht einmal mit Hilfe einer Sauerstoffmaske. Als Denby ihn jetzt betrachtete, flatterten die Augenlider und blieben dann geschlossen. Denby runzelte die Stirn. »Hat er vorher schon einmal das Bewusstsein verloren?«, fragte er die Assistenzärztin.
Sie schüttelte den Kopf. »Er hat wegen des Fiebers etwas phantasiert – ich bin mir nicht sicher, ob ihm klar ist, wo er sich befindet. Aber bis jetzt hat er auf Ansprache reagiert.«
Ein hartnäckiges Piepsen war zu hören, und auf dem Bildschirm zeigte sich ein neuer Tiefstand des Sauerstoffgehalts in Bishops Blut. »Wir müssen intubieren«, sagte Denby und klang zerstreut. »Und mehr Flüssigkeit. Ich glaube, er ist etwas dehydriert.« Allerdings würde das weder das Fieber noch den Husten erklären. Aktiviert von dieser Anweisung, eilte die Assistenzärztin sofort aus dem kleinen Zimmer, das das beste war, was das Bradfield Cross Hospital für diese Fälle zu bieten hatte, die auch in der äußersten Notsituation ihre Privatsphäre brauchten. Denby rieb sich grübelnd das Kinn. Robbie Bishop hatte über eine Spitzenkondition verfügt, fit und stark, und laut seinem Mannschaftsarzt war sein Befinden nach dem Training am Freitag einwandfrei gewesen. Am Samstag hatte er nicht mitgespielt, weil der gleiche Arzt nach einer Untersuchung zuerst eine Art Grippevirus vermutete. Jetzt, achtzehn Stunden später, lag er hier, und sein Zustand verschlechterte sich zusehends. Und Thomas Denby hatte weder eine Ahnung, warum, noch, wie er dies aufhalten könnte.
An eine solche Situation war er nicht gewöhnt. Er wusste, dass er ein verdammt guter Arzt war. Als geschickter Diagnostiker sowie kluger und oft einfallsreicher Kliniker hatte er auch genug diplomatisches Talent, um dafür sorgen zu können, dass die Bürokraten die Bedürfnisse seiner Station nicht oft übergingen. So segelte er erfolgreich durch sein Berufsleben, und es geschah nur selten, dass die Gebrechen seiner Patienten ihm zu denken gaben. Robbie Bishop kam ihm angesichts seiner Fähigkeiten wie ein Affront vor.
Als die Assistenzärztin mit dem Intubationsbesteck und zwei Schwestern zurückkam, seufzte Denby. Er warf einen Blick auf die Tür. Auf der anderen Seite wartete, wie er wusste, Robbie Bishops Teammanager. Martin Flanagan hatte die Nacht auf einem Stuhl zusammengesunken neben seinem Starspieler verbracht. Sein teurer Anzug war jetzt zerknittert, der Anflug von Bartstoppeln ließ sein knorriges Gesicht finster erscheinen. Sie waren sich schon in die Haare geraten, als Denby darauf bestanden hatte, dass der kampflustige Nordire den Raum verlassen solle, während sich die Ärzte besprachen. »Haben Sie eine Ahnung, wie viel der Junge Bradfield Victoria wert ist?«, hatte Flanagan gefragt.
Denby hatte ihn mit kaltem Blick gemustert. »Er ist mir genau das Gleiche wert wie jeder andere Patient, den ich behandle«, hatte er entgegnet. »Und ich sitze ja auch nicht an der Seitenlinie und gebe Ihnen Ratschläge, welche Taktik Sie anwenden sollen. Lassen Sie mich also meine Arbeit machen, ohne sich einzumischen. Ich verlange, dass Sie meinem Patienten seine Intimsphäre lassen, wenn ich ihn untersuche.« Der Manager war schimpfend gegangen, aber Denby wusste genau, dass er trotzdem mit sorgenvollem und angsterfülltem Gesicht warten würde, weil er unbedingt etwas hören wollte, das im Gegensatz zu der Verschlimmerung stand, von der er schon etwas mitbekommen hatte.
»Wenn Sie damit fertig sind, geben wir ihm Azidothymidin«, sagte er zu seiner Assistenzärztin. Ihm blieb nichts mehr außer diesem starken retroviralen Medikament, das ihnen vielleicht genug Zeit verschaffen würde, herauszubekommen, was Robbie Bishop fehlte.
Montag
Sag mir noch mal, wieso ich dir erlaubt habe, diese dritte Flasche zu öffnen«, seufzte Chief Inspector Carol Jordan, legte den Gang ein und fuhr langsam ein paar Meter weiter.
»Weil es seit deinem Umzug in die Yorkshire Dales das erste Mal war, dass du uns mit einem Besuch beehrt hast, und weil ich heute früh in Bradfield sein muss und du kein richtiges Gästezimmer hast. Deshalb brachte es nichts, gestern Nacht noch zurückzufahren.« Ihr Bruder Michael beugte sich vor und drehte an den Radioknöpfen. Carol schlug ihm auf die Hand.
»Lass das«, sagte sie.
Michael stöhnte. »Bradfield Sound. Wer hätte gedacht, dass ich so etwas je erleben würde? Lokalradio aus der tiefsten Provinz.«
»Ich muss hören, was sich in meinem Bezirk tut.«
Michael war skeptisch. »Du leitest die Sondereinsatzzentrale. Du bist der britischen Version des FBI angeschlossen. Du musst doch nicht wissen, ob ein Wasserrohrbruch den Verkehr auf dem Methley Way aufhält. Oder dass irgendein Fußballer mit Atemwegsproblemen ins Krankenhaus eingeliefert wurde.«
»Hey, Mr. IT. Du warst das doch, der mir den Spruch ›Mikro wird zu Makro‹ beigebracht hat, oder? Ich weiß gern Bescheid über das, was sich ganz unten tut, weil es manchmal unerwartete Ereignisse am anderen Ende auslöst. Und er ist nicht ›irgendein Fußballer‹, sondern Robbie Bishop, der Stratege des Mittelfelds von Bradfield Victoria. Noch dazu ein Junge von hier. Seine weiblichen Fans belagern schon das Bradfield-Cross-Krankenhaus. Möglicherweise Verstöße gegen die öffentliche Ordnung.«
Schmollend gab Michael auf. »Was auch immer. Mach doch, was du willst, Schwesterchen. Gott sei Dank, dass man den Sender nicht weit außerhalb der Stadt empfangen kann. Ich wäre verrückt geworden, wenn du mich gezwungen hättest, mir das auf dem ganzen Weg hierher anzuhören.« Er machte kreisende Bewegungen mit seinem Kopf und zuckte, wenn es krachte. »Hast du nicht so ’n Blaulicht, das du aufs Dach setzen kannst?«
»Doch«, gab Carol zurück, kam im Verkehr etwas weiter voran und betete, dass er diesmal in Bewegung bleiben würde. Sie fühlte sich trotz der Dusche, die sie vor weniger als einer halben Stunde genommen hatte, verschwitzt, und ihr war leicht übel. »Aber ich soll es nur im Notfall benutzen. Und denk erst gar nicht dran: Nein, dies hier ist kein Notfall. Es ist nur der Berufsverkehr.«
Während sie noch sprach, löste sich plötzlich der Stau auf, und der Verkehr begann zu fließen. Nach den nächsten zweihundert Metern war es schon nicht mehr ersichtlich, warum es eigentlich zwanzig Minuten gedauert hatte, um achthundert Meter zurückzulegen, da doch jetzt alles relativ glattlief.
Michael runzelte leicht die Stirn, betrachtete seine Schwester und sagte dann: »Also, Schwesterchen, wie läuft’s denn mit Tony?«
Carol bemühte sich, ihre Gereiztheit zu verbergen. Sie hatte gedacht, sie wäre noch mal davongekommen. Ein ganzes Wochenende mit ihren Eltern, ihrem Bruder und seiner Partnerin, ohne dass einer von ihnen den Namen erwähnt hatte. »Eigentlich ganz gut. Ich mag die Wohnung. Er ist ein sehr guter Vermieter.«
Michael schüttelte den Kopf. »Du weißt doch, dass ich das nicht gemeint habe.«
Carol seufzte und schob sich vor einen Mercedes, der sie jetzt anhupte. »Wir haben uns wahrscheinlich öfter gesehen, als wir noch in entgegengesetzten Stadtteilen wohnten«, erzählte sie.
»Ich dachte …«
Ihre Hände hielten das Steuerrad fest umfasst. »Da hast du falsch gedacht, Michael, wir sind beide Workaholics. Er liebt seine Verrückten, und ich hatte ein neues Team auf Trab zu bringen. Ganz zu schweigen davon, dass ich versuchen musste, Paula wieder auf die Beine zu helfen«, fügte sie hinzu, und ihr Gesichtsausdruck wirkte beim Gedanken daran angespannt.
»Das ist schade.« Der Blick, den er ihr zuwarf, war kritisch.
»Wenn ich vom Zusammensein mit Lucy etwas gelernt habe, dann ist es, dass das Leben um einiges leichter ist, wenn man den Alltag mit jemandem auf der gleichen Wellenlänge teilt. Und ich glaube, du und Tony Hill – ihr seid das.«
Carol riskierte einen kurzen Blick, ob er sich über sie lustig machte.
»Der Mann, der einmal sozusagen fast glaubte, du könntest ein Serienmörder sein? Du meinst, der Mann sei auf einer Wellenlänge mit mir?«
Michael rollte mit den Augen. »Hör auf, dich hinter der Vergangenheit zu verstecken.«
»Es geht nicht ums Verstecken. Bei einer Vergangenheit wie der unsrigen, da braucht man Steigeisen und Sauerstoff, um sie zu überwinden.« Carol fand eine Lücke im Verkehrsfluss und fuhr mit blinkender Warnleuchte an den Gehweg heran. »Und hier ist die Stelle, wo du losrennen musst«, erklärte sie in einer nicht besonders guten Shrek-Imitation.
»Hier willst du mich absetzen?« Michael klang ziemlich empört.
»Um zur Vorderseite des Instituts zu kommen, brauche ich zehn Minuten«, sagte Carol und zeigte an ihm vorbei aus dem Beifahrerfenster. »Wenn du einfach durch die neue Einkaufspassage gehst, bist du in drei Minuten bei deinem Kunden.«
»Ach Gott, du hast ja recht. Jetzt sind wir gerade mal drei Monate von der Stadt weg, und schon habe ich das alles nicht mehr im Kopf.« Er legte ihr einen Arm um die Schultern, gab ihr einen kleinen Kuss und stieg dann aus. »Wir sprechen uns in ’ner Woche.«
Zehn Minuten später betrat Carol das Polizeipräsidium von Bradfield. In der kurzen Zeit, die zwischen dem Absetzen von Michael und dem Betreten des dritten Stocks lag – hier hatte das Team seinen Sitz, das sie für eine Ansammlung chaotischer Originale hielt –, hatte sie die Verwandlung von der Schwester zur Polizeibeamtin vollzogen. Das einzige Element, das die beiden Figuren gemeinsam hatten, war der leichte Kater.
Sie ging den Korridor entlang, dessen lavendelfarben und weißgetönte Wände von Türen aus Stahl und Glas unterbrochen wurden. Der mittlere Teil der Scheiben war so mattiert, dass nur schwer Einzelheiten des Geschehens dahinter zu erkennen waren, es sei denn, es spielte sich am Boden ab oder irgendetwas hing von der Decke herunter. Die aufgebretzelten Räume erinnerten sie an eine Werbeagentur. Aber andererseits schien die moderne Polizeiarbeit oft genau so viel mit Imagepflege zu tun zu haben wie mit der Jagd auf Schurken. Gott sei Dank hatte sie in ihrem Berufsalltag so nah an der konkreten Wirklichkeit bleiben können, wie es bei einer Beamtin ihres Ranges möglich war.
Sie stieß die Tür zu Zimmer dreihundertsechzehn auf und betrat das Land der Toten und Geschädigten. So früh am Montagmorgen waren die Lebenden dünn gesät. Detective Constable Stacey Chen, die IT-Alleskönnerin des Teams, sah kaum von ihren zwei Bildschirmen auf ihrem Schreibtisch auf und brummte etwas, das Carol als Morgengruß interpretierte. »Morgen, Stacey«, erwiderte Carol. Als sie durch das Büro ging, trat Detective Sergeant Chris Devine hinter einer der langen weißen Tafeln hervor, die wie Planwagen um ihre Tische herumstanden, um Deckung vor dem Feind zu bieten. Verblüfft blieb Carol stehen. Chris hielt beschwichtigend die Hand hoch.
»’tschuldigung, Chefin, wollte Sie nicht erschrecken.«
»Nicht weiter schlimm.« Carol seufzte leise auf. »Wir sollten wirklich diese durchsichtigen Tafeln kriegen.«
»Was? Solche wie im Fernsehen?« Chris schnaubte leicht. »Darin seh ich keinen Sinn. Ich finde immer, dass man das Geschriebene darauf sauschlecht lesen kann. Alles im Hintergrund stört.« Sie ging neben Carol auf den Glaskubus zu, der ihr als Büro diente. »Was gibt’s Neues von Tony? Wie geht’s ihm?«
Das war ja eine merkwürdige Ausdrucksweise, dachte Carol. Sie zuckte leicht mit den Schultern und sagte: »Soweit ich weiß, geht’s ihm gut.« Ihr Tonfall zeigte an, dass sie das Thema nicht weiter verfolgen wollte.
Chris drehte sich schnell um, stand nun Carol gegenüber und prüfte den Gesichtsausdruck ihrer Chefin. »Oh mein Gott, Sie wissen es noch gar nicht, oder?«
»Was weiß ich nicht?« Carol spürte, wie ihr Magen sich panisch zusammenzog.
Chris legte Carol eine Hand auf den Arm, deutete mit einer Kopfbewegung auf ihr Büro und sagte: »Ich glaube, wir sollten uns setzen.«
»Mein Gott«, entfuhr es Carol, und sie ließ sich hineinführen. Während Chris die Tür schloss, trat sie auf ihren Stuhl zu. »Ich war doch nur in den Yorkshire Dales, nicht am Nordpol. Was war denn hier los? Was ist mit Tony passiert?«
Chris ging auf ihre erschrockene Frage ein. »Er ist angegriffen worden. Von einem der Insassen in Bradfield Moor.«
Carol hob die Hände vors Gesicht und formte ihren Mund zu einem O. Sie atmete tief ein. »Was ist passiert?«, fragte sie mit erhobener Stimme, fast schreiend.
Chris fuhr sich durch ihr kurzes, graugesprenkeltes Haar. »Man kann es nicht schonender sagen, Chefin. Er kam einem Verrückten mit einer Feuerwehraxt in die Quere.«
Chris’ Stimme klang, als käme sie von weit her. Zwar hatte sich Carol an den Anblick von Szenen gewöhnt, die bei den meisten Menschen Heulen und Zähneklappern auslösen würden. Aber wenn es um Tony Hill ging, nützte ihr diese Erfahrung nichts, er war ihr wunder Punkt. Sie mochte dies zwar abstreiten, aber in Augenblicken wie diesen war alles anders. »Was …?« Ihre Stimme versagte. Sie räusperte sich. »Wie schlimm ist es?«
»Nach dem, was ich gehört habe, ist sein Bein ziemlich lädiert. Er hat eins aufs Knie bekommen. Hat ’ne Menge Blut verloren. Es hat eine Weile gedauert, bis die Sanitäter an ihn rankamen, weil der Irre mit der Axt noch unterwegs war«, berichtete Chris.
So schlimm dies auch sein mochte, war es doch weniger schrecklich als das, was ihre Phantasie in Sekundenschnelle bereits heraufbeschworen hatte. Blutverlust und ein zerschmettertes Knie, das ließ sich bewältigen. Eigentlich nicht so schlimm, wenn man es im größeren Zusammenhang betrachtete. »Herrgott«, sagte Carol erleichtert aufatmend. »Was ist denn passiert?«
»Ich habe gehört, dass einer der Insassen einen Helfer überwältigt hat, er nahm ihm den Schlüssel ab und ist auf seinem Kopf herumgetrampelt, dann ist er ins Hauptgebäude des Krankenhauses eingedrungen, wo er eine Scheibe einschlug und sich die Axt griff.«
Carol schüttelte den Kopf. »Sie haben dort Feuerwehräxte in Bradfield Moor? In einem speziell gesicherten Krankenhaus für psychiatrische Fälle?«
»Anscheinend genau deshalb. Weil es sicher ist. Viele verschlossene Türen und Sicherheitsglas mit Drahtverstärkung. Die Vorschriften besagen, dass man im Fall eines Brandes oder eines Versagens der elektronischen Schließanlage in der Lage sein muss, die Patienten herauszuholen.« Chris schüttelte den Kopf. »Blödsinn, wenn Sie mich fragen.« Bei Carols mahnendem Gesichtsausdruck breitete sie resigniert die Hände aus. »Ja, na ja. Besser, so ein paar verrückte Mistkerle verbrennen als so ’n Desaster. Ein Helfer tot, ein weiterer auf der Liste mit kritischen inneren Verletzungen, die nie wieder ganz ausheilen werden, und Tony zusammengeschlagen. Ich würde lieber ein paar mordlustige Spinner loswerden, um so etwas zu vermeiden.« Dieser Gefühlsausbruch wurde durch Chris’ starken Cockney-Akzent noch verstärkt.
»Es gibt hier kein Entweder-oder, das wissen Sie doch, Chris«, erinnerte sie Carol. Obwohl ihre eigene spontane Reaktion ähnlich war wie die ihres Sergeants, wusste Carol, dass hier mehr die Emotionen sprachen als der gesunde Menschenverstand. Aber heutzutage sagten nur Leichtsinnige und Unbedachte ihre Meinung so offen am Arbeitsplatz. Carol mochte ihre Außenseiter. Sie wollte keinen dadurch verlieren, dass falsche Ohren es mitbekamen, wenn sie sich Luft machten. Deshalb bemühte sie sich, ihre schlimmsten Ausraster zu mäßigen. »Wie wurde Tony da hineingezogen?«, erkundigte sie sich. »War es einer seiner Patienten?«
Chris zuckte mit den Schultern. »Weiß nicht. Anscheinend war er aber der Held der Stunde. Hat den übergeschnappten Kerl abgelenkt, damit zwei Pfleger den verwundeten Helfer in sichere Entfernung ziehen konnten.«
Aber nicht weit genug, um sich selbst zu retten. »Warum hat mich niemand benachrichtigt? Wer hatte dieses Wochenende Dienst? Sam, oder?«
Chris schüttelte den Kopf. »Sam sollte Dienst haben, aber er hat mit Paula getauscht.«
Carol sprang auf und öffnete die Tür. Als sie sich im Raum umschaute, sah sie Detective Constable Paula McIntyre, die gerade ihren Mantel aufhängte. »Paula? Bitte kommen Sie mal einen Moment rein«, rief sie. Als die junge Beamtin durch den Raum schritt, spürte Carol das wohlbekannte Schuldgefühl in sich aufkommen.
Vor nicht allzu langer Zeit hatte sie Paula in eine gefährliche Situation gebracht, und diese war dabei zu Schaden gekommen. Zwar war es eine offiziell abgesegnete Aktion gewesen, aber Carol war diejenige gewesen, die versprochen hatte, Paula zu schützen, und sie hatte versagt. Der doppelt schwere Schlag dieser misslungenen Aktion und des Verlusts der Kollegin, mit der sie am engsten zusammengearbeitet hatte, brachte Paula fast dazu, ihre Karriere bei der Polizei aufzugeben. Carol kannte diese Situation. Auch sie hatte das erlebt und unheimlicherweise aus ganz ähnlichen Gründen. Sie hatte Paula jede nur mögliche Unterstützung angeboten, aber schließlich war es Tony gewesen, der sie vom Abgrund wieder zurückholte. Carol hatte keine Ahnung, was zwischen ihnen geschehen war. Aber für Paula war es dadurch möglich geworden, ihren Beruf als Polizistin wiederaufzunehmen. Und dafür war Carol dankbar, selbst wenn das bedeutete, dass sie auf diese Weise ständig an ihr eigenes Versagen erinnert wurde.
Carol trat zur Seite, um Paula Platz zu machen, und ging dann wieder zu ihrem Stuhl zurück. Paula lehnte sich an die Glaswand, die Arme verschränkt, als könne sie so verbergen, wie viel sie abgenommen hatte. Ihr dunkelblondes Haar sah aus, als hätte sie vergessen, sich nach dem Trockenrubbeln zu kämmen, und ihre dunkelgraue Hose und der Pullover hingen beide zu weit an ihr herunter. »Wie geht es Tony?«, fragte sie.
»Ich weiß es nicht, weil ich gerade erst von dem Angriff auf ihn gehört habe«, entgegnete Carol vorsichtig, um es nicht anklagend klingen zu lassen.
Paula war niedergeschmettert. »So ein Mist«, stöhnte sie. »Ich kam gar nicht drauf, dass Sie es nicht wissen könnten.« Sie schüttelte frustriert den Kopf. »Man hat mich nicht mal von dort angerufen. Ich hab es erst gehört, als ich am Samstagvormittag die Fernsehnachrichten angeschaltet habe. Ich habe einfach angenommen, dass irgendjemand Sie anrufen wird …« Sie verstummte bestürzt.
»Niemand hat mich angerufen. Ich war zu einem Familienwochenende mit meinem Bruder und meinen Eltern in den Dales. Deshalb hatten wir weder den Fernseher noch ein Radio eingeschaltet. Wissen Sie, in welcher Klinik er liegt?«
»Im Bradfield Cross«, antwortete Paula. »Am Samstag wurde sein Knie operiert. Ich hab nachgefragt. Man sagte mir, er hätte die Operation gut überstanden und sei ohne Beschwerden.«
Carol stand auf und packte ihre Tasche. »Gut. Wenn ihr mich braucht, bin ich dort. Ich nehme an, es ist über Nacht nichts Neues hereingekommen, um das wir uns kümmern müssten?«
Chris schüttelte den Kopf. »Nichts Neues.«
»Umso besser. Wir haben sowieso genügend andere Fälle.« Sie klopfte Paula im Vorbeigehen auf die Schulter. »Ich wäre von der gleichen Annahme ausgegangen«, beruhigte sie sie und ging hinaus. Aber ich hätte trotzdem nachgefragt.
Trockener Mund. Zu trocken, um zu schlucken. Das war ungefähr der komplizierteste Gedanke, der seinen mit Watte angefüllten Kopf durchdringen konnte. Seine Augendeckel zuckten.
Er hatte eine dunkle Ahnung, dass es keine gute Idee wäre, sie zu öffnen, und dass es einen Grund dafür gab, aber er konnte sich nicht an ihn erinnern. Er war nicht einmal sicher, ob er sich auf diese unklare Warnung aus seinem Gehirn verlassen konnte. Was konnte so schlimm daran sein, die Augen aufzumachen? Die Leute taten es doch ständig, und es passierte ihnen nichts Schlimmes.
Die Antwort kam mit schwindelerregender Schnelligkeit. »Wurde ja auch Zeit«, versetzte die schnippische Stimme von irgendwo hinter seinem linken Ohr. Ihr scharfer, kritischer Ton war ihm vertraut, aber nur aus der Vergangenheit. Sie schien zu dem zusammenhanglosen Eindruck, der ihm von seinem jetzigen Leben geblieben war, nicht so recht zu passen.
Tony rollte den Kopf zur Seite. Diese Bewegung ließ einen Schmerz wiederaufflammen, den er nicht genau orten konnte. Es kam ihm wie ein allgemeines Schmerzgefühl im ganzen Körper vor. Er stöhnte und öffnete die Augen. Und erinnerte sich daran, warum es besser gewesen wäre, sie geschlossen zu lassen.
»Wenn ich schon hier sein muss, könntest du dich wenigstens mit mir unterhalten.« Ihr Mund presste sich zu dem missbilligenden Strich zusammen, den er so gut kannte. Sie klappte ihren Laptop zu, stellte ihn neben sich auf den Tisch und schlug die mit einer Hose bekleideten Beine übereinander. Ihre Beine hatte sie nie gemocht, dachte Tony dabei völlig sinnlos.
»Tut mir leid«, krächzte er. »Ich glaube, es kommt von den Medikamenten.« Er streckte die Hand nach dem Glas Wasser auf seinem Tablett aus, konnte es aber nicht erreichen. Sie machte keine Bewegung. Er versuchte, sich hochzuziehen und aufzusetzen, und vergaß dabei dummerweise, weshalb er in einem Krankenhausbett lag. Sein linkes Bein bewegte sich, durch eine dicke Gipsschiene beschwert, nur ein winziges bisschen, dies tat aber so unverhältnismäßig weh, dass er aufstöhnte. Mit dem Schmerz kam die Erinnerung. Lloyd Allen, der sich auf ihn stürzte und etwas schrie, das er nicht verstand. Das Aufblitzen von Licht auf blauem Stahl. Ein Moment lähmender Schmerzempfindung, dann nichts mehr. Danach Bewusstseinsfetzen, Ärzte, die über ihn sprachen, Schwestern, die sich über ihn beugten und redeten, ein Fernseher, der auf ihn einquatschte. Und sie, die Gereiztheit und Ungeduld ausstrahlte. »Wasser?«, schaffte er hervorzustoßen und war nicht sicher, ob sie ihm den Gefallen tun würde.
Sie seufzte, gereizt wie eine Frau, die weidlich ausgenutzt wird, hob dann das Glas Wasser und richtete den Halm auf seine trockenen Lippen, damit er trinken konnte, ohne sich aufsetzen zu müssen. Er sog das Wasser in kleinen Schlucken auf und genoss es, dass sich wieder Feuchtigkeit in seinem Mund ausbreitete. Einsaugen, auskosten und schlucken. Er wiederholte das, bis er das Glas halbleer getrunken hatte, dann ließ er den Kopf aufs Kissen zurückfallen. »Du brauchst nicht hier zu sitzen«, sagte er. »Mir geht’s gut.«
Sie schnaubte. »Du glaubst doch nicht etwa, dass ich aus freien Stücken hier bin. Das Bradfield Cross ist einer meiner Kunden.«
Dass sie ihn immer noch so brutal enttäuschen konnte, war keine Überraschung, aber trotzdem tat es weh. »Um den Schein zu wahren, was?«, meinte er und konnte einen bitteren Tonfall nicht unterdrücken.
»Wenn mein Einkommen und mein Ruf auf dem Spiel stehen? Darauf kannst du wetten.« Sie sah ihn mürrisch an, und die Augen, die seinen so ähnlich waren, wurden schmal, als sie ihn einschätzend taxierte. »Tu nicht so, als seist du dagegen, Tony. Wenn es darum geht, den Schein zu wahren, könntest du England bei den Olympischen Spielen vertreten. Ich wette, keiner deiner Kollegen hat einen blassen Schimmer, was in deinem schmuddeligen Köpfchen vorgeht.«
»Ich hatte eine gute Lehrmeisterin.« Er wandte den Blick ab und gab vor, das Morgenmagazin im Fernsehen anzusehen.
»Also gut, wir brauchen ja nicht zu reden. Ich habe Arbeit und bin mir sicher, wir können dir etwas zu lesen bringen lassen. Ich bleibe einen oder zwei Tage, nur so lange, bis du wieder auf den Beinen bist. Dann werd ich dir nicht mehr im Weg sein.« Er hörte, wie sie sich zurechtsetzte und dann etwas auf den Tasten tippte.
»Wie hast du es erfahren?«, fragte er.
»Anscheinend bin ich in deiner Personalakte als nächste Verwandte eingetragen. Entweder hast du sie in den letzten zwanzig Jahren nie aufs Laufende gebracht, oder du bist immer noch der Einzelgänger, der du schon immer warst. Und so eine gewiefte Oberschwester hat mich erkannt, als ich reinkam. Jetzt sitze ich also hier fest, solange der Anstand es verlangt.«
»Ich hatte keine Ahnung, dass du irgendeine Verbindung zu Bradfield hast.«
»Hast gedacht, hier wärst du sicher, was? Aber anders als du, Tony, bin ich erfolgreich. Ich habe überall im Land Verbindungen. Das Geschäft läuft auf Hochtouren.« Wenn sie angab, wurde ihr Gesichtsausdruck milder.
»Du brauchst wirklich nicht hierzubleiben. Ich sage ihnen, ich hätte dich weggeschickt.« Er sprach schnell, die Worte überschlugen sich bei dem Versuch, sich so wenig wie möglich beim Sprechen anzustrengen.
»Und warum sollte ich glauben, dass du die Wahrheit über mich sagen wirst? Nein, danke. Ich werde meine Pflicht tun.«
Tony starrte die Wand an. Gab es in der englischen Sprache einen deprimierenderen Satz?
Elinor Blessing rührte die Schlagsahne mit einem Holzstab in ihren Mokka. Starbucks war vom Hintereingang des Bradfield Cross Hospital zwei Minuten zu Fuß entfernt, und sie meinte, auf dem Gehweg müssten die vielen Schuhe junger Ärzte, die mit Koffein den Schlaf abwehrten, eine Furche hinterlassen haben. Aber heute Vormittag bemühte sie sich nicht, wach zu bleiben, sondern wollte nur nicht im Weg sein.
Eine senkrechte Falte erschien zwischen ihren Brauen, und ihre grauen Augen starrten in die Ferne. Ihre Gedanken überschlugen sich, während sie überlegte, was sie tun sollte. Sie war schon so lange Thomas Denbys Assistenzärztin, dass sie inzwischen eine ziemlich klare Meinung von ihm hatte. Er war wahrscheinlich der beste Diagnostiker, mit dem sie je zusammengearbeitet hatte, und ergänzte dies durch gründliche klinische Behandlung. Anders als viele andere Chefärzte, die sie gekannt hatte, schien er es nicht nötig zu haben, sein Ego zu pflegen, indem er untergeordnete Ärzte und Studenten zur Schnecke machte. Er ermutigte sie, bei der Visite eine aktive Rolle zu spielen. Wenn seine Studenten seine Fragen beantworten konnten, schien er sich zu freuen, und war enttäuscht, wenn die Antwort falsch war. Die Enttäuschung war ein besserer Ansporn zum Lernen als Sarkasmus und Demütigung, die viele seiner Kollegen austeilten.
Aber Denby stellte im Allgemeinen – wie ein guter Anwalt – immer Fragen, auf die er die Antworten bereits wusste. Würde er genauso großzügig sein, wenn einer seiner Untergebenen die Antwort auf ein Problem hatte, das er nicht hatte lösen können? Würde er der Person danken, die den glatten Ablauf seiner Visite mit einem Vorschlag unterbrach, den er noch nicht in Betracht gezogen hatte? Besonders wenn sich herausstellen sollte, dass sie recht hatte?
Man konnte argumentieren, dass er erfreut sein sollte, egal wer die Theorie vertrat. Die Diagnose war der erste Schritt auf dem Weg, dem Patienten zu helfen. Außer wenn es eine ausweglose Diagnose war. Unheilbar, heikel, unmöglich zu behandeln. Niemand wünschte sich diese Art von Diagnose.
Besonders wenn der Patient Robbie Bishop war.
Es hatte für Carol etwas Entmutigendes, sich in einem Krankenhaus so gut auszukennen. Aus dem einen oder anderen Grund war sie durch ihre berufliche Tätigkeit mit allen wichtigen Abteilungen des Bradfield Cross vertraut. Der einzige Vorteil daran war, zu wissen, welchen der überfüllten Parkplätze sie am besten ansteuern sollte.
Die Frau, die im Schwesternzimmer der chirurgischen Männerabteilung Dienst hatte, erkannte sie. Ihre Pfade hatten sich schon mehrfach während der Operation und Wiederherstellung eines Vergewaltigers gekreuzt, dessen Opfer es unfassbarerweise geschafft hatte, sein Messer gegen ihn zu erheben. Seine Schmerzen hatten ihnen beiden ein gewisses Vergnügen bereitet. »Sie sind Inspector Jordan, nicht wahr?«, sagte sie.
Carol bemühte sich nicht, sie zu verbessern. »Stimmt. Ich suche einen Patienten, der Hill heißt. Tony Hill.«
Die Schwester schien überrascht. »Sie sind doch etwas zu weit oben in der Hackordnung, um Aussagen aufzunehmen.«
Carol überlegte kurz, wie sie ihre Beziehung zu Tony beschreiben sollte. »Kollege« genügte nicht, »Vermieter« war irgendwie irreführend, und »Freund« war zugleich zu viel und zu wenig, um wahr zu sein. Sie zuckte mit den Schultern. »Er füttert meinen Kater.«
Die Schwester kicherte. »So einen brauchen wir alle.« Sie zeigte rechts den Korridor entlang. »An den Vierbettzimmern vorbei, da ist eine Tür auf der linken Seite. Dort liegt er.«
Während Angst an Carol wie eine Ratte an einem Knochen nagte, folgte sie der Wegbeschreibung. Vor der Tür blieb sie stehen. Was würde geschehen? Was würde sie vorfinden? Sie hatte wenig Erfahrung im Umgang mit körperlichen Gebrechen anderer Menschen. Aus eigener Erfahrung wusste sie, dass sie bei Schmerzen auf keinen Fall Leute, die ihr wichtig waren, um sich haben wollte. Deren offensichtlicher Kummer verursachte ihr Schuldgefühle, und sie mochte es nicht, die eigene Verletzlichkeit so offen zeigen zu müssen. Sie hätte wetten können, dass Tony ähnlich fühlte, und rief sich eine frühere Gelegenheit ins Gedächtnis zurück, bei der sie ihn im Krankenhaus besucht hatte. Damals hatten sie sich noch nicht gut gekannt, aber sie erinnerte sich, dass es nicht gerade ein gemütliches Treffen gewesen war. Nun ja, wenn sich herausstellte, dass er allein sein wollte, würde sie nicht bleiben. Nur kurz reinschauen, damit er wusste, dass sie Anteil nahm, und sich dann freundlich verabschieden, nicht ohne dafür zu sorgen, dass er wusste, sie würde auf seinen Wunsch hin wiederkommen.
Tief einatmen, dann klopfen. Danach die vertraute Stimme, etwas undeutlich. »Kommen Sie, wenn Sie den Stoff haben.« Carol grinste. Also nicht so schlimm. Sie stieß die Tür auf und ging rein.
Sofort war sie sich darüber im Klaren, dass noch jemand anderes im Zimmer war, aber zunächst hatte sie nur Augen für Tony. Der Dreitagebart betonte das Grau seiner Haut. Er sah aus, als hätte er abgenommen, was er sich nicht leisten konnte. Aber die Augen waren hell, und sein Lächeln schien echt. Eine merkwürdige Konstruktion aus Streckapparaten und Seilen hielt sein Knie in der Gipsschiene in einem Winkel fixiert, der nicht gerade bequem aussah. »Carol«, setzte er an, wurde aber unterbrochen.
»Sie müssen die Freundin sein«, sagte die Frau, die in der Ecke saß, mit schwachem, aber erkennbar hiesigem Dialekt. »Wieso hat das so lang gedauert?« Carol sah sie überrascht an. Sie schien Anfang sechzig, gut erhalten, da es ihr recht geschickt gelungen war, sich die Jahre vom Leib zu halten. Das Haar war sorgfältig goldbraun gefärbt, das Make-up untadelig, aber dezent. Ihre blauen Augen blickten berechnend, und die sichtbaren Fältchen wiesen nicht auf einen gütigen und großzügigen Charakter hin. Sie war eher dünn als schlank und trug ein Business-Kostüm mit einem Schnitt von überdurchschnittlicher Klasse. Jedenfalls deutlich aufwendiger als das, was Carol sich für ein Kostüm zu zahlen leisten konnte.
»Wie bitte?«, fragte Carol zurück. Es kam nicht oft vor, dass man sie auf dem falschen Fuß erwischte, denn selbst Schurken waren selten so ungehobelt.
»Sie ist nicht meine Freundin«, warf Tony ein, und seine Gereiztheit war ihm anzumerken. »Das ist Detective Chief Inspector Carol Jordan.«
Die Frau hob die Augenbrauen. »Da wär ich nie draufgekommen.« Ihrem dünnen Lächeln fehlte jeder Humor. »Was die Rolle als Freundin betrifft, meine ich, nicht, dass Sie bei der Polente sind. Denn was hat schließlich eine hochrangige Polizistin mit diesem unbrauchbaren Subjekt hier zu schaffen, außer um ihn festzunehmen.«
»Mutter«, stieß Tony wütend zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. An Carol gewandt zog er ein Gesicht, das eine Mischung aus Frust und der Bitte um Verzeihung war. »Carol, das ist meine Mutter. Carol Jordan, Vanessa Hill.«
Keine der beiden Frauen schickte sich an, der anderen die Hand zu reichen. Carol unterdrückte ihre Überraschung. Sie hatten zwar nie viel über ihre Familien gesprochen, aber sie hatte eindeutig den Eindruck gehabt, dass Tonys Mutter nicht mehr lebte. »Freut mich, Sie kennenzulernen«, sagte Carol. Sie wandte sich wieder an Tony: »Wie geht’s dir?«
»Bis oben vollgepumpt mit Medikamenten. Aber heute kann ich wenigstens länger als fünf Minuten wach bleiben.«
»Und das Bein? Was sagen sie dazu?« Während sie sprach, bemerkte sie, dass Vanessa Hill ihren Laptop in eine bunte Neoprentasche packte.
»Es ist anscheinend ein einfacher, gerader Bruch. Die Ärzte haben ihr Bestes getan, den Knochen wieder zusammenzufügen …« Er verstummte. »Mutter, gehst du?«, fragte er, als Vanessa mit dem Mantel über dem Arm und der Handtasche sowie dem Laptop über der Schulter am Fußende des Bettes vorbeikam.
»Ganz recht, ich gehe. Du musst dich ja jetzt um dein Mädchen kümmern. Da bin ich fein raus.« Sie ging auf die Tür zu.
»Sie ist nicht meine Freundin«, rief Tony. »Sie ist meine Mieterin, meine Kollegin und mit mir befreundet. Und sie ist eine Frau, kein Mädchen.«
»Was auch immer«, entgegnete Vanessa. »Jetzt lasse ich dich ja nicht mehr im Stich. Du bist in guten Händen. Der Unterschied wird für die Schwestern offenkundig sein.« Sie deutete ein Winken an und verschwand.
Carol starrte der Frau mit offenem Mund nach. »Verdammt noch mal«, meinte sie und wandte sich wieder Tony zu. »Ist sie immer so?«
Er ließ den Kopf aufs Kissen zurückfallen und wich ihrem Blick aus. »Bei anderen Leuten wahrscheinlich nicht«, antwortete er matt. »Sie hat eine sehr erfolgreiche Personalagentur. Man kann es kaum glauben, aber sie wirkt bei Personalentscheidungen mit und organisiert die Ausbildung in einigen Spitzenunternehmen des Landes. Ich glaube, ich bewirke, dass sie ihre schlechteste Seite zeigt.«
»Ich fange an zu verstehen, warum du nie über sie gesprochen hast.« Carol zog den Stuhl aus der Ecke und setzte sich neben das Bett.
»Ich sehe sie fast nie. Nicht mal zu Weihnachten oder an Geburtstagen.« Er seufzte. »Ich hatte auch nicht viel von ihr, als ich aufwuchs.«
»Und dein Vater? War sie auch zu ihm so unfreundlich?«
»Gute Frage. Ich habe keine Ahnung, wer mein Vater ist. Sie hat sich immer geweigert, mir irgendetwas über ihn zu erzählen. Ich weiß nur, dass sie nicht verheiratet waren. Kannst du mir mal die Fernbedienung fürs Bett geben?« Er brachte ein richtiges Lächeln zustande. »Du hast mich vor einem weiteren Tag mit meiner Mutter gerettet. Das Mindeste, was ich dafür tun kann, ist, mich für dich aufzusetzen.«
»Ich bin gekommen, sobald ich davon erfuhr. Es tut mir leid. Niemand hat mich angerufen.« Sie gab ihm die Fernbedienung, und er drückte auf die Knöpfe, bis er halb aufrecht saß und leicht zusammenzuckte, als er sich zurechtrückte. »Alle dachten, jemand anders hätte mir Bescheid gesagt. Ich wünschte, du hättest es mich wissen lassen.«
»Ich wusste doch, wie sehr du ein freies Wochenende brauchtest«, erwiderte er. »Außerdem kann ich ja nicht endlos Gefälligkeiten von dir verlangen und dachte, ich würde mir das lieber für eine Gelegenheit aufsparen, wenn ich sie wirklich brauche.« Plötzlich blieb ihm der Mund offen stehen, und seine Augen weiteten sich. »Ach Mist«, rief er aus. »Bist du schon zu Hause gewesen oder direkt ins Büro gekommen?«
Das schien eine merkwürdige Frage, aber sie war ihm wohl sehr wichtig. »Ich bin direkt ins Büro gefahren. Warum?«
Er schlug die Hände vors Gesicht. »Es tut mir furchtbar leid. Ich habe Nelson ganz vergessen.«
Carol brach in Lachen aus. »Ein Verrückter schlägt dir das Bein mit einer Feuerwehraxt kaputt, du wirst am Wochenende operiert, und da machst du dir Sorgen, dass du meinen Kater nicht gefüttert hast? Er hat eine Katzentür, er kann rausgehen und kleine Tiere fangen, wenn’s eng wird.« Sie nahm seine Hand und tätschelte sie. »Vergiss den Kater. Sag mir, wie es um dein Knie steht.«
»Es ist verdrahtet, aber wegen der Wunde können sie noch keinen richtigen Gipsverband machen. Die Chirurgin sagt, sie müssen sichergehen, dass es richtig heilt und sich nicht entzündet. Dann können sie einen Gips anlegen, und vielleicht kann ich’s bis Ende der Woche mit einem Gehbock versuchen. Wenn ich brav bin«, fügte er spöttisch hinzu.
»Wie lang wirst du also im Krankenhaus bleiben müssen?«
»Mindestens eine Woche. Es kommt darauf an, wie gut ich mit dem Gehen klarkomme. Sie werden mich erst entlassen, wenn ich mich fortbewegen kann.« Er schwenkte seinen Arm. »Und wahrscheinlich auch, wenn ich ohne Morphiuminfusion auskomme.«
Carol grinste verständnisvoll. »Das hast du jetzt davon, dass du den Helden gespielt hast.«
»Da war nichts Heldenhaftes dran«, entgegnete Tony. »Die Typen, die versuchten, ihren Kollegen da rauszuschleppen, das waren die Helden. Ich hab ihn nur abgelenkt.« Seine Augenlider flatterten. »Aber das war das letzte Mal, dass ich noch so spät arbeite.«
»Brauchst du etwas von zu Hause?«
»Vielleicht T-Shirts. Das muss bequemer sein als diese Krankenhauskittel. Und ein paar Boxershorts. Es wird interessant sein zu sehen, ob wir sie über die Schiene kriegen.«
»Wie wär’s mit etwas zum Lesen?«
»Gute Idee. Ich soll zwei Bücher besprechen, sie liegen auf dem Nachttisch. Du kannst an den Klebezetteln auf dem Umschlag sehen, welche es sind. Oh, und meinen Laptop, bitte.«
Carol schüttelte belustigt den Kopf. »Meinst du nicht, dies könnte eine gute Gelegenheit zum Ausspannen sein? Vielleicht mal was Leichtes zu lesen?«
Er schaute sie an, als spräche sie Isländisch. »Warum?«
»Ich glaube nicht, dass irgendjemand von dir erwartet, dass du arbeitest, Tony. Und ich vermute, es wird nicht so leicht sein, sich zu konzentrieren, wie du es dir vorstellst.«
Er runzelte die Stirn. »Du glaubst, ich weiß nicht, wie man sich entspannt.« Das war nur zum Teil scherzhaft gemeint.
»Das glaube ich nicht, sondern ich weiß es. Und ich kann es verstehen, weil ich ähnlich gestrickt bin.«
»Ich kann mich sehr wohl entspannen. Ich sehe mir Fußballspiele an. Ich spiele Computerspiele.«
Carol lachte. »Ich hab gesehen, wie du Fußball schaust und wie du Computerspiele spielst. Die Bedeutung des Wortes ›entspannend‹ lässt sich auf solche Aktivitäten nicht anwenden, wenn du dich damit beschäftigst.«
»Ich werde das nicht mal einer Antwort würdigen. Aber wenn du mir den Laptop bringst, kannst du mir auch Lara …« Er zwinkerte ihr zu.
»Du armer Kerl. Wo finde ich sie?«
»In meinem Arbeitszimmer. Auf dem Regal, das du vom Stuhl aus mit der linken ausgestreckten Hand erreichst.« Er unterdrückte ein Gähnen. »Und jetzt ist es an der Zeit zu gehen. Ich muss schlafen, und du hast ein Sondereinsatzteam zu leiten.«
Carol stand auf. »Ein Sondereinsatzteam ohne besondere Einsätze. Aber ich beklage mich nicht«, fügte sie hastig hinzu. »Ich habe kein Problem mit einem beschaulichen Tag im Büro.« Sie tätschelte noch einmal seine Hand. »Ich komm heute Abend noch mal vorbei. Wenn du noch etwas brauchst, ruf mich an.«
Sie ging den Korridor entlang und zog schon ihr Mobiltelefon heraus, damit sie es beim Verlassen des Krankenhauses anschalten konnte. Als sie am Schwesternzimmer vorbeikam, zwinkerte ihr die Frau zu, mit der sie vorhin gesprochen hatte. »So ist das also mit dem Katzefüttern.«
»Was meinen Sie?«, fragte Carol und blieb stehen.
»Seine Mutter sagte, er tut ein bisschen mehr als das für Sie.« Sie lächelte verschmitzt und warf ihr einen wissenden Blick zu.
»Sie sollten nicht alles glauben, was Sie hören. Weiß Ihre Mutter alles über Sie?«
Die Schwester zuckte mit den Schultern. »Aha, kapiert.«
Carol hantierte zugleich mit Tasche und Handy und zog schließlich eine Karte heraus. »Ich komme später noch mal vorbei. Das ist meine Karte. Wenn er etwas braucht, sagen Sie mir Bescheid, und ich seh zu, was ich tun kann.«
»Alles klar. Gute Katzensitter sind schließlich nicht so leicht zu finden.«
Yousef Aziz sah auf die Uhr am Armaturenbrett. Es lief gut. Niemand erwartete, dass er von einer Besprechung um neun Uhr viel früher als zur Mittagszeit zurück in Blackburn sein würde. Alle kannten den Verkehr über die Pennines am Montagmorgen. Was sie aber nicht wussten, war, dass er die Besprechung auf acht Uhr vorverlegt hatte. Sicher, das hieß, dass er in Bradfield etwas früher losfahren musste, aber nicht eine ganze Stunde früher, weil er den schlimmsten Berufsverkehr vermeiden würde. Um sich abzusichern, hatte er seiner Mutter nur sagen müssen, er wolle sicher sein, sich bei diesem wichtigen neuen Kunden nicht zu verspäten. Er wusste, dass er sich hätte schlecht fühlen sollen, als sie seine angebliche Pünktlichkeit lobend als Tadel gegenüber seinem kleinen Bruder nutzte. Aber an Raj prallte das sowieso ab. Ihre Mutter hatte ihn als jüngsten Sohn verwöhnt und erntete jetzt, was sie gesät hatte.
Das Wichtigste war, dass Yousef sich selbst einen kleinen Zeitgewinn hatte schaffen können. In den letzten Monaten hatte er sich daran gewöhnt, das zu tun, und war zum Experten darin geworden, aus dem Arbeitstag einige Stunden für sich herauszuquetschen, ohne Verdacht zu erregen. Seit … Er schüttelte den Kopf, wie um den Gedanken zu verscheuchen. Er beunruhigte ihn zu sehr. Er musste versuchen, die widersprüchlichen Elemente seines Lebens voneinander getrennt zu halten, sonst würde er sich verraten.
Yousef hatte die Besprechung in Blackburn so kurz wie möglich gehalten, ohne zu dem neuen Kunden unhöflich zu sein, und hatte jetzt anderthalb Stunden für sich. Er folgte den Anweisungen des Navigationssystems auf der Autobahn und mitten nach Cheetham Hill hinein. Er kannte den nördlichen Teil Manchesters ziemlich gut, aber genau dieses Viertel verwirrend angelegter Straßen mit roten Backsteinhäuschen war ihm nicht vertraut. Er bog in eine schmale Straße ein, in der eine heruntergekommene Serie langweiliger Reihenhäuser einem kleinen Gewerbegebiet gegenüberlag. In der Mitte der Reihe entdeckte er das Schild, das er suchte. PRO-TECH-SUPPLIES stand in Rot auf weißem Hintergrund mit einer Umrandung aus schwarzen Ausrufezeichen.
Er blieb mit dem Lieferwagen draußen stehen, stellte den Motor ab und lehnte sich tief atmend über das Steuerrad, denn er spürte, wie sich sein Magen verkrampfte. Am Morgen hatte er fast nichts gegessen und seine Eile als Grund vorgeschoben, um die bedrückende Sorge seiner Mutter wegen seines in letzter Zeit so schlechten Appetits zu zerstreuen. Natürlich hatte er keinen Appetit mehr, genauso wie er auch nicht mehr als zwei Stunden schlafen konnte. Was konnte er anderes erwarten? So war es eben, wenn man so etwas in Angriff nahm. Aber es war wichtig, keinen Verdacht zu erregen, deshalb versuchte er wenn möglich an den gemeinsamen Mahlzeiten nicht teilzunehmen.
Er konnte kaum glauben, wie energiegeladen er war, obwohl er so wenig aß und schlief. Manchmal war ihm ein bisschen schwindlig, aber er dachte, das hatte mehr damit zu tun, dass er sich über die Auswirkungen ihres Plans Gedanken machte, als mit dem Mangel an Essen und Entspannung. Jetzt richtete er sich hinter dem Steuerrad auf, stieg aus und ging durch die Tür, an der VERKAUF stand. Sie führte in einen Raum mit zehn Meter langen Wänden, der von dem dahinterliegenden Lager abgetrennt war. Hinter einer mit Zinkblech beschlagenen, den Raum unterteilenden Theke saß ein dünner Mann mit hochgezogenen Schultern an einem Computer. Alles an ihm war grau, sein Haar, seine Haut und sein Arbeitsanzug. Als Yousef eintrat, sah er vom Bildschirm auf. Auch seine Augen waren grau.
Er stand auf und stützte sich auf den Monitor. Diese Bewegung ließ einen bitteren Geruch von billigem Tabak zu Yousef herüberdriften. »Alles klar?«, fragte Yousef.
»Alles klar. Was kann ich für Sie tun?«