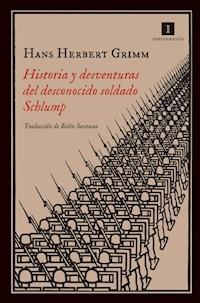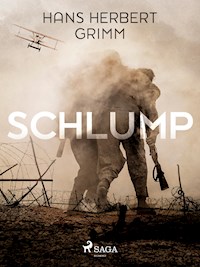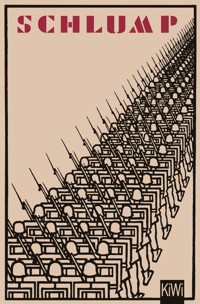
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Die Wiederentdeckung: Schlump ist ein vergessener Klassiker, ein grandioser Antikriegsroman aus dem Jahr 1928 »Antinationalistisch, unheroisch, menschenfreundlich, pazifistisch, franzosenfreundlich, humanistisch, europäisch, ziemlich gut gelaunt und ziemlich gut geschrieben. Ein helles Buch aus dunkler Zeit.« So beschrieb Volker Weidermann diesen Roman in seinem FAS-Artikel im April 2013.Hans Herbert Grimm bekannte sich erst nach dem Zweiten Weltkrieg dazu, einen Roman über den Ersten Weltkrieg geschrieben zu haben, der sich immer noch ganz frisch, ganz gegenwärtig liest und sich damit abhebt von vielen heute nur noch literaturgeschichtlich kanonisierten Romanen. Die »Geschichten und Abenteuer aus dem Leben des unbekannten Musketiers Emil Schulz, genannt ›Schlump‹, von ihm selbst erzählt« – so der Untertitel – zeigen den Weg eines unbedarften jungen Helden von der Etappe aufs Schlachtfeld, ins Lazarett und zurück. Und sie erzählen die Geschichte eines modernen Hans im Glück, der nach Romanzen Ausschau hält und am Ende die große Liebe trifft, die immer schon auf ihn wartete. »Ein französisch anmutendes Weisheitsbuch von lateinischer Heiterkeit«, so Volker Weidermann, der in seinem Nachwort Informationen zu Autor und Werk liefert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 374
Ähnliche
Hans Herbert Grimm
Schlump
Geschichten und Abenteuer aus dem Leben des unbekannten Musketiers Emil Schulz, genannt »Schlump«Von ihm erzählt
Kurzübersicht
> Buch lesen
> Titelseite
> Inhaltsverzeichnis
> Über Hans Herbert Grimm
> Über dieses Buch
> Impressum
> Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
Inhaltsverzeichnis
Erstes Buch
Schlump war gerade sechzehn Jahre alt geworden, als im Jahre 1914 der Krieg ausbrach.
Am Abend sollte Tanz sein im Reichsadler, der letzte; am nächsten Tag mußten die Soldaten eintreffen. Und als die Sonne untergegangen war, schlich er sich mit seinem Freunde hinauf auf die Galerie. Denn in den Tanzsaal wagten sie sich nicht. Die Großen, die zwanzigjährigen Dreher und Schlosser, gönnten ihnen nichts von ihrem Reichtum. Sie brauchten alle Mädchen selber, sie verstanden keinen Spaß, und sie konnten fürchterlich grob sein. Oben beugten sich die zwei über das Geländer und schauten hungrig hinunter in den Saal.
Um Mitternacht blies die Musik ein Trara, und der Trompeter verkündete eine Pause von fünfzehn Minuten, damit sich die Mädchen abkühlen. Schlump drückte sich mit seinem Freunde hinaus in die wohlige Sommernacht, unter die alten, mächtigen Ahornbäume.
Die Viertelstunde war vorbei, und sie zogen zurück. Da begegnete ihnen eine breite Kette lachender Mädchen; sie sperrten die ganze Straße. Sie waren so alt wie er und mit ihm in die Schule gegangen, aber natürlich durften sie schon mittanzen. Ja, sie waren gerade am meisten gesucht von den Burschen. Da rief eine aus der Kette zu Schlump heraus: »Du, Schwarzer, komm mal her zu mir!« Schlump sah, wie das Laternenlicht auf ihren blonden Locken spielte, die jetzt fast weiß schienen. Er traute dem Mädchen nicht. Aber die Schlanke löste sich los, und die anderen riefen ihm zu, und sein Freund sagte: »Geh doch, bei der hast du Chancen!« Da ging er hinüber, und zwei Hände faßten ihn und zogen ihn in einen schmalen Gang, unter das dichte Laub, an dessen Ende eine Laterne spärlich leuchtete. Das machte ihm Mut, und er faßte sie um die Hüften und drückte sie. An der Laterne griff er sie ans Kinn und sah ihr ins Gesicht: »Du bist hübsch«, sagte er, »wie heißt du denn?« – »Johanna«, sagte sie leise, »ich kenn dich schon lange.« Dann zog er sie in den Schatten und küßte sie andächtig und lange auf den Mund. Da flüsterte sie ihm ins Ohr, er solle mit ihr tanzen und er dürfte sie dann nach Hause bringen, sie würde die anderen Burschen schon versetzen.
Er schlich wieder hinauf auf die Galerie und wollte sie seinem Freunde zeigen. Aber er fand sie nicht. Dann gingen sie nach Hause, Schlump war selig und froh. Er fühlte sich unglaublich glücklich und war überzeugt, daß es etwas Schöneres als die Mädchen auf der Welt nicht geben konnte.
Nach ein paar Tagen hatte er die Johanna vergessen.
Die Jugend ist verschwenderisch, sie lebt im Paradies und merkt es nicht, wenn ihr das leibhaftige Glück begegnet.
Schlump wohnte hoch oben unterm Dach. Sein Vater war Schneider und hieß Ferdinand Schulz. Wenn er von seiner Nadel aufschaute, flog sein Blick über die bunten Dächer der alten Stadt und grüßte den Türmer in seinem Stübchen. Die Mutter hatte die lustige Nase und die blanken Augen aus ihrer Jugend mitgebracht. Damals sprang sie mit den Buben über die Zäune und mauste Erdbeeren. Und zu Fastnacht und zu Pfingsten zog sie Jungenshosen an und sang bei den Leuten vor der Tür und rappelte sich einen Sack voll Brezeln und Kuchen zusammen. Als aber unter ihrer Bluse die kleinen Brüste wuchsen und als sie überhaupt merkte, daß sie ein Mädel war, da zog sie sich stille in die Stube zurück und dachte an hübsche Kleider und an schöne Schuhe. Aber wenn sie ein Fest feierten, wurde sie lebhaft und lustig. Und die Burschen hätten mit der Katze aus einem Napf gefressen für einen guten Blick von ihr.
Mit siebzehn Jahren nahm sie den ernsthaften Schneider, und mit neunzehn heiratete sie ihn, weil ihr sein gesetztes und ehrliches Wesen gefiel. Sie feierten auch gleich Kindtaufe, aber das Mädchen starb bald nach der Geburt. Dann blieben sie zehn Jahre allein. Der Schneider machte sich selbständig und nähte auf seiner Stube am Fenster für die Leute. Er wurde schnell alt. Seine kurzen Haare färbten sich grau, und seine Stimme klang matt und ängstlich. Inzwischen bekam sie noch einen Jungen, den sie Emil tauften, weil der Bruder der Mutter, der Soldat, auch so hieß. Emil war seiner Mutter aus dem Gesicht geschnitten, sagten die Leute. Er kam in die Schule und gab bald den Hauptmann ab und den Spaßmacher für seine Abc-Schützen. Und man hörte sie schon von weitem lärmen, wenn Emil Schulz unter ihnen spaßte.
Einmal waren Buden aufgebaut auf dem Markt für das Vogelschießen am Sonntag. Emil riß den Ranzen vom Buckel und kletterte auf die erste Bude. Und mit ungeheurem Geschrei warfen die kleinen Rüpel alles auf die Straße, was ihre Fäuste packen konnten. Aber das Unheil nahte schon: Der Schutzmann packte Emil am Schlafittchen und brüllte ihn an: »Du Schlump!« Vielleicht dachte er an Lumpen und an Spitzbuben und an andere Kerle, die mit Sch anfangen. Dann bezog Emil eine vollgemessene Tracht Prügel und lief brüllend nach Hause.
Am Markt aber wohnten lauter fleißige Leute, die standen den ganzen Tag vor ihrem Laden und rauchten Zigarren. Die hatten alles gesehen. Und als der kleine Held am nächsten Tage leise über den Marktplatz schlich, redeten sie ihn an: »Na du, Schlump, wer hat dir denn die Hosen ausgeklopft?« – Und alle sagten Schlump zu ihm, und so blieb es zeit seines Lebens.
Die Eltern hatten ihn in die Realschule geschickt. Mit großen Opfern, denn die Schule war teuer, und der Schneider hatte kein Geld. Zu Ostern hatte Schlump sein Examen gemacht.
Das Zeugnis nützte ihm nicht viel; aber er hatte Talent zum Zeichnen. Er trat in eine Weberei ein und lernte Muster zeichnen und Entwürfe machen. Doch über seiner Arbeit dachte er an die Mädchen und an den Krieg. Ein paar von seinen Bekannten waren Soldat, und er wollte sich auch freiwillig melden. Er sah sich schon, in feldgrauer Uniform, wie ihn die Mädchen anguckten und ihm Zigaretten schenkten. Dann ging er in den Krieg. Er sah die Sonne scheinen, die Feldgrauen stürmten, einer fiel, die anderen liefen weiter, schrien hurra, und zwischen grünen Hecken verschwanden die roten Hosen. Am Abend saßen die Soldaten um ein Lagerfeuer und schwatzten von zu Hause. Einer sang ein schwermütiges Lied. Draußen in der Dunkelheit standen die Doppelposten, auf die Gewehrmündung gestützt, und dachten an die Heimat und an das Wiedersehen. Am Morgen brach man auf, marschierte singend in die Feldschlacht, wo mancher fiel und mancher verwundet wurde. Endlich war der Krieg gewonnen. Siegreich zog man zu Hause ein. Die Mädchen warfen Blumen aus den Fenstern, und es wurden Feste gefeiert ohne Ende. Schlump bekam es mit der Angst zu tun, daß er nicht dabei sein könnte, und wollte sich durchaus freiwillig melden. Aber die Eltern verboten es ihm.
An seinem siebzehnten Geburtstag ging er heimlich in die Kaserne und stellte sich freiwillig. Er wurde untersucht, er war tauglich für Infanterie. Stolz kam er nach Hause. Die Eltern gaben ihren Widerstand auf. Die Mutter weinte. Am 1. August 1915 nahm er seine Kiste und zog stolz in die Kaserne.
Schlump war schwipp und schlank und kräftig gewachsen. Ihm machte die Rekrutenausbildung keine Not. Er rührte sich flink wie ein Wiesel und stellte sich geschickt an mit dem Gewehr. Am Anfang taten ihm alle Glieder weh, und am liebsten wäre er auf allen vieren die fünf Stufen zur Latrine hinaufgekrochen.
Gleich in der zweiten Woche hatte er Stubendienst, das hieß, die Stube reinhalten und Kaffee holen. Am Dienstag war er gerade fertig mit Waschen, klemmte seinen Schemel unter den Ellbogen und sauste mit der Waschschüssel hinein in die Kaserne an der Unteroffiziersstube vorbei. Da griff ihn eine harte Hand am Arm. »Du, Kleiner, hast’n Dreier. Hol mir mal Kaffee aus der Kantine!« Schlump hielt den Dreier in der Hand, der Unteroffizier war verschwunden. »Wenn du jetzt gehst«, dachte er, »dann mußt du lange warten in der Kantine. Die Alten stehen vor dem Ladentisch und lassen keinen Rekruten vordrängen. Dann kommst du zu spät zum Kaffeeholen für die Korporalschaft, und du bist unten durch bei allen, bei deinem Unteroffizier hast du verschütt für alle Zeiten. Jeder hält dich für einen Brummochsen.« Da kam ihm eine Idee. Er warf den Dreier in den Kaffeetopf, stellte ihn hinter die Haustür, flitzte an der Unteroffiziersstube vorbei, faßte die große Kanne, klemmte sich rasch die Brille von seinem Stubennachbar und stürzte hinaus zum Kaffeeholen. Rückwärts begegnete er dem Unteroffizier. Der fuchtelte mit der Faust herum und schimpfte und fluchte wie ein Rollkutscher. Schlump machte ein dummes Gesicht hinter seiner Brille und zog an ihm vorbei.
Dann ging es zur Instruktionsstunde in die Exerzierhalle. Mit Schemeln und im Drillichzeug. Nichts als schwarze Schlacken und verdreckte Fenster. Es war eiskalt in der Halle, die Sonne ging gerade auf. Schlump mußte an den Krieg denken. Wenn es da auch so nüchtern war und so grausam kalt?
Sie zogen aus zum Übungsmarsch. Schlump war wieder lustig und marschierte in den Morgen hinein und jubelte mit den Lerchen, die trillernd aus den Schollen emporflogen.
Der Offizier-Stellvertreter Kieselhart leitete die Ausbildung der Rekruten. Er hatte seltsame Gepflogenheiten. Oft schlich er sich hinter einen armen Rekruten und griff ihm herzhaft in den Hosenspiegel. Wehe, wenn er einen schlappen Popo zu fühlen bekam; sein Zorn kannte keine Grenzen. Eines Tages stand er hinter Schlump, dessen Hosenboden so weit herabhing, weil ihm die Hosen einen Meter zu groß waren. Aber der Vorgesetzte fand einen Hintern, der war hart wie Stahl. Da lobte ihn der Offizier-Stellvertreter vor allen Unteroffizieren und vergaß es ihm nie und zog ihn bei allen Gelegenheiten vor. So hatte Schlump den ersten Schritt in seiner Laufbahn vorwärtsgetan (es sollte aber auch der einzige bleiben).
Eins aber gefiel ihm nicht: Sie trugen die blaue Friedensuniform mit den blanken Knöpfen. Und er vermochte nicht die Geduld aufzubringen, alle diese Knöpfe ordentlich zu putzen, daß sie blitzten und strahlten wie weißglühendes Eisen. Wenn die Kompagnie angetreten war, hob er rasch die Rockschöße empor, fuhr mit den Knöpfen des linken und des rechten Ärmels energisch über den Hosenboden und dann mit der Innenseite der Ärmel über die vordere Knopfreihe. Darauf stellte er sich so stramm hin, als er nur konnte, und wenn der Feldwebel streng herankam, blitzte er ihn mit den blanksten Augen der Welt an, so daß des Feldwebels Blicke zu seinem Nachbar abrutschten, zu dem Musketier Speck. Der war Schuster von Beruf. Er putzte und wienerte mit rührendem Eifer in jeder freien Stunde. Wenn er aber den Rock zuknöpfte, fuhr er mit dem Daumen über die blanken Spiegel und löschte ihre Lichter aus. Und dann kam der Feldwebel und donnerte ein ganzes Gewitter auf den armen Schuster herunter.
So gewann Schlump viel freie Zeit für die Kantine. Hier hantierten zwei hübsche und brave Mädchen; die eine drall und blau und blond, die andere schlank mit braunen Augen und braunem Zopf. Die Dralle versteckte für ihn jeden Morgen ein Brötchen und ein Stück Wurst, das er vor dem Ausrücken rasch abholte. Die Schlanke fütterte ihn nachmittags in der Freizeit mit Schokolade. Und wenn sie allein in der Kantine waren, steckte sie die schwarze Schokolade zwischen die weißen Zähne, und Schlump mußte sie andächtig abbeißen. Das tat er mit viel Vergnügen.
Einmal, es dämmerte schon stark unter den Kastanien, da sah Schlump die Blonde Wasser holen. Er eilte ihr nach und schwang galant den Pumpenschwengel. Dann wollte er noch den Eimer tragen. Sie aber wehrte ab, und es kam zu einem lieblichen Handgemenge, das in einen langen, langen Kuß ausartete. Just in diesem Augenblick trat der alte Sergeant Bauch aus dem Haus und ging an den beiden vorbei. Schlump war noch nicht lange genug Soldat, um in allen Lebenslagen den richtigen Ausweg zu finden. Er geriet in große Not, riß die Hacken zusammen, daß sie knallten, preßte das arme Mädchen mit eiserner Gewalt an sein Herz, so daß ihr glühendes Köpfchen auf seine Schulter fiel, und legte die rechte Hand an die Hosennaht.
Der Sergeant war ein verständiger Mann. Er hatte selber zwei solche Jungen im Krieg. So lächelte er milde und ging vorbei.
Die Zeit verging rasch. Acht Wochen lang sollten sie in der Heimat ausgebildet werden. Sechs Wochen waren vorüber. Die Rekruten kamen nach Altengrabow auf den Truppenübungsplatz. Der Feldwebel-Leutnant Bobermin, der sie sonntags drei Stunden lang um den Kasernenhof herumlaufen ließ und dabei immer nur »Hinlegen! Auf, marsch, marsch!« kommandierte, so daß die Soldatenbräute oben auf den Bänken vor der Kaserne anfingen zu heulen – der Feldwebel-Leutnant Bobermin hatte den Rekruten kurz vor dem Abmarsch folgende Instruktionsrede gehalten: »Stillgestanden! Ihr kommt jetzt nach Altengrabow! Auf den Truppenübungsplatz. Dort werdet ihr in Baracken untergebracht. Bindet euch jeden Abend den Arsch an, damit er euch in der Nacht nicht geklaut wird! Weggetreten!«
Alle Morgen, früh, früh, marschierten sie aus, den Affen auf den Rücken voll Sand, scharfe Patronen in der Tasche am Koppel. Kalt war es und grau, und unbarmherzig standen die Baracken da. Alles ohne Farbe, die Welt sah aus wie eine leere Fabrik. Die Artilleristen nebenan schliefen noch, und nichts rührte sich. Lange marschierten sie, und die Nebel teilten sich, und die Sonne stieg hoch, und die Rekruten schwitzten, und der Sand klebte ihnen die Augen zu, und der Schweiß lief über die Backen und ließ kleine Rinnen hinter sich und tropfte auf die Patronentasche. Das Koppel drückte auf die Hüften und rieb, und die Spaten klopften an die Schenkel, und das Kochgeschirr schlug einem an den Kopf, wenn man den Tornister rückte. Schlump hatte das volle Sandgewicht auf dem Rücken, denn er war am Morgen erwischt worden. Der Unteroffizier Mückenheim hob den Tornisterdeckel auf – Schlump hatte vergessen, die Riemen festzuschnallen –, er entdeckte den leeren Sandsack. Schlump mußte ihn auffüllen und sollte zu Mittag feldmarschmäßig in der Unteroffiziersstube antreten, blank geputzt, und hundertmal kehrtmachen.
Schlump schwitzte und hatte eine Wut im Leibe. Endlich durften sie die Gewehre zusammenstellen. Dann schossen sie auf bewegliche Schützen. Das machte ihm Spaß, drüben die dunklen Köpfe auftauchen zu sehen und darauf zu schießen. Das war lustig und machte ihn gespannt auf den Krieg.
Rückwärts gab es Kompagnie-Exerzieren. Der Hauptmann saß auf dem Pferde und kommandierte. Die Unteroffiziere schwitzten und machten böse Gesichter, obwohl sie keine Tornister trugen, und ließen ihren Ärger an den Rekruten aus. Die Rekruten mußten Schwenkungen machen und wurden durch den Sand gehetzt wie die Hasen. Sie kochten vor Hitze und vor Wut. Sie begegneten den Artilleristen, die verschlafen auf ihren Protzen saßen und zum Schießen fuhren. Hinter dem Wäldchen vor dem Sandberg mußten sie sich hinlegen, das Gewehr in beide Hände nehmen, und dann sollten sie sich mit den Ellbogen durch den Sand auf den Berg hinaufzuckeln. Das war das Schlimmste. Manche rasten vor Wut, daß ihnen die Tränen kamen. Endlich waren sie oben. Der Hauptmann ließ die Kompagnie antreten und kommandierte im Marsch: »Mit Platzpatronen laden und sichern! Von rechts anreitende Kavallerie, zum Schuß! Fertig! Feuer!« Die Salve krachte, des Hauptmanns Pferd taumelte, der Hauptmann sprang ab. Der Schimmel hatte einen Schuß in den Hals. Die Kompagnie marschierte nach Hause. Kein Mensch erfuhr je den Schuldigen. Schlump freute sich. Ihn hatte der Marsch nicht so angestrengt, denn er war kräftig, aber er freute sich doch. Denn er hoffte, daß sie ein paar Tage Ruhe hätten.
In langer Reihe traten sie an zum Essenholen. Es gab Sauerkraut mit Schweinsbauch. Schlump trug die volle, kochendheiße Schüssel in die Eßbaracke und wollte sich an den ersten Tisch setzen. Da stand ein baumlanger Kavallerist auf und sagte zu ihm: »Was? Du? Du dreckiger Sandaffe willst bei uns essen?« Schlump fühlte den Hohn und die Verachtung: Er faßte seine Schüssel und warf sie dem langen Kerl in die Fresse. Der taumelte und schrie laut auf, denn das heiße Kraut verbrühte ihm das Gesicht und lief ihm in den Hals. Seine Kameraden sprangen auf, stürzten über die Infanteristen, die mit ihren vollen Schüsseln hereinkamen. Und im Augenblick war eine Schlacht im Gange, die mit Sauerkraut und Schüsseln ausgefochten wurde. Es gab auf beiden Seiten Verwundete, und erst ein starkes Kommando Infanterie konnte Frieden schaffen. Schlump hatte sich verkrümelt. Die Kavalleristen saßen mit verbeulten Schädeln im Arrest.
In der folgenden Nacht brach bei den Rekruten die Lagerruhr aus. Eine rote Spur zeichnete den Weg von der Baracke zur Latrine. Sie wurden abgesperrt und aßen für sich. Schlump war froh darüber; denn er fürchtete die Rache der Kavalleristen.
Eine Woche später fuhren sie in die Garnison zurück.
Am 4. Oktober wurden sie verladen. Die Musik spielte auf dem Bahnhof, und es klang, als schrie sie in namenlosem Schmerz, und die Leute vor dem Zug weinten zum Herzzerbrechen. Die Soldaten waren aufgeregt und neugierig, die Zukunft stand vor ihnen wie ein schreckliches Ungeheuer, das sie bekämpfen mußten. Fünf oder sechs Tage dauerte die Fahrt. In Libercourt wurden sie ausgeladen. Dann marschierten sie durch schmutzige Dörfer und wunderten sich über die nüchternen Häuser, die freudlosen Bauernhöfe der Franzosen. Nirgends die schmucken Gärten vor den Gütern wie bei uns. Nirgends das heimliche Fachwerk am Giebel, das sich unter eine riesige Linde schmiegt wie bei uns. Die Fenster standen wie schmutzige Löcher, und schmutzige Stufen führten von der Straße in die Küche. Das soll Frankreich sein? Alte Weiber begegneten ihnen mit schwarzen Bärten und Schnupftabak an der Nase. Der Himmel hing tief und bleischwer hernieder; es fing an, fein zu regnen.
Die Straße nahm kein Ende. Die Rekruten waren schwer bepackt; sie trugen noch Pakete in der Hand, Liebesgaben, die ihnen zuletzt in den Zug gereicht wurden. Da hauten schon welche ab, sie setzten sich in den Straßengraben und keuchten.
Endlich wurde haltgemacht. Sie setzten die Gewehre zusammen. Und nach endlosem Abzählen kamen sie in die Quartiere: eine leere Fabrik mit zerbrochenen Scheiben, durch die der Regen hereinwehte. Ein wenig nasses Stroh lag auf der Diele. Es war finster, und die Soldaten stolperten über die Löcher im Fußboden, die von den Maschinen stammten. Manche hatten eine Kerze und wurden von allen beneidet. Es gab Kaffee und Brot. Dann schliefen sie.
Am nächsten Tag begann der Dienst. Es war schlimmer als in Altengrabow. Die Soldaten kugelten auf den nassen, klebrigen Feldern herum und kamen dreckig zurück wie die Schweine. Dann gab es Appell, und sie kamen nicht zu Verstand.
Nach ein paar Tagen mußte Schlump auf die Schreibstube kommen. »Du bist Einjähriger, du kannst Französisch?« fragte der Feldwebel, »melde dich auf der Ortskommandantur, sofort, marsch!« Schlump rannte und meldete sich. Er durfte auf dem Büro bleiben und brauchte keinen Dienst zu machen. Er gab sich unglaubliche Mühe, um nicht ungeschickt zu scheinen, und es gelang ihm auch bald, die Franzosen zu verstehen, mit denen er zu tun hatte. Er mußte den Dolmetscher spielen, und das war nicht leicht, denn die Franzeks sprachen eine fürchterliche Mundart. Ein paar Wochen später kam die Meldung, daß die Kommandantur Loffrande zu besetzen sei, weil der Train dort abzog. Sie wußten keinen anderen als Schlump zu schicken.
Schlump war stolz. Am Abend machte er sich auf den Weg. Er ging langsam und dachte nach über sein neues Amt. Er sollte allein drei Dörfer verwalten, er, der siebzehnjährige Rekrut. Langsam ging er durch Deux Villes, wo die Rekruten in ihrer Fabrik lärmten. Sie kamen eben vom Marsch zurück, und Schlump war froh, daß er nicht dabei war. Dann führte der Weg aufs freie Feld. Unten verstreut und halb im Nebel versteckt lag Loffrande und rechts drüben ein paar Häuser von Martinval, das er noch gar nicht kannte, und links Drumez. An einer Wegtafel blieb er stehen. Auf der einen Seite stand »Ortskommandantur Mons-en-P.«, auf der anderen »Ortskommandantur Loffrande«. Das sollte sein Reich werden. Das Dorf kam ihm freundlicher vor als die anderen. Es gab herrliche, große Bäume, und die Häuser lagen versteckt hinter dichten grünen Hecken, zwischen denen sich schmale heimliche Pfade hindurchschlängelten. Vor der Kommandantur, einem Estaminet, plätscherte ein freundlicher kleiner klarer Bach. Er sprang darüber und trat ein. Links war die Schreibstube – ein großer Raum mit einem Tisch, vielen Stühlen und einem kleinen Ofen. Rechts die Schankstube, eine große Küche. In der Schreibstube hantierten die Trainsoldaten, drei Schreiber, ein Wachtmeister und ein Unteroffizier. Sie übergaben ihm eine Zigarrenkiste und sagten, das wäre die Kasse. Dann zeigten sie auf eine Menge Akten und Bücher, nahmen ihr Gepäck und verschwanden. Es waren Holsteiner, und Schlump verstand sie nicht, wenn sie untereinander sprachen. Dann stand er allein in der Kommandantur, und es wurde ihm ein wenig angst.
Er ging hinüber. Inzwischen war es ganz finster geworden. Er öffnete die Tür. Tabakqualm und viele Stimmen quollen ihm entgegen. Die Schenke war gestopft voll von französischen Bauern. Er konnte nichts sehen als den matten Schein einer Petroleumlampe im Hintergrund. Endlich fand er rechts in der Ecke einen leeren Stuhl. Aber es war ganz finster dort. Da kam ihm die Wirtin entgegen. Sie schien schon zu wissen, wer er war. Er sagte, er hätte kein Quartier für die Nacht, und ob sie ihm helfen wollten: Da stand ein Mädchen auf, nahm ein Tuch über die Schulter und sagte ihm etwas, er verstand nur »Monsieur«, und schlüpfte eilig durch die Tür. Eine Stimme sagte ihm aus dem Qualm heraus, daß Estelle ihm ein Quartier suchen ging und daß es schwer sei, denn die Soldaten rückten erst am Morgen ab. Allmählich gewöhnte sich sein Auge an die Umgebung. Lauter junge Burschen und kräftige Männer saßen an kleinen Tischen und spielten Karten. Sie rauchten alle und hatten vor sich winzig kleine Gläser mit Bier stehen. Hinten bei der Lampe schenkte eine Frau mit ihrer Tochter. Kein Mensch kümmerte sich mehr um ihn. Er hatte zwei Eier einstecken und wollte sie gerne gekocht haben. Endlich entdeckte er den Wirt und bat ihn darum. Der nahm sie bereitwillig, und nach ein paar Minuten brachte ihm die Frau einen Teller und ein Messer und die Eier. Sie wollte mit ihm schwatzen, aber er verstand sie schlecht. Er merkte aber, daß sie ängstlich war und es gut meinte.
Nach einer halben Stunde kam Estelle wieder, außer Atem und mit roten Backen. Sie schien blau und blond zu sein wie die Dralle in der Kantine. Sie nahm ihn an der Hand und zog ihn hinaus und führte ihn in sein Quartier. Schlump wunderte sich und ging gerne mit. Draußen flackerten die Sterne, es war eine kalte Nacht. Er fragte, ob sie Estelle hieß. Sie nickte und meinte, das wäre der Name eines Sternes. Er zeigte ihr den Stern, die Stella, und sie sah ihn lange an. Sie schien stolz darauf zu sein, aber sie schien auch den fremden Soldaten zu bewundern, der ihren Stern wußte. Dann gingen die beiden Kinder schweigsam nebeneinanderher, und Schlump dachte an seine Mutter. Es war ihm, als führte ihn sein guter Engel. Plötzlich blieb sie stehen, zeigte ihm sein Quartier und huschte davon. Er spürte noch ihre warme Hand. Dann drehte er sich langsam um und ging hinein in das Haus.
Schlump erschrak heftig, als er am andern Morgen an seine Kommandantur herankam. Schon von weitem schwoll ihm ein Stimmengewirr entgegen, und sowie er näherkam, drehten sich alle Gesichter nach ihm um und wurden stille. Rechts standen die Männer mit ihren Pferden und links die Mädchen und Frauen des Dorfes. Schlump begriff, daß sie auf ihn warteten und daß er sie anstellen mußte. Er fing an zu schwitzen und suchte alle seine Schulkenntnisse zusammen und präparierte krampfhaft, was er sagen wollte. Er hatte sein Krätzchen auf dem Kopfe und schämte sich über seine Hosen, die ihm viel zu weit waren. Dann trat er unter sie und faßte sich ein Herz und ging hin zu den Weibern, vor denen er am meisten Angst hatte. Er fragte sie: »Qu’est-ce que vous avez fait hier?« – »Was habt ihr gestern gemacht?« Da antworteten sie ihm alle durcheinander, und die Mädchen guckten ihn mit verschmitzten und lachenden und spöttischen Augen an, und die Frauen redeten halb belustigt und halb verächtlich, aber ununterbrochen auf ihn ein. Er verstand nichts und sagte zu ihnen: »Eh bien, faites la même chose aujourd’hui!« – »Gut, macht weiter heute!« Sie drehten sich alle um und rückten ab und wollten sich ausschütten vor Lachen.
Schlump wollte sich an die Männer wenden. Da sah er einen seltsamen Soldaten die Straße herunterkommen. Die Mädchen begrüßten ihn von weitem, und Schlump hörte, daß sie ihn Carolouis nannten. Er hatte unglaublich krumme Beine, und seine Mütze saß schief auf dem Kopfe, darunter aber lachte ein höchst gutmütiges Gesicht. »Kamerad, ich gehöre zur Kommandantur, ich bin hier in Loffrande bodenständig und habe die Aufsicht über die Leute«, sagte er in seinem Pfälzerdeutsch. Darauf ging er mit den Männern fort.
Schlump trat in seine Kommandantur ein und wollte sich zu schaffen machen. Da steckte die Madame den Kopf durch die Tür und rief: »Monsieur ne veut pas déjeuner?« – »Wollen Sie nicht frühstücken?« Schlump ging hinüber und setzte sich mit dem Wirt, Monsieur Doby, an einen Tisch und trank mit ihm heiße Milch und aß schönes weißes Brot dazu. Monsieur behandelte ihn mit großer Hochachtung und wollte gern schwatzen, aber Schlump verstand ihn nur schlecht. Dann ging er wieder hinüber in sein Büro. Dahinter lag ein kleines Zimmer mit einem Bett, in dem er von jetzt an schlief. Er hielt die Hände an den Ofen und wunderte sich, daß sie in Frankreich keine Ofentür hatten und daß sie alle Töpfe erst herunternehmen und die Ringe abheben mußten, wenn sie Kohle aufschütten wollten. Dann stöberte er in den Akten und Büchern herum und suchte sich zurechtzufinden, telephonierte an alle vorgesetzten Stellen, die er schon kannte, und gab den Schreibern gute Worte, daß sie ihm behilflich waren und ihn erinnerten, wenn er etwa einen Termin versäumen sollte. Denn er wußte, daß es manches zu melden gab.
Das war bald geschehen. Schlump setzte sich an den Tisch und stützte den Kopf auf die Hände und lauschte auf die schauerliche Melodie, die von der Front herüberdröhnte. Die Kanonen schossen immerfort, und die Scheiben klirrten an den Nägeln, in denen sie sich hielten, denn der Kitt war längst herausgefallen. Schlump horchte auf ihr böses Lied und dachte an seine Mutter und wunderte sich, daß er so ganz allein in Frankreich saß und plötzlich Gemeindevorstand spielen sollte.
Dann ging er hinaus und sah sich das Dorf an und pfiff lustig vor sich hin.
Trüb und eng spannte sich der graue Himmel über das Land. Schlump ging durch die Felder und sah das Laub von den Bäumen drüben am Walde fallen und freute sich, daß er lebte. Er hörte längst nicht mehr das Lied, das die Kanonen alltäglich in sein Ohr trommelten. Die Burschen pflügten, und die Pferde wieherten, und der Atem stob aus ihren Nüstern und rauchte in die helle Herbstluft. Die Männer gruben das Wasser ab, das aus den Wiesen zusammenlief, und hoben den Schlamm aus den Gräben. Dazwischen purzelte Carolouis mit seinen krummen Beinen von einer Furche zur anderen, und die frisch gepflügten Schollen lachten in die Sonne hinein, die sich soeben durch den Nebel hindurchgefunden hatte.
Schlump ging hinüber nach Martinval, wo die Frauen arbeiteten. Er hatte sie in zwei Scheunen untergebracht, in der einen die Frauen, in der anderen die Mädchen. Sie lasen Kartoffeln aus und schwatzten dabei. Die Frauen sagten nicht viel zu ihm. Als er aber zu den Mädchen kam, merkte er, daß eine am Tore verschwand, die auf ihn gepaßt haben mußte. Denn die Scheune lag in einer Ferme, und man konnte ihn nicht kommen sehen. Er hörte, wie ihr Gesang plötzlich abbrach und wie sie ganz stille wurden. Er trat hinein, sie waren eifrig bei der Arbeit. Eine machte sich an einem kleinen Spirituskocher zu schaffen und bot ihm eine Tasse Kaffee an. Schlump wunderte sich, daß die Tenne so blank gefegt war. Eine andere zeigte ihm die gelesenen Kartoffeln und das, was noch zu lesen war. Dann fingen sie wieder an zu singen. Die hübsche Marie stand auf und tanzte, und Schlump mußte sich auf einen Stuhl setzen, den sie für ihn geholt hatten. Das Mädchen tanzte und sang dazu und blitzte ihn von der Seite an mit seinen dunklen Augen, und die schwarzen Haare ringelten sich wie Schlangen um ihren kleinen Kopf. Dann trat sie ab, und die Céline tanzte und forderte ihn auf, mit ihr zu tanzen, und die anderen sangen dazu. Und er merkte, daß ihn die Mädchen gern hatten, und er drückte sie und tanzte mit allen der Reihe nach, nur mit Estelle nicht, die in der Ecke sitzengeblieben war und ihn mit großen, stillen Augen ansah.
Schlump ging wieder hinaus in den Herbst, und die Mädchen sangen hinter ihm, und er sah immer das schwarze Köpfchen der Marie vor sich und die großen Augen der Estelle. Er war ganz glücklich über die vielen schönen Mädchen, aber er ahnte nicht, daß er viele von diesen Rosen, die ihm so freundlich entgegenblühten, auch hätte pflücken dürfen. Der glückliche Knabe begnügte sich mit ihrem süßen Duft und begehrte ihren Honig noch nicht.
Am Abend kam die hübsche Marie in das Estaminet gehuscht und strich an ihm vorbei und blitzte ihn oft verstohlen an mit ihren schwarzen Augen und schaute dann hinüber zu Estelle, die ihre Augen nicht aufhob und die Hände ruhig im Schoße hielt.
Am Sonntag hatte Schlump ernste Pflichten. Um neun Uhr mußte er den Hafer ausgeben für die Pferde. Die Bauern schickten ihre Mädchen, die ihn mit ihren Säcken am Scheunentor erwarteten. Wenn er aufgeschlossen hatte, stürmten sie wie die wilde Jagd die steile Stiege hinauf, daß die Röcke flatterten und Schlump die Grübchen an den Knien zählen konnte. Oben trieben sie allerhand Allotria und haschten sich und balgten sich und flogen in den Hafer und traten mit den Füßen auf die Waage und schauten ihm in die Augen, um ein paar Kilo Hafer mehr für die armen Pferde herauszuschlagen. Denn die Ration wurde karg bemessen und war genau vorgeschrieben.
Um elf Uhr versammelten sich die Burschen und Männer zwischen 16 und 60 Jahren zum Appell. Schlump verlas ihre Namen, und sie antworteten »présent« und gingen dann hinein in die Schenke. Monsieur Fleury, ein reicher Getreidehändler, ließ sich nie die Ehre nehmen, für Schlump einen chopzu bezahlen. Das war ein riesiger alter Bursche. Sein breites Kreuz lief in gerader Linie über den Hals hinauf nach dem Kopf, wie bei den Stieren. Die lebendigen blauen Augen lagen tief versteckt unter den dichten weißen Brauen; und wenn er lachte, ließen seine vollen Lippen zwei Reihen weißer Zähne zwischen den roten Backen sehen. Seine Stimme dröhnte, als käme sie aus einem Weinfaß. Er sagte zu Schlump: »Das ist allerhand, mit 17 Jahren die alten Männer und die jungen Weiber zu kommandieren, was?« Als er hinaus war, setzte sich der Wirt, Monsieur Doby, zu Schlump und sagte zu ihm: »Ich will Ihnen eine kleine Geschichte erzählen von Herrn Fleury, das ist nämlich ein alter Filou. Sie wissen ja, daß er der reichste Mann unserer Gegend war. Eines Tages fuhr er mit seinen Pferden, die im ganzen Lande bekannt waren, denn es waren immer die schönsten Pferde, die es gab – eines Tages also fuhr er mit seinen Pferden hinüber nach Contigny. Er kam bei dem Geschirrhändler vorüber und wunderte sich, daß der Laden geschlossen war und daß sie die Hausflur schwarz ausgeschlagen hatten. Er hielt an, und da er die junge Frau gut kannte, stieg er aus und ging die Treppe hinauf, um sich nach dem Trauerfall zu erkundigen. Oben fand er die Witwe weinend am Sarge ihres Mannes. Er nahm seinen Hut ab und bekreuzigte sich und betete, wie sich das gehört. Dann setzte er sich neben die Witwe und wartete still, indem er ihren Schmerz taktvoll respektierte. Nach einer halben Stunde streichelte er ihre Hand und nahm ihr sachte das Taschentuch aus den Fingern und trocknete ihr die Zähren von den Wangen. Die Witwe schluchzte nur immer, und der Bock stieß sie, und sie vermochte kein Wort hervorzubringen. Monsieur Fleury hatte unendliche Geduld, er redete ihr sanft zu wie ein Pastor und fand erhebende Worte des Lobes für ihren Gatten, so daß sie von neuem in Tränen ausbrach. Und wieder trocknete er sie mit ihrem Taschentuch und legte zart seinen Arm um ihre Taille, denn es schien ihm, als wolle sie in ihrem Schmerze ohnmächtig werden. Und wirklich lehnte sie sich auch schutzsuchend an seine Brust und schluchzte und konnte noch immer nicht reden.
Monsieur Fleury strich ihr leise das Haar aus dem Gesicht und faßte sie unterm Kinn und tätschelte ihre Wangen und küßte sie auf die Stirn und tröstete sie mit aufrichtigen Worten.
Und wenn sich ihr wieder ein Seufzer von den Lippen stehlen wollte, dann küßte er ihn vom Munde herunter, ehe er noch geboren war.
Sie saßen aber so unbequem, denn ihre Knie stießen sich an den harten Sarg. Und er bat sie, den Sarg ein wenig auf die Seite zu tragen, damit sie besser auf dem Sofa säßen. Seufzend gehorchte sie und packte an einem der beiden Henkel an und schleppte den Sarg mit ihm in die Ecke. Dann saßen sie wieder auf dem Sofa, und die Pferde vor dem Hause mußten bis zum anderen Morgen warten, ehe sie ihren Herrn wiedersahen.
Und als er dann im Morgengrauen fortfuhr, grüßte er mit der Peitsche zärtlich zurück, und hinter der Gardine winkte ihm lächelnd die Witwe nach, bis sie ihn in der Ferne verschwinden sah. Dann wischte sie sich die beiden dicken Tränen ab, die auf jeder Wange saßen, und ließ den Vorhang fallen.«
Madame Doby, die Wirtin, hatte die letzten Worte ihres Gatten gehört. Sie schien die Geschichte zu kennen und war höchst ungehalten über ihren Gatten. »Glauben Sie nicht«, sagte sie zu Schlump, »was Monsieur Doby Ihnen erzählt, er lügt immer soviel.«
Schlump hatte sich eingewöhnt in Loffrande, und er vergaß beinahe, daß er Soldat war. Er machte seine Meldungen pünktlich und setzte allen Ehrgeiz drein, keinen Termin zu verpassen. In den landwirtschaftlichen Fragen ließ er sich von Monsieur Doby beraten, und es verrieten alle seine Maßnahmen eine erstaunliche Fachkenntnis, und niemand hatte Grund, mit ihm unzufrieden zu sein. Es herrschte Ordnung, und abgesehen von den Kanonen, die von der Front herüberbrummten, herrschte tiefer Frieden in seinen drei Dörfern.
Nichts als Bauern gab es in Loffrande, und einen Schmied. Aber keinen Schuster, Schneider, keine Krämer, nichts. Die Bäuerinnen kauften ihre Seife, ihre Töpfe, ihren Kram in Mons-en-P. ein. Sie kamen zu diesem Zwecke alle Dienstage zusammen, denn sie durften ohne militärische Erlaubnis den Bezirk der Kommandantur nicht verlassen. Und dann zogen sie los, und Carolouis torkelte hinter ihnen drein und geleitete sie treulich und hütete sie vor Gendarmen und anderer Obrigkeit. Aber einmal kam Carolouis wütend zurück und schimpfte wie ein Rohrspatz. Es hatte ihn eine tête de baudet genannt. Sonderbarerweise wußte er recht wohl, was das bedeutete. Sonst stand er mit dem Französischen nicht eben vertraulich. Er wunderte sich, daß sie fourche sagten, wenn sie eine Gabel meinten, wo Furche doch etwas im Felde ist, das man mit den Pferden gräbt. Er schüttelte den Kopf und konnte die Franzosen nicht begreifen. Aber von nun an zog er nicht mehr mit den Bäuerinnen nach Mons-en-P. Außerdem hatte er ja auch auf dem Felde zu tun.
Schlump bestellte Soldaten aus dem Feldrekrutendepot, seine Kameraden. Die sollten den Weibern gebieten. Das waren nette, gute Kerle, die ihre Sache vorzüglich machten. Einmal kam einer, der die Mütze kerzengerade auf dem Kopfe hatte. Er war zwanzig Jahre alt und Supernumerar von Beruf und ein sehr sauberes Bürschchen. Er wußte wohl, daß man zu solchen Aufträgen nur die Klügsten nahm, und meldete sich stolz bei Schlump und sah ihn ein wenig verächtlich von oben bis unten an. Denn Schlump hatte die Mütze schief auf dem Kopfe, und sein Hosenboden hing immer noch etwas herunter. Die Frauen versammelten sich draußen vor der Kommandantur, und Schlump instruierte den Rekruten mit kurzen Worten: daß er die Frauen anstellen müsse zu vieren, am besten in Gruppenkolonne, daß er sie in Mons-en-P. von einem Laden zum anderen führen und daß er sie wieder ordentlich zu Hause abliefern müsse. Dann ging der Rekrut erhobenen Hauptes hinaus. Die Bäuerinnen zogen los, als sie ihn kommen sahen, und einige waren schon ein ganzes Stück voraus. Unser Rekrut rannte ihnen aber nach und hielt sie am Arm fest und zog sie wieder zurück. Die Bäuerinnen waren starr, sie guckten einander an und wußten nicht, was sie sagen sollten. Die ersten blieben wirklich stehen, aber die fünfte wehrte sich und stürzte zurück zu den anderen. »Mais il est fou, ce Prussien! Il est maboule, hein?« Und sie schnatterten aufgeregt und erbost und fuchtelten mit ihren dicken Regenschirmen. Aber der Rekrut ließ nicht locker. Er wurde hochrot im Gesicht und schnaufte und kommandierte, und schließlich hatte er sie wirklich einigermaßen zusammen und zog mit ihnen ab und marschierte an der Seite als Zugführer. Unterwegs traf er seinen Hauptmann. Er kommandierte: Abteilung marsch! und wichste die Beine im Paradeschritt heraus. Der Hauptmann blieb starr vor Staunen auf der Straße stehen und sah ihm lange nach. Schlump hatte mit Herrn Doby hinter der Gardine gestanden und sich halb totgelacht.
Die Amazonen kamen glücklich auf dem Marktplatz in Mons-en-P. an – und mit einem Mal waren die Frauen verschwunden. Die eine lief dahin, die andere dorthin, und der Rekrut konnte gerade noch die letzte am Rocke festhalten. Die aber wehrte sich und wurde falsch und klopfte ihm mit dem Schirm auf die Finger und lief laut gackernd davon. Der arme Junge stand bestürzt da, allein mitten auf dem Marktplatz, und wußte nicht, was er machen sollte. Zurück zu seiner Kompagnie wagte er sich nicht, denn er konnte ja nicht melden, daß er den Befehl richtig ausgeführt hätte, und nach Loffrande zurück mochte er auch nicht gehen. So blieb er eine Weile stehen. Dann drehte er sich langsam um und schlich nachdenklich in die Kantine. Er machte sich die schlimmsten Gedanken, er fürchtete, womöglich vor ein Kriegsgericht gestellt zu werden. Er saß lange in der Kantine, die Ellbogen auf den Tisch gestützt, und machte ein ängstliches Gesicht.
Um fünf Uhr nachmittags aber sah er ein paar bekannte Röcke über den Marktplatz kommen und vor der Kantine warten, und nach wenigen Minuten waren sie alle wieder beisammen. Und friedlich, diesmal nicht in Gruppenkolonne, zogen sie wieder nach Hause.
Schlump schob dem Kameraden ein paar gekochte Eier in die Tasche für die Angst und lobte ihn und bestätigte ihm, daß die Sache gar nicht so einfach sei.
Die Woche ging zu Ende, und es gab eine Menge Berichte zu machen. Jeden an eine andere Stelle. Denn unser braves deutsches Heer war bis ins Kleinste organisiert, und es gab viel Vorgesetzte, die im Rücken der Kanonen ihres Amtes walteten. Die einen wollten jede Woche wissen, wieviel Heu er zur Verfügung hatte, die anderen, wieviel Getreide, Kartoffeln und Saatgut, die dritten, wieviel Schaufeln, Spaten und feste Säcke, die vierten, wieviel in der Woche geackert war und geeggt und gesät, wieviel schon vorher getan und wieviel noch zu tun war, die fünften erkundigten sich nach der Einwohnerzahl und nach der Anzahl der gefangenen Russen, die in seinem Bezirk beschäftigt waren. In dem letzten Falle durfte er jede Woche eine »Fehlanzeige« machen. Er arbeitete fleißig und machte sich von jeder Meldung eine Abschrift, die er in einer besonderen Mappe aufbewahrte. Denn oft kamen Rückfragen, und dann war es peinlich, wenn man nicht wußte, was man gemeldet hatte. Dann kam Monsieur Bartolomé herein, der am besten säen konnte im ganzen Dorfe. Er holte die Schlüssel zum Saatboden und ließ jeden Tag die Tür hinter sich offen. Und jeden Tag fluchte Schlump wie ein Bauer und schrie hinter ihm drein: »Clos chl’huis, nom di Diou!« Bartolomé kehrte um, grinste und sagte in gutem Französisch: »Pardon, Monsieur, je n’y pensais pas.« Dann rückte er ab mit den Schlüsseln und klapperte mit den riesigen Hölzern, an denen sie hingen.
Er war kaum hinaus, da ging die Tür wieder auf. Aber diesmal kam ein wilder kleiner Teufel mit schwarzen Haaren und schwarzen Augen: die Marie. Sie hüpfte auf Schlump zu, nahm ihn an beiden Händen, zog ihn hinter seinem Tisch vor in eine Ecke, wo man sie nicht sehen konnte. Dort schlang sie ihre beiden Arme um Schlump und küßte ihn so kräftig, daß er keine Luft kriegte. Aber Schlump wußte Rat. Er packte sie noch derber und küßte sie noch toller. Sie zappelte in seinen Armen wie eine Katze und wollte ihm entwischen. Da hob er sie auf und trug sie hinter in sein Stübchen, in dem es weiter nichts gab als sein Bett und einen alten Schrank. Er spürte ihre kleine, feste Brust und drückte sie fest, sie strampelte mit den Beinen, und es entspann sich ein heißer Kampf, jener ewig alte, schöne Krieg, bei dem das Unterliegen ebenso süß ist wie das Siegen. Und Schlump war nahe daran, den Sieg zu erringen, und die Marie war dabei, mit vieler Lust zu unterliegen – da klingelte das Telephon.
Schlump war immerhin noch Rekrut. Er gehorchte brav und ließ den Teufel liegen und seinen Sieg im Stich und ging ans Telephon. Er nahm den Hörer ab und horchte: »Von Nordwesten feindliche Flieger im Anmarsch. Meldung weitergeben!« Diese Meldung kam fast alle Tage und oft in der Nacht. Sie war nicht unnütz, denn schon einmal hatten englische Flieger ihren Unrat abgeworfen unter die Frauen und Mädchen von Loffrande. Sie hatten eine getötet und mehrere schwer verletzt. Aber es gab keine Fabriksirene im Dorfe, und Schlump konnte nicht warnen, denn ehe er aufs Feld lief oder in die Scheunen zu den Frauen, wäre alles schon geschehen.
Er hing den Hörer wütend wieder an und stürmte zurück in sein Nest. Aber der Vogel war ausgeflogen, und Schlump merkte, daß er eine Dummheit gemacht hatte.
Die Marie aber ist nicht wiedergekommen, und wenn ihr Schlump begegnete, sah sie ihn kaum an und ließ ihn merken, daß sie ihn verachtete. Da merkte er erst recht, daß er ein Schafkopf gewesen war.
Später, nach Jahren, als der Krieg zu Ende ging, unterhielt sich Schlump mit einem alten Landsturmmann über das Leben. Der sagte zu ihm: »Siehst du, mein Junge, ich bedaure und bereue nur eins: alle die Augenblicke, wo ich versäumt habe, einem hübschen Mädchen gut zu sein.« Da dachte Schlump an Loffrande.
Wenn die Bauern in ein anderes Dorf oder in die Stadt gehen wollten, um einen Freund oder eine Schwester zu besuchen oder um Wäsche zu kaufen oder einen Hut, dann mußten sie von Schlump einen gelben Ausweis holen. Schlump hatte für solche Fälle den Freitag festgesetzt, wo sie mit ihren Groschen kamen, um die gelben Laissezpassers zu holen. Und wenn dann die Bauern die Feder nahmen, um ihre Unterschrift zu geben, dann malten sie drei schiefe Kreuze hin, die aussahen wie zerbrochene Leichensteine. Darüber staunte Schlump sehr, und er erzählte ihnen, daß bei ihm zu Hause in der Heimat nicht bloß die Bauern, sondern auch die Kühe lesen und schreiben konnten.
Am Nachmittag pflegten die Mädchen zu kommen. Oft ein Dutzend und mehr. Da war die liebliche blonde Céline mit den lebhaften Augen und dem Näschen wie eine kleine Maus. Sie hatte ein feines zartes Fell, das in der Sonne sanft schimmerte, und schnupperte ununterbrochen mit den feinen schlanken Nüstern. Dann kam die braune Suzanne mit den großen braunen Augen und den braunen Locken, die über die Stirn heruntertanzten, um die schlimmen Gedanken zu verstecken. Sie hatte einen Körper wie eine Gazelle und lange, schlanke, lüsterne Finger. Und dann die blasse Jeanne mit dem schwarzen Haar. Sie hielt sich gerade und hatte einen weichen, leisen Tritt und legte den Kopf in den Nacken und schob die Schenkel vor, die sich hinaufwölbten nach den weichen Hüften. Und andere schöne Mädchen, denen der Schalk in den Augen lachte. Sie wollten am Sonntag alle in die Kirche gehen zu Monsieur Cahot, dem hübschen, ernsten Pfarrer. Auch die große Marianne mit den üppigen roten Backen und hoher gesunder Brust und mit den schönen Zähnen. Und neben ihr die kleine Anne. Sie hatte ganz wasserblaue Augen und zwei winzige Brüste und eine bläulich schimmernde zarte Haut. Sie sprach fast nie, aber sie schaute immer, und oft atmete sie heftig, und dann glühten ihre Augen auf wie Diamanten im Mondlicht.
Es dauerte bis zum Abend, bis er sie alle loshatte. Denn die Mädchen waren übermütig und machten dem armen Schlump das Leben schwer. Sie drängten sich um ihn und sprachen alle auf ihn ein und ganz schnell und ganz tolles Zeug, damit er sie nicht verstand. Dann lachten sie und stießen sich mit den Ellbogen und blitzten den armen Schlump mit ihren Augen an. Sie diktierten ihm dummes Zeug, wenn er schrieb, und nahmen die falschen Ausweise mit. Endlich waren sie fort, und Schlump hörte sie alle davontrippeln.