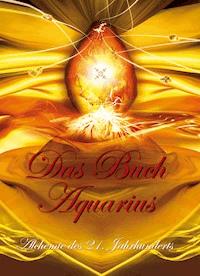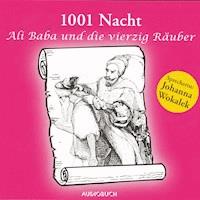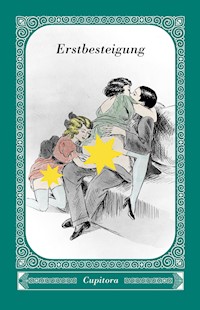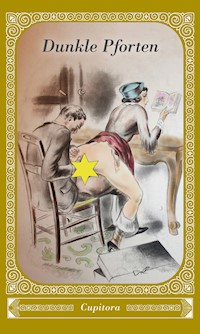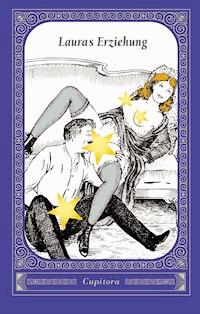Ein unsittlicher Tatsachenbericht aus dem Jahre 1916, versehen mit vielen eindeutigen Zeichnungen.
Das E-Book Schlüpferstürmer wird angeboten von Cupitora und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Porno, Sex, pornographische Zeichnung, Rex Gildo
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 169
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Exklusiv für unsere Leser
Schlüpferstürmer
„Allem kann ich widerstehen,
nur der Versuchung nicht.“
Ein unsittlicher Tatsachenbericht aus dem Jahre 1916, versehen mit vielen eindeutigen Zeichnungen.
eISBN 978-3-95841-734-2
© 2017 by Cupitora in der BEBUG mbH, Berlin
1.
Elf Uhr nachts – Friedrichstraße … Der in der ganzen Welt bekannte Höllenspektakel tobt durch die schmale, taghell erleuchtete Straße. Es ist, als hätten hunderttausend Teufel sich hier Rendezvous gegeben, um an dieser Stelle ihre durch Beelzebubs Großmutter in Schranken gehaltene Fröhlichkeit auszutollen. Und dabei sind es doch nur Menschen, die dieses erstaunliche Konzert vollbringen, allerdings Menschen, deren einzige gegenwärtige Sorge darin besteht, sich zu amüsieren, und nach der lieben Art der Berliner, sich möglichst laut zu amüsieren. In das Lachen, Schreien und Quietschen der Passanten und Passantinnen schrillt das Kreischen der Zeitungsverkäufer hinein: »Neueste Nummer der ›Wahrheit‹«, »Das Warenhaus als Bordell!« – »Heiratszeitung – letztes Rettungsmittel!« – »Sensationelle Enthüllungen der ›Tribüne‹ über die Gräfin Waltensleben!« Den Grundbass zu dem Chorus bildet das Tuten der vorübersausenden Autos, das Dröhnen der großen Omnibusse, das Klappern der Droschken, das Klingeln der Elektrischen – – mitten drin als Glanzeffekt übertönen zwei kreischende Weiberstimmen das Ganze – irgend zwei der beputzten und bemalten Dämchen sind aneinandergeraten.
Johlend, schreiend sammelt sich die Menge um die zwei Feindinnen. Man hetzt sie aufeinander wie zwei Kampfhähne – sie werden wild, die Worte genügen nicht mehr; die Schirme treten in Aktion, die Zöpfe fliegen, die schönen Hüte gehen in Fransen – und der gut gekleidete Mob amüsiert sich – – bis die Pickelhauben der Schutzleute auftauchen.
Der Strom flutet weiter, hinauf, zurück, ergießt sich in die Leipziger Straße, füllt den Leipziger und den Potsdamer Platz. Vornehme Viveurs, die den Rummel einmal mitmachen, elegante Damen, ängstlich an den Arm des Kavaliers geschmiegt, daneben die Talerdirne, die sich in irgendeinem Hausflur die Röcke aufhebt, Arbeiterinnen, Ladenmädels, Kommis, Offiziere in Zivil, Studenten, Hochstapler, Bankdirektoren, Taschendiebe, Kriminalschutzleute, Demimondainen – – wie aus Satans Höllenkessel herausgeblasen, quirlt und zischt das alles durcheinander. –
An der Seite des Stromes, der sich langsam, aber unaufhaltsam vorwärtsschiebt, schleicht sich scheu ein kleines, sechsjähriges Mädel. Barfüßig, ohne Hut, in elende Fetzen gehüllt, äugt die Kleine scharf nach den Passanten. Oh, sie ist schlau und gerissen! Sie drängt sich nicht an die jungen Männer, sondern an die Alten und die ganz Alten und bietet ihnen mit zittriger, flehentlicher Stimme ein paar Schnürsenkel oder ein Päckchen Streichhölzer an. Schmierig und zerzaust ist sie wie ein Straßenköter, aber die nackten Beine sind rund, und wenn sie sich an so einen Wackelgreis heranmacht, reibt sie sich lüstern an seinem Knie und Schenkel. Sie versteht’s! Da ist Keiner, der ihr nicht einen Groschen schenkt. Und wenn einer grad’ Handschuhe anhat, greift er ihr auch wohl unters Kinn und drückt ihr dann zwanzig Pfennig oder gar einen Fünfziger in die kleine, harte Hand.
Oh, sie versteht ihr Geschäft! Wie ein Fuchs beschleicht sie ihre Kunden, hängt sich hartnäckig an sie an und lässt sie nicht eher aus den Klauen, ehe sie nicht ihren Groschen hat. Dabei ist sie immer bereit, vor der ersten besten Pickelhaube durchzubrennen und frech wie ein Feldspatz doch wieder auf ihren Beuteplatz zurückzukehren.
Bis eins harrt sie auf ihrem Posten aus. Bis der große Strom nachlässt und vor allem ihre besten Kunden – die alten Herren – aus ihm verschwinden. Dann hastet sie über die Behrens- und Königstraße dem Alexanderplatz zu, biegt in die Prenzlauer Straße ein und verschwindet schließlich in einer stockfinsteren, schmutzigen Nebengasse. Durch ein offenes Kellerfenster kriecht sie in das düstere, fünf Stock hohe Haus, klettert die schlüpfrige Kellertreppe empor, geht über den Hof und steigt im Hinterhaus drei Treppen in die Höhe, klinkt eine angelehnte Türe auf, tritt in eine übelriechende Küche, turnt über viele Schlafende hinweg, die da am Boden liegen, schiebt sich in das anstoßende Zimmer und ist daheim.
Dieses Zimmer, das nicht viel größer ist als die Küche, beherbergt nicht weniger als sechs Personen, die sich auf zwei Betten und ein schmales Sofa verteilen. In dem einen Bett schlafen Lores Eltern mit dem Jüngsten, das die Mutter noch an der Brust hat, in dem andern zwei Schlafburschen, während auf dem Kanapee Fritz, Lores zehnjähriger Bruder, es sich bequem gemacht hat.
Niemand achtet auf den Eintritt des Kindes, das sich in der Finsternis an den Schrank tastet, ein Stück Brot herauslangt und sich mit diesem lukullischen Abendbrot zu dem Kanapee schiebt, in dessen unterer Ecke sein Lager bereit ist. Auf dem Wege dorthin muss es das Bett passieren, in dem die zwei Schlafburschen liegen.
Da fühlt sich Lore plötzlich von einer Hand festgehalten, die aus dem Bett heraus nach ihrem Rocke greift. Der lange Wilhelm ist’s, ein sechzehnjähriger Arbeiter, der sie an sich zu ziehen versucht.
»Du, Lore, komm mal her!«, flüstert er mit heiserer, leiser Stimme.
Aber die Kleine ist so müde und hat gar keine Lust. Sie hat nur ein Verlangen – sich gut auszuschlafen.
»Nee – lass mir – –«, murmelt sie und versucht, sich loszumachen.
»Ick schenk dir ’n Jroschen.« Und er zieht sie ganz ans Bett heran. »Ick liege schon die ganze Nacht und laure uff dir. Der Schwanz steht mir wie ’n Donnerwetter.«
Weder der Groschen, noch das Donnerwetter können Lore reizen. Sie ist zu müde und zu hungrig.
»Nee, nee – Willem – – ick bin heute zu müde.«
»Ick jebe dir zwee Jroschen – gleich vorher – da« er kramt unter seinem Kissen sein kleines, zerfetztes Portemonnaie hervor und drückt ihr zwei Groschen in die Hand.
Zwei Groschen sind mehr als einer. Lore beginnt zu schwanken.
»Du bist ’n Aas«, zischt Wilhelm, »wenn de jetzt kommst, kriegste nachher noch ’n Jroschen.«
Das entscheidet.
»Jibste mir ooch janz bestimmt den annern Jroschen?«
»Natierlich! Nu mach’ aber schon!«
Da lässt sich Lore neben ihn ins Bett fallen. – Wilhelm ist kein zärtlicher, sanfter Liebhaber. Ohne viele Umstände geht er gleich auf sein Ziel los, schiebt ihr die Röcke zurück, und während er sein Bajonett pflanzt, tut sie apathisch die Schenkel auseinander und beißt in ihr Stück Brot.
Der Hunger ist größer in ihr als der Durst nach Liebe. Wilhelm arbeitet wacker auf ihrem kleinen Bauch und sie verzehrt dabei ihr Abendbrot. Natürlich kann sie gleichzeitig nicht mit dem Feuer bei der Sache sein, das ihr Bereiter für wünschenswert hält. Er gibt ihr einen derben Knuff in die Seite zur Ermunterung.
»So rühr’ dich doch!«, keucht er. »Wie ’n Klotz liegste da!«
Mechanisch schiebt Lore mit dem kleinen, runden Popo ein paarmal auf und nieder, und das genügt schon, um bei Wilhelm den Feuerstrom aller Freuden auszulösen. Wie aus einer Pumpe spritzt er in Lores Loch, das trotz ihrer sechs Jahre schon so groß ist, dass es Wilhelms Wonneinstrument so ziemlich in sich aufnehmen kann.
Befriedigt lässt sich Wilhelm von ihr herunterfallen und sie schlüpft aus dem Bett, dessen zweiter Inhaber gar nichts von dem Ritt gemerkt hat, den die Zwei miteinander ausführten.
»Wat is mit mein’ Jroschen?«, fragt sie.
»Mach’, dass de wegkommst, sonst jeb’ ick dir eens in die Fresse«, brummt er.
Verschüchtert wagt Lore keinen Protest mehr gegen diesen Wortbruch und schleicht zu dem Kanapee. So gut sie kann huschelt sie sich in die freie Ecke zurecht und fünf Minuten später schläft sie fest und ruhig.
***
Es ist schon lange her, dass Lore die Beine auseinander gibt, wenn es ein Mann oder ein Junge von ihr verlangt. Aber sie ist schlau; umsonst tut sie’s nicht, wenn sie nicht grade mit Gewalt dazu gezwungen wird. Fünf Pfennige sind ihre geringste Taxe, aber für ein Stück Kuchen lässt sie sich eventuell auch schon bereitfinden. Minett macht sie nicht unter einem Groschen – mit einem Worte, sie ist die richtige kleine Hure, die sich mehr des Profits halber als um des Vergnügens willen auf den Rücken legt.
Mit fünf Jahren wurde ihre Jungfernschaft die Beute eines fremden Mannes, der sie vom Hof, wo sie mit ihren Freundinnen spielte, auf den Abort lockte. Er hielt ihr ein blankes Fünfzig Pfennigstück vor die Nase und für fünfzig Pfennig wäre Lore, die mit dem frühreifen Verstande des Proletarierkindes den Wert des Geldes kannte, bis ans Ende der Welt gegangen.
Sie wusste ganz genau, was der Mann von ihr wollte, zumal damals die Vergewaltigungen kleiner Mädchen in Berlin an der Tagesordnung waren. Einen Moment lang zögerte sie – wenn ihr der Mensch auch so den Bauch aufschlitzte, wie sie es mit der Trude Schulz aus der Linienstraße gemacht hatten? Aber der sah so nett und freundlich aus! Und vor allem: Das Fünfzig-Pfennigstück wirkte!
Also ging sie mit. Kein Mensch sah sie, wie sie in dem Klosett verschwanden. Aber bevor sie noch die Türe hinter sich zumachte, ließ sie sich das Geld geben.
Wie ein geiler Bock fiel der Fremde über sie her. Er setzte sich auf das Brett und riss sie auf seinen Schoß. Während er ihr mit der einen Hand den Mund zuhielt, fuhr er mit der andern zwischen die Beine und bohrte ihr seinen großen, dicken Zeigefinger in die eng geschlossene Scheide. Der Schmerz war furchtbar und sie versuchte, sich loszureißen; allein mit brutaler Faust hielt er sie fest und bohrte sich zwischen ihren Lefzen durch! Mit einem einzigen brutalen Stoß riss er ihr die Scheide auseinander – sie fühlte nur noch, wie ihr das Blut über die Beine herunterschoss, dann wurde sie ohnmächtig.
Als sie wieder zu sich kam, lag sie in einem schönen weißen Bett und ein Mann mit einer goldenen Brille und eine Frau in einem schwarzen Gewande und einer weißen Haube betrachteten sie aufmerksam. Ihr erster Gedanke waren die fünfzig Pfennig, aber sie getraute sich nicht, danach zu fragen, sondern schlürfte gehorsam die warme Suppe hinunter, die ihr die Pflegeschwester einlöffelte.
Drei Wochen lag sie im Krankenhaus, wo es ihr sehr gut gefiel. Sie konnte schlafen, solange sie nur wollte, bekam gut zu essen und zu trinken und man war immer nett und freundlich zu ihr. Einmal kamen zwei Herren von der Polizei, die sie nach dem Menschen ausfragten. Was ihr passte, erzählte sie, was ihr nicht passte, verschwieg sie. Für ihr Leben gern hätte sie sich nach dem Verbleibe des Geldes erkundigt, aber aus Angst, man würde sie dann strafen, weil sie freiwillig mitgegangen, schluckte sie die Frage danach hinunter. Man hatte sie blutüberströmt und bewusstlos gefunden, der Kerl war natürlich längst schon verschwunden. Man hat ihn auch nie erwischt.
Nach diesem Abenteuer, das um ein Haar hätte schiefgehen können, dauerte es nicht lange, bis Lore das Vergnügungsobjekt der Hausbewohner wurde. Der erste, der sich an sie heranmachte, war ihr Bruder Fritz.
Eines Tages, als die Kinder allein im Zimmer waren, fragte er sie unvermittelt:
»Du, Lore, wat hat eijentlich der Mann mit dir jemacht?«
Lore spielte gerade eifrigst mit einem zusammengedrehten Klumpen Fetzen, der eine Puppe vorstellte und gab daher nicht gleich Auskunft. Ihr Bruder kam auf sie zu und stellte sich vor sie hin.
»Hörste nich?«, schrie er sie an. »Wat hat denn der Mann mit dir jemacht?«
»Wat für’n Mann?«
»Na der auf’t Klosett, stell’ dir man nich’ gar so dämlich. Du weeßt schon.«
»Ach so, der! I – det war ’n Schwein!«
»Wieso? So rede doch! Ich habe neulich, wie ich mit Vattern unten in de Destille war, jehört, wie eener, der mieße Brandt, jesagt hat, der Kerl müsste dir mit ’n Messer ’n Stich versetzt haben.«
»I wo. Mit de Hand hat er mir hinjejriffen.«
»Wat – mit der Hand – jleich rin in dein Loch?«
»Ja.«
Fritz setzte sich neben seine Schwester auf die Erde und blickte interessiert auf eine gewisse Stelle ihres Rockes.
»Wie hat er denn det jemacht? Vielleicht so?« Und schwupp war er mit der Hand zwischen ihren Beinen.
»Aber Fritz, biste überkandidelt? Wat willste denn da?«
Fritz war mächtig in Rage.
»Lass mir man – du – weeßte, ick habe jestern zujesehen, wie et Ede mit seiner Schwester Mieze jemacht hat. Er hat ihr sein Ding rinjesteckt da in det Loch – – –«
»Hat’s ihr ooch so weh jetan?«
»Nee – sie hat ihm noch beijeholfen. Mir wollte sie ooch ranlassen, aber da kam ihre Olle dazwischen. Wir könnten det ja ooch mal zusammen probieren. Willste? Die Mieze sagte, et schmeckte wunderschön.«
Lores Neugier wurde rege. Also legte sie sich auf den Rücken und spreizte die Beine, wie es ihr Bruder verlangte. Fritz hatte einen regelrechten Ständer, aber weil er noch so ungeschickt war, konnte er nicht gleich den richtigen Anschluss finden. Mit seinem kleinen, holzsteifen Pflöckchen stieß er sie immer gegen den Bauch, bis sie ungeduldig wurde.
»Du«, sagte sie, »det kann ich aber nich schön finden.«
»Ick bin noch nich drinnen. Steck’ du ihn mal rin.« …
Das tat sie. Da ihre Scheide durch den brutalen Angriff jenes Fremden einmal geöffnet war, bereitete ihr das keine großen Schwierigkeiten.
»Nu pass mal uff«, knirschte er und legte los.
Und siehe da, die Geschichte war wirklich nicht übel. Zuerst tat es ein bischen weh, aber Fritzens Maschine war nicht so groß. Bald überwog ein angenehm kitzelndes Gefühl, und Lore folgte dem Beispiel des Bruders, der immer rauf- und runterfuhr. Schließlich fühlte sie, wie so ein paar warme Tropfen in ihr Inneres spritzten – gleich darauf machte Fritz einen tiefen Seufzer und fiel wie ein Klotz über sie. Als sie an sein Ding fasste, war es ganz glitschig und weich.
Von da an legten sie sich, sooft sie nur konnten, aufeinander. Und von einem Mal zum andern schmeckte es ihr besser, und schließlich genügte ihr Fritzens Schwänzchen nicht mehr. Er musste ihr seine älteren und größeren Freunde zuführen und je stärker so einer armiert war, desto freudiger nahm sie ihn auf.
Oh, sie arbeitete schon fest mit und gab redlich Stoß um Stoß zurück. Ja, sie lernte es sogar, die Scheide so fest zusammenzupressen, sodass sich der Schwanz, der drinnen steckte, nicht rühren konnte. Ihr Ruf verbreitete sich in der ganzen Umgebung und wie die Hunde einer läufigen Hündin, so liefen ihr die großen und die kleinen Jungen aus dem Scheunenviertel nach. Oft machte sie so ihrer sechse, sieben hintereinander glücklich.
Eines Tages überraschte sie einer der Schlafburschen ihrer Eltern, wie sie sich gerade wieder von ihrem Bruder bearbeiten ließ. Meinecke hieß er; er war ein schon ziemlich alter Mann, der einmal bessere Tage gesehen hatte. Er war paff, als er die beiden Rangen erblickte.
»Lasst euch man nich’ stören«, sagte er, gutmütig lachend, »aber wenn Ihr fertig seid, möcht’ ick ooch mal ’ne Nummer machen. Det kleene Luder scheint ja die Sache famos zu verstehen!«
Gesagt, getan. Nachdem Fritz von Lore heruntergekrochen, hob Meinecke sie auf seinen Schoß und nahm sie von hinten vor. Zum ersten Mal machte sie mit einem regelrecht ausgewachsenen Gliede eines Mannes Bekanntschaft. Das füllte sie voll aus und bereitete ihr solches Vergnügen, dass sie im Eilzugstempo darauf auf- und niederflog. Meinecke spuckte nur so vor Wonne.
»Da sieh mal Eener an – so ’ne Kröte – so ’ne kleene Hure – – wie se arbeitet – wat, det Ding schmeckt dir? – Det is ’ne Nummer? – man feste – feste – – ick schenk’ dir ooch ’n Groschen uff Bonbons – ah – feste – –«
Die Aussicht auf den Groschen heizte Lore noch mehr ein und sie absolvierte ihre Aufgabe zur denkbar größten Zufriedenheit ihres Gönners, der ihr auch sein Wort hielt und ihr den versprochenen Nickel spendierte.
Nun wusste sie, dass sie mit ihrem Löchelchen Geld verdienen konnte und gab es seitdem nicht mehr umsonst her. Höchstens, dass sie mal ihren Bruder Fritz aus schwesterlicher Liebe unentgeltlich naschen ließ. Aber sonst, wenn sie nicht gerade Einer im Keller oder auf der Treppe hinschmiss und ihr seinen Stempel mit Gewalt einpresste, wich sie nicht von ihrem Geschäftsprinzip ab. Die so verdienten Sechser und Groschen sparte sie sich in einem Winkel hinterm Herde.
2.
Vor allem bekam ihr das Geschäft körperlich. Sie entwickelte sich rascher und üppiger als die andern Mädchen, bekam runde, volle Glieder und sah mit zehn Jahren aus, wie eine Vierzehnjährige.
Natürlich betrieb sie dabei intensiv den Handel mit Schnürsenkeln und Streichhölzchen weiter, denn die daraus geschöpften Einnahmen bildeten einen wichtigen Bestandteil des elterlichen Budgets. Hie und da kam sie auch mit der Polizei in Konflikt, wenn sie’s mal gar zu arg trieb. Einmal musste sie die ganze Nacht auf dem Revier sitzen.
Alle diese Erfahrungen dienten nur dazu, ihre Lebensklugheit zu erhöhen. Sie war wohl das verschlagenste, gerissenste kleine Luder, das die Friedrichstraße unsicher machte.
Gott und alle Welt belog und betrog sie, und da war kein Mensch, der mit ihr fertig werden konnte. Ihre Mutter wusste ganz genau, dass das Paradies ihres Töchterleins ein Absteigequartier für Jedermann war, aber weil Lore eine gute Verdienerin war und keinen Abend unter zwei, drei Mark nach Hause brachte, schwieg sie still – aus Angst, der kleine Racker könnte ihr durchgehen und sich selbständig machen. Ja, sie bewunderte insgeheim ihre Tochter und pflegte ihre Meinung auch Jedem, der es hören wollte, mitzuteilen.
»Passen Se uff«, sprach die Wackere, »meine Lore, die bringt et noch zu wat janz Feinem. Die jeht sicher noch bei’s Theater oder in ’n Balllokal oder so wat sonst!«
Das Schicksal gab ihr recht. Die Lore machte Karriere.
***
An einem sehr stürmischen Herbstabend drückte sich die Kleine wie gewöhnlich auf der Friedrichstraße herum. Aber heute wollte das Geschäft gar nicht in Schwung kommen. Noch nicht eine Schachtel hatte sie bisher verkauft und wie die Aussichten bestanden, würde sie auch sehr wahrscheinlich ihren gesamten Vorrat wieder mit nach Hause schleppen. Bei dem Hundewetter machten die wenigen Leute, die auf der Straße waren, dass sie unter Fach und Dach kamen und schoben die Lore, wenn sie sich in ihrer bekannten Manier an sie herandrängte, ärgerlich beiseite.
Der Wind pfiff durch die Passage, heulte um die Ecke Friedrich- und Behrensstraße und peitschte den kalten Regen durch die Straßen. Zähneklappernd und zitternd an allen Gliedern presste sich Lore hinter einen Pfeiler des Lindentheaters und wartete geduldig, bis die Vorstellung zu Ende war. Wenn die Menschen aus dem lustigen Stück kamen, waren sie ja besser aufgelegt.
Aber auch diese Hoffnung täuschte.
Einer, den sie besonders arg bedrängte, drohte ihr sogar mit dem Schutzmann. Lore war wütend. Lore war verzweifelt. Lore weinte armdicke Tränen. Und so bot sie in ihrem kurzen, fadenscheinigen Röckchen, mit den schlotternden Gliedern und den tränenverschleierten Augen wirklich ein Bild des Jammers, das auch den härtesten und misstrauischesten Menschen rühren musste.
Da entdeckte sie im Gewühl einen alten, feingekleideten Herrn, der sich gerade vergebens bemühte, eine Zigarette anzuzünden. Wie eine Schlange schob sie sich an ihn heran.
»Ach, ick bitte, lieber Herr, sind Se doch mal so freundlich und koofen Se mir doch ’ne Schachtel Zündhölzchen ab. Ick habe heute noch nischt jejessen und meine Mutter is zu Hause krank.«
Der alte Herr sah mitleidig auf das armselige Geschöpf herab, das sich so flehentlich an ihn anschmiegte und sah, wie rund und fest die Beine waren, die unter dem Röckchen hervorlugten.
»Möchtest wohl was Gutes essen, mein armes Kind?«, fragte er mit weicher Stimme.
Lore merkte gleich, dass mit dem Alten da was zu machen wäre.
»Ach ja«, heulte sie los, »seit drei Tagen hab’ ick immer nur Brot jejessen. Mutter is ja so krank.«
Der »Olle« griff gerührt in seine Hosentasche und holte ein Fünfmarkstück heraus, das er Lore unter die Nase hielt
»Kennst du das?«
»Ja.« Lore konnte fast gar nicht reden, so sehr aufgeregt war sie beim Anblick des Mammons.
»Komm’ morgen zu mir. Lützowstraße 63, Regierungsrat Scheibler – wirst du dir das merken?«
Lore murmelte krampfhaft:
»Lützowstraße 63, Regierungsrat Scheibler – ick werd’ et nich verjessen.«
»Also komm’ morgen um fünf Uhr! Und da hast du inzwischen fünfzig Pfennig, damit du dir was zu essen kaufen kannst.«
***
Am nächsten Tage wusste Lores Mutter sich gar nicht zu fassen vor Erstaunen, als sie sah, wie ihr Töchterchen sich wusch, kämmte und zum Ausgehen rüstete.
»Wohin jehste denn?«
»Ich hab ’n Weg«.
In die näheren Details ihre Mutter einzuweihen, hielt sie nicht für notwendig. Ihre Streichhölzer und Schnürsenkel nahm sie mit, auch zog sie sich nicht ihr gutes Sonntagsnachmittagkleid, sondern ihre Bettellumpen an.
Oh, sie war schlau, die Lore!
Als sie in dem feinen, vornehmen Haus in der Lützowstraße die teppichbelegte Treppe emporstieg, ließ sie jedoch ihre gewohnte Frechheit im Stiche. Am liebsten wäre sie wieder umgekehrt und noch, als sie zaghaft die Hand an die Türglocke legte, musste sie sich mit aller Gewalt das große, schöne Fünfmarkstück vorstellen, um nicht noch im letzten Augenblicke zu verschwinden.
Sie erschrak selber, als sie die von ihr selbst gezogene Glocke drinnen im Korridor schrillen hörte.