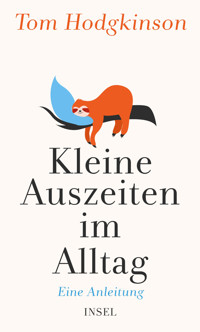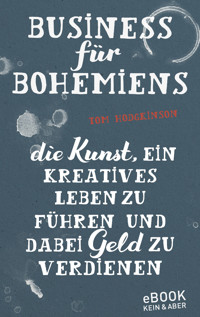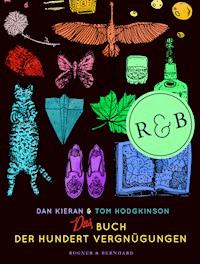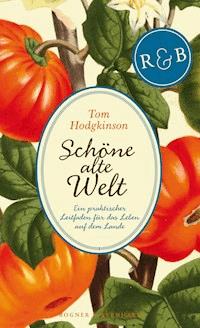
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kein & Aber
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Als Tom Hodgkinson, der »Prophet aller Faulenzer«, mit seiner Familie auf einen chaotischen Bauernhof in Devon zieht, hat er im Sinne, aus dem Hamsterrad des Kapitalismus auszusteigen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Aber das einfache Leben auf dem Lande ist komplizierter als gedacht. Er hält Hühner, Schweine und Kaninchen, seine Frau Victoria versucht sich als Imkerin, backt Brot und stampft Butter. Sie brauen mieses Bier und köstlichen Holunderlikör. Mit enzyklopädischem Wissen und wohldosierter Selbstironie führt uns dies Buch durch ein abenteuerliches Jahr auf dem Land.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 412
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Tom Hodgkinson
SCHÖNE ALTE WELT
Ein praktischer Leitfadenfür das Leben auf dem Land
Aus dem Englischen vonAnita Krätzer
1. Auflage, November 2011
Copyright © Tom Hodgkinson
Die Originalausgabe erschien 2011 unter dem Titel Brave Old World bei Penguin Books Ltd., Großbritannien
© der deutschen Ausgabe 2011
by Rogner & Bernhard GmbH & Co. Verlags KG, Berlin
ISBN 978-3-95403-030-9
e-Pub 978-3-95403-035-4
www.rogner-bernhard.de
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der mechanischen, elektronischen oder fotografischen Vervielfältigung, der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, des Nachdrucks in Zeitschriften oder Zeitungen, des öffentlichen Vortrags, der Verfilmung oder Dramatisierung, der Übertragung durch Rundfunk, Fernsehen oder Internet, auch einzelner Text- und Bildteile.
Lektorat: Evelin Schultheiß, Ahrensburg
Umschlaggestaltung: www.studiograu.de / Chrish KloseUmschlagabbildung: „Solanum Texanum“ von Francois van Houtte,aus: Flore des serres et des jardins de l’Europe, 1845Layout und Herstellung: Leslie Driesener, Berlin Gesetzt aus der Stempel Garamond durch omnisatz GmbH, Berlin
E-Book Konvertierung: Exemplarr Worldwide Ltd., Chennai, India
Für Alan und Alan,meine Landbaugurus
Wir müssen zurück zur Freiheit odervoran in die Sklaverei.
GILBERT KEITH CHESTERTON
Inhalt
Einführung
Januar: Hacke Holz
Februar: Grabe die Erde um
März: Säe aus
April: Hege das Geflügel
Mai: Backe Brot
Juni: Kümmere dich um die Bienen
Juli: Mähe die Wiese
August: Bringe die Ernte ein
September: Jage und sammle
Oktober: Braue Bier
November: Schlachte das Schwein
Dezember: Feiere
Dramatis Personae
Literaturverzeichnis
Einführung
Labor omnia vicit.
(Harte Arbeit siegt über alles.)
Vergil
So wichtig sie für unseren Alltag sind, so sehr werden sie von uns heute vernachlässigt. Die Rede ist hier schlicht von der Philosophie, der Landwirtschaft und der Heiterkeit. Philosophie ist die Suche nach der Wahrheit und die Erforschung der Möglichkeiten, gut zu leben. Landwirtschaft ist die Kunst, sich und seine Familie zu versorgen. Und Heiterkeit ist die wichtige Fähigkeit, sich gut zu amüsieren und das heißt, zu feiern, zu tanzen, zu scherzen und zu singen.
Diese Aspekte des Lebens wurden in der schönen alten Welt noch aktiv gepflegt. Mit »schöner alter Welt« meine ich die Zeit vom antiken Griechenland bis zum Ende des Mittelalters, die zweitausend Jahre also von ungefähr 500 v. Chr. bis 1500. Die alte Welt endete gegen 1535 mit der Reformation, dem Calvinismus, der Renaissance und der Plünderung und Zerstörung der Klöster. Die Philosophie, die Landwirtschaft und die Heiterkeit sind zwar weiterhin gepflegt und verfeinert worden und werden es von ein paar wackeren Seelen bis heute. Dennoch sind sie mit der industriellen Revolution unwiderruflich auf den zweiten Platz geraten hinter die Arbeit, die seitdem für die meisten Menschen Lohnsklaverei bedeutet, also langweilige Arbeit, die einen anderen reich macht – das Unternehmen und seine Aktionäre – oder dem Wohl des bürokratischen, totalitären Staates dient.
In der alten Welt war die kultivierte Muße der wichtigste Teil des Lebens. In der neuen hat der Beruf den Vorrang. Die Kunst des Denkens ist Stück um Stück aus den Lehrplänen der Schulen gestrichen worden. Und die Kunst, seine eigenen Lebensmittel zu erzeugen, wurde ersetzt durch den Gang zum Supermarkt, wo alles, was man braucht, zu kaufen ist. Dadurch sind wir ärmer, nicht reicher geworden.
Mein Buch, das Unterhaltung mit praktischer Anleitung zu verbinden sucht, dient der Erkundung der alten Sitten. Dabei wird sich zeigen, dass es oft gute Sitten waren, die, würden wir sie heute übernehmen, unser Leben unendlich verbessern könnten. Dies ist in keiner Weise als Ausdruck einer schrulligen Nostalgie zu verstehen. Natürlich ist es unmöglich, eine Zeitreise in die Vergangenheit zu unternehmen. Wir stecken im Hier und Jetzt, und es gibt in der Moderne durchaus viel Positives. Aber die Angst, nostalgisch zu wirken, sollte nicht so weit gehen, uns davon abzuhalten, die guten Dinge in der Vergangenheit zu erkennen und wertzuschätzen. Wie Ovid in seinen Fasti im Jahre 8 schrieb:
Laudamus veteres, sed nostris utimur annis:mos tamen est aeque dignus uterque coli.
(Wir loben die alte, nutzen aber die neue Zeit:doch die Sitten beider Zeiten sind es wert, geehrt zu werden.)
So können wir ein Loblied auf die großartigen Beispiele technologischer Neuerungen wie das Buch und die Sense singen und gleichzeitig das iPad oder Skype und all die moderne Technologie genießen, die Huxley als »fast übernatürlich« bezeichnete. (Aber man frage sich einmal, welches von beiden – das iPad oder die Sense – es in tausend Jahren wohl noch geben wird.)
Dieses Buch legt den Schwerpunkt auf die selbstversorgende Landwirtschaft. Damit meine ich, dass man den eigenen Haushalt von einem beliebigen Ort, an dem man nach der Arbeit vor einem riesigen Fernsehschirm sitzt, in eine kreative und produktive Einheit verwandelt. Das im englischen Begriff »husbandry«, Landwirtschaft, steckende Wort »husband« leitet sich vom altenglischen »húsbonda« her und bedeutet ursprünglich »Leiter des Haushalts«. Gleichzeitig deutet das Wort auf einen umsichtigen und sparsamen Manager hin. »Husbandry« bedeutet hegen und pflegen – Tiere, Nutzpflanzen, die eigenen Kinder und sich selbst.
Als Vorbereitung für dieses Buch habe ich alte Texte über Landwirtschaft gelesen – unter anderem von Hesiod, Columella, Varro und Cato. Unübersehbar bildet Vergils großes Lehrgedicht Georgica einen zentralen Bezugspunkt. Im Mittelalter gab es – vor allem in Flandern – die wunderbare Tradition der Land- und Gartenbaukalendarien, auf die ich mich ebenfalls beziehen werde. Es handelt sich dabei um immerwährende Kalender mit einem speziellen Zahlenschlüssel, über den sich der jeweilige Wochentag zu einem bestimmten Datum ermitteln lässt. Diese Kalendarien sind mit wunderschönen kleinen Bildern illustriert, die Männer und Frauen bei ihren Tätigkeiten zeigen. Praktisch jeder Landwirt hatte ein solches Kalendarium an seiner Wand hängen.
Ich habe gelernt, dass die Bücher über den Land- und Gartenbau eine eigenständige literarische Form darstellen: Das Lehrgedicht über den Landbau geht auf Hesiods Werke und Tage aus dem 7. Jahrhundert v. Chr. zurück und erreichte seinen Höhepunkt wohl mit Vergils Georgica. Ich verstehe mein Buch als einen bescheidenen Beitrag zu diesem Genre. Wie schon die vielen Autoren vor mir zitiere auch ich große Geister, etwa den liebenswerten Thomas Tusser, Autor des Tudor-Bestsellers Five Hundred Points of Good Husbandry. John Evelyns Gartenratgeber Directions for the Gardiner aus dem 17. Jahrhundert und William Cobbetts The English Gardener aus dem 19. Jahrhundert habe ich ebenfalls studiert wie auch die mittelalterliche Übersetzung der vorzüglichen Schriften über den Land- und Gartenbau von Palladius, einem römischen Schriftsteller aus dem 4. Jahrhundert.
Schöne alte Welt versteht sich auf keinen Fall als umfassender Ratgeber zur Selbstversorgung, sondern als Ergänzung zur jeweils eigenen Literatur über Land- und Gartenbau. Obwohl mein Buch eine Menge praktischer Tipps enthält, ist es vielleicht eher ein literarischer als ein praktischer Leitfaden und steht damit ganz in der Tradition der frühen Autoritäten: Auch Vergil hielt es nicht für nötig, selbst Bienen zu halten, um über sie zu schreiben, und stützte sich bei der Abfassung der Georgica auf frühere Experten. Bei William Cobbett war es ebenso: Viel von dem Material seines landwirtschaftlichen Ratgebers Cottage Economy stammte von einer alten Bäuerin. Und eines der großen Werke von John Evelyn über den Gartenbau war eine Übersetzung des französischen Bestsellers Le Jardinier François von Nicolas de Bonnefons. Evelyn, ein enger Freund von Charles II., hat auch ein brillantes Gartenbaukalendarium verfasst, das Kalendarium Hortense, das folgenden, für das 17. Jahrhundert typischen ausschweifenden Untertitel trug: »Oder: Des Gärtners Almanach; eine Anweisung, was er im Laufe des Jahres monatlich tun soll und welche Früchte und Blumen jeweils ausgereift sind«.
Die frühen Gartenbücher boten stets eine Mischung aus Belehrendem und Romantischem, aus Praktischem und Literarischem. Und natürlich muss man als Verfasser eines guten Buches über die Landwirtschaft nicht notgedrungen selbst ein guter Landwirt sein. Tusser, der in Eton und Cambridge studiert hatte, war sogar ein notorisch nicht erfolgreicher Landwirt. Seine persönlichen Versuche, mit der Landwirtschaft Geld zu verdienen, endeten angeblich allesamt in einer Katastrophe. Thomas Fuller, ein Zeitgenosse von Samuel Pepys, dem lebensfrohen Tagebuchschreiber, der vom »großen Tom Fuller« sprach, meinte in The Worthies of England über Tusser:
Dies könnte unser englischer Columella mit den Worten des Dichters sagen:
Monitis sum minor ipse meis.
(Ich werde meinen eigenen Grundsätzen nicht gerecht.)
Ovid
Niemand war in der Landwirtschaft theoretisch besser und praktisch schlechter als Tusser. Seine Fähigkeit lag also in der Kommunikation.
In Schöne alte Welt zitiere ich solche literarischen Größen und verbinde dies mit Geschichten aus meinem Leben auf einem angemieteten Bauernhof in Norddevon. Und ich muss zugeben, dass auch ich nicht besonders gut in praktischer Landwirtschaft bin. Leser meiner Anleitung zum Müßiggang kennen unser Anwesen als chaotischen Kleinbauernhof. Ich bin 2002 mit meiner Familie von London hierher gezogen, und seitdem haben meine Frau Victoria und ich vielerlei Erfahrungen im Land- und Gartenbau gesammelt. Wir haben Gemüse angebaut, Schweine und Hühner gehalten, sie getötet, zubereitet und gegessen. Wir haben ein Pony geerbt, und Victoria hat Bienen gezüchtet und verloren. Wir haben Frettchen in Kaninchenhöhlen geschickt und Kaninchen getötet und gehäutet. Wir haben lausiges Bier gebraut und wunderbaren Holunderblütenlikör hergestellt. Victoria hat Butter und Brot gemacht – die beste Butter und das beste Brot überhaupt. Wir haben Konfitüre, Essiggurken und Marmelade aus Zitrusfrüchten hergestellt. Wir haben Holz gehackt, gestapelt und getrocknet. Wir haben tausend Feuer angezündet und tausend Schnecken umgebracht. Wir haben Pastinakenwein gemacht und Eier verkauft.
Wir haben festgestellt, dass das einfache Leben außerordentlich kompliziert und auch sehr hart ist. Es steckt voller Enttäuschungen, schafft aber auch eine immense Befriedigung. Unterm Strich ergibt sich schlicht: Man spart eine Menge Geld und bereitet viel besseres Essen zu. Dabei verbindet man sich mit der lebendigen Welt, mit der Natur, mit dem Kosmos und auch mit der alten Tradition der Hauswirtschaft, der Haushaltsführung, des Landbaus oder wie immer man es nennen will. Sich auf diese Weise selbst zu versorgen heißt, sich von der Welt der Supermärkte mit ihren extrem niedrigen Preisen und ihrer extrem niedrigen Qualität abzukoppeln. Man fühlt sich gesund und ganz.
Doch es ist weder möglich noch besonders erstrebenswert, komplett zum Selbstversorger zu werden. Autarkie setzt eine willentliche Abschottung von anderen voraus, während es bei der Landwirtschaft darum geht, die Arbeit und das Wissen zu teilen. Ich liebe Bücher, aber der beste Ratschlag kommt immer noch von dem Nachbarn, der das, was du vorhast, bereits hinter sich hat. Du brauchst Menschen, die dir helfen. Und wenn dein Geschäft gedeiht und du Leute als Hilfe einstellen kannst, dann ist das umso besser. Also: Stell Dinge her und verkauf sie.
Man muss seine eigenen Grenzen akzeptieren. Es ist schlicht unmöglich, seinen Lebensunterhalt zu verdienen und über Nacht ein akzeptabler Gemüsegärtner, Koch, Schlachter, Geflügelhalter, Schweinehirt, Waldarbeiter, Hausbauer, Bäcker, Konfitürenmacher, Heumacher, Imker, Brauer, Senner und Schreiner zu werden. Nicht mal in zehn Jahren ist das zu schaffen. Beginne klein und erwarte wenig.
All die genannten Tätigkeiten sind Künste und müssen als solche Schritt für Schritt und über viele Jahre erlernt werden. Man muss sie sorgfältig studieren, viele Bücher darüber lesen, Kurse besuchen und aus seinen eigenen Erfolgen und Misserfolgen ebenso lernen wie aus denen anderer Leute. Das bedeutet harte Arbeit. Glaub es nicht, wenn dir beispielsweise erzählt wird, es sei einfach, Gemüse anzubauen. Es ist nämlich ungeheuer kompliziert. Ich baue nun seit fünf Jahren Gemüse an. In diesem Jahr habe ich das Prinzip des Nichteingreifens, wonach man die Natur alle Arbeit erledigen lässt, endgültig aufgegeben. Ich habe es ausprobiert, und am Ende hatte ich eine fürchterliche Wildnis. Es war ein entsetzliches Durcheinander, und es war grauenhaft, auch nur daran zu denken – ganz zu schweigen davon, hinauszugehen und etwas dagegen zu unternehmen.
In diesem Jahr bin ich zum traditionellen Anbau zurückgekehrt und habe hart gearbeitet. Ich habe gegraben und gedüngt und Unkraut gejätet. Ich habe die Pflanzen mit Eierschalen und Gittern geschützt. Ich habe sogar biologisches Schneckenkorn eingesetzt, weil ich es zu deprimierend fand zuzusehen, wie meine Salatpflanzen in einer einzigen Nacht der Gier der üblen Schnecken zum Opfer fielen. Ich habe die Wege mit der Spatenkante abgestochen. Ich habe die Hühner ferngehalten. Und jetzt bereitet es mir Freude, in dem kleinen Gemüsegarten zu arbeiten. Es graut mir nicht mehr wie früher davor, meine Runden dort zu machen. Im Gegenteil: Ich freue mich darauf.
Obgleich es mir als Müßiggänger nicht ganz leicht fällt, dies zuzugeben: Gärten benötigen viel Pflege. Dazu Vergil im ersten Band der Georgica:
Labor omnia vicitimprobus, et duris urguens in rebus egestas.
(Harte Arbeit siegt über alles, unablässig harte Arbeit, und die in schweren Zeiten drückende Not.)
Die gute Nachricht ist, dass diese Plackerei tausendmal angenehmer und befriedigender ist als die tägliche Mühsal der Büroarbeit, die ohne wirkliches Ergebnis bleibt, das einen für seinen psychisch belastenden Einsatz entschädigen könnte. Dabei genügt eine Stunde pro Tag für einen kleinen Garten oder eine Parzelle, und gelegentlich kommen zwei oder drei Stunden fürs Graben oder Düngen hinzu. Wenn ich also von harter Arbeit spreche, meine ich wirklich nur einen geringen, aber regelmäßigen Aufwand und keine aufreibende Schufterei.
Der Titel dieses Buches spielt natürlich auf Huxleys Schöne neue Welt an, und Huxleys Titel wiederum ist ein Zitat aus Der Sturm. Ich will damit zum Ausdruck bringen, dass die alte Welt in der Tat schöner, weil aufrechter und wackerer war als unsere. Im Krieg sind die Ritter und Könige an vorderster Front ihrer Armeen ausgeritten und nicht, wie die heutigen Feiglinge in der Politik, in irgendwelchen Hinterzimmern geblieben, um von dort aus Tausende junger Männer in den Tod zu schicken. Früher kämpften wir, wenn unsere Freiheiten angegriffen wurden, um sie zu verteidigen. Wir ritten auf Pferden, gingen kilometerweit, schlugen Holz, bauten Gemüse an. Wir waren kühn, frei und stark. Heute drängen wir uns als kränkliche, unterwürfige Sklaven in den Arztpraxen, um amerikanische Medikamente und Wundermittel zu bekommen.
Doch was ist mit den Seuchen, den Qualen, den Zahnschmerzen? Nun, dieser Punkt wird von George Orwell in Der Weg nach Wigan Pier untersucht, wo er die »Anbetung der Maschine« als entmenschlichend kritisiert. Heute geht es um die »Anbetung der Technik«. Orwell fand sich auf der Seite der Angegriffenen wieder, als er die schöne alte Welt mit den Worten verteidigte:
In Wirklichkeit geht die Schelte des Mittelalters und der Vergangenheit im Allgemeinen, die von Apologeten der Moderne vorgetragen wird, meistens an der Sache vorbei, weil ihr eigentlicher Trick darin besteht, einen modernen Menschen in seiner Zimperlichkeit und seinem hohen Komfortbedürfnis in ein Zeitalter zu projizieren, in dem all dies völlig unbekannt war. … Trichtern Sie ihm das ein und erklären Sie ihm, dass Sie darauf aus sind, das Leben einfacher und härter statt weicher und komplexer zu machen, und der Sozialist wird gewöhnlich annehmen, dass Sie zu einem »Naturzustand« zurückkehren wollen – womit er irgendeine stinkende paläolithische Höhle meint …
Es wäre jedoch ein Fehler, der schönen alten Welt jeden Komfort abzusprechen. Sie war in Wirklichkeit sinnlicher, und die Menschen liebten prasselndes Feuer, Wein und Musik. Es gab viele Freuden. Vielleicht geht es im Kern darum, dass wir, bevor die Klimaanlagen und Einkaufszentren alles nivellierten, ein Leben der Kontraste führten. Man durchlebte von klirrender Kälte bis zu glühender Hitze alles. Dem Hungern folgte das Schlemmen, bitteren Tränen eine fröhliche Ausgelassenheit. Man lebte ein Leben voller Leidenschaft.
Einen eigenen Garten zu unterhalten heißt, die von Huxley beschriebene schöne neue Welt voll und ganz abzulehnen. In der schönen neuen Welt wird den Menschen beigebracht, zimperlich zu sein und die Natur zu hassen – es sei denn, sie ist etwas, wohin man reist und das man am Wochenende anstarrt. Beispielsweise steigen die Leute der schönen neuen Welt in Hubschrauber, um in irgendeinem Naturschutzgebiet ein Wochenend-Picknick zu veranstalten. Körperliche und seelische Qualen wurden in der schönen neuen Welt praktisch ausgerottet. Wenn einem alles ein wenig viel wird, nimmt man einfach einen Tranquilizer und ist vierzehn Stunden lang selig. Der Drang, Schmerzen auszuschalten, ist sicher ein Merkmal unserer modernen Welt, in der einem jederzeit Ibuprofen gegen körperliche und Antidepressiva gegen seelische Qualen zur Verfügung stehen.
Illegale Drogen wie Ecstasy werden vorwiegend in den westlichen Ländern genommen – von allen Altersgruppen und quer durch alle sozialen Schichten. Zu meiner Überraschung habe ich kürzlich erfahren, dass die Einnahme von Ecstasy beim britischen Landadel und seinen Höflingen – von den Fünfzehn- bis zu den Achtzigjährigen – groß in Mode ist. Für Schmerzmittel wird mit Slogans wie »Pack den Schmerz dort, wo er wehtut« geworben. Es gibt sogar eine amerikanische Bewegung, welche die vollständige Beseitigung des Schmerzes anstrebt. Es ist eine Welt der Behaglichkeit. Meine Mutter, der Archetyp der ehrgeizigen Pennälerin, findet dies alles wunderbar. Sie hat Schöne neue Welt gelesen und nicht gemerkt, dass es sich um eine Satire handelt. Sie hielt es für ein gelungenes Konzept. »Du musst nicht auf deine Kinder aufpassen. Es gibt keine Unordnung. Keine Natur. Welchen Nutzen hat die Natur überhaupt?«, sagte sie zu mir.
In Schöne neue Welt diskutiert der Weltaufsichtsrat für Westeuropa, Mustafa Mannesmann, gegen Ende mit dem Wilden über die neue Philosophie, bei der es um die Beseitigung der Unannehmlichkeiten geht:
»Aber ich liebe die Unannehmlichkeiten.«
»Wir nicht!«, versetzte der Aufsichtsrat. »Uns sind die Bequemlichkeiten lieber.«
»Ich brauche keine Bequemlichkeiten. Ich will Gott, ich will Poesie, ich will wirkliche Gefahren und Freiheit und Tugend. Ich will Sünde.«
»Kurzum«, sagte Mustafa Mannesmann, »Sie fordern das Recht auf Unglück.«
Wahrheit, Schönheit, Schmerz, Unglücklichsein: Die moderne Welt versucht, diese Dinge, denen wir in der alten Welt Tag für Tag begegnen, abzuschaffen. Ich sehe sie täglich auf meinem Gemüsebeet.
Können wir wirklich glücklich sein? Wollen wir glücklich sein? In der heutigen Welt ist eine ganze Industrie rund um die Vorstellung, dass wir glücklich sein können, erblüht: Da draußen gibt es Bücher und Seminare, die versprechen, die Geheimnisse des Glücks zu offenbaren. Es gibt Konferenzen und Seminare zu diesem Thema. Das englische Internat Wellington College bietet sogar Glücksunterricht an. Dieses Phänomen hat Huxley in seiner Einleitung von 1946 zu Schöne neue Welt – also zehn Jahre nach Erscheinen der Erstauflage – vorhergesagt. Huxley deckt auch die eigentliche Absicht auf, die hinter dem Glücksprojekt steht:
Die wichtigsten »Manhattan-Projekte« der Zukunft werden umfangreiche, von der Regierung geförderte Untersuchungen dessen sein, was die Politiker und die beteiligten Wissenschaftler »das Problem des Glücks« nennen werden – mit anderen Worten, das Problem, wie man Menschen dahin bringt, ihr Sklaventum zu lieben.
Huxley sagt, dass wir zur Erreichung dieses Ziels eine ausgefeiltere Methode zur Konditionierung von Kindern benötigen. Die wird tatsächlich schon in den Internaten angewandt, welche auf Kosten der Vermittlung von Grundlagen wie dem Einmaleins oder der Grammatik die beiden Ausbildungsziele Wohlbefinden und IKT (Informationsund Kommunikationstechnologie) ins Zentrum ihres Lehrplans stellen. Den Kindern wird von klein auf eingeprägt, dass sie in einer technologischen Utopie leben und Glück haben, nicht in der schrecklichen Vergangenheit oder auf einem grässlichen, von Hungersnot geplagten Kontinent wie Afrika leben zu müssen. Ihnen wird beigebracht, glücklich und fröhlich zu sein oder, anders ausgedrückt, die Welt, die sie im Begriff sind zu betreten, nicht in Frage zu stellen. Und die Welt der Werbung verstärkt ihrerseits diese Botschaft. McDonald’s und Tesco sind eure Freunde, und sie bieten gut gelaunte Idioten wie Ronald McDonald an, um das zu beweisen, und natürlich ihre ziemlich unklaren Slogans wie: »Jedes bisschen hilft«, »Stets niedrigere Preise« oder »Ich liebe es«. (Wer liebt was?)
Interessant ist auch, dass die Menschen in Schöne neue Welt in »Fühlfilme« gehen, eine weiterentwickelte Version des Kinofilms. In den Fühlfilmen kann man den gezeigten Vorleger aus Bärenfell tatsächlich auch spüren. Nun ist dies nicht allzu weit von der modernen Verwendung des Wortes »Erfahrung« in den Werbetexten entfernt. Anstelle von gutem Essen bieten Restaurants eine »hochwertige Esserfahrung« an. Reiseveranstalter gebrauchen das Wort ebenso wie Themenparks und andere Spaßverkäufer. Ich kann eine Zeit vorhersehen, in der Bücher als »aufregende Leseerfahrung« verkauft werden. Das Leben ist reduziert worden auf lange Phasen der Langeweile im Büro, die unterbrochen werden durch hochgepushte »Erfahrungen«, nur damit diese in der persönlichen Liste der Dinge, die man getan haben möchte, bevor man stirbt, abgehakt werden können. Das ist kein wirkliches Leben. Das ist eine durch gelegentliche Zirkusspiele aufgelockerte Sklaverei.
Auch die Wissenschaft der Positiven Psychologie zielt darauf ab, die Arbeitenden glücklich zu machen. Das tut sie, weil, wie die Anhänger dieses verlogenen Glaubens sagen, glückliche Arbeitende produktiv Arbeitende sind. Glück steigert den Gewinn. Deshalb plädieren Managementtheoretiker dafür, die Angestellten am Arbeitsplatz fröhlich und positiv zu stimmen. Die Kehrseite davon ist allerdings, dass man selbst Schuld hat, wenn etwas schiefgeht. Man wird nicht schlecht behandelt. Man ist nicht unterbezahlt. Man darf nicht streiken oder herumnörgeln. Stattdessen wird man zum unternehmenseigenen Therapeuten oder Betriebsarzt geschickt, der imstande sein sollte, einen wieder in Ordnung zu bringen. Er muntert dich auf und schickt dich, erfüllt von Dankbarkeit, in die Sklavengrube zurück. Und wenn die Therapie nicht greift, gibt es immer noch die Psychopharmaka. Schluck ordentlich was von dem Beruhigungszeug, und du kehrst sanftmütig und glücklich an deinen Arbeitsplatz zurück, weil deine Aufmüpfigkeit chemisch oder mechanisch ausgelöscht wurde. Unterdessen schnellen die Gewinne der Pharmaunternehmen in die Höhe – ganz nach dem Motto in Private Eye: »Für alle einen Dreifachen!«
***
Dies also ist die Situation, aus der ich hoffe ausbrechen zu können, indem ich bestimmte Traditionen der schönen alten Welt zelebriere. In der alten Welt sind wir glücklich, unglücklich zu sein. Wir schlagen der Regierung und den Unternehmen ein Schnippchen. Wir haben keine Angst vor der Wahrheit, der Schönheit und dem Schmerz. Der Weg zur Freiheit ist nicht eben und gerade. Er ist voller Mühen. Aber er lohnt sich.
Ich will dieses Kapitel mit folgendem schönen Gedanken von Gilbert Keith Chesterton abschließen, den er 1916 in seiner Einleitung zu Cobbetts Cottage Economy niedergeschrieben hat:
Wir müssen zurück zur Freiheit oder voran in die Sklaverei. Der freie Mann Englands wird, wo er noch existiert, es zweifellos als ungeheures Unterfangen empfinden, drei Jahrhunderte zurückzuspulen. Er sollte in jedem Fall bedenken, welche Gefahr und Pein und herzergreifende Komplikation mit diesem Zurückdrehen der Spule verbunden sind. Aber er sollte ebenso die Alternative abwägen; und die Alternative besteht darin, erdrosselt zu werden.
Tom Hodgkinson, August 2010, North Devon
ERSTES KAPITEL
Januar:Hacke Holz
Igne levatus hiems.
(Der Winter wird durch das Feuer erträglicher.)
Ovid
Im Januar soll man sich warm halten. Es ist der Monat zum Faulenzen am Feuer und fürs Feiern bis spät in die Nacht; der Monat für Kerzen, die Wärme des Holzofens und den köstlich süßen Geruch von Holzrauch. In der vorindustriellen Zeit lieferte das raue Wetter eine gute Entschuldigung, drinnen zu bleiben und harte Arbeit zu meiden.
Das Wort »Januar« leitet sich von dem doppelgesichtigen römischen Gott Janus ab, und die mittelalterlichen Kalendarien zeigen Janus, wie er an seinem aufgebockten Tisch feudal isst, während das eine Gesicht nach hinten auf das gerade zu Ende gegangene Jahr und das andere nach vorn auf das beginnende Jahr blickt. Ein französisches Gedicht aus dem 13. Jahrhundert betont die Bedeutung des Vergnügens und der Gemütlichkeit während dieses unfreundlichen Monats:
Quant je le tens refroidierVoi, et geler,Et ces arbres despoillierEt iverner,Adone me vueil aisierEt sejornerA bon feu, lès le brasier,Et à vin cler,En chaude maison,Por le tens felon.Je n’ait il pardonQui n’aime sa garison!
(Wenn ich merke, dass das Wetter kalt wird und der Frost kommt und die Bäume ihre Blätter verlieren, dann will ich es mir angesichts des schlechten Wetters bequem machen und vor einem guten Feuer bleiben, neben der glühenden Holzkohle, mit einem hellen Wein in einem warmen Haus. Es ist unverzeihlich, wenn man nicht für seine eigene Behaglichkeit sorgt!)
Vergil brachte es im ersten Band seiner Georgica auf den Punkt:
Hiems ignava colono.(Im Winter ist der Bauer träge.)
Eine ähnliche Szene wie die in dem französischen Gedicht beschriebene findet sich in einem Brief von Alexander Pope aus dem Jahre 1712:
Ich befinde mich gerade im Gegensatz zu all diesem Trubel; eingeschlossen in ein enges Kämmerchen, räkele ich mich auf einem Armsessel und verdöse meine Tage an einem Feuer, wie das Bild des Januar in einem alten Salisbury Primer.
Eine wunderbare Illustration zum Januar gibt es in Les Très Riches Heures du Duc de Berry, einem kunstvollen Kalendarium, das 1409 von zwei Miniaturmalern, die als die Limbourg-Brüder bekannt sind, gefertigt wurde. Den Auftrag dazu hatte der unglaublich reiche Duc de Berry erteilt. In dem Kalendarium sehen wir, wie der Herzog ein Fest gibt. Er ist von Höflingen umringt, und alle verteilen und empfangen Geschenke. Die Szene für Februar zeigt eine bescheidenere Winterszene: Zwei Bauersleute wärmen sich in ihrem gemütlichen Kleinbauernhof die Füße am Feuer. Sie haben ihre Arbeitskittel hochgezogen und die Knie weit gespreizt, und es ist klar, dass weder Mann noch Frau irgendwelche Unterwäsche tragen.
Uns räkeln, ein Nickerchen machen, uns den Bauch vollschlagen und den Körper warm halten – dies ist die Grundhaltung, die wir wieder in den Januar zurückbringen müssen. Und wir müssen viel schlafen. Um es mit den Worten eines mittelalterlichen schottischen Dichters aus der Sammlung von W. A. Craigie auzudrücken:
Ane nap is nowrissand eftir noneAne fyre is fosterrand for my feit,With dowbill sokkis for my schoneAnd mittanis for my handis meit.
(Ein Nickerchen erquickt nach dem Mittag, und ein Feuer labt meine Füße, die mit doppelten Socken in meinen Schuhen stecken, und willkommen sind die Fäustlinge für meine Hände.)
Im Januar konzentrieren Victoria und ich uns darauf, die Feuer am Brennen zu halten und gut zu essen – wir tun also genau das, wozu die alten Weisheiten raten. Wir haben zwei Holzöfen, einen im Wohnzimmer und einen in meinem Arbeitszimmer, die den Januar und Februar hindurch nahezu ohne Unterbrechung brennen müssen. Es gibt nichts Trübseligeres als eine graue Feuerstelle an einem Wintertag und nichts Aufmunternderes als ein rot glühendes Feuer.
Mit einigem Geschick ist es möglich, die Kohleöfen vierundzwanzig Stunden am Tag durchbrennen zu lassen. Vor dem Zubettgehen stapeln wir Holzklötze in den Flammen und schließen dann die Lüftungsklappen vorn am Ofen und auch den Lüftungsschlitz hinten am Ofenrohr. So, ganz ohne Sauerstoffzufuhr, glimmt das Feuer in der Nacht langsam vor sich hin. Am Morgen öffnen wir den Lüftungsschlitz einfach wieder, bewegen das Feuer ein wenig mit dem Schüreisen, und schon lodert es erneut empor, was eine tiefe Zufriedenheit bereitet. Zudem erspart es einen großen Teil der Arbeit, die es kostet, das Feuer wieder neu anzuzünden.
Im letzten Winter waren wir für neun Tage eingeschneit, und das war sehr angenehm: Es gab keine Arbeit und keine Schule, nur die erfreulichen Aufgaben, sich zu wärmen, zu kochen und Spiele zu spielen. Das bringt mich zum Kern der Sache: die knifflige Kunst, für einen guten Holzvorrat zu sorgen. Man muss viele Holzscheite haben, und sie müssen trocken sein. Nach acht Jahren des Landlebens versage ich noch immer bei dieser grundlegenden Aufgabe, und Anfang März gehen unsere Vorräte zu Ende. Ich bin dann gezwungen, die demütigende Fahrt zur Gärtnerei zu unternehmen, um sehr teure orangefarbene Netze mit abgelagertem Holz zu kaufen.
DIE NOTWENDIGKEIT, TROCKENES HOLZ ZU HABEN
Für ein gutes Feuer, so die einfache Regel, braucht man vollkommen ausgetrocknetes oder abgelagertes Holz. Frisch geschlagenes Holz ist durch und durch mit Wasser getränkt. Dabei handelt es sich nicht um das Wasser, das vom Himmel auf den Baum hinabgeregnet ist, sondern um die Feuchtigkeit, die er aus dem Boden aufgesaugt hat, um sich zu ernähren. Je weniger Wasser in dem Holz ist, desto schneller und leichter brennt es. Ein feuchtes Holzscheit dagegen schwelt nur vor sich hin und sorgt für Frustration.
Woran erkennst du, dass deine Holzscheite ordentlich ausgetrocknet sind? Nun, ich habe mich eingehend mit diesem Thema beschäftigt. Ja, ich war geradezu besessen davon. Von Freunden gefragt, worüber Tom am liebsten spricht, antwortet Victoria: »Über Holzscheite.« Ich habe mir sogar ein Buch zum Thema gekauft, ein tolles Werk mit dem Titel The Harrowsmith Country Life Guide to Wood Heat, das von dem kanadischen Holzspezialisten Dirk Thomas geschrieben wurde. Er listet folgende Merkmale auf:
Gewicht: Abgelagertes Holz ist erheblich leichter als grünes Holz derselben Sorte.
Geruch: Grünes Holz hat oft einen angenehmen, saftigen Duft. Abgelagertes Holz riecht auch nach Holz, aber nicht so intensiv.
Lose Rinde: Wenn Holz trocknet, haftet die Rinde nicht mehr so fest.
Farbe: Holz verblasst mit der Trocknung. Wenn deine neue Fuhre eine glänzende und frische statt eine matte und gedämpfte Farbe hat, dann solltest du sie dir genauer ansehen.
Dies sind gute Indikatoren, aber man braucht Erfahrung, um sie zu erkennen, weil sie relativ sind. Ein absolut sicherer Weg zu kontrollieren, ob deine Holzscheite trocken sind, besteht darin, in einen Holzfeuchtigkeitsmesser zu investieren. Dieses kleine Gerät zeigt dir den Prozentsatz des Wassergehalts in deinem Holzscheit an. Du solltest die Holzscheite mit einer Axt spalten und das Holz an mehreren Stellen überprüfen, indem du die beiden kleinen Nadeln des Geräts in das Holz steckst. Ein LCD-Display zeigt dann den Messwert an. Ein sehr feuchtes und schweres Holzscheit hat einen Wassergehalt von 70 Prozent und mehr. Ideal sind 20 Prozent – so weit durchgetrocknete Holzscheite brennen wunderbar, und dein Feuer wird herrlich leuchten und die Hitze nur so herauspumpen.
Es ist wichtig, darüber Bescheid zu wissen, weil Holzhändler generell behaupten, dass ihr Holz abgelagert ist, was in Wahrheit nur selten der Fall ist. Ich weiß das aus eigener bitterer Erfahrung. Ich habe nämlich schon kalte Abende am Feuer verbracht und versucht, ein Feuer mit Holzscheiten anzufachen, die, wie ich heute weiß, innen noch viel zu feucht waren. Verflucht habe ich sie, die verlogenen Holzhändler, die uns stapelweise Holz verkauft haben, das einfach nicht brannte! Ein feuchtes Holzscheit verbrennen zu wollen ist reine Energieverschwendung: Die Hitze des Feuers wird durch die Verdunstung des Wassers im Holz aufgebraucht. Man hört sofort das entmutigende Zischen, und von dem Holzscheit steigt Dampf statt Rauch auf. Fast scheint es, als ob das Feuer sogar noch zusätzlich Wärme aus dem Raum saugen würde.
WAS MAN BEIM KAUF VON HOLZSCHEITEN BEACHTEN SOLLTE
Im Gespräch über Holzhändler meinte meine Vermieterin: »Sie müssen ihnen voraus sein.« Das heißt, man muss davon ausgehen, dass die Holzhändler nie abgelagertes Holz liefern und deswegen – um auf der sicheren Seite zu sein – die Holzscheite wenigstens ein Jahr früher bestellen, als man sie braucht. Holz benötigt viel Zeit zum Trocknen. Victorias Cousine Lucy ist sogar der Überzeugung, dass es für mindestens zwei Jahre gelagert werden sollte. Und der wegweisende Ökobauer Guy Watson plädiert für drei Jahre. Ich habe einmal eine Ladung feuchtes Holz gekauft und es in einer Steinbaracke aufgestapelt. Nach einem Jahr hatten die größeren Stücke noch immer einen Feuchtigkeitsgehalt von 40 Prozent. Diese Art des Vorausdenkens ist für einen in der Stadt aufgewachsenen Typen wie mich, der daran gewöhnt ist, mal eben schnell zum rund um die Uhr geöffneten Supermarkt zu gehen, wenn ihm ein wichtiges Nahrungsmittel ausgeht, keine Selbstverständlichkeit. Aber ich lerne. Eine gute Idee ist, große Mengen Holz auf einmal zu bestellen, die größeren Scheite zu zerhacken und sie hübsch säuberlich aufeinanderzustapeln.
Man kann Holzscheite auch in weniger als einem Jahr trocknen. Mein Gewährsmann in dieser Angelegenheit ist erneut Dirk Thomas, und sein Rat lautet, das Holz an einem windigen und sonnigen Platz aufzustapeln, zum Beispiel dort, wo die Wäsche immer trocknet. Denn so nutzt man zusätzlich die Sonne und den Wind, um die Holzscheite auszutrocknen.
Wir haben etwas im Hof errichtet, das Thomas als »solaren Holzscheittrockner« bezeichnet: Das Holz wird auf Paletten gestapelt. Dadurch wird verhindert, dass Wasser aus dem Boden in die Holzscheite dringt. Nach drei Seiten hin sind die Scheite ungeschützt dem Wetter ausgesetzt. Oben sind sie mit einem in Dachpappe eingeschlagenen Sperrholzdach abgedeckt, so dass sie in der Sonne braten, aber vor Regen weitgehend geschützt sind. Am Dach haben wir eine Regenrinne angebracht, um das Wasser zu sammeln und nicht nass zu werden, wenn wir an einem Regentag Holz holen.
Mein Freund Nick hat mir erzählt, dass man in Schweden Holzschober baut: Die feuchten Scheite werden kreisförmig gestapelt und abgedeckt mit einem schrägen Dach aus Scheiten, deren Rinde nach außen weist und sie vor Regen schützt. Auch hier bläst der Wind durch den Stapel, und die Sonne brät ihn.
Je kleiner ein Scheit ist, desto schneller trocknet er. Darum spalte ich die größeren in zwei oder drei, bevor ich sie stapele. Schichte sie nicht zu eng aufeinander. Wenn du sie stapelst, musst du darauf achten, dass viel Raum zwischen ihnen bleibt, damit die Luft zirkulieren kann. Ich habe festgestellt, dass auf diese Weise gestapeltes Holz in ein paar Monaten trocknet und nicht, wie in einem feuchtkalten Schuppen, ein oder zwei Jahre braucht. Nach Aussage des besagten kanadischen Holzspezialisten hat ein »solarer Holzscheittrockner« das Potenzial, die Holzscheite in nur zwei Wochen auszutrocknen, aber nach meiner Erfahrung ist das reichlich optimistisch.
Im vergangenen Winter hatten wir dank meiner wackeren Anstrengungen, das ganze Jahr hindurch Holz zu kaufen, zu hacken und zu stapeln, einen hervorragenden Vorrat an trockenem Holz. Ich sollte jedoch hinzufügen, dass ich hierfür einen immensen Aufwand an Arbeit und Gedanken getrieben habe. Der Holzhändler kippt die Holzklötze in den Hof. Ich muss sie zerhacken und aufstapeln. Im Winter karre ich dann haufenweise Holzscheite vom Stapel zur Terrasse und trage sie von der Terrasse zu den Feuern selbst. Zusätzlich braucht man noch einen guten Vorrat an trockenen Zweigen und Anmachholz, um das Feuer am Brennen zu halten.
Wenn die Öfen so richtig lodern, verbrennen sie so viel Holz, dass man den Vorrat gleich wieder auffüllen muss. Man muss zudem täglich die Asche aus dem Feuer entfernen und dafür sorgen, dass die Kamine jedes Jahr gekehrt werden. Entscheidend ist, dass man die Arbeit genießt. Und während es nichts gibt, was ich an einem kalten, regnerischen Tag weniger gern tue, als in den Schuppen zu gehen und Holz zu hacken, kann es wirkliches Vergnügen bereiten, sobald man mit dieser Art von Arbeit erst einmal begonnen hat. Es ist außerdem ein gutes Training und hält dich warm.
Holzhacken – eine Aufgabe, die meist von Männern übernommen wird – ist ungeheuer befriedigend. Und es ist ein körperliches Ventil. Häufig bin ich nach einem Streit mit Victoria in den Holzschuppen gestürmt und habe mich wie wild über einen Haufen Holzklötze hergemacht.
ZU DEN UNTERSCHIEDLICHEN HOLZARTEN
Das Problem, Holz zu trocknen und zu verbrennen, wird noch komplizierter durch die verschiedenen Eigenschaften der unterschiedlichen Holzarten. Manche sind weich, manche hart, und alle haben spezifische Eigenschaften. Eiche, Buche und Esche geben eine Menge Hitze ab, während Weichhölzer wie Kiefer und Birke weniger Hitze erzeugen und schnell wegbrennen.
Wie im Folgenden aufgezeigt, ist der Holzhändler, der falsche Aussagen über die Trockenheit seiner Holzscheite macht, kein neues Phänomen. Ein anonymes altes Gedicht mit dem Titel »Brennholz« klagt über die verlogenen Holzhändler:
Brennholz, Brennholz, Brennholz,Brennholz, das Kohle spart, macht stolz.Doch lass dir den Verstand nicht brechen,hörst du des Holzmanns leicht’s Versprechen.
Glaube niemals seiner alten Mähr,dass gutes Holz er wird dir geben her.Lies diese Zeilen, und lern zu erkennen,welche Art von Holz wird richtig brennen.
Ein anderer gereimter Rat zu den einzelnen Holzarten lautet so:
Buchenholzfeuer sind hell und klar,wenn die Scheite wurden gelagert ein Jahr.Kastanienholz sorgt nur dann für Behagen,wenn die Scheite lange trocken lagen.Verbrennst du einen Holunderbaum,dann kommt der Tod in dein Haus, welch Graun.Aber Esche frisch oder Esche altlässt selbst eine Königin nicht kalt.
Birken- und Tannenholz brennen zu schnell;sie lodern hoch auf, doch es ist nur kurz hell.Die Iren brennen den Weißdorn allein,um zu backen ein Brot so süß und fein.Ulmenholz schwelt lustlos vor sich hin,viel Wärme ist selbst in den Flammen nicht drin.Aber Esche grün oder Esche braun,darauf kann selbst eine Königin baun.
Pappel ergibt einen bitteren Rauch,vernebelt die Augen und die Lunge auch.Apfelholz lässt herrliche Düfte steigen,und Birkenholz schließt sich an diesem Reigen.Eichenholz, wenn trocken und alt,lässt den Winter dir nie werden kalt.Aber Esche feucht oder Esche trockenkann selbst einen König ans Feuer locken.
»Grün« ist hier im Sinne von nicht abgelagert gemeint, und es wird allgemein die Ansicht vertreten, dass Eschenholz selbst dann brennt, wenn es frisch geschlagen wurde und noch feucht ist. Es stimmt, dass es einen niedrigeren Feuchtigkeitsgehalt hat als die meisten anderen Hölzer, aber dennoch wird es besser, wenn es ein paar Monate lang dem Wind und der Sonne ausgesetzt ist. Tannenholz lodert tatsächlich, aber man kann als Schutz einfach die Ofentür schließen. Nach meiner Erfahrung brennt Eichenholz gut, aber es muss sehr trocken und gut abgelagert sein, und das dauert zwei Jahre. Am liebsten ist mir die Buche, weil es sie überall gibt, sie schneller trocknet als Eiche und hell und heiß brennt, wie in dem Gedicht angedeutet.
Vermutlich wäre es ideal, einen schönen Stapel aus unterschiedlichen Hölzern zu haben, die in verschieden große Stücke zerlegt wurden: kleine Stücke Kiefernholz, um das Feuer anzufachen, und dann schön große Eichenklötze, die man dazulegt, sobald es sehr heiß ist. Die angebliche Bitterkeit des Pappelrauchs werde ich bald selbst feststellen können. Vor einem Jahr habe ich netterweise eine Ladung Schnittholz aus dem Garten eines Freundes bekommen, das größtenteils fast zwei Meter lang war und teilweise aus Pappel bestand. Meine alte Nachbarin ist vorbeigekommen und hat sie mir mit der Kettensäge so zerkleinert, dass ich sie mit der Axt zerhacken konnte.
Vor allem an einen Punkt musst du denken: Du brauchst erheblich mehr Holz, als du annimmst, und du wirst viel mehr im Voraus kaufen müssen, als du meinst. Und lass dich beim Kauf einer Axt beraten. Es gibt spezielle Äxte für spezielle Tätigkeiten.
WAS ZU TUN IST, WENN DIR DAS HOLZ AUSGEHT
Aber wie gut wir unser Holz auch kaufen und lagern, es ist immer damit zu rechnen, dass unser Vorrat an trockenem Holz irgendwann vorzeitig zur Neige geht. Das passiert meist im Februar oder März. Was kann man tun, wenn alles trockene Holz verbraucht ist? Nun, ich habe ein paar Notmaßnahmen ausfindig gemacht:
1. Kauf einen Sack Kohle. Du kannst auf die brennenden Scheite in einem Holzofen eine Handvoll Kohle werfen. Die Kohle wird schön heiß brennen – vielleicht heiß genug, um ein paar der feuchten Hölzer in Brand zu setzen. Die Kohle brennt auf der Asche, so dass du nicht unbedingt einen Feuerrost brauchst. Und Kohle hat den Vorteil, dass man sich nicht dauernd um sie kümmern muss. Aber sie ist auch schmutzig und erzeugt keine so schöne Hitze wie ein Holzfeuer.
2. Trockne die feuchten Scheite schnell, indem du sie in sehr kleine Stücke zerhackst. Stell sie mit den Enden ums Feuer oder leg sie ins Ofenrohr, damit sie trocknen. Mein Freund Graham hat es tragischerweise versäumt, sich einen ordentlichen Vorrat an trockenen Scheiten für seinen Rayburn-Holzofen zu beschaffen, und konnte die Scheite nur noch mit der Hitze der vorigen Scheite trocknen, um sie brennfähig zu machen.
3. Organisier dir Holz, ohne dafür zu bezahlen. Es ist möglich, sich große Mengen Holz zusammenzuklauben. Paletten brennen herrlich, weil sie aus gut abgelagertem Weichholz angefertigt sind. Wie findet man ausgediente Paletten? Nun, ich habe festgestellt, dass es erheblich mehr bringt, wenn man, statt ins Internet zu gehen, die Praxis der alten Welt anwendet, die als »Herumfragen« bekannt ist. Ja, ich würde so weit gehen zu sagen, dass »Herumfragen« das neue Internet ist. Indem du herumfragst, stellst du eine Verbindung mit einem Netzwerk aus mindestens einem Dutzend und womöglich Hunderten von Leuten aus deiner Region her, von denen jeder sein eigenes lokales Wissen hat.
Das Internet hat das Herumfragen kommerzialisiert, weil es daraus Gewinn zu schlagen versucht. Es hat die Bedeutung des Vermittlers vergrößert; es ist eine Vermittlerfantasie. Finde Transaktionen, die ohnehin stattfinden würden, und schöpfe davon etwas ab. Simsalabim! Und schon ist ein riesiger Reichtum entstanden. Wo wir einst jemanden in der Kneipe oder auch unsere Arbeitskollegen gefragt hätten, verbringen wir nun nutzlose Stunden damit, bei eBay rumzusuchen. Digitale Netzwerke treten an die Stelle von realen Netzwerken. Und sie nehmen etwas dafür. Entweder direkt wie bei eBay oder PayPal (man beachte den Neusprech) oder indirekt durch Werbeeinnahmen wie beim mächtigen Facebook.
Beim Herumfragen gibt es keinen Vermittler, wohingegen es beim Kapitalismus genau um den geht. Kapitalisten tun nichts. In dem Moment, in dem du dem Standbesitzer auf dem Markt dein Geld geben willst und er dir seine Ware, taucht der gewitzte Kapitalist zwischen euch auf, rechnet es sich als Verdienst an, dass er euch miteinander bekannt gemacht hat, und nimmt 5 Prozent dafür. Die Geschichte des Kapitalismus seit 1535 könnte den Titel tragen: »Der Aufstieg des Vermittlers«.
Wie dem auch sei – immer, wenn du eine ausgediente Palette siehst, nimm sie mit nach Hause. Ich singe ein Loblied auf die gewöhnliche Palette. Sie ist ungemein nützlich und kann fürs Bauen ebenso wie fürs Verbrennen verwendet werden. Sie eignet sich hervorragend, um Wände für Komposthaufen zu bauen oder aber eine Bühne für einen Gig, den du in deiner Scheune veranstaltest. Du kannst auch Tische, Stühle und Bänke daraus machen.
Ich plaudere über solche Sachen in der Regel morgens mit Trevor, dem Schulbusfahrer. Er bekommt Containerladungen mit altem Holz von Baumärkten. Es macht einige Arbeit, es zu zersägen und klein zu hacken, aber das Holz kostet nichts. Neben Axt und Säge brauchst du noch einen Kuhfuß, um die Paletten zu zerlegen. Und sorg dafür, dass du eine gute Axt bekommt, die speziell für das Zerhacken von Holzklötzen geeignet ist. Ich habe nach acht Jahren festgestellt, dass ich mich mit der falschen Axt abgemüht habe. Es kommt entscheidend darauf an, dass man gute Werkzeuge hat. Kauf die besten, die du dir leisten kannst.
4. Organisier dir Holz aus dem Wald. Meine Nachbarin fährt regelmäßig mit einem Transporter und einer Kettensäge in den Wald, zersägt Fallholz und transportiert es nach Hause zu ihrem Schuppen, wo sie es zerhackt. Dieses Fallholz ist bereits an Ort und Stelle abgelagert. Indem sie das Fallholz einsammelt, so ihre Argumentation, räumt sie den Wald auf. Und ich habe erfahren, dass inzwischen auch einige Waldexperten wieder der Meinung sind, dass der Wald sehr davon profitiert, wenn Menschen in dieser Art intervenieren. Allerdings musst du den Waldbesitzer natürlich um Erlaubnis bitten.
Im 20. Jahrhundert herrschte die Ansicht vor, dass man den Wald am besten in Ruhe und heruntergefallene Zweige zum Verrotten liegen lassen sollte. Mittlerweile behaupten manche Förster, dass Wälder gesünder sind, wenn man ein wenig aufräumt. Beispielsweise beginnen dann wieder Wildblumen zu wachsen. Wenn wir durch unsere Wälder gehen, schleppe ich oft ein paar Zweige nach Hause. Diese »Reisigbündel«, um das wunderbare Wort zu verwenden, bestehen aus sehr trockenem Altholz, das dicker als dünne Zweige, aber nicht so dick wie Äste ist. Wir sammeln auch dünne Zweige, die leicht brechen, wenn sie trocken sind. Man kann feuchte dünne Zweige schnell trocknen, indem man sie beispielsweise ein paar Tage auf den Kohleofen legt.
5. Organisier dir Esche. Wenn ich dringend Holz brauche, säge ich die Eschenäste aus den Hecken meiner Vermieterin. Ich habe einen besonders dicken Ast mit einer Handsäge abgesägt und dafür etwa eine halbe Stunde gebraucht. Anschließend dauerte die Verarbeitung des Dings noch mal zwei oder drei Stunden. Zunächst einmal müssen die dickeren und dünneren Zweige mit der Baumschere abgeschnitten und dann der Ast mit der Motorsäge zerlegt werden. (Kettensägen sind furchterregend, und man sollte sie meiner Meinung nach besser den Händen von Fachleuten überlassen.) Dann müssen die Stücke in Scheite gehackt werden. Tja, das hat einen halben Tag Arbeit gekostet, und das Feuer hat vielleicht maximal fünf Stunden gebrannt. Es wird wohl besser sein, wenn ich künftig jemanden dafür bezahle, dass er einmal im Jahr mit einer Kettensäge vorbeikommt und alles zersägt.
6. Kauf abgelagertes Holz von einer Gärtnerei. Die dort in orangefarbenen Netzen zum Verkauf angebotenen Scheite sind allerdings sehr teuer. Und ich finde es demütigend, sie zu kaufen. Für mich ist ein Haufen orangefarbener Netze ein Eingeständnis, dass ich versagt habe, für einen angemessenen Holzvorrat zu sorgen. Das Holz ist dir ausgegangen, und jetzt wirfst du Geld hinaus, um das Problem zu lösen.
Im vergangenen Winter bin ich in der Gärtnerei zufällig einem Nachbarn begegnet. Er kaufte ebenfalls die orangefarbenen Netze. Wir sahen einander verlegen an, als wollten wir sagen: Wenn du’s niemandem sagst, sag ich’s auch niemandem. Zu Hause angekommen, nahm ich die Scheite schnell aus den Netzen und legte sie auf meinen Holzstapel, um jedem Besucher den Eindruck zu vermitteln, dass ich sie zwei Jahre zuvor selbst zerhackt und seither sorgfältig gelagert hatte.
Um solch eine Pein zu vermeiden, musst du vorausdenken. Wenn du Zugang zu einem Waldgebiet hast, dann säge und hacke das ganze Jahr hindurch. Wenn nicht, musst du dir jährlich zwei oder drei Ladungen Holz im Voraus kommen lassen. Du kannst nie zu viel Holz haben – überall, in verschiedenen Stapeln, unterschiedlich trocken. Du kannst mit deinem Holzfeuchtigkeitsmesser deine wöchentlichen Runden machen, um das Fortschreiten des Trocknungsprozesses zu messen.
ÜBER DEN KAUF EINES HOLZOFENS
Als Erstes würde ich sagen, dass Holzöfen vielleicht nicht sonderlich romantisch sind, aber dafür ist ihre Effizienz erheblich größer, und sie sind leichter zu bedienen als ein offenes Feuer. Letzteres hat zwar den Vorteil, dass man darin Scheite ganz unterschiedlicher Größe verbrennen kann, dafür aber lässt es sich auch nicht so leicht kontrollieren. Holzöfen sind auch sauberer, und sie heizen einen Raum sehr schnell. Außerdem passen sie in eine Stadtwohnung ebenso gut wie in ein Landhaus.
Als wir in unser Haus zogen, gab es bereits einen Holzofen im Wohnzimmer, aber mein Arbeitszimmer besaß keine Heizung und war sehr kalt. Darum haben wir uns dafür entschieden, dort ebenfalls einen Holzofen hineinzustellen. Ich musste einen billigen aus zweiter Hand finden. Also fragte ich herum. Als Erstes fragte ich Alan, ob er jemanden kenne, der einen Holzofen zu verkaufen habe. Er verwies mich an Greg, in dessen Schuppen ein paar heruntergekommene alte Brenner standen. Ich kaufte einen von ihnen für 50 Pfund, also nicht ganz 60 Euro. Es ist ein Efel Kamina, ein alter belgischer Ofen, mit einem sehr schönen Löwenmotiv. Er brauchte eine neue Glasscheibe für die Tür und musste geschrubbt und neu bemalt werden. Es gelang mir nach und nach, ihn für rund 100 Pfund zu erneuern. Ein Freund baute ihn für mich ein, und er funktioniert wirklich sehr gut.
In dieser Zeit habe ich auch gelernt, nicht auf den Rat der Verkäufer von Holzöfen zu hören. Sie sagten zu mir, es sei ein Fehler gewesen, den Efel Kamina zu kaufen, und ich sei besser beraten, mir einen neuen für 600 Pfund zuzulegen. Aber die neuen sind nicht nur scheußlich teuer, sondern sehen in der Regel auch schrecklich bieder und kitschig aus. Es gab keinen einzigen Holzofen, dessen Machart mir gefiel, wohingegen mein alter Efel Kamina wunderschön ist.
WIE MAN FEUER MACHT
Nach Möglichkeit vermeide ich es, Feueranzünder zu verwenden. Ich empfinde das als eine Art Schummelei. Genauso gut, wenn nicht besser, funktionieren acht oder zehn zusammengeknüllte Seiten Zeitungspapier, ein paar Streifen Pappe oder ein alter Kerzenstumpf, die am besten auf ein Aschebett auf dem Boden des Holzofens gelegt werden. Über dem Papier errichtet man aus ein wenig schön trockenem Anzündholz eine Pyramide, auf deren Spitze ich immer noch drei oder vier kleine Scheite oder Reisige oder etwas Späne oder Palettenstücke lege. Dann zündet man das Ganze mit einem Streichholz an und beobachtet das allmählich aufflackernde Feuer. Möglicherweise musst du in ihm stochern oder Luft hineinblasen oder -pusten. Es muss viel Luft um das Feuer streichen. Schließ nun die Tür und öffne alle Ventile.
Es gibt nichts Besseres, als die Flammen schön auflodern zu sehen und zu spüren, wie sich das Zimmer zu erwärmen beginnt. Ein Holzofen kann äußerst viel und äußerst behagliche Wärme im Zimmer erzeugen, nicht zu vergleichen mit der künstlichen Wärme der seelen- und blutlosen Erfindung der schwachen neuen Welt – der Zentralheizung. Wir sitzen im tiefsten Winter im T-Shirt da.
Lege fortlaufend weiteres Brennmaterial auf die Scheite und schüre das Feuer immer wieder. Das Einzige, womit du das brennende Holz versorgen musst, ist Luft. Aber das kannst du neben deiner anderen Arbeit tun, die du im Haus verrichtest. Das Feuer zu schüren und Scheite im Holzofen in meinem Arbeitszimmer nachzulegen ist für mich eine willkommene Unterbrechung vom Lesen, Schreiben oder Verschicken von E-Mails. Es verschafft mir eine kleine Pause. Und wenn du mit den Scheiten hantierst, nehmen deine Hände einen angenehmen Geruch an. Manchmal verbrennst du dir die Finger, und das gibt dir ein Gefühl des Lebendigseins. Es ist auch ein Test für deinen zunehmenden Stoizismus.
Das Holz knackt und knistert. Feuer zu machen ist ein sinnlicher Genuss. Das Holz bereitet ein intensives Vergnügen, und das hat teilweise etwas mit dem Kontrast zu der Kälte zu tun, die dem Feuer vorangegangen ist. Die alte Welt war voller Extreme und »leidenschaftlicher Intensität«, um es mit Yeats zu sagen. Sie war in sinnlichen Dingen erheblich reicher als die unsrige. Unsere neue Welt hat durch Klimaanlage und Zentralheizung alles auf konstante 20 Grad das gesamte Jahr hindurch eingeebnet, und wir erleben keine Schwankungen, wenn wir von unserem Haus ins Auto, vom Büro in den Supermarkt und von dort wieder in unser Haus wechseln. Wir laufen durch ein Techno-Utopia und verwenden keinen Gedanken auf die vergnügliche Kunst, uns selbst zu wärmen.
WAS GEGEN DIE ZENTRALHEIZUNG SPRICHT
Holz lässt das Feuer brennen. In seinem Essay »Feuer« schrieb Edward Verrall Lucas, der vielseitige und populäre Essayist des beginnenden 20. Jahrhunderts, dass ein Holzfeuer de natura eine antiautoritäre Aussage sei. Es schlage dem Big Business und der Regierung ein Schnippchen. Ganz im Gegensatz dazu das Heizen mit dem leblosen und eintönigen Gas:
Wer könnte vor einem Gasofen schon geistreich oder menschlich sein? Er gibt dem Auge so wenig und der Fantasie nichts; seine Flamme ist so künstlich und auf ein Ding reduziert, sein glühendes Herz ist so dürftig und kleinlich. Er hat keine Stimme, keine Persönlichkeit, keine Überraschungen; er unterwirft sich der Herrschaft eines Gasunternehmens, das seinerseits vom Parlament beherrscht wird. Ein echtes Feuer hingegen hat nichts mit dem Parlament zu tun. Ein echtes Feuer hat Launen, Ziele und Anwandlungen, die ein Gasbrenner nicht kennt.
Eine Zentralheizung ist langweilig, gleichförmig, fade und möglicherweise auch noch schlecht für deine Gesundheit. Sie sollte aus allen Häusern herausgerissen werden. Wir müssen die Türen aufreißen und die Luft hereinströmen lassen. Die Zentralheizung ist ein Teil der komfortistisch-kapitalistischen Verschwörung. Ihr wohnt keine Freude, kein Leben, keine Gefahr inne, und sie ist zudem sehr teuer.