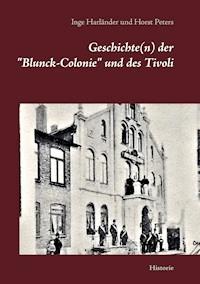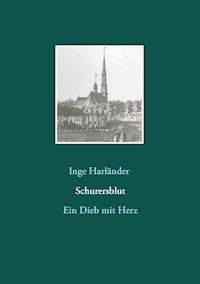
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Schurersblut entführt uns in die deutsch-dänische Provinz des frühen 19. Jahrhunderts. Anhand der Lebensgeschichte des Helden Peter-Johannes Ohloff werden alte Sitten und Gebräuche wieder lebendig. - Nach dem Tod der Eltern ist der sentimentale junge Mann auf sich selbst gestellt und versucht, sein Leben zu meistern. Dabei gerät er immer wieder auf die schiefe Bahn, was sein Gewissen belastet. Durch das Hab und Gut anderer Menschen sammelt er sich im Laufe der Zeit ein beträchtliches Vermögen an. Schließlich wird er sogar als König der Diebe bezeichnet. Erst als er sich verliebt, will er sein Leben grundlegend ändern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 232
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inge Harländer, geboren 1954 in Schleswig-Holstein, schreibt Romane mit historischem Hintergrund.
Sie beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Geschichte ihrer Geburtsstadt.
Schurersblut war die erste literarische Veröffentlichung und erfährt jetzt eine leicht veränderte Neuauflage.
Der Roman begründet sich auf historischen Begebenheiten.
Schwanenteich Zeichnung Amalie Braune geb. Grimm
Der Kirchturm der Heider St.Jürgen Kirche. Zeichnung Amalia Braune geb. Grimm
Eisige Kälte hielt die Landschaft umfangen.
Überall waren hohe Schneeverwehungen entstanden. Ein scharfer Ostwind blies und wirbelte die Flocken durch die engen Gassen des unter dänischer Herrschaft stehenden Ortes.
Der Krieg war vorbei. Die Kosakenschar war abgezogen, aber das Land war ausgeblutet von der langen Besatzung und der dänische Staat war bankrott. Dazu kam dieser schlimme Winter. Man fror in den Häusern der ärmeren Leute, die aus nicht viel mehr als Kammer und Küche bestanden. Nicht nur das Geld war knapp, auch Holz und Torf waren es. Schwierige Zeiten waren es, als die Hebamme den jungen Ohloff ans Licht der Welt zog.
Und so musste der Vater Johannes, nachdem er sich durch den Eiswind zum Pastorat am Markt gekämpft hatte, dem Pfarrer zunächst sagen, dass Mutter und Kind wohlauf wären, bevor er stolz verkünden konnte, dass sein Stammhalter geboren war. Ja, stolz war er auf seinen kleinen Sohn, auch wenn er nicht wusste, wie er von seinem kargen Erwerb einen weiteren Mund stopfen sollte.
Stolz war er, als der Pfarrer zur Feder griff, sie in die zähe Eisengallustinte tauchte um den Namen Peter-Johannes im Kirchenbuch zu verzeichnen. Der Name Johannes fand sich nicht zum ersten Mal dort. Es war seit langem Tradition, dass die Erstgeborenen der Familie Ohloff diesen Namen trugen. Auch manchen Peter hatte es gegeben; zum Beispiel den Großvater seiner Frau, der sich bei allen, die ihn kannten, ein Andenken als rechtschaffener und hilfsbereiter Mann bewahrt hatte. Aber sein Peter-Johannes trat nun zum ersten Mal in die Register ein.
Der Vater machte deshalb ein ernstes Gesicht, während der Pfarrer sorgfältig im Buch verzeichnete:
Peter-Johannes Ohloff, geboren am 1.Februar 1814, ehelicher Sohn des Johannes Ohloff, Besenmacher, wohnhaft in Heide und seiner Ehefrau, Dorothea, geborene Jacobs, Dienstmagd. Darunter ergänzte er, denn die Taufe war ohnehin für den kommenden Sonntag geplant:
Paten sind der Holzarbeiter Claus Claussen und der Prediger Hans Mommsen.
Noch heute lesen wir diesen Eintrag genau so, wie ihn der Pfarrer vor zwei Jahrhunderten in den Kirchenbüchern hinterließ. Und wir wissen aus den Annalen auch, freilich aus anderen Chroniken, dass aller Grund bestand, ein ernstes Gesicht zu machen.
Aber der Pfarrer konnte dies nicht wissen, als er dem Vater eine Rübe, einige Kartoffeln und eine größere Menge Butter in ein Tuch band. Der Vater wusste es auch nicht, als er der Hebamme auftrug, daraus ein warmes Essen zu bereiten. Die Hebamme wusste es nicht, als sie in Vorfreude auf die erste warme Mahlzeit seit langem den Topf auf die Feuerstelle setzte. Und auch Mutter Dorothea wusste es nicht. Da half es auch nichts, dass sie die Schule fleißig besucht hatte und lesen, schreiben und sogar etwas rechnen konnte.
Und der kleine Peter-Johannes wusste es schon gar nicht. Er schlief in seinem Esel, den der Vater gezimmert hatte, und nahm vorerst von kaum etwas Notiz.
Der Esel, ein Holzgestell, das man zusammenklappen konnte, war sehr praktisch für die engen Häuser. Die Mutter hatte, singend, einen Strohsack mit Stoff umnäht und Kissen und Bettdecke mit Enten- und Gänsedaunen befüllt.
Trotz der drückenden Verhältnisse wuchs Peter-Johannes gesund heran.
Er war eher schmächtig und klein, doch das blonde Haar seiner Mutter und die leuchtend blauen Augen des Vaters trugen nicht wenig dazu bei, dass jeder ihn verwöhnte so gut es eben ging.
Er war ein aufgewecktes Kind mit gutem Herzen. Häufig, wenn er - besonders im Sommer – im Schatten der alten Kastanien am Ende der Dohrnstraße spielte, lugte er in den Schüttkoven. Wenn Tiere darin waren, rupfte er Grasbüschel heraus und fütterte sie. Er wusste von seinem Vater, dass jeder, der ein entlaufenes Tier einfing, es dorthin brachte, bis es vom Besitzer gegen eine Gebühr ausgelöst wurde. Nur warum niemand den Tieren Futter gab, solange sie dort waren, hatte er nicht verstanden.
Auch, dass der alte Name Schüttkoven daher stammt, dass etwas eingesperrt oder eben eingeschüttet wurde, hatte ihm sein Vater erklärt.
Tausend Fragen musste ihm der Vater beantworten, wenn er mit seinem Sohn in die Rüsdorfer oder Süderholmer Moore ging, um Birkenreisig für die Besen zu holen.
„Vater, warum wachsen die Birken alle so schräg in eine Richtung?“, „Vater, warum bricht dem Buntspecht der Schnabel nicht ab, wenn er damit immer gegen die Bäume hämmert?“, „Vater, wieso ist der Boden unter unseren Füßen hier so weich?“, „Vater, weshalb drehen sich die Igel immer zu einer Kugel zusammen, wenn man ihnen zu nahe kommt?“ Geduldig antwortete Johannes seinem wissbegierigen Sohn auf dessen Fragen und erklärte ihm so Vieles über die Natur.
An der Westerweide gab es eine Kuhle, in der altersschwache und kranke Pferde abgestochen wurden. Darin lagen oft zwei, mitunter sogar vier Pferde und verwesten allmählich, weil niemand das Fleisch von kranken Pferden aß. So übernahmen Füchse, Hunde aber auch Krähen die Kadaverbeseitigung. Ganze Krähenschwärme saßen auf den toten Tieren, hackten darin herum, rissen sich Stücke heraus und stoben hoch, wenn man nahe herankam. Niemand nahm sonderlich Anstoß daran, aber der Junge musste dann immer an die Worte denken, die sie jede Woche im Gottesdienst sprachen:„Hinabgestiegen in das Reich des Todes… aufgefahren in den Himmel.“
Er wusste, dass jene Worte hier fehl am Platz waren und etwas bedeuteten, was er noch nicht verstand. Aber denken musste er doch immer wieder daran, während der Vater stumm neben ihm herschritt und froh war, dass sein Sohn bald in die Schule ging. Über manche Dinge mochte ein Lehrer wohl besser Bescheid wissen, als ein armer Besenbinder.
Gern tobte Peter-Johannes durch die anderen kleinen Gassen des Ortes. Spielte oft auf Kleinheide mit seinem Freund Marten und den Söhnen des Müllers Schmidt. Mit Vergnügen ließen sie alte Wagenräder, die beim Müller an der Hauswand lehnten, über die Wege rollen. Gewonnen hatte, wessen Rad als letztes umfiel.
Aber nicht nur solche Wettbewerbe mochte er. Gern sah er den Schwalben bei ihren Flugkunststücken zu.
Die Schwalben nisteten im Stall, wo immer ein Fenster für sie offen gelassen wurde. Die Mutter meinte: „Wo Schwalben nisten, ist das Glück im Haus“, und lachte ihre beiden Männer an. Gern half er ihr auch, den weißen Sand, den man in Rüsdorf kaufen konnte, oder aus Büsum heranschaffte, gleichmäßig über den Lehmboden des Häuschens zu verteilen. Wie hell und feierlich wurde es doch im engen Stübchen!
Und neugierig war der kleine Junge. Er freute sich immer, wenn er mit seiner Mutter am Postamt Ecke Südermarkt vorbeikam. Er tippte auf die Liste der zur Abholung ausgelegten Briefe. Sie musste ihm dann die Anschriften und Portopreise vorlesen und er dachte sich Geschichten dazu aus.
Auch in den Gottesdienst ging er gern, denn auch dort hörte man immer neue Geschichten. Ob eine Kuh entlaufen oder im Ort ein Haus zu verkaufen war, all das teilte der Pastor mit, denn die wöchentliche Zeitung konnte sich nur die wohlhabende Bevölkerung Heides leisten.
Die Predigt interessierte ihn weniger. Er vertrieb sich die Zeit, indem er die Kirchenstühle mit den Geschlechterwappen, Hausmarken, Jahreszahlen und Namen der einstigen Inhaber betrachtete. Sein Vater hatte ihm erklärt, dass die Kirche St. Jürgen über dreihundert Jahre alt war, und dass die Finger seiner Hände nicht ausreichten, um auszurechnen, wie viele Mal älter sie war, als Peter-Johannes selbst. Der konnte nicht begreifen, dass es so viel Zeit geben sollte, in der er noch nicht da gewesen war. Aber auch die schadhafte Balkendecke, für deren Renovierung derzeit kein Geld da war, lenkte seine Aufmerksamkeit nach oben: Ob die wohl mal über uns zusammenbricht?
Nach Beendigung des Gottesdienstes spazierte die kleine Familie gern einmal um den Markt. Vorbei an den kleinen Häusern mit schmalen Vorgärten, die oft säuberlich von einer Hecke umrahmt waren.
Ein beliebter Spazierweg von etwa einem Kilometer, da blieb immer genügend Zeit für einen Klönschnack mit Bekannten. Das einzig Störende waren die Dunghaufen, die oft zum Markt hin, an den Vorderseiten der Häuser gelegen waren. Manchmal weiteten Ohloffs den Spaziergang auch über den Schuhmacherort hinaus, oder sie spazierten über Kleinheide, wo es mit den gepflegten Bürgerhäusern und den Häusern der Handwerker, Grützmüller, und Käsehändlern so anheimelnd aussah.
Der Spazierweg führte sie dann am Scheibenwall entlang, einer großen Sandkuhle mit dem so genannten Schoolpool, einem Wasserrückhaltebecken. Anschließend ging es linker Hand am Armenhaus vorbei.
Manchmal sah er ein paar zerlumpt gekleidete Kinder vor dem Gebäude spielen, und seine Mutter erzählte ihm, dass die Armen morgens und abends Gerstengrütze mit trockenem Brot zu essen bekamen und mittags abwechselnd Buchweizengrütze mit Kartoffeln oder Erbsensuppe mit etwas Speck.
Auf dem Nachhauseweg grübelte er dann. Warum legte der liebe Gott Ihnen nicht auch mal ein Stück Fleisch auf den Teller? Manchmal ritt der Landvogt mit seinem Schimmel an ihnen vorüber. Alles sprang zur Seite, wenn das Pferdegetrappel zu hören war, denn der hohe Herr hatte Vorrang und genoss dies. Man grüßte ehrfurchtsvoll und der Landvogt erwiderte freundlich manchen Gruß.
„Vater, wenn ich groß bin, möchte ich wohl auch so ein Pferd haben.“
„Ja, mein Jung, das ist nichts für unsereins. Was wir bräuchten, wäre ein ordentliches Arbeitspferd, damit wir unseren Torf selbst aus dem Moor holen können.“
Warum durfte ein Besenbinder nicht auch so ein edles Pferd besitzen wie ein Landvogt? Er wollte sich eins anschaffen.
Als Peter-Johannes sechs Jahre alt war, wurde alles anders. Der Sommer war zu trocken. Es begann damit, dass sich überall im Ort Gestank ausbreitete. Er drang aus den Dungstätten und Aborten, die direkt neben den Häusern zur Straßenseite hin angelegt worden waren. Kein Regen spülte den Unrat fort, den die Leute vor ihre Tür kehrten.
Die den Markt umgebenen Gräben waren von einer grünen Schlammschicht bedeckt. Und dann fingen das Gerede und die Streitereien um die Pumpen an.
Neunundsechzig Wasserpumpen gab es in Heide, die bestimmten Straßenzügen zugeordnet waren. Einige lieferten ganz gutes Wasser, andere verschlammten oder drohten gänzlich trocken zu fallen. Aber es war streng verboten sich anderswo zu bedienen. Die Wasserpumpe, die zu ihrem Straßenbereich gehörte, lieferte nur noch brackiges Oberwasser. Da und dort in den Häusern gab es Kranke und bald zählte man schon vier Tote in der unmittelbaren Nachbarschaft.
Irgendwann traf es auch seinen Vater. Typhus. Peter-Johannes streichelte stundenlang dessen fieberheiße Hand und bettelte, er möge wieder aufstehen. Aber der Vater schaffte es nicht.
Die Nachbarn kamen, kleideten unter Beileidsbekundungen den Toten, wie es die Tradition vorsah und legten ihn in den Sarg. Der war vom Tischler Haders aus Holzplanken zurechtgezimmert worden.
Der Halbwaise sah diesen sehr ruhigen Handlungen mit verweinten Augen zu. Ihm tat seine Mutter so leid. Die schluchzte nur leise vor sich hin. Immer wieder umarmten sie sich. So versuchten sie sich gegenseitig zu trösten.
Der Sarg des Vaters wurde noch am gleichen Tag von Nachbarn bei sengender Hitze durch die staubigen Straßen zum Friedhof getragen. Der war mit einer niedrigen Mauer eingefasst und lag direkt neben der Kirche auf dem Markt. Weil auf dem kleinen Kirchhof nicht genügend Platz vorhanden war, wurden die Särge übereinander gestapelt. Auch wurden die Kuhlen oft nicht tief genug ausgehoben. Eingefallene Gräber und herumliegende Knochenteile vervollständigten dieses schaurige Bild.
Oft war deshalb vorgeschlagen worden, den Friedhof zu verlegen, aber die Kirchenspieldeputierten waren der Meinung, dass die Ausdünstungen für die Menschen nicht schädlich seien, der Wind würde schon alles forttragen. Sie wollten wohl die anstehenden Kosten sparen.
Auch der Sarg seines Vaters wurde auf den Sarg des Großvaters vorsichtig ins Grab gesenkt.
Die Trauergemeinde begab sich nach der Beerdigung in die Kirche, wo der Pastor vom Altar aus eine kurze Rede hielt.
Anschließend erhielt er von Dorothea die zwei Mark, die ihm für die Beerdigung vierter Klasse zustanden.
Für die Schulknaben, die die Sterbelieder gesungen hatten, warf der Priester einige Münzen auf den Boden, woraufhin zwischen ihnen die übliche Keilerei entbrannte. Nur die Kräftigsten erhaschten eine Münze.
Ein paar tröstende Worte für Mutter und Sohn gab es gratis dazu.
Peter-Johannes bekam mit, dass der Pastor Geld für die vierte Klasse erhalten hatte und fragte: „Mutter, warum wird Vater vierter Klasse beerdigt? Was bedeutet das?“
Aus ihrer tiefen Trauer gerissen, aber froh, dass ihr Sohn zu seiner alten Neugier zurückfand, erklärte sie geduldig: „Die erste Klasse ist für die Reichen. Also, für die Kaufleute, Kirchenvorsteher, Landvögte und höhere Beamte. Unsere beiden Prediger holen die Leiche dann zu Hause ab, die Glocken werden geläutet und einer der Pastoren spricht in der Kirche das Gebet, der andere am Sarg. Diese Klasse kostet zwei Reichstaler. Die zweite Klasse ist für die Kleinhändler, die Handwerksmeister und deren Ehefrauen. Dabei wird die Leiche zwar nicht vom Sterbehaus abgeholt, aber die beiden Prediger halten ihre jeweiligen Reden und bekommen jeder einen Reichstaler. Zur dritten Klasse gehören alle wohlhabenden Bürger, die nicht zu den ersten oder zweiten gehören. Dieser Gruppe steht es frei, ihre Toten zur Abendzeit mit einer Einsegnung, oder am Tag mit einer Rede von der Kanzel beerdigen zu lassen. Diese Beerdigung kostet einen Reichstaler. Kannst du dir das alles merken, Peter-Johannes?“, fragte sie ihn und er nickte eifrig.
Sie fuhr fort: „Die vierte Klasse ist nun die für Vater und später, so Gott will, auch für mich. Zur vierten Klasse gehören also diejenigen, die eigene Häuser und ein ehrliches Einkommen haben. Wie es vor sich geht, hast du ja gerade erlebt. Diese Klasse kostet zwei Mark. Aber es gibt auch noch eine fünfte Klasse. Die gilt für die Tagelöhner und alle, die unvermögend sind. Dieser Gruppe steht es frei, ob sie ihre Toten mittags mit einer kurzen Rede auf dem Kirchhof, oder abends, ohne Rede begraben lassen. Der Pastor erhält dafür eine Mark.“, endete sie.
Peter-Johannes grübelte ein wenig, dann flüsterte er seiner Mutter zu: „Ich möchte wohl später einmal erster Klasse beerdigt werden.“
„Ja, mein Sohn, so Gott will, soll es so geschehen.“
*
Glücklicherweise fand Dorothea bald eine Anstellung als Dienstmagd bei dem reichen Bauern Nielsen in der Westerstraße. Wie hätte sie Peter-Johannes sonst durchbringen sollen!
Der Junge war nun tagsüber auf sich allein gestellt, denn die Mutter kam immer erst kurz nach dem achten Glockenschlag müde nach Hause. Ab und zu steckte die Bäuerin Dorothea ein kleines Stückchen Fleisch oder einige Kartoffeln extra zu. Das ergänzte dann das armselige Essen, das oft genug nur aus Gerstengrütze und Brot bestand. Er langweilte sich oft und war froh, als er zur Schule kam.
Ganz stolz war er, als sie ihm eine Schiefertafel gekauft hatte, auf der er Schreiben lernen sollte.
Ein kurzer Weg führte ihn in die Westerstraße, wo gerade ein neues Schulgebäude neben dem Grundstück vom Gerber Stammer erbaut worden war.
Der Unterricht begann im Sommer um sechs Uhr und dauerte drei Stunden. Nachmittags ging er von zwölf bis sechzehn Uhr. Die erste Nachmittagsstunde war immer dem Gesang mit dem Konrektor gewidmet. Zuhause sang seine Mutter ihm mit ihrer hellen Stimme häufig die Lieder vor, sodass Peter-Johannes ein guter Sänger wurde, auch wenn er diesen Unterricht nicht so schätzte. Es ging ihm zu langsam voran. Die Meisten konnten keinen Ton halten und auch die Texte vergaßen sie immer wieder.
„Ihr sollt nicht brüllen, wie die Kühe im Stall“, sagte der Konrektor immer wieder. Er war dem Pfarrer verantwortlich, dass die Beerdigungsgesänge der Schüler der Würde des Anlasses gerecht wurden.
Im Winter begann der Unterricht eine Stunde später. Bei Eintritt in die Schule mussten drei Schillinge bezahlt werden. Jeden Sommer kam ein Schilling dazu, im Winter anderthalb Schillinge.
Im Winter mussten die Kinder noch ihre eigenen Kerzen mitbringen. Manchmal saßen sie auch zu zweit bei einer Kerze, um am teuren Wachs zu sparen.
Bevor Peter-Johannes das erste Mal in der Kirche zur Beerdigung mitsang, ermahnte der Lehrer die Klasse: „Wenn für die Leichen die Predigt gehalten wird, habt ihr still in der Kirche zu bleiben und zuzuhören, damit ihr die Sterbekunst lernt! Habt ihr das begriffen?“
Er sah seine Schulkinder nacheinander ernst an. „Jedem, den ich ertappe, dass er aus der Kirche läuft oder sich in den Gängen rumtreibt, erteile ich fünf Hiebe.“ Dabei ließ er den Rohrstock in seinen Händen auf- und abwippen. „Haben wir uns verstanden?“ Ein mehrfaches Ja-Herr-Lehrer kam als Antwort. „Und noch eins“, sprach er mit fester Stimme. „Derjenige von euch, der sich beim Singen mehr Mühe gibt als andere, bekommt das Geld. Es wird auf Anordnung des Herrn Landvogtes kein Geld mehr in die Gänge geworfen. Also, ernsthaft und andächtig gesungen!“
Und Peter-Johannes gab sich große Mühe. So konnte er doch zu Hause seinen kleinen Schilling vorlegen. Dorothea nahm ihren Sohn beglückt in den Arm. Was für ein gutes Kind hatte sie doch.
Mit dem Herrn Konrektor, Schreibmeister Kose, kam er anfangs ganz gut zurecht. Erst später machte er Bekanntschaft mit dessen Rohrstock.
Acht Schläge quer über beide Handflächen bekam er verabreicht, weil er nicht sauber genug geschrieben hatte. Dann fragte der Lehrer auch noch: „Hast du genug?“ Und er antwortete mit gequälter Stimme:„Ja, Herr Lehrer Kose.“ Hätte er mit einem Nein geantwortet, wie er es von den älteren Jungen gehört hatte, hätte es noch einmal so viele Schläge gegeben. So mutig war er noch nicht. Der Mädchen wegen, mit denen sie bis zum neunten Lebensjahr gemeinsam unterrichtet wurden, war es ihm peinlich zu weinen. Zumal eines der Mädchen immer gehässig grinste, wenn der Lehrer Stockhiebe austeilte. Das war Hedwig, die Tochter vom Kornmüller Lorenz.
Von allen ungeliebt, versuchte sie dennoch, sich immer wieder - vor allem bei den Lehrern - einzuschmeicheln. Sie war es auch, die die Tintenfässer, die auf den Schulbänken standen, herunter warf. Sie war es, die die Tinte mit Wasser verdünnte. Die Schuld dafür wälzte sie regelmäßig auf andere ab. Das Schlimmste jedoch war, dass die Lehrer sie nie in Verdacht hatten, weil sie so unschuldig tat und den Lehrern gegenüber beständig freundlich war. Peter-Johannes mochte Hedwig ganz und gar nicht.
*
1825, als Peter-Johannes elf Jahre alt war, wurde der Friedhof unter großer Anteilnahme der Bevölkerung doch noch umgelegt.
Die Einwohner erfuhren, dass ein reicher Heider Bürger, Friedrich Wilhelm Peters, der Kirchengemeinde ein Stück Brachland, außerhalb des Ortes geschenkt hatte. Weil viele Bewohner sich aber über den weiten Weg zu dem moorigen Landstück beklagten, tauschte der Landvogt seine an der Heistedter Weg gelegene Weide dagegen ein. Diese lag auch viel näher am Ortskern und war erheblich trockener.
Wer Verstorbene auf dem alten Friedhof an der Kirche hatte, bekam ein kostenfreies Anrecht auf einen Grabplatz auf dem neuen Friedhof. Die Gebeine der Verstorbenen sollten ausgegraben und umgesetzt werden.
Peter-Johannes und Marten kamen mit einigen Mitschüler nach dem Schulunterricht gerade darauf zu, wie einige Gräber ausgehoben wurden. Die Knochenteile lugten aus den Särgen oder lagen auf den Wegen verstreut.
„Mensch guck mal, Peter-Johannes, jetzt haben sie das Grab von deinem Vater zu fassen. Uh, wenn da mal nicht gleich was raus fällt!“, meinte einer der Jungen belustigt. Ihm wurde bei der Vorstellung daran übel und er verabschiedete sich hastig. Marten rannte hinter ihm her, legte kumpelhaft seinen Arm um Peter-Johannes. „Denk dir doch nichts dabei. Er hat es bestimmt nicht böse gemeint. Komm doch mit zu uns. Meine Mutter wollte heute Erbsensuppe kochen, da kannst du gut mitessen, weil sie die immer für mehrere Tage im Voraus kocht.“ So gingen die Schuljahre dahin und Peter-Johannes wuchs zu einem kräftigen, schlanken Jungen heran. Bald war die Konfirmation, er würde aus der Schule entlassen werden und müsste sich nach einem Lehrherrn umsehen.
Und dann kam dieser denkwürdige Sonnabend.
Denkwürdig für die Heider, nicht minder denkwürdig für Peter-Johannes. Jedes Detail dieses Tages würde er für immer im Gedächtnis behalten. Nie würde er vergessen, wie ihn morgens die Kirchturmglocke weckte und er die Schläge zählte. Acht mal hatte es geläutet: So spät war es schon. Er hörte die Vögel in der milden Herbstluft ihre Lieder trällern. Schnell sprang er aus der Schlafkoje, schlug, wie seine Mutter es ihm beigebracht hatte, die Federdecke zum Auslüften zurück und ging zur Waschschüssel, die sie ihm schon früh gefüllt hatte. Oberflächlich wusch er sich das Gesicht, die Ohren, den Hals und stieg in seine Hose. Wollene Socken und die abgelaufenen Holzschuhe folgten. Geschwind zog er sich ein sauberes Hemd und die Jacke über und griff zum Tonkrug, um sich einen Becher Milch einzugießen, den er mit Genuss trank. Bevor er jedoch zum Markt ging, um Käse einzukaufen, fütterte er die Tiere im Hof. Dann marschierte er voller Freude Richtung Wochenmarkt.
Was es hier alles zu sehen und zu kaufen gab!
Da war zunächst einmal das Vieh: Pferde, Kühe und kräftige Bullen waren an den Häusern rings um den Markt an eisernen Ringen oder an zwischen den Steinen hängenden Ketten befestigt und wurden zum Verkauf angeboten. Peter-Johannes streichelte die Pferde gern, klopfte ihnen den Hals und träumte davon, selbst einmal eines zu besitzen um damit über die Felder zu galoppieren oder gemächlich, wie der Landvogt, erhobenen Hauptes durch den Ort zu schreiten.
Schafe, Federvieh und Schweine wurden auf dem Markt angeboten. In einem großen Weidenkorb standen einige quiekende Ferkel. Er blieb stehen, um dem Schweinehändler, der ein kleines rosiges Ferkel auf dem Arm hielt, und einem Käufer beim Feilschen um den Preis zuzuhören. Das schien sich hinzuziehen. Bei jedem neuen Gebot schlugen die beiden Männer die Hände gegeneinander. Doch endlich waren sie sich einig. „Schlag ein!“, hieß es und sie besiegelten das Geschäft mit einem Handschlag.
In großer Zahl waren mit Korn beladene Wagen angefahren. Die Händler verkauften das Getreide vom Wagen herunter und die Käufer tauschten es danach meistens bei den Bäckern gegen Brot ein.
Auch Torf, Holz, Stroh und Heu wurden angeboten. Fische, die sogar von Fischern aus Helgoland angepriesen wurden, lagen zum Kauf aus. Zwanzig, je nach Jahreszeit sogar dreißig Stände der Schlachter waren an der Westseite aufgebaut. Aber auch Kuchen, Eier und Käse wurden präsentiert. Selbst Käsehändler aus der Wilstermarsch waren zahlreich da. Peter-Johannes ließ sich mit seinem Käseeinkauf aber noch Zeit. Er wollte sich erst einen Überblick verschaffen.
Interessant war der Planwagen von Male Semp, weil die Menschen Schlange standen, um den von ihr selbstgemachten Senf zu kaufen. Er kannte Male, denn sie war eine gute Bekannte seiner Mutter. Sie wohnte in einer kleinen Kate in der Mühlenstraße, wo sie nach eigener Rezeptur mit ihrer Handmühle die Grundlage für ihr beliebtes Produkt herstellte. Leute aus der gesamten Umgebung kamen extra zum Wochenmarkt, um bei ihr zu kaufen, wenn sie mit ihrem Planwagen mal länger nicht über die Dörfer gezogen war.
„Junge“, rief sie ihn an, als er sie grüßte, „was bist du groß geworden. Kommst ja ganz nach deinem Vater! Einen schönen Gruß an Mutter und sie soll mal wieder auf einen Schwatz vorbeikommen.“
„Danke, Frau Semp, ich richte den Gruß gern aus“, gab Peter-Johannes zurück und huschte weiter zu den mit Leinen bespannten Holzbuden. Hier gab es Tuch- und Kurzwaren, aber auch Holzspielzeug.
Die geschnitzten Tiere schaute er bewundernd an. Ein Pferd hatte es ihm besonders angetan und er musterte es schon eine ganze Weile. Er fühlte sich fast zu groß, um so ein Spielzeug anzufassen, aber dieses Tier hätte er gerne in die Hand genommen, um mit dem Finger die fein gearbeitete Mähne entlang zu fahren.
Misstrauisch beäugte ihn der Händler schon eine ganze Weile, denn es wurde häufig gestohlen, besonders in letzter Zeit. Dann bemerkte er aber, dass der Junge bloß ganz vernarrt in das Holzpferd war. „Wenn du saubere Hände hast, kannst das Pferd gern mal nehmen.“
Behutsam und ein wenig schüchtern nahm der die schöne Holzarbeit in die Hand, drehte und wendete das Pferd, kontrollierte, ob auch fein sauber alle Kanten geschliffen waren und stellte es an seinen vorherigen Platz zurück.
Ihm kam ein Gedanke: Vielleicht sollte er Holzspielzeugmacher werden. Er könnte ja noch mal bei Meister Haarländer in der Weddingstedter Straße anfragen, ob der einen fleißigen Lehrjungen brauchte. Sein Sohn Christian war ja gerade mit der Gesellenzeit fertig und einen anderen hatte der Meister wohl noch nicht eingestellt.
Mit diesem neuen Gedanken - oder Traum? - spazierte er weiter über den Markt, vorbei an den Ständen der Goldschmiede, der Schuster und Reepschläger, den Bürstenmachern, Schaufelherstellern, Torfstechern und den Obst- und Gemüsehändlern. Zum Teil wurden Waren auch auf dem Boden liegend angeboten. Diese Art des Verkaufens kostete nur die Hälfte der sonst üblichen Marktgebühren. Viele Töpfer und Holzwerkmacher mit ihren nicht zu großen Erzeugnissen nahmen dieses Angebot bevorzugt an.
Und dann geschah es.
Harmlos stand er an einem Obststand, als er plötzlich angesprochen wurde.
„Einen guten Tag wünsche ich dir, Peter-Johannes“, kam es ausgerechnet von Hedwig, die er seit seinem Wechsel in die Knabenschule im neunten Lebensjahr nicht mehr gesehen hatte. Verblüfft sah er sie an.
„Na, wirst ja demnächst konfirmiert, hast schon einen Lehrherren?“, fragte sie und fügte gehässig hinzu: “Oder wirst du doch bloß Tagelöhner?“
„Hedwig, lass mich einfach in Ruhe. Ich möchte nicht mit dir reden“, gab er zur Antwort und wollte einfach weitergehen, als sie laut rief: „Er hat geklaut! Peter-Johannes Ohloff hat zwei Äpfel gestohlen, ich habe es genau beobachtet!“
Ihm fiel vor Schreck die Kinnlade herunter. Bevor er noch etwas erwidern konnte, hatten ihn zwei Männer gepackt, zerrten ihn an den Armen mit sich und schimpften laut: „Zum Stockmeister mit ihm!“
Der Junge wehrte sich verzweifelt, denn was der Stockmeister bedeutete, war ihm klar.
„Ich habe nichts gestohlen, ich habe nichts getan, bitte, ihr Herren, lasst mich los“, rief er verzweifelt. Aber es nützte nichts. „Dieb, du gemeiner!“, schimpfte der eine, „Lump!“, der andere. Und sie zerrten ihn in Richtung Stockhaus, das neben dem Gefängnis in der Österstraße lag.
Trotz des geschäftigen Treibens ringsherum erregte das Aufmerksamkeit. „Vielleicht hat der Junge ja wirklich nichts!“, rief jemand. Über seinem Kopf dröhnte die Stimme des Häschers zurück: „Solch ein Gesindel wohl auch noch verteidigen? Du bist wohl selber ein Gauner, was?“
„Sich an Kindern vergreifen, das können sie, aber die wirklichen Diebe kriegen sie nicht“, schallte es aus einer anderen Richtung. Dem wurde geantwortet: „Dazu sind die doch sowieso zu feige.“ „Vielleicht hat er nur Hunger, wenn deiner Hunger hätte, würdest du ihn dann auch zum Stockmeister schleppen?“ „Aber da könnte ja jeder kommen“, gab jemand anders zu bedenken, doch das ging schon fast im allgemeinen Tumult unter. Jeder hatte eine Meinung und wollte sie kundtun. „Die Kleinen schlägt man und die Großen lässt man laufen“, hörte Peter-Johannes noch. Seine beiden Häscher beeilten sich nun, ihn aus dem Zentrum des Geschehens fortzubekommen. Schimpfend gaben sie ihn beim Stockmeister ab. „Jetzt nehmen die schon die Diebe in Schutz, Zeiten sind das!“, und schilderten aus ihrer Sicht, was vorgefallen war.
Peter-Johannes beteuerte seine Unschuld, aber wer glaubt schon einem dahergelaufenen Jungen gegen das Zeugnis zweier ehrenwerten Männer! Eine gehörige Tracht Hiebe mit dem Stock wurde ihm umgehend verabreicht. Das war es, was allen widerfuhr, die an diesen Ort eingeliefert wurden. Sowohl bei der Ankunft, als auch bei der Verabschiedung. Er schrie verzweifelt. Nach dieser Misshandlung war er kaum in der Lage, nach Hause zu gehen. Der entrüstete Stockmeister hatte sich Mühe gegeben.
Sein Vorfall wurde inzwischen überall diskutiert. Jedem waren die Diebstähle der letzten Zeit unheimlich, denn jeder wusste inzwischen von irgendeinem Nachbarn zu berichten, dem etwas abhanden gekommen war. Mal gewannen die Rufe nach hartem Durchgreifen die Oberhand, mal diejenigen, die wegen der herrschenden Not – zumindest bei Kindern – Milde gelten lassen wollten. Schließlich kam man überein, dass die Strafe unrecht gewesen wäre, weil der Diebstahl schließlich nicht erwiesen sei.
Peter-Johannes bekam von alledem nichts mit und schleppte sich derweil durch die Seitenstraßen nach Hause. Er schämte sich und traute sich deswegen nicht noch einmal über den Markt.
Einige Marktbesucher die von dem Vorfall gehört hatten, sahen ihn dabei und verkündeten dies wie eine Sensation auf dem Markt. Bald schwirrten die unglaublichsten Gerüchte herum. Es hieß, der Junge sei schwer misshandelt worden und eine Blutspur würde sich vom Stockhaus an durch die Straßen ziehen. Kurz darauf wurde schon behauptet, der Junge sei halb tot geprügelt worden und liege im Sterben.