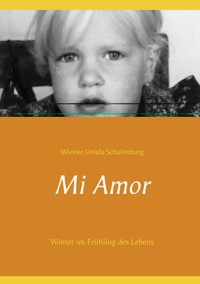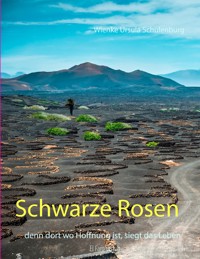
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: El Faro
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Hineingeboren in eine Familie, die in einfachen Verhältnissen auf einer kleinen Insel Mitte des letzten Jahrhunderts lebt, erfährt Santiago eine Kindheit voller Schrecken, ausgeliefert der Zügellosigkeit und Willkür seiner Mutter, die ihn in ihre seelischen Abgründe zieht. Er wird ihr Liebhaber wider Willen, hin und her gerissen zwischen Gier, Abhängigkeit und Sehnsucht nach sich selbst, zwischen Liebe und Untergang, zwischen Leben und Tod. Nur knapp entkommt er dem Wahnsinn seines ihn gefangen haltenden Umfeldes und findet sein Leben über schicksalhafte Begegnungen mit Menschen, die ihn ein Stück auf der Suche nach seiner Wahrheit und Freiheit begleiten. Eine Irrfahrt durch die Welt der verrohten und verdorbenen Gefühle beginnt, bei der er immer wieder mit dem bösen Geist seiner Vergangenheit konfrontiert wird, die ihn ihm weiterlebt, um am Ende, Kraft seines unabdingbaren Willens und Liebe zum Leben, seine Freiheit zu finden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1059
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Danksagung
Mein ganz besonderer Dank geht an Dietmar Schoof, Gründer des Opferschutzvereins „El Faro e.V., Verein zur Hilfe und Unterstützung von Opfern sexuellen Missbrauchs und Gewalt“, der mir über Jahre hinweg mit seiner ganzen Kraft und Liebe zur Seite stand.
Lieber Dietmar, ohne Dich wäre ich heute nicht der Mensch, der ich bin. Danke, dass Du mir geholfen hast, mein Leben wieder zu finden als alles verloren schien. Du bist ein wahrer Seelen-Not-Retter, für mich und so viele, viele andere.
Danke, dass Du in den dunklen Stunden meines Lebens da warst. Danke, dass Du in den hellen Stunden meines Lebens da warst und bist. Und danke, dass Du immer da sein wirst, mein Seelenfreund, mein Weggefährte.
Mein Dank geht an Frau Schoof, die mir mich gesehen hat, als niemand mich mehr erkannte, weil meine Essenz verschüttet unter den Trümmern meiner Seele lag und die mir die Tür zu mir selbst öffnete. Danke, dass Sie an mich geglaubt und das Beste in mir gesehen haben.
Meinen Weggefährten aus alten Tagen, Frau Huber und die vielen Menschen, die mir Schutz und Halt gaben.
Meine Seelenfamilie, Mitstreiterinnen und liebe Kolleginnen Ina, Marion und Christina, die jeden Tag ihre Kraft und Wissen für dieses schwierige Thema einsetzen und mit denen zusammen dieser Weg so viel schöner und leichter ist!
Cora und Alma – Herz und Seele, meine treuen, wachsamen, wehrhaften Begleiterinnen.
Sifu, „Engel aus der Hölle“ ;)
Meine Seelenschwestern Nandi, Nele und Birgit.
My Spiritual Familiy and CWG-friends all over the world for being who you are.
Y Alejandro, mi gran amor, por formar parte de mi vida y por ser un angelito.
Widmung
Den Menschen gewidmet, die durch die Hölle auf Erden gehen mussten. Die, wie so viele von uns, dem seelischen Tod ins Auge blickten und dennoch die Kraft fanden, weiter zu leben und zu kämpfen, für sich und ihr Leben
Es ist denen gewidmet, die in den härtesten Stunden ihres Daseins nicht die Hoffnung verloren, sondern weiter atmeten und vertrauten, wohl wissend, dass dort, wo noch Hoffnung ist, stets das Leben siegt.
Inhaltsverzeichnis
Santiagos Jugend und Encarnas dunkles Geheimnis
Das Militär und das Tor zur Welt
Warten auf Veränderung
Klara
Der Weg in die Freiheit
Nachwort
Es war einmal auf einem Fleckchen Erde, irgendwo verloren in den Weiten eines Ozeans an einem Ort, der auch genauso gut überall hätte sein können, wenn er nicht so besonders gewesen wäre…
Auf diesem Eiland, weit draußen im Meer, wurde eines Tages ein kleiner Junge geboren, ein Kind, das die Sonne in seinem Herzen und die Anlagen eines starken, schönen, in sich geraden und aufrechten Menschen in sich trug. Ein Kind, dessen Bestimmung es war, ein König der verlorenen Herzen zu werden. Ein Mensch, der durch die Kraft seiner Seele und Reinheit seiner Gefühle anderen Menschen ein Spiegel der Wahrheit werden sollte, in dem sie sich selbst und ihr Leid erkennen sollten, um an ihm zu wachsen und wieder heil zu werden und so sich selbst und ihrer Bestimmung ein Stück näher zu kommen. Es sollte ein Mensch werden, der, durch sein eigenes Leid gezeichnet und geprägt und dessen Überwindung gereift, zu einem Beschützter derjenigen wurde, die hilflos und schwach ihrem Schicksal und der Willkür anderer ausgeliefert waren und verloren gewesen wären, wenn nicht er schützend seine Arme um sie gehalten und stets ein waches Auge auf sie gehabt hätte.
Für diese Menschen sollte er eines Tages zu einem Vorbild werden, einem Menschen, der vielen anderen half, ihr Leben und ihre Seele zu retten und sich aus den Verwirrungen und Verstrickungen ihres fremdbestimmten Lebens zu befreien. Ein Mensch, der aus seinem Inneren heraus strahlte und der im Äußeren doch so unscheinbar und bescheiden daherkam, dass man ihn übersehen hätte. Und der sich tief in die Gefühle der Menschen grub, da er ihre verschütteten, verletzten Seelen mit der seinen, die erst starb, um Kraft seines Willens und der unstillbaren Sehnsucht nach Freiheit und Selbstbestimmung wieder geboren zu werden, berührte und wieder erweckte.
Denn nur der, der dem Tod ins Auge blickte, nur der, der die tiefsten Abgründe seines Lebens durchschritt und einem Phönix aus der Asche gleich sein Schicksal überwindet, wird die Kraft und den Mut haben, den verschütteten Seelen in den Schluchten der Verdammnis die Hand zu reichen, um ihnen heraus zu helfen, aus der Hölle ihres Daseins.
Man hatte den Pfarrer nach alter Sitte und auf den dringlichen Wunsch der Mutter zu dem Neugeborenen gerufen, war dies doch ein alter Brauch in ihrer Gemeinde und darüber hinaus die Geburt eines Kindes etwas nicht Alltägliches und bedeutsam genug, um sich den Segen Gottes zu holen. Eilig hatte der Dorfpfarrer seine heiligen Pflichten ruhen gelassen und war hinauf geeilt den langen, beschwerlichen Weg einer holprigen Straße, die sich durch die verlassene, karge Landschaft ihrer Insel wand, vorbei an knorrigen Olivenbäumen, vertrocknetem Gestrüpp und ein paar mühsam angelegten Feldern und Gärten, wo man der Erde das Nötigste zum Leben abrang. Es war eine karge Landschaft, die geprägt war von den riesigen Vulkanen, die einst ihre Insel geboren hatten und die majestätisch und stolz ihre Krater gen Himmel hoben und zu schlafen schienen, denn seit langer Zeit herrschte Ruhe auf ihrer Insel, der Feuerinsel. Nur die unendlich scheinenden, schwarzen Lavafelder zeugten von einer Zeit, in der die wahren Herrscher der Insel ihre Macht demonstriert und sie unter ihrer feurigen Wut und ihrem glühenden Atem begraben hatten.
Es war heiß an diesem Hochsommertag, die Sonne brannte ohne Gnade von dem blauen, wolkenlosen Himmel herab und brachte die schwarzen Steine zum Glühen, die, einer zweiten, schwarzen Sonne gleich, ihre Hitze zurück strahlten. Der Pfarrer schwitzte unter seiner dunklen Robe und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Er war keiner von hier, sondern ein „Fremder“, wie man ihn lange Zeit genannt und damit auch zurückgewiesen hatte, ein Fremder vom weit entfernten Festland, den die Kirche zu ihnen geschickt hatte. Es hatte ihn viel Kraft, Geduld und Zeit gekostet, sich auf dieser Insel und in den Herzen und Gemütern der Insulaner zurecht zu finden. Obwohl sie die gleiche Sprache sprachen und dem gleichen Land angehörten, gingen die Uhren hier anders Die Insulaner bildeten gemeinsam mit den Menschen der Nachbarinseln des Archipels eine eigene, verschworene Gemeinschaft, die nur schwer zu erobern war.
Oft wäre er fast an ihnen verzweifelt und hätte seiner Aufgabe den Rücken gekehrt, wenn er nicht gespürt hätte, dass hier sein Schicksal lag und es Gottes Wille wäre, seinen Dienst an der Menschheit zu verrichten. Hier in der Einsamkeit einer verlassenen Inselwelt, auf diesem Eiland, wo sich der Herzschlag der Erde, ihr Herzblut und ihre Seele mit der Sonne verband, wo ein Stück Land und Leben aus einem Ozean heraus entstanden war; hier, wo Tod und Leben so eng beieinander waren, dass sie sich die Hand zu geben schienen, hatte Er ihn festgehalten. Intuitiv wusste er, dass er nur hier das würde lernen und erleben können, was seine Seele als Impuls und Ausreifung in diesem Leben brauchte.
Selten hatte er eine leblosere, ödere Landschaft gesehen als auf dieser Insel. Und selten so deutlich und nah den Kampf des Lebens miterleben können, das sich überall auszubreiten und sein Territorium zurück zu gewinnen versuchte. Diese Kraft war es, die auch er in sich trug und die er an den Menschen bewunderte, die noch dort ihre Felder bestellten, wo andere nur kopfschüttelnd aufgegeben hätten. Doch hatte er auch ihre Schattenseiten kennengelernt; Seiten, die wohl in allen schlummerten und vielleicht hier, wo die Menschen noch mehr auf sich selbst zurückgeworfen waren, deutlicher zum Vorschein kamen. Zumindest kam es ihm so vor, gab es hier doch weniger Ablenkung von dem, was die Menschen in ihrem Innersten bewegte, was sie vorwärts trieb und was sie hinderte, was sie über sich selbst hinauswachsen ließ oder sie hinunter zog in die Abgründe ihrer Seele.
Ja, es war eine Gratwanderung zwischen Leben und Tod, dachte er sich, als er die letzte Biegung zu dem alten Gehöft nahm, eine Gratwanderung, die auch ihn mehr als einmal herausgefordert und mit den Schattenseiten seiner selbst konfrontiert hatte. Und wäre nicht sein tief verwurzelter Glaube an Gott und die Gerechtigkeit des Lebens gewesen, vielleicht hätte er sich nicht halten können, hätte seinen geraden Weg verloren und wäre hinab gestürzt in den Schlund der Hölle, der ihm hier näher an den Menschen vorkam als sonst. Quoll nicht hier und da aus den scheinbar verloschenen Kratern der Vulkane noch Rauch und Dampf und Schwefel hervor? Und obwohl er nicht viel von dem Aberglauben der Insulaner hielt, so musste doch auch er zugeben, dass der heiße Atem der Erde nicht viel Gutes verhieß und einem trotz seiner Wärme einen kalten Schauder über den Rücken laufen ließ.
So war er schließlich auf dem alten Hof der Familie Ferrer angekommen, einem Gehöft, das wohl schon seit Menschengedenken hier stand und immer wieder auf- und ausgebaut worden war. Hier lebte Encarnación Dolores mit ihrem Mann Carlos, einem Fischer, und ihren zwei Kindern. Eine typische Insulanerfamilie. Er kannte Encarnación Dolores seit sie ein kleines Mädchen gewesen war und es war wohl das Schicksal, das diese beiden Menschen sich hier hatte begegnen und ihre beiden Leben miteinander hatte verbinden und verweben lassen. War er doch für sie mehr als nur ein kirchlicher Vater, sondern auch der stille Wächter ihrer Seele, der sie zwar nicht vor den Unbilden des Lebens hatte schützen, sie aber in ihrem Leid doch zumindest hatte begleiten können. Sie war einer der wenigen Menschen, die ihr Herz für ihn geöffnet hatte, eine der wenigen, die ihm Zutritt zu ihrer Seele gestattete und an ihr hatte er aufs Bitterste lernen müssen, dass ihm trotz Macht seines Amtes die Hände gebunden waren und seine Hilfe darauf beschränkt blieb, ihr seelische Unterstützung zu geben, sie aber nicht retten zu können. Durch sie war er auf das zurückgeworfen worden, was er war, durch sie hatte er an seinem Glauben gezweifelt, um wiederum tiefer zu ihm zurück zu finden und es war so, als hätte ihm das Leben selbst diesen Menschen geschickt, damit er durch sie die wahre Bestimmung seines Berufes und seines Lebens würde finden können.
Er öffnete die Tür und betrat die kühle Stube, die hinter dicken Steinmauern lag und die Hitze an sich abprallen ließen. Dankbar nahm er ein ihm gereichtes Glas kühlen Wassers an und setzte sich. Einige Fensterläden waren geschlossen und so war es dunkel in diesem großen Raum, der Küche, Esszimmer und Wohnzimmer zugleich beherbergte. Es war ein traditionelles Haus, das wohl mehr gesehen haben mochte im Laufe der Jahre und Generationen, die hier gelebt hatten, als er wissen wollte.
Die Mutter von Encarnación kam die knarrende Treppe herunter, im Arm ein Bündel.
„Das ist er, Herr Pfarrer“, richtete sie ihre Worte an ihn, „mit den ersten Sonnenstrahlen hat er das Licht der Welt erblickt.“
Der Pfarrer näherte sich langsam der alten Frau mit dem Kind auf dem Arm. Tief berührt nahm er den kleinen Erdenbürger in den Arm und ihm war, als wäre er dem Göttlichen dieser Welt ein Stück näher als sonst, als würde er Gottes Wirken unmittelbar spüren können, so wie er es auch oft erlebt hatte, wenn er einen Menschen in den Tod begleitet hatte. Lange betrachtete er das zarte Geschöpf und spürte das Wunder des Lebens, das sich hier in diesem Menschen verwirklicht hatte. Obwohl so klein und hilflos, hatte dieses Wesen bereits einen Charakter und eine Seele, die noch rein und unschuldig war und doch schon mit seiner Geburt in diese Familie besetzt und auf gewisse Weise infiziert worden war durch das, was es als Aufgabe, Schicksal und Last in seinem Leben zu tragen und zu überwinden haben würde.
Angesichts dessen, was dieses kleine Geschöpf in ihm an Gefühlen auslöste, fühlte er sich selbst klein und unwissend hinsichtlich der wahren Geheimnisse des Lebens. Er spürte, dass er, obwohl er täglich um die Wahrheit kämpfte, ein kleiner, demütiger Schüler war, der wusste, dass dieses sein Leben nicht ausreichen würde, um es in seiner Unendlichkeit begreifen zu können und wenn er nur eine Ahnung von ihm bekäme, er sich schon glücklich würde schätzen dürfen.
„Herr Pfarrer“, hörte er die raue Stimme der alten Frau, „meine Tochter lässt fragen, ob Sie bei der Namensgebung nicht behilflich sein könnten.“
Lange betrachtete er das schlafende Kind in seinen Armen und öffnete sein Herz, so weit er konnte, um zu spüren, was ihm dieses Wesen sagen wollte. Um zu fühlen, wer dieser Mensch war und welcher Name am besten das ausdrücken würde, was er als Essenz und Aufgabe in sich trug.
Behutsam strich er über den von dunklem Flaum bedeckten Kopf und obwohl dieses Wesen kleiner und zerbrechlicher nicht hätte sein können, so ging doch eine Stärke von ihm aus, die ihn erstaunen hieß. Ihm war, als umgäbe diesen Menschen eine Kraft wie ein Magnetfeld und eine Entschlossenheit, sein Leben zu leben und zu meistern, die er selten bei einem Menschen gespürt und wahrgenommen hatte. Santiago, fuhr es ihm plötzlich durch den Kopf, Santiago de Compostela! Ja, auf dem Jakobsweg, dem Pilgerweg zum Grab des heiligen Santiago, hatte er sich so entschlossen und wie von einer Wolke aus Licht und Kraft umgeben, gefühlt, als er über Wochen hinweg durch die Hitze eines spanischen Sommers pilgerte und er mit den Zweifeln über seinen Weg in die Zukunft kämpfte. Er erinnerte sich noch genau an jenen Moment, als er nach langem Kampf endlich eine Antwort in sich gefunden hatte und er seine inneren Schatten hatte besiegen können und für einen Moment das tiefe Gefühl von Klarheit und Einsicht hatte, Einsicht in sein Leben und das, was seine tiefere Bestimmung sein würde.
Als hätte der kleine Junge seine Gefühle gespürt, öffnete er plötzlich seine Augen und sah den Pfarrer an. Es war ein wacher, sehender und wissender Blick, wie es ihm vorkam. Ein Blick, der ihm direkt in die Seele ging und dem er sich nicht entziehen konnte, traf er ihn doch dort, wo er nur im tiefsten Gebet versenkt hinzuschauen vermochte. Tief ergriffen verharrte der Pfarrer einen Moment. Wen hatte er hier in diesem kleinen Menschen vor sich? Es musste eine alte, reife Seele sein, die ihn hier aus den Augen dieses Säuglings anblickte. Eine Seele, die sich noch einmal dazu entschlossen hatte, sich einen Körper aus Fleisch und Blut zu suchen, um, in ihm gefangen, durch die Niederungen des Lebens zu gehen, um sich formen und verwunden zu lassen, um wachsen, reifen und ein Stück vollkommener werden zu können.
Plötzlich fing der kleine Junge an zu schreien. Der Pfarrer zuckte zusammen, als wäre er aus einer anderen Welt zurück in das Hier und Jetzt gerissen worden. Die Alte trat schnell auf ihn zu und nahm ihm das Kind ab.
„Ich werde ihn zu seiner Mutter bringen, Herr Pfarrer.“
Vorsichtig übergab er das kleine Bündel an die alte Frau, die ihn mit erwartungsvollem Blick ansah. „Santiago soll er heißen, sagen Sie das Ihrer Tochter.“ Und als befürchtete er, die Alte könne den Namen vergessen, wiederholte er noch einmal mit Nachdruck: „Santiago, Señora!“
„Wie der Schutzheilige unseres Landes!“, entgegnete diese, drehte sich um und ging die knarrende Treppe hinauf zum Schlafgemach ihrer Tochter.
-
Jahrzehnte waren ins Land gegangen, als auf einem anderen Flecken Eerde, irgendwo in dieser Welt, auf einer fernen Insel, ähnlich der, auf der Santiago geboren worden war, ein kleines Segelboot antrieb. Sein Mast war gebrochen und das Segel lag in Fetzen über dem Deck und es schien, als ob die Schicksalskräfte das Schiff gepackt und mit ihm gespielt hätten und es samt seiner Besatzung dem Tode geweiht gewesen wäre, wenn nicht die Hand Gottes selbst sich schützend um seinen zerbrechlichen Rumpf gelegt und es sicher gen festen Boden getrieben hätte. Das Ruder war gebrochen, der Diesel für den kleinen Hilfsmotor war auf der langen Fahrt zur Neige gegangen und hatte den Motor verstummen lassen. So waren sie lange, lange Tage ziellos, wie es schien, vor sich hingedümpelt, irgendwo verloren im Nichts der Unendlichkeit eines Ozeans, ohne ein menschliches Zeichen, ohne Funkkontakt, mit immer spärlicher werdenden Vorräten und Trinkwasser, das in der Hitze der unbarmherzig glühenden Sonne in seinen Kanistern zu verdunsten schien.
Schon von weitem hatten die Kinder, die lärmend am Strand spielten, das kleine Boot gesehen und waren aufgeregt zum Inselhafen gelaufen, um dort von dem fremden Ankömmling zu berichten, denn es kam selten vor, dass sich jemand zu ihnen verirrte. Sofort hatte man ein paar kleine Fischerboote klar gemacht und war hinaus gerudert, den Fremden entgegen.
Das Wasser war glasklar in dieser kleinen Bucht, ein weißer Strand lag wie ein weißes Band zwischen dem Wasser und dem Mangrovenwald und ein Himmel so blau, wie Santiago ihn von daheim kannte, überspannte sie wie ein großes Zelt. Das muss das Paradies sein, dachte er, während er sich von der Sonne verbrannt und ausgedörrt mit müden Händen und letzten Kräften an der Reling hochzog und wie gebannt auf das Fleckchen Erde starrte, das sich vor seinen Augen aus dem Wasser erhob.
Winkend und laut rufend waren einige Männer in kleinen, abenteuerlichen Booten zu ihm hinaus gefahren. Rettung ist in Sicht, dachte er sich, endlich Rettung! Wenig später machten die kleinen Boote längsseits fest und ein paar kräftige Männer kletterten an Bord. Sie redeten in einer Sprache, die der seinen sehr ähnlich klang und obgleich er schwieg, sprach das Bild, das sich ihnen bot, mehr als es tausend Worte vermocht hätten: ein fast völlig zerstörtes Schiff, ein Mann mit ausgemergeltem Körper und verwildertem Bart, sichtlich am Ende seiner Kräfte. Nur zu gut kannte man hier die Tücken der See und wie es aussah, musste dieser Fremde von weit her kommen, wie die Flagge verriet, die sonnengegerbt und vom Wind zerschlissen am Heck seines Schiffes wehte.
Ich habe überlebt, endlich ist Rettung da, waren die letzten Worte, die Santiago durch den Kopf gingen, bevor ihn eine tiefe Ohnmacht umfing und er auf dem Deck zusammenbrach. Es fiel aller Druck und alle Angst und Anspannung der letzten Wochen von ihm ab und erst jetzt, wo er sich in sicheren Händen wusste, konnte er sich fallen lassen. Noch bevor er auf die harten Planken aufschlug, hatten ihn zwei kräftige paar Hände gepackt und festgehalten. Viele Stimmen riefen durcheinander, man suchte nach Wasser, um es dem Fremden zu geben und zog und zerrte an ihm, um ihn zurück zu holen. Doch von alledem bekam Santiago nichts mit, zu tief war die Ohnmacht, in die er gefallen war und zu erlösend das Gefühl, diese Odyssee heil überstanden zu haben.
In der Zwischenzeit war man mit dem fremden Segler im Schlepptau zum kleinen Inselhafen zurück gerudert. Ein alter Fischer hatte sich Santiagos angenommen und nachdem er sich davon überzeugt hatte, dass sein Herz schlug und er atmete, die anderen davon abgehalten, ihn in diese Welt zurück zu holen. Er war ein alter, erfahrener Seemann und hatte selbst so manchen Sturm hier draußen erlebt. Er wusste, dass das, was dieser Fremde hier brauchte, Ruhe und Zeit war. Zeit, um die Wogen seiner Seele zu glätten und festen Boden unter den Füßen zu spüren. Er hatte den wilden, fast wirren Blick in seinen Augen gesehen, den er nur zu gut von sich selbst und seinen Kameraden kannte. Ein Blick, der die riesigsten Wellen und tiefsten Tiefen des Ozeans gesehen hatte und der von einer Seele sprach, die aufgerissen und wild sich hier draußen im Kampf der Naturgewalten verloren und auf geheimnisvolle Art wieder gefunden hatte.
Als Santiago zu sich kam, lag er weich gebettet. Ein leichter Wind zog zu ihm hinein, es war angenehm kühl und ein seltsamer Vogel zirpte ein noch seltsameres Lied. „Wo bin ich?“, fragte er sich und konnte doch keine Antwort auf seine Frage finden. Seine Augen waren schwer. Langsam fuhr er mit seinen Fingern über das Bettlaken. Es musste weiß sein, weiß und gestärkt, denn es roch sauber und frisch und seine Oberfläche war hart. Angst machte sich plötzlich in ihm breit. Wo bin ich? Er versuchte, sich zu erinnern. Er fühlte sich gefangen in sich selbst, gefangen in einer Zeit, die er nicht einzuschätzen wusste. Bin ich wieder zu Hause und wird, wenn ich meine Augen wieder öffnen kann, meine Mutter vor mir stehen, mit streng zurück gebundenem Haar, dem alles wissenden Blick, mir sanft über den Kopf streicheln und meine Erinnerung in mir auszulöschen versuchen, so, wie sie es immer getan hat? Würde alles wieder von neuem beginnen? Würde dieser Spuk niemals zu Ende sein?
Wenn dem so war, so dachte er bei sich, dann bin ich sicherer hier und bleibe in dieser Welt zwischen den Welten, lebendig und doch tot, da und doch so fern, alles wahrnehmend und doch gleichzeitig nichts fühlend.
„Hermana Virginia!“, hörte er eine helle Stimme, „Schwester, ich glaube, er ist wieder zu sich gekommen!“
Bald darauf betrat sie den Raum. Ihre Schritte waren gewichtig, so dass der Boden unter ihnen federte. Langsam näherte sie sich seinem Lager.
„Ja, du hast Recht, er ist aufgewacht“, sagte sie nach einer Weile, nachdem sie Santiago die Hand auf die Stirn gelegt hatte, „aber noch ist er nicht bei uns, ich befürchte, er hat sich irgendwo in sich verlaufen und es wird noch eine Weile dauern, bis er zurück in die Gegenwart gefunden hat.“
„Aber woher willst du das wissen?“, fragte die junge Stimme.
„Ich weiß es nicht, es ist nur so ein Gefühl“, antwortete die ältere, „es passiert oft, dass Menschen, die ihr Bewusstsein verloren, sich im Labyrinth ihrer Seele verlaufen und Zeit brauchen, um den Ausgang zu finden. Bleib bei ihm, nimm seine Hand in die deine und erzähle ihm etwas von uns und unserer Insel, ich bin mir sicher, er kann dich hören.“
„Ja, Schwester Virginia“, hörte er wieder die helle Stimme, die zu einer jungen Frau gehören musste. Doch wer war sie? Er versuchte, sich zu erinnern. Kannte er eine Schwester Virginia? Und dieser Klang in der Stimme? Daheim bei ihm sprach man nicht so.
Als er wieder aufwachte, war es dunkel um ihn herum. Er versuchte wahrzunehmen, ob er alleine war, denn immer noch zog in ihm die Angst, wieder zu Hause zu sein, in seinem Zimmer, das er sich mit seinem älteren Bruder teilte. Doch so sehr er sich auch anstrengte, dessen Atem und leises Schnarchen zu hören, es war still. Plötzlich griff jemand nach seiner Hand. Er wollte zusammenfahren und seine Hand wegziehen, doch es ging nicht. Es waren zwei weiche, breite Hände, die die seine umschlossen hielten. Die seiner Mutter waren klein und hart, dachte er noch bei sich.
„Fremder“, hörte er die ruhige, warme Stimme einer älteren Frau neben sich, „du bist in Sicherheit. Du bist im Hospital der Heiligen Jungfrau Maria und ich bin Schwester Virginia. Wir sind ein kleines Kloster mit einem Hospital und sie haben dich zu uns gebracht, damit wir auf dich Acht geben. Der jungen Frau, die mit dir gereist ist, geht es gut, sie ist schon wieder auf den Beinen. Jetzt warten wir darauf, dass du wieder zurück zu uns findest, denn wie es scheint, bist du noch irgendwo zwischen hier und dort, vielleicht noch auf dem Meer in dem furchtbaren Sturm, in das euer Schiff hinein geraten sein muss. Ich weiß, dass du mich hören kannst, hab keine Angst, es ist alles gut. Du bist hier in guten Händen und du hast überlebt, das ist das Wichtigste.“
Schwester Virginia spürte, wie der Fremde ihre Worte aufsog, gerade so, als zöge er sich an ihnen zurück in die Gegenwart.
Dann bin ich nicht daheim, dachte er mit schwerem Kopf, und was sagte die Frau, ein Sturm? Mein Schiff?
Mühsam wanden sich die Gedanken durch seinen Kopf und langsam kam die Erinnerung an das zurück, was er in den letzten Wochen erlebt hatte.
Er spürte, wie eine Hand über seinen Kopf fuhr. „Lass dir Zeit, Fremder, lass dir Zeit. Versuche zu schlafen, damit dein Körper wieder zu Kräften kommt, dann kehrt auch die Erinnerung zurück.“
Es waren einige Tage vergangen und Santiago saß in einem wunderschönen Garten auf einer alten Bank und betrachtete die Welt um sich, als sähe er sie zum ersten Mal. Sein Körper war noch schwach und er ging mühsam einige Schritte hin und her, bevor er wieder auf der Bank zusammensackte. Das Kloster war einstmals von Vorfahren seines Volkes gebaut worden, die die Insel entdeckt und erobert hatten und wurde jetzt geführt von einem Orden, der sich um die Kranken der Insel kümmerte, eine kleine Schule für die Einheimischen unterhielt und in seinem Klostergarten Kräuter und Heilpflanzen anbaute. Die Schwestern trugen schwarze Gewänder, ähnlich derer, die er von Nonnen aus seiner Heimat kannte. Schwester Virginia war die Leiterin der Krankenstation, eine alte und doch rüstige Frau, deren graues Haar unter ihrer Haube hervorlugte. Eine furchtbare Narbe entstellte ihr Gesicht und doch leuchtete aus diesem mehr Mitgefühl und Verständnis, als er es bei den meisten Menschen je erlebt hatte. Sie hatte einen wachen, klaren Blick und zwei dunkle, tiefe Augen, die nicht nur die Sonnenseite dieses Lebens, sondern vielmehr die Hölle gesehen haben mussten, um so tief und wissend schauen zu können. Sie erinnerte ihn an seine geliebte Klara, die Frau, die einst sein Herz geöffnet und den Schleier des Vergessens von seiner Seele genommen hatte, einst, vor langer, langer Zeit.
Ich bin so froh, diese Frau hier getroffen zu haben, dachte Santiago, nachdem Schwester Virginia sich zu ihm gesetzt hatte. Ich fühle mich fremd und verloren, nicht nur hier auf dieser Insel, sondern auch in mir. Es war mein großes Ziel, die Fremde und die Ferne zu erreichen, ich habe all meine Kraft darauf verwandt, ohne zu wissen, was mich hier erwartet und was für Aufgaben für mich bereit liegen.
Sie verstanden sich auch ohne viele Worte, denn sie waren Bruder und Schwester in ihrem Leid und in ihrer Seele, die Ähnliches erlebt hatten. Und trug der eine die Narbe äußerlich in seinem Gesicht, so trug sie der andere in seinem Herzen, wo sie ihn bei jedem Blick nach innen daran erinnerte, was für ein Schicksal er erlebt und ertragen hatte.
„Weißt du, Santiago“, sagte sie zu ihm, als hätte sie seine Gedanken gehört, in ihrer klaren Art mit einfachen Worten, die stets das Praktische im Leben suchten, „dass dein Boot hier angetrieben wurde, ist wie ein Wunder und dass du lebst, ein umso größeres. Du kommst von weit her und hast mit vielen Stürmen und Herausforderungen gekämpft und mein Gefühl sagt mir, dass dein innerer Weg noch um einiges stürmischer, härter und bedrohlicher gewesen war als der über den Ozean. Wenn du es bis hierher geschafft hast, dann nur, weil du eine schier unerschöpfliche Kraft in dir hast und den unerschütterlichen Glauben an die Freiheit in dir trägst. Und auch wenn du den Sinn all dessen noch nicht sehen kannst, so liegt er doch in dir. Eines Tages wirst du ihn greifen können, glaube mir.
So geht es vielen von uns, die vom Leben auf die Probe gestellt, nach Jahren und oft Jahrzehnten des Kampfes, oft um Leben und Tod, erschöpft zusammenbrechen, wenn sie spüren, dass die Zeit des Überlebenskampfes vorbei ist. Es vergehen oft Jahre, bis sie wieder aufstehen können und den Sinn ihres Überlebens verstehen. So habe ich hier meine Aufgabe gefunden, indem ich die Kranken dieser Insel pflege und ihnen Hoffnung und Trost spende und ihnen helfe, die Zeichen ihrer Krankheit und ihres Schicksals zu deuten. Wenn du möchtest“, fuhr sie nach einer kurzen Pause fort, „kannst du eine Weile hier bleiben. Ich habe mit der Ordensschwester gesprochen, es gibt hier viel Arbeit. In der Schule wird noch ein Lehrer gebraucht und das Land muss bestellt werden. Wenn du Arbeit suchst, wirst du sie hier finden. Du weißt, wir sind ein Orden im Namen des Herren und wir leben im Gebot der Besitzlosigkeit und können dich nicht bezahlen, aber bei uns ist noch keiner verhungert.“
Als Schwester Virginia gegangen war, blieb er noch eine Weile im Garten sitzen. Er konnte sein Glück nicht fassen, heil gelandet zu sein, obwohl er in seinem Herzen stets gewusst hatte, dass das Leben einen Plan für ihn hatte und ihn nicht im Nichts des Ozeans verschwinden lassen würde. Ihm war, als würde erst jetzt, nachdem er den Sprung in sein neues Leben gewagt hatte, dieses wirklich beginnen und er fühlte sich seiner wahren Bestimmung so nah, wie noch nie in seinem Leben zuvor, obwohl ihm noch nicht ganz klar war, was es sein würde.
„Sieh, Santiago“, hatte Schwester Virginia zu ihm gesagt, „wir, die wir das Grauen überlebt haben und einen Weg aus ihm heraus fanden, wir tragen die Antwort in uns, die viele Menschen verzweifelt suchen. Wir wissen nicht nur, wie man das Grauen überlebt, sondern auch, wie man aus ihm herauskommt und es anschließend überwindet, um im Herzen frei zu werden. Wer, wenn nicht wir, hat den Schüssel zur Freiheit in den Händen? Wer, wenn nicht wir, könnte anderen Menschen zeigen, wie sie ihre Schritte lenken müssen, um die gefährlichen Klippen des Lebens zu umschiffen? Glaube mir, wir selbst sind das Licht, das uns durch die Abgründe unserer Seele geleitet hat und wir haben somit die Kraft, das Licht in anderen Menschen zu entzünden, auf dass auch sie den Weg durch das Labyrinth ihrer verlorenen Seelen finden können.“
Ja, dachte er sich, ich werde erst einmal hier bleiben und sehen, wohin mich das Leben treibt. Hat es mich mit gebrochenem Ruder auf hoher See nicht vergessen, wird es mich hier und jetzt auch nicht im Stich lassen!
Er hatte begonnen, sein kleines Boot im Hafen wieder in Stand zu setzen. Es war übel zugerichtet, doch hatte es den Stürmen getrotzt und war wie ein Korken schwimmend über die Wellenkämme und durch die -täler gejagt, ohne je die Hoffnung zu verlieren, eines Tages wieder friedlich in einem Hafen vor sich hindümpeln zu können. Santiago hatte zwei geschickte Hände und schon bald war das Boot wieder das kleine Heim, in dem er lebte. Es war sein Zuhause das er mit sich nahm wie die Krebse zwischen den Steinen in der Brandung seiner Heimat. Denen hatte er als Kind so oft zugeschaut und die ihr Haus in Form eines leeren Schneckengehäuses auf ihrem Rücken umher trugen, um es gegen ein größeres tauschten, sobald ihnen das alte zu eng geworden war.
Jeden Morgen machte er sich auf den Weg zu dem alten Kloster, in dem er die Kinder der Insel in seiner Sprache unterrichtete. Es waren kleine, wilde Racker, die ihn an die Zeit seiner Kindheit erinnerten und in ihm so manche Erinnerung wach riefen. Neugierig wollten sie alles über ihn wissen und so kam es, dass er oft lange, nachdem der Unterricht vorbei war, noch mit ihnen zusammen saß und ihnen von seinem Leben auf der Feuerinsel fern der ihren erzählte, einer Insel, die gar nicht so anders war als die ihre. Denn dort, wo Menschen leben, wiederholen sich stets ähnliche Schicksale, und auch wenn unser Schmerz stets ein anderer ist, so sind wir doch in unseren Seelen zu ähnlich, als dass wir einander nicht verstehen könnten.
Abends, wenn er nach getaner Arbeit auf seinem Boot saß und in die Ferne schaute, gesellten sich oft die jungen Männer zu ihm, gerade so, wie er damals selbst in den Hafen seiner Inselhauptstadt gegangen war, wenn wieder einmal ein fremdes Schiff angelegt hatte. Doch die jungen Männer hier wollten mehr als nur Geschichten aus einer fremden Welt hören, denn bald hatte er ihnen alles aus seiner Heimat erzählt und sie wurden nicht müde, sich Abend für Abend bei ihm einzufinden, um ihm zu lauschen.
Was ist es, was sie von mir wollen, fragte er sich oft erstaunt, denn es war ihm, als ob sie nicht nur seine Worte und Geschichten aufsogen, sondern vielmehr sein Gefühl, ihn selbst und in ihn hinein zu schauen schienen, als ob sie dort einen Teil ihres eigenen Weges erkennen könnten. Ja, es schien ihm, als würden sie in ihm wie in einem Buch lesen, als würden sie in ihm die Informationen finden, nach denen sie so lange gesucht und sie bisher doch nirgends gefunden hatten. Erst jetzt erkannte er in vielen von ihnen sich selbst als junger Mann, der ziellos und verloren in einer Welt gelebt hatte, die ihm doch jeden Schritt vorgegeben und vorbestimmt hatte. Wie sehr hatte er sich danach gesehnt, einem Menschen zu begegnen, der ihm Klarheit und Sicherheit hätte geben können. Einen Menschen zu treffen, der die geheimen Gesetze des Lebens kannte, die Zusammenhänge seiner Schicksalsmomente zu deuten vermochte, die Verstrickungen zwischen den Menschen durchschaute und bei all dem ein Mensch geblieben war. Einer, der, demütig vor dem Schicksal, seinen Weggefährten half, um letztendlich durch sie wiederum ein Stück von sich selbst erkennen zu können.
Vielleicht ist das meine Aufgabe, dachte er sich eines Abends, als er an Deck liegend den nächtlichen Himmel betrachtete. Den Menschen von dem zu berichten, was ich als Grauen erlebt habe. Einem Grauen, das keinen Namen kennt und das niemand sich auszusprechen traut, aus Angst vor der Rache derer, die ihn zum Stillschweigen verurteilten. Vielleicht ist es an der Zeit, das zu erzählen, was mir in den Jahren meiner Kindheit und Jugend widerfahren ist und wie ich einen Weg hinaus aus der Verstrickung meiner Gefühle fand, damit andere, die ähnlich leiden, wie ich es tat, gleichfalls einen Weg finden, in ihre Freiheit zu gehen.
So setzte er sich noch an diesem Abend hin und begann, alles das nieder zu schreiben, Wort für Wort, was seine Seele ihm diktierte. Es waren einfache Worte und Sätze, die gerade durch ihre Einfachheit die Herzen der Menschen würden erreichen können, kamen sie doch aus der Tiefe seiner Seele und konnten so die erreichen, die es wollten. In eben jener Seele eines jeden Einzelnen, um dort Licht und Klarheit zu schaffen, wo bisher nur Dunkelheit, Angst, Verdrängung und Chaos herrschte.
-
So war damals mit der Geburt des kleinen Santiagos der Sonnenschein eingezogen in das Haus mit der dunklen Seele. In ein Haus, in dem Menschen lebten, die schon lange die Hoffnung in ihrem Leben begraben hatten und aus denen der Schatten mehr strahlte als das Licht, wenn er denn hätte strahlen können. Und so sollte es nur eine Frage der Zeit sein, wann diese Schatten auch in das Leben des kleinen Santiago Einzug halten sollten, wann sie sich seiner bemächtigen würden, um seine hell leuchtende Seele zu umhüllen. Denn die Menschen um ihn herum ertrugen nicht das Licht, das von ihm, dem kleinen Santiago ausging und ihnen nur zeigte, wie verletzt sie waren und wie dunkel sie in sich geworden waren.
Carlos, der Mann von Encarnación oder Encarna, wie sie hier nur genannt wurde, wobei ihr Name wörtlich übersetzt „Fleischwerdung“ bedeutet und Dolores, ihr zweiter Name „Schmerzen“, Namen, die hier und zu dieser Zeit durchaus üblich waren, war ein stiller, in sich gekehrter Mann, der als Fischer sein Brot verdiente. Vielleicht war es die Weite des Meeres, die ihn hatte verstummen lassen oder aber das Meer der Traurigkeit in ihm, in dem er sich schon vor vielen Jahren verloren hatte. Er war durch seinen Beruf wenig zu Hause und wenn es ihn dann einmal hierher verirrte, dann erst, nachdem er einen Umweg über die Hafenkneipe genommen hatte. Er war im Grunde seines Herzens ein gutmütiger Mensch, aber einer, den man zu oft gereizt hatte und der gegen die in ihm aufsteigenden Dämonen gar nicht so viel antrinken konnte, wie sie sich in ihm breit machten.
Die beiden, Carlos und Encarna, hatten einst geheiratet oder besser gesagt, waren zweckmäßig verheiratet worden. Hatte die Mutter von Encarna doch damals händeringend nach einem Mann für ihre Tochter und Vater für deren ungeborenes Kind gesucht. Und da sie Haus und Hof mit in die Ehe bringen würde, hatte er schließlich eingewilligt und sie zu seiner Frau genommen. Liebe hatte diese beiden Menschen also nicht zueinander geführt und Liebe sollte sich auch nie wirklich zwischen ihnen entwickeln, waren sie doch beide früh ihrer Fähigkeit zu lieben beraubt worden und ihre Herzen verschüttet, so wie einst ihre Insel von den feurigen Lavamassen, die einst über sie hineinbrachen.
So gingen die beiden mehr schlecht als recht miteinander um, vermieden es, sich allzu häufig über den Weg zu laufen, auch wenn das in einem gemeinsamen Haus nicht einfach war. Beide sahen es insgeheim als Segen, dass Carlos seine Arbeit auf dem Wasser verrichtete und sie sich für eine Weile aus den Augen waren. Encarna kümmerte sich um Haus und Hof, so wie es hier üblich war, bestellte einen kleinen Garten, der sich hinter dem alten Gut erstreckte, hielt Hühner und Ziegen und versorgte die Kinder. Es war ein hartes, einfaches Leben und dennoch gehörten sie zu denen, die ein eigenes Stück Land besaßen und wenn es erst weiter bergauf gehen würde, könnte man nach alter Tradition die weiten Lavafelder kultivieren und Wein anbauen, der sich auf dem Festland und an die wenigen Touristen, die ab und zu ihre Insel besuchten, verkaufen ließ.
Dies war also die Welt, in der der kleine Santiago aufwachsen sollte, als zweites Kind neben seinem älteren Bruder, der durch einen Umstand, den man tunlichst geheim hielt, in seinem Wesen einfältig und verkümmert war. Eine liebe Kreatur, die Zeit ihres Lebens in ihrem Herzen ein Kind bleiben sollte, hatte man ihr doch die Möglichkeit zu wachsen genommen, bevor sie das Licht der Welt erblicken konnte. Es war eines dieser dunklen Geheimnisse, die alle irgendwie ahnten und die man doch besser hütete als die wenigen Schätze, die man besaß, ging es doch um die Ehre der Familie, um das Ansehen der eigenen Person und nicht zuletzt um das eigene Gewissen, das man hoffte, mit einer Lüge und dem Verschließen der Augen beruhigen zu können.
Santiagos Mutter war eine junge und doch viel zu früh gealterte Frau, der das Leben von klein auf übel mitgespielt hatte. So wie ihre Seele verletzt und von vielen Narben gezeichnet war, so zogen sich bereits die ersten Falten in das noch junge Gesicht und sprachen von dem Leid, das sich in ihr Herz gegraben hatte. Trotz ihrer jungen Jahre hatte sie bereits einen Gang, der an den einer alten Frau erinnern ließ und aus ihren Augen war der Glanz und die Lebensfreude einem dumpfen, leeren Blick gewichen, der sein Ziel im Leben verloren hatte. Sie war eine gelittene Seele, die man früh ihrer Unschuld und Stärke beraubt hatte und wäre nicht der Herr Pfarrer gewesen, der sich liebevoll ihrer angenommen und ihr Halt und Schutz in seinem Herzen gewährt hätte, sie wäre wohl längst den Weg in den seelischen Tod gegangen, wenn nicht sogar in den realen. So aber hatte sie, zäh wie sie war und mit den sieben Leben einer Katze, immer irgendwie überlebt, hatte sich, einer Ertrinkenden gleich, über Wasser gehalten und den Unbilden ihres Lebens getrotzt, so gut es eben ging. Doch im Laufe dieses nunmehr jahrzehntelangen Kampfes hatte sie ihre Kraft verloren und war darüber alt und müde geworden, hoffnungslos und verbraucht. Und so war die Geburt ihres zweiten Kindes der Hoffnungsschimmer, der sie davor bewahrte, sich für immer in sich selbst zu verschließen und dieser Welt den Rücken zu kehren.
Der kleine Santiago mit seinem reinen, unschuldigen Wesen war wie alles, was klein und unschuldig daher kommt, so zart und sanft, so weich und schutzbedürftig, dass er selbst das versteinertste Herz für einen Moment erwärmen konnte. Vielleicht war es seine Hilflosigkeit, die in ihr mehr als die Mutterinstinkte weckte und sie dazu bewegte, noch einmal ihr Herz zu öffnen, ging von ihm doch keine Gefahr aus, dass er sie verletzen könnte, wie man es schon so oft in ihrem Leben getan hatte. Zudem war er ein besonders niedliches Geschöpf, das bald mit seinem zarten Lächeln sich seine Welt und vor allem ihr Herz eroberte und wenn er als kleines, warmes Bündel in ihren Armen lag, konnte sie nicht anders, als sich für ihn zu öffnen.
Und so kam Encarna schon bald wieder auf die Beine und hatte sich viel schneller erholte, als es bei der Geburt ihres Erstgeborenen der Fall gewesen war. Mit jedem Tag, den sie an der Seite ihres neuen Glücks verbrachte, öffnete sie sich ein Stück mehr in ihrem Inneren. Sie blühte auf wie eine Blume, die ihre Knospe hatte senken müssen, noch bevor sie erblühen konnte. Jetzt, durch das Wasser des Lebens einer neuen Liebe, die sie durchströmte, vermochte sie sich aufzurichten und zaghaft ihre Blüte in Richtung Sonne wenden.
Es war, als hätte Encarna mit der Geburt ihres Kindes selbst die Chance einer Wiedergeburt erfahren, die Möglichkeit eines Neuanfanges, die Möglichkeit, mit diesem Kind zu wachsen und sich einen Platz in diesem Leben zu erkämpfen. Nun lag es an ihr, ob und wie sie diese Möglichkeit für sich ergreifen würde. Denn es war das erste Mal in ihrem Leben, dass sie frei entscheiden konnte, frei deshalb, weil sie von außen keiner beeinflusste, aber dennoch unfrei, trug sie doch das Erbe vieler Tausender und Abertausender, zum Teil sogar gewaltsamer Manipulationen in sich und es würde ein harter, erbitterter Kampf werden, wollte sie sich gegen dieses dunkle innere Erbe in sich durchsetzen.
So kam es, dass die Lebensfreude und Reinheit dieses kleinen Erdenbürgers wie ein Licht war, das ihr Inneres ausleuchtete, wie ein warmer Sommerwind, der ihr erkaltetes Herz erwärmte und eine Quelle der Kraft, aus der sie trank. Ihr Schicksal hätte eine glückliche Wende nehmen können, wenn nicht mit dieser Öffnung für sich selbst auch der Teil in ihr an die Oberfläche und ans Tageslicht gekommen wäre, der, stärker als sie es für sich erhoffte, bald die ersten Schatten auf ihr ungetrübtes Glück werfen sollte.
Denn wenn wir uns dazu entschließen, die Tür zu unseren Gefühlen zu öffnen, so finden wir in den verschlossenen Räumen nicht nur unsere Lebensfreude, unsere Liebe und das Glück, zu leben, sondern auch alles das, was uns dazu veranlasste, uns aus diesem unserem Leben zurück zu ziehen. Hierhin verbannten wir alle Dämonen und Schatten, die uns im Laufe unseres Lebens begegneten, die uns in die Knie zwangen und der wir nicht Herr werden konnten.
So erging es auch Encarna, die nach den ersten Wochen und Monaten des wiedergefundenen Glücks nicht bemerkte, wie sich langsam aber sicher in ihr eine bis dahin unbekannte Stimme zu Wort meldete. Eine Stimme, die, hervor gelockt durch die Unschuld ihres Kindes und der Kraft, die von diesem ausging, wie ein hungriges Tier langsam aus seiner Höhle gekrochen kam, in das grelle Licht der Sonne blinzelte und seine Glieder reckte. Lange Zeit bemerkte Encarna nichts von dieser Bestie, die in ihr wie ihr neues Leben erwacht war. Nur manchmal durchzogen, wie ein böser Schatten, dunkle Gedanken ihren Kopf und Erinnerungen blitzten auf, die sie aber schnell wieder beiseite drängte. Nichts sollte ihr neues Glück trüben, das hatte sie sich geschworen und die Vergangenheit konnte sie ohnehin nicht mehr ändern!
Hätte sie doch nur gewusst, dass das, was uns in der Vergangenheit widerfuhr, in uns als dunkles Erbe so lange weiterlebt, bis es sich erneut erfüllte oder wir in der Lage waren, es zu überwinden! Hätte sie doch nur gewusst, dass alles das, was sie so sehr verabscheute und ablehnte und weit von sich wies, dennoch so nah bei ihr war, ja, direkt in ihr wohnte und sich von dem gleichen Blut ernährte wie sie selbst, sie wäre wohl vorsichtiger gewesen. Und so sollte sie es sein, die mit ihren eigenen Händen, gelenkt durch die Erfahrungen ihrer Vergangenheit, das Unheil heraufbeschwören und ihm als Instrument dienen würde. Sie sollte es sein, die von langer Hand gelenkt das Gebäude ihres neuen Lebens und Glücks zum Einsturz bringen würde. Diesmal würde es niemanden geben, dem sie die Schuld zuweisen und gegen den sie ihren Hass, ihre Wut und Verzweiflung über das, was geschehen würde, schleudern könnte, war sie es doch selbst, die als die Autorin des Schreckens handeln würde.
Dass es in Wirklichkeit das Erbe ihrer Familie war, das Erbe ihres erfahrenen Leids, das in ihr auferstand, sich ihrer bemächtigte und sie von innen heraus steuerte, lenkte und irgendwann gänzlich vereinnahmen und überwältigen sollte, wusste sie nicht, sondern ahnte dies nur in einem entfernten Winkel ihres Herzens. Doch war diese Ahnung zu schwach, um sie für sich Realität werden zu lassen, war nicht Mahnung genug, um innerlich aufzustehen und gegen das Unheil in sich anzukämpfen. Und so wartete sie, bis diese Ahnung Gewissheit wurde und es zu spät war, den Kampf zu gewinnen. Denn – und das wusste sie von ihrem Vater – wenn ein Hund gebissen und Blut geleckt hat, gibt es kein Zurück mehr: entweder der Hund würde zukünftig seinen Besitzer dominieren oder dieser griff zu einem Knüppel und erschlug das Tier, bevor es weiteren Schaden anrichten könnte.
Doch das Tier in Encarna war noch nicht gänzlich erwacht, sondern blinzelte zunächst nur verschlafen in das grelle Tageslicht. So war es zuerst ein verstohlener Blick, wenn der Kleine nackt strampelnd vor ihr lag, während sie ihm die Windeln wechselte und ein seltsam ziehendes Gefühl ihren Körper durchlief. Es war dieses seltsame Gefühl, wenn sie ihn stillte und dies eine Gier in ihr wachrief, die sie irgendwann nicht mehr ignorieren und einfach wegwischen konnte. Oft betrachtete sie ihren Sohn wie es schien stundenlang und konnte nicht glauben, was für Regungen sich in ihr breitmachten: Gefühle, die sie zutiefst anekelten und zugleich faszinierten, Gefühle von Macht, von Besitzen-Wollen, von Dominanz und von Rache. Keine Rache, die zerstörte, sondern eine Rache, die ihr die Befriedigung von Vergeltung und Ausgleich bringen würde, wie die Tilgung einer Schuld, die man an ihr verbrochen hatte.
Es fiel ihr schwer, das, was sie dumpf in sich wahrnahm, in Worte zu fassen, hätte dies doch bedeutet, dass sie es hätte zulassen und anerkennen müssen. Vielmehr spielte sich all dies auf einer ihr zwar bewussten, aber dennoch immer wieder verdrängten und vor sich selbst versteckten Gefühlsebene ab, die wie ein „zweites Leben“, wie ein dumpfer Grundton, neben ihren „realen“ Erfahrungen herlief. Zumindest zu diesem Zeitpunkt konnte sie ihre dunkle Gefühlswelt noch so weit von sich weg und auf Distanz halten, dass diese sich, wie sie hoffte, nicht mit ihrer realen vermischen würde.
Wie nahe sie jedoch schon am Abgrund stand, wie tief sie schon in dem Schlund des Bösen gefangen war, ahnte sie nicht. Nein, sie wollte es auch gar nicht wissen, zu mächtig und groß erschien ihr dieses „zweite Leben“, dieser Feind in ihr, als dass sie den Mut gehabt hätte, ihm mit offenen Augen zu begegnen. Zu oft war sie unterlegen, als dass sie noch daran geglaubt hätte, diese Schlacht einmal gewinnen zu können.
Mit der Zeit wurden diese versteckten, bisher verdrängten Gefühle immer stärker in ihr und die Sehnsucht nach dem kleinen, unschuldigen Körper ihres Sohnes und der Unberührtheit dieser Seele wurde wie ein Wahn, der sie ständig begleitete, wie ein Surren in ihrem Kopf, das sie nicht auszuschalten vermochte. Und auch wenn sie dagegen ankämpfte, so doch auf eine Art, die nicht einmal im Ansatz ausreichte, als dass sie es wirkungsvoll hätte bekämpfen können. Denn sie ließ dem Bösen in sich doch zu viel Raum, indem sie es verdrängte und von sich wegschob, was aber kein wirkungsvoller und heilsamer Weg sein konnte. Es war, als drängte alles in ihr, sich in der Unschuld ihres Kindes selbst rein zu waschen, als könnte sie mit ihm all das, was sie hatte erfahren und erleiden müssen, auslöschen. Nur dass sie auf diesem Wege die Seele ihres Kindes verschmutzen und das dunkle Erbe auf dieses übertragen würde, war ihr nicht bewusst. Wie ein Dürstender in der Wüste, der schon Tage ohne Wasser hatte auskommen müssen und nun vor dem rettenden, kühlen Nass stand, das freudig aus einem kleinen Brunnen vor seinen Augen plätschert, so drängend empfand sie den Wunsch nach Reinheit in sich, dass ihr zunehmend die Mittel und Wege, zu diesem Rein-Sein zu kommen, gleichgültig wurden. Gleichzeitig brach in ihr Stück für Stück und mit jedem Tag mehr jenes Monster hervor, das einst ihr Vater in sie gepflanzt hatte. Ein Monster, das sie zeitlebens nur „den Dämon“ genannt hatte, zu schmerzvoll war die Erkenntnis, dass es sich bei dem Bösesten, was es einst in ihrem kleinen Leben gab, um ihren eigenen Vater handelte, den sie doch liebte und auf ihre kindliche Art verehrte und der ihr Schutz und Heimat war.
Den ganzen Abend lang hatte sie neben ihrem kleinen Sohn verbracht und seine Nähe und Wärme in sich aufgesogen und genossen. Sie fühlte, wie er an sie geschmiegt neben ihr lag und strich ihm immer wieder und wieder durch sein inzwischen schon recht dichtes Haar und über seinen weichen, kindlichen Mund. Voller Verzückung betrachtete sie seine langen, schwarzen Wimpern, die seinem Gesicht etwas Weiches, ja fast Engelhaftes gaben.
Vielleicht war es dieser engelhafte Ausdruck, der sie dazu verführte, in ihm so etwas wie ein Mädchen zu sehen, die Tochter, die sie sich so sehr wünschte, ihr aber bisher nicht geschenkt worden war. Ein Mädchen, ein zartes Wesen, das so sein würde wie sie: verletzlich, offen, eine weibliche Kreatur, die sie verstehen würde, weil sie so war wie sie, in der sie sich selbst sehen und neu erleben und neu erschaffen konnte, um so das Leid ihrer eigenen zerstörten Kindheit zu kompensieren. Mit dieser Tochter könnte sie sich und ihr Leben neu erschaffen, durch sie würde sie eine Kindheit voller Liebe und Mütterlichkeit erleben können, ohne einen Vater, zu dessen Geliebten sie hatte werden müssen, ohne die Härte dieses „verdammten männlichen Geschlechts“, wie sie es nannte, das ihr so furchtbar mitgespielt hatte.
Und wie der Schmerz ihrer eigenen, von Missbrauch und Gewalt geprägten Vergangenheit in ihr hoch kam, kam zugleich ihr Hass und Zorn auf den, der ihr das angetan hatte. Eine Wut, die sie vor sich selbst erschaudern ließ. Eine Wut und ein Hass, der sie zur Mörderin werden lassen könnte, wenn da nicht ihr Vater vorsorglich eine Schranke in ihre Psyche eingebaut hätte, die diese rasende Wut zwar nicht besiegen, sie aber doch insofern unterdrücken konnte, als dass sie dumpf und schwer in ihr brodelte, nicht aber zum Ausbruch kommen konnte. Diese Wut in ihr wandelte sich stattdessen irgendwann in eine tiefe Ohnmacht und Depression, die Encarna wie einen Schatten umgab und sie von innen her auffraß und aushöhlte.
Voller Angst betrachtete sie ihren Sohn. Was wäre, wenn sie sich nicht kontrollieren könnte und wie ein wildes Tier über ihn herfallen würde?
Entsetzen machte sich in ihr breit, denn deutlich wie nie zuvor spürte sie das Tier in sich, das nur darauf wartete, endlich losstürmen zu können. Jetzt war er noch klein und unschuldig, was aber würde sein, wenn er groß und schließlich stärker wäre als sie? Würde er dann seine Mutter hassen, so wie sie ihren Vater hasste? Würde er sie voller Wut umbringen, zerstückeln und zerstören wollen? Mein Gott, durchfuhr es sie, was ist, wenn er fühlen wird wie ich? Und er sich schwört, so wie ich einst, diesen Unmenschen zu töten, murmelte in ihr eine Stimme; eine Stimme, die sie als ihre eigene wahrnahm im immer lauter werdenden Gewirr all derer, die sich in ihr zu Wort meldeten.
Es durchfuhr sie wie ein glühender Schmerz und die Angst, ihre Liebe, die sie in ihren Sohn gepflanzt und zurückgelassen hatte, zu verlieren, war unendlich. Schweiß trat auf ihre Stirn, Panik machte sich breit und die Angst, wieder allein mit der Kälte ihres Herzens leben und ausharren zu müssen, wenn sie ihn verlöre. Wie lang waren die Jahre ihrer Trostlosigkeit gewesen? Zu lange die unendliche Sehnsucht nach Liebe und Nähe, die ihr keiner zu geben vermocht hatte, nicht einmal ihr Mann.
Erst mit der Geburt von Santiago war alles in ihrem Leben bergauf gegangen. Ein Sonnenschein, der zärtlich an ihren Brüsten sog und sie mit seinem noch zahnlosen Mund anlachte, dass ihr warm ums Herz wurde. Die Händchen, die zärtlich unbeholfen nach ihrem Hals griffen und sich in ihren Haaren festklammerten und dazu diese schwarzen, ernsten Augen, die sie bis tief in ihrer Seele berührten, ohne dass sie hätte sagen können wie. Santiago, ihr zweiter, der eigentlich ihr erster war, zumindest der erste in ihrem Herzen, denn mit seinem älteren Bruder war alles anders gewesen. Bei ihrem Erstgeborenen, so erinnerte sie sich mühsam und voller Schwere, war es das Gegenteil: die Geburt, die ihr fast das Leben gekostet hätte und bei der dieses „kleine Scheusal“, wie sie ihn heimlich nannte, ihr das Geschlecht zerriss. Ein Kind wie ein kleiner Teufel, wie sie voller Schrecken und Abscheu manchmal dachte, wenn er hart nach ihrem Busen griff und sie zu beißen schien; ein Baby, mit den Gesichtszügen ihres verhassten Vaters, der sie trotz seiner wenigen Tage als neuer Erdenbürger scheinbar schon zu dominieren versucht hatte, wie es ihr vorgekommen war. Nein, dieses kleine Wesen war ein einziger Albtraum gewesen, das ihr die Brustwarzen wund und blutig sog, ständig schrie und sie abwies, wenn sie ihn in den Armen hielt. Bastard hatte sie ihn schon genannt, als er noch in ihrem Bauch weilte und er absichtlich, wie es ihr vorkam, nach ihr trat und sich alles andere als wohl in ihr fühlte. Hätte sie gewusst, wie nahe sie mit ihrem Gefühl des Bastards an der Wahrheit war, vielleicht hätte sie sich und ihre Empfindungen gegenüber ihres Erstgeborenen besser verstanden.
So hatte der Kleine viel zu kurz die Brust bekommen, hatte nächtelang schreiend in seiner Wiege gelegen und auch ansonsten mehr Schläge, Hiebe und Härte als mütterliche Liebe, Aufmerksamkeit und Geborgenheit erfahren. Kein Wunder, dass sich Pablo, wie sie ihn nach ihrem Vater, der Tradition folgend, hatte nennen müssen, sich später ihrem Mann zuwandte und versuchte, sich mit diesem zu identifizieren, brachte dieser ihm doch nicht so viel Abneigung und Hass entgegen wie seine Mutter, die erst versteckt und dann ganz unverhohlen dem Jungen gegenüber ihre negativen Gefühle zeigte.
Es sollten Jahre vergehen, bis sich zwischen ihnen ein Gefühl von Normalität einstellte. Jahre, in denen der kleine Pablo, der geistig etwas zurückgeblieben und deformiert, wie ein Tier litt und nicht selten wie ein solches behandelt wurde. Er hatte eine ungezügelte Wut, wie seine Mutter es nannte, schrie sie an, spuckte nach ihr, biss und kratzte sie. Trotz seiner jungen Jahre sperrte sie ihn ohne Gnade in den Hühnerstall, wo er schreiend und weinend mit seinen kleinen Fäusten gegen die Tür trommelte, bis er erschöpft auf den schmutzigen Stallboden sank, das Gesicht verquollen und tränen- und schmutzverschmiert.
Ja, es war eine furchtbare Zeit gewesen, in der sie sich nicht wiedererkannt hatte. Eine Zeit voller Wut und Hass, voller Rohheit und Härte, die sie gegen ihren Sohn und gleichzeitig gegen sich selbst lebte, denn mit jedem Mal, wenn sie unbarmherzig gegen das Kind vorging, es schlug und weinen ließ, schlug sie auch sich selbst und übersah ihre eigenen Tränen. Hätte sie nur gesehen, wie ihre Hände sich in die ihrer Mutter verwandelten, wenn sie auf den kleinen Körper einschlug, hätte sie nur erkannt, wie das Böse ihres Vaters aus ihren Augen hervortrat, sie hätte sich wohl selbst nicht wieder erkannt und hätte erschrocken ihre Hände sinken lassen über das, was sie da tat.
So führte Pablo in den ersten Jahren seines Lebens ein Leben, das ihn noch hinter das eines Tieres der kleinen Granja, dem Bauernhof stellte. Während seine Mutter sich um Hof und Garten kümmerte, blieb er meist eingesperrt im Hühnerstall, in dem er, wie seine Mutter fand, den geringsten Schaden anrichten konnte. Denn seitdem der Kleine zu krabbeln und später zu laufen begonnen hatte, riss er alles um, was sich ihm in den Weg stellte, öffnete Schränke, ja, sogar die Klappe des alten Herdes, der noch in alter Tradition mit Holz befeuert wurde, so dass später die Glut auf den Boden fiel und wäre der Boden nicht aus Stein gewesen, sicherlich das ganze Haus in Flammen gesteckt hätte, wie Encarna ihrem Mann, der voller Entsetzen seinen Sohn im Hühnerstall des Abends vorgefunden hatte, erklärte.
Der glühende Hass, der mit ihrem ersten Kind aus ihr heraus gebrochen war, war so groß, dass er ihr keine Möglichkeit ließ, etwas anderes zu empfinden. Vielleicht war es die Tatsache, dass sie zum ersten Mal in ihrem Leben stärker war als ihr Gegenüber, das sie dazu veranlasste, zuzuschlagen anstatt geschlagen zu werden. Vielleicht war aber auch der Druck in ihr zu groß, der Druck des über Jahre hinweg aufgestauten Leids, der tausendfach hingenommenen Schläge und Gewalt, das alles jetzt aus ihr herausbrach, zügellos, ohne Kontrolle, ohne Sinn und Verstand und alles zerstörte und unter sich begrub, was sich ihr in den Weg stellte.
Dass es nun ausgerechnet ihr kleiner Sohn war, der mit seinen ersten Gehversuchen sich ihr in den Weg stellte, mag Ironie des Schicksals gewesen sein. Und dass er es war, der von ihr diese Härte erfuhr, der ohnehin vom Leben durch seine Behinderung gezeichnet war, kann man nur als eine Ungerechtigkeit bezeichnen, die laut in Gottes Ohren hätte klingen müssen. Doch niemand schien die verzweifelten Schreie des Kindes zu hören, noch viel weniger hier draußen in der Einsamkeit ihrer Ländereien. Da man hier ohnehin nicht allzu zimperlich mit aufsässigen Kindern umging, fiel der eine oder andere blaue Fleck an Pablos Armen und Beinen nicht weiter auf. Außerdem stürzten Kinder in diesem Alter schon mal des Öfteren und wer wollte Encarna schon so eine Barbarei, eine körperliche Misshandlung unterstellen?
Selten hatte sie so viel Abscheu und Ablehnung für einen Menschen empfunden wie für diesen, außer für ihren Vater, der übermächtig groß sich in ihrem Inneren verewigt hatte und dessen Bestrafung sie mehr fürchtete als das Fegefeuer der Hölle. Nie hätte sie es gewagt, ihre Hand gegen ihren Vater, ihren Peiniger zu erheben, nicht einmal, um sich und ihr Leben zu verteidigen. Zu früh hatte er sämtlichen Widerstand in ihr gebrochen, als dass ein Funke von Kampfgeist in ihr verblieben wäre. Nein, gegen ihn würde sie in diesem Leben nicht mehr aufstehen können; diese Schlacht, diesen Kampf hatte sie verloren. Doch es gab für Encarna andere Menschen in ihrem Umfeld, gegen die sie diesen Kampf führen konnte, andere Kreaturen, die, weil schwächer als ihr Vater, ihr nur allzu gelegen kamen, um sich über diese Erleichterung zu verschaffen und endlich die Genugtuung zu spüren, die es mit sich bringt, sich gegen seinen Peiniger durchgesetzt zu haben. Dass dies ausgerechnet die Menschen sein würden, die sie lieben und schützen sollte, dass es ausgerechnet ihr Mann sein würde, mit dem sie zusammen eine Familie gründete und ihr Sohn, den sie lieben und aufbauen anstatt zerstören sollte, sah sie in ihrer Verletztheit nicht. Dies konnte sie nicht sehen, denn durch die in sich tragende Wut und den Hass war sie gleich einer Blinden, blind für das Opfer, auf das diese Gefühle hernieder gingen und blind für das Leiden desjenigen, der sie empfing.
Sieben lange Jahre hatte die Schlacht zwischen ihrem ältesten Sohn und ihr getobt, sieben lange Jahre, in denen das Tier in ihr wütete und alles in dem Jungen zerstörte, was diesem an Seele geblieben war. Sieben lange Jahre, in denen sie all das auslebte, was an Boshaftigkeit und Gewalt in sie hineingelegt oder sollte man besser sagen hineingeprügelt worden war. Dass der Junge dies überlebte, grenzte an ein Wunder, denn wenn sie ihn ungezügelt mit Schlägen eindeckte, kam es nicht selten vor, dass der Kleine stürzte, mit dem Kopf aufschlug und sich verletzte. Es war wie ein Zwang, unter dem sie stand und in dem sie handelte; es war wie ein Gewitter, das fast täglich in ihr aufzog und der Druck in ihr erst wich, wenn sie sich entladen konnte. Danach allerdings war sie, wenn auch nur für kurze Zeit, ruhig, auch wenn der Hass und die Wut, die sie gegen dieses unschuldige Wesen gelebt hatte, sich nun in Hass und Verachtung gegenüber sich selbst richtete über das, was sie diesem kleinen Wesen, das immerhin ihr Kind war, angetan hatte.