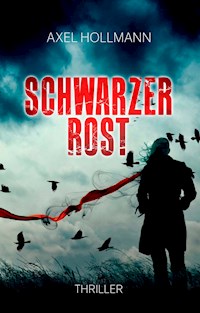
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Deutscher Selfpublishing Preis Shortlist 2018 Johannesburg-Südafrika · Denver-USA · Kuala Lumpur-Malaysia Der Schwarze Rost vernichtet die Getreideernten Afrikas. Unaufhaltsam breitet sich der Pilz von dort aus. Ohne Hilfe werden Millionen verhungern. Der Journalist Finn Sadah will seine Leser mit einer Reportage über den Schwarzen Rost aufrütteln, doch dann verstrickt er sich in eine Mordserie an Genforschern. Und schließlich gerät er selbst in die Schusslinie des skrupellosen Killers. Lüge ist Wahrheit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Schwarzer Rost
Axel Hollmann
Impressum
Axel Hollmann
Insterburgallee 33d, 14055 Berlin
Web: www.axelhollmann.com
E-Mail: [email protected]
Facebook: axelhollmannautorenseite
Twitter: @axelhollmann
7. Auflage
Copyright © 2018 Axel Hollmann
Alle Rechte vorbehalten. Eine Kopie oder anderweitige Verwendung, auch auszugsweise, ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Autors gestattet.
Lektorat: Kerstin Brömer, kerstin-broemer.de
Cover: Axel Hollmann - stock.adobe.com
Inhalt
Der Autor
Das Buch
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
FATALE LÜGEN - AUSZUG
Prolog
1
2
3
Danksagung
Weitere Bücher
Der Autor
Axel Hollmann, Jahrgang 1968, steckte schon als Jugendlicher seine Nase in alle SF-Romane und Fantasy-Rollenspiele, denen er habhaft werden konnte. Während seines Studiums verbrachte er mehr Zeit mit dem Lesen von Krimis und Thrillern, als in BWL-Vorlesungen. Rechtszeitig vor seinem 30. Geburtstag macht er sein Hobby zum Beruf: Er wurde Mitinhaber eines Buch- und Spieleladens. 2014 erschien sein erster Thriller. Mit seiner Frau und seinen Söhnen lebt er in Berlin.
Das Buch
Johannesburg-Südafrika · Denver-USA · Kuala Lumpur-Malaysia
Der Schwarze Rost vernichtet die Getreideernten Afrikas. Unaufhaltsam breitet sich der Pilz von dort aus. Ohne Hilfe werden Millionen verhungern. Der Journalist Finn Sadah will seine Leser mit einer Reportage über den Schwarzen Rost aufrütteln, doch dann verstrickt er sich in eine Mordserie an Genforschern. Und schließlich gerät er selbst in die Schusslinie des skrupellosen Killers.
Lüge ist Wahrheit.
YouTube
Prolog
Wie oft er den Brief in den letzten Tagen verflucht hatte. Den Brief, der ihn quer über den indischen Subkontinent an diesen furchtbaren Ort geführt hatte. Raj Kamal Singh nahm die Aktentasche, in der sich das Schreiben befand, in die linke Hand. Mit der rechten fischte er sein Taschentuch aus der Hosentasche.
Die goldene Stadt wurde auch Jaisalmer genannt, doch Jaisalmer stank!
Beim Anblick der flachen Häuser aus gelbbraunem Sandstein und der unbefestigten Straßen empfand er nichts als Verachtung. Die westlichen Touristen mochten die Stadt inmitten der Wüste Thar exotisch nennen, verzückt durch die engen Gassen der Altstadt streifen oder Fotos von dem alten Fort auf dem Trikuta-Felsen schießen. Er dagegen wünschte sich nur, weit weg zu sein. Weit, weit weg. Daheim, am Fachbereich für Biologie der Universität von Mumbai. Wo sein Land das Joch des Kolonialismus abgestreift hatte und in eine stolze Zukunft blickte. Eine Zukunft, in der sich der azurblaue Himmel Indiens in glänzenden Hochhausfassaden spiegelte und in der es nicht nach Fäkalien stank. Weder nach Fäkalien noch nach den Leibern, die in den Gruben vor Jaisalmer verbrannt wurden. Am Tag und selbst in der Nacht, so viele Tote waren es inzwischen.
Er presste sich das Taschentuch vor die Nase.
Ein Mann in einer schmutzigen Baumwollkurta hob eine Augenbraue, als er es sah. Singh verzog keine Miene. Wozu sollte er sich seine Verärgerung anmerken lassen? Nein, er hatte es nicht nötig, sich eine solche Blöße zu geben. Wenn dieser Kerl ihn für einen Snob hielt, na und? Das war allemal besser, als den furchtbaren Gestank auch nur eine Sekunde länger zu ertragen.
An der nächsten Straßenecke blieb er stehen, um einen Moment zu verschnaufen. Raj Kamal Singh fuhr sich durch die grauen, schütteren Haare. Er war nicht mehr der Jüngste, auch wenn es ihm schwerfiel, sich das einzugestehen.
In der Nacht hatte es geregnet. Ein Bus rumpelte durch eines der unzähligen Schlaglöcher und grauer Schlamm spritzte auf seine Kaschmirhose.
»Hey!«, schrie Singh, doch die Leute, die aus den offenen Seitenfenstern des völlig überfüllten Fahrzeugs hingen, starrten ihn lediglich teilnahmslos an. Mit seinem Taschentuch wollte er den Dreck wegwischen, doch er verteilte ihn nur über den teuren Stoff. Wütend schmiss er das ruinierte Leinen zu Boden. Und auch die Hose war hin. Dreißigtausend Rupien hatte sie gekostet. Mehr als die meisten Inder in einem Vierteljahr verdienten.
Singh ballte die Hände zu Fäusten. Was für eine Schweinerei! Dieses verdammte Pack! Warum blieben die Leute nicht in ihren Dörfern? Glaubten sie, ihrem Schicksal in Mumbai oder Panaji zu entkommen? Nein, natürlich würden sie das nicht. Im Gegenteil, wie ein gieriger Heuschreckenschwarm verbreiteten sie den Hunger immer weiter und weiter. War das so schwer zu begreifen? Nein, aber aus welchem Grund auch immer, die Regierung in Neu-Delhi blieb untätig. Wieder einmal. Wozu gab es die Polizei und das Militär? Warum taten der Premierminister und die Regierung nichts, um die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten?
Als sich ein weiterer Bus näherte, trat er sicherheitshalber einen Schritt zurück. Auf dem Blechdach stapelten sich Koffer und Kartons. Dazwischen saßen Männer mit eingefallenen Gesichtern, die nackten Oberkörper so dürr, dass man die Rippen zählen konnte.
Angewidert wandte Singh den Blick ab. Er wartete, bis sich das rostige Gefährt entfernt hatte, dann überquerte er im Laufschritt die Hanuman Cir Road. Zwei Mädchen in orangefarbenen Saris wichen ihm im letzten Moment mit ihren Mofas aus. Sie hupten und eine schimpfte ihm hinterher, doch er eilte weiter.
Seit er den Brief des Südafrikaners gelesen hatte, war er ein Getriebener. Marq van Beukes hatte es weit gebracht, weiter, als er es seinem ehemaligen Studenten zugetraut hatte. Ja, der Südafrikaner schien ein gewisses Talent für die Naturwissenschaften zu besitzen, das musste er ihm zugestehen. Widerwillig. Jetzt war van Beukes Professor an der Universität von Pretoria und unterrichtete Genetik und Molekularbiologie. Grüne Gentechnik, das war der Schwerpunkt seiner Arbeit. Genauso wie Singhs. Nur dass van Beukes sich immer mehr für Politik und linksradikale Ideen als für die Wissenschaft interessiert hatte.
Was aber, wenn seine wilde Theorie stimmt?, meldete sich die nagende Stimme in Singhs Kopf.
Der Gedanke, ausgerechnet van Beukes könnte ein Geheimnis gelüftet haben, an dem sich so viele den Kopf zerbrochen hatten, ließ ihn keine Ruhe finden. Er musste Gewissheit haben, nur deshalb hatte er die Strapazen der Zugfahrt nach Jaisalmer auf sich genommen. Auch wenn er es inzwischen beinahe bereute. Jetzt musste er nur noch einen Mietwagen auftreiben, der den holprigen Straßen Rajasthans gewachsen war. Keinen klapprigen Land Rover. Die Briten verstanden nichts vom Autobau. Besser einen BMW oder wenigstens einen Japaner. Hauptsache, der Wagen hatte eine Klimaanlage.
Singh schlängelte sich an einer Gruppe Asiaten vorbei, die sich für die frittierten Fleischspieße mit Brot interessierten, die ein Straßenhändler anbot. Die Preise waren Wahnsinn, doch die Touristen schien es nicht zu kümmern. Der Geruch nach Curry, der in der Luft hing, ließ auch Singh das Wasser im Mund zusammenlaufen.
Der Concierge seines Hotels hatte ihm die Adressen einiger Mietwagenagenturen genannt. Wie Lebensmittel waren auch Autos zurzeit Mangelware und wie zu erwarten gewesen war, hatte er bei den ersten beiden kein Glück gehabt. Er konnte nur hoffen, dass er bei der dritten mehr Erfolg haben würde.
Singh hatte noch immer den würzigen Currygeruch in der Nase, als er in der spiegelnden Fensterscheibe eines Geschäftes, das bunte Stoffe anbot, den Mann bemerkte, der ihm mit einigen Schritten Abstand folgte.
Er war nicht groß, aber breitschultrig. Das Haar trug er militärisch kurz rasiert. Es war rot, so rot wie der Dreitagebart, der ihm ein ungepflegtes Aussehen verlieh. Er war Europäer, da war sich der Wissenschaftler sicher. Vielleicht ein Brite? Vermutlich, er strahlte diese gewisse Arroganz aus, die allen Briten zu eigen war. Jedenfalls war es derselbe Mann, mit dem er gestern in dem Gedränge auf dem Bahnsteig beinahe zusammengestoßen war, ja, daran bestand kein Zweifel. Und heute Morgen hatte er ihn in der Lobby seines Hotels gesehen. Natürlich konnte es ein Zufall sein. Gut möglich, oder …
Singh presste die Aktentasche mit dem Brief gegen seine Brust. Sein Herz schlug schneller, er spürte es ganz deutlich. An der nächsten Straßenecke wandte er sich nach rechts. Er drängelte sich an einem Alten mit gebeugtem Rücken vorbei, der mit einem Gewürzhändler um ein Säckchen Pfefferkörner feilschte. Hinter einem alten Haveli mit verwitterten Fassadenmalereien und brüchigen Balkonen bog er abermals ab. Aus den Augenwinkeln sah er, dass es der Mann mit den roten Stoppelhaaren ihm gleichtat.
Er verfolgte ihn! Kein Zweifel.
Raj Kamal Singh beschleunigte seine Schritte. Er zwängte sich zwischen den dicht an dicht parkenden Autos hindurch, überquerte die Straße und verschwand in einer schmalen Gasse zwischen zwei Wohnhäusern. Die Gassen der Altstadt waren ein Labyrinth. Aufs Geratewohl schlug er mal die eine, mal die andere Richtung ein. Das Geräusch seiner Ledersohlen auf dem steinharten Lehm hallte von den hohen Wänden wider. Er überquerte einen Hof, auf dem drei Frauen gelbe und orangefarbene Tücher zum Trocknen aufhängten. Ein kleiner Junge warf einen Ball gegen die Wand und fing ihn wieder auf. Dann ging es ein paar Stufen hinunter und schließlich durch einen niedrigen Torbogen. Erst jetzt wagte Singh es, stehen zu bleiben und sich umzublicken.
Sein Herz hämmerte, als würde es jeden Moment zerspringen, aber von seinem Verfolger war nichts zu sehen.
Erleichtert atmete Raj Kamal Singh aus. Wahrscheinlich hatten ihm seine Nerven einen Streich gespielt. Dieser verwünschte Brief! Wenn es etwas ändern würde, hätte er Marq van Beukes’ Schreiben auf der Stelle zerrissen. Zerrissen und die Fetzen dem Wind überantwortet. Doch dafür war es zu spät.
Langsam ging er weiter und allmählich beruhigte sich sein Pulsschlag. Vor einem Hauseingang standen einige Mülltonnen. Daneben saß ein Mann auf dem lehmigen Boden. Den Rücken gegen eine der Tonnen gelehnt. Er war so ausgemergelt, dass Singh unmöglich sein Alter hätte schätzen können. Die Wangen des Mannes waren eingefallen. Seine Augen saßen tief in den Höhlen. Er starrte geradeaus, regungslos, obwohl Fliegen über sein schmutziges Gesicht krabbelten. Singh würgte. Er konnte nicht sagen, ob seine Übelkeit von den überquellenden Tonnen herrührte oder ob der Mann so widerwärtig roch. War er vielleicht tot und verweste bereits? Singh schauderte. Wie dumm, dass er sein Taschentuch weggeworfen hatte.
Der Wissenschaftler atmete flach und durch den Mund. Mit dem Rücken an die Hauswand gedrückt, stieg er über die nackten Füße des Mannes. Ja, er ist tot, dachte er, doch auf einmal bewegte die armselige Gestalt ihre Lippen.
»Hun…«
Singh verharrte. Die Gestalt hatte so leise gesprochen, dass er sich nicht sicher war, ob er das Wimmern richtig verstanden hatte.
»Hun…«, wiederholte sie. »Hun…«
Stumm starrte er den Mann vor seinen Füßen an, dann begriff er. Hunger, das wollte er wohl sagen.
Die Gestalt hob eine dürre Hand. Erschrocken und angewidert zugleich, wich Singh zurück. »Lassen Sie mich in Frieden! Ich habe nichts zu essen!«
Er drehte sich um und hastete davon. Ganz gewiss war es nicht seine Aufgabe, sich um irgendwelche Bettler zu kümmern. Er hatte schließlich seine eigenen Probleme. Singh beschleunigte seine Schritte. Alle paar Meter sah er über die Schulter, doch zum Glück machte die ausgemergelte Gestalt keine Anstalten, ihm zu folgen.
Außer Atem taumelte er aus der Gasse auf die Gadisar Road. Der grelle Sonnenschein blendete ihn, daher erkannte er den rothaarigen Mann erst, als dieser ihm in den Weg trat.
Als wäre er vor eine Wand gelaufen, blieb Singh stehen.
»Was … was soll das?«, stammelte er.
Der rothaarige Mann verzog den Mund zu einem spöttischen Grinsen und musterte ihn gründlich. Wie ein Raubtier seine Beute, schoss es Singh durch den Kopf.
»Gehen Sie mir gefälligst aus dem Weg«, versuchte Raj Kamal Singh es noch einmal.
Sein Gegenüber antwortete nicht, trat aber einen Schritt zur Seite.
Singh schluckte. »Na also.«
Er schob sich am rothaarigen Mann vorbei, doch plötzlich schossen zwei kräftige Hände vor und packten seine Schultern.
»Hey! Was …«
Der Mann stieß ihn von sich. Singh verlor das Gleichgewicht und stolperte auf die Straße. Ein lautes Hupen ertönte und er sah die mächtige Front eines Busses vor sich. Viel zu nah. Viel zu schnell. Wieder erscholl die Hupe. Bremsen quietschten. Zwei Scheinwerfer flammten auf und dann …
Raj Kamal Singh sah den Himmel seines Heimatlandes über sich. Vor dem Azurblau erkannte er eine schwarze Rauchfahne und unwillkürlich musste er an die Gruben vor der Stadt denken, über denen die Geier ihre Kreise zogen. Die Gruben wurden mit Bulldozern ausgehoben und wieder zugeschüttet, sobald die Flammen verloschen waren. Holz gab es schon lange nicht mehr, deshalb übergoss man die Toten mit Öl oder Benzin. Vom Zug aus hatte er gesehen, wie sich die leblosen Leiber in der Hitze aufbäumten. Wie sie loderten, wie sie verkohlten, bis nur noch schwarze Asche übrig war.
Ich will nicht sterben!
Jeder einzelne seiner Knochen musste gebrochen sein. Er wollte sich aufrichten, aber er war unfähig, auch nur einen Finger zu rühren. Ich bin gelähmt, Hilfe!, versuchte er trotz der unfassbaren Schmerzen zu sagen, doch seine Lippen bewegten sich stumm.
Ein Schatten fiel auf sein Gesicht.
Rufen Sie einen Krankenwagen, flehte er in Gedanken. Bitte …
Doch dann erkannte er, dass es der rothaarige Mann war, der sich über ihn beugte.
»Fahr zur Hölle, Gandhi«, hörte er ihn höhnen.
Tatsächlich, seine Stimme hatte einen britischen Akzent.
Der Mann bückte sich und aus den Augenwinkeln sah Raj Kamal Singh, wie er die Aktentasche aufhob. Die Aktentasche, in der sich der Brief befand.
Der Inder schloss die Augen. Marq van Beukes hatte sich also nicht geirrt. Ihr Götter!
1
Auch in diesem Dorf waren die Felder von der Krankheit gezeichnet. Finn betrachtete den Weizenhalm in seiner Hand. In dunklen Linien brachen die Sporen des Pilzes, der in dem Stängel wie ein Krebsgeschwür wucherte, aus ihm hervor. Sie bedeckten ihn auf seiner gesamten Länge. Selbst die Blätter waren befallen. Rostbraun und Schwarz. Daher hatte die Erkrankung ihren Namen.
Getreideschwarzrost.
Vor einem Jahr hatte er das Wort zum ersten Mal in einem Zeitungsartikel gelesen. Damals wussten nur wenige Fachleute etwas mit der Krankheit anzufangen, doch in den letzten Monaten hatte sich das geändert. Jetzt wusste jeder, was der Schwarze Rost war.
Er ließ die Ähre durch die Finger zu Boden gleiten. Wie winzig die wenigen verkrüppelten Körner waren. Die Regierung hatte verkündet, der Pilz sei für Menschen völlig harmlos.
»Schön möglich«, sagte Finn zu sich selbst, »aber habt ihr nicht auch behauptet, dass ihr den Pilz in ein paar Monaten in den Griff bekommt?« Tja, wie sagte man so schön? Irren ist menschlich.
Er wischte die Handflächen an dem Stoff seiner Cargohose ab. Am liebsten hätte er sich gründlich mit Wasser und Seife geschrubbt. Er fuhr sich mit der Hand über die Wangen. Ja, und eine Rasur wäre auch nicht schlecht, denn in den letzten zwei Wochen war aus seinem lässigen Dreitagebart ein Vollbart geworden. Er kratzte, doch das nächste Hotelzimmer mit fließend Wasser und einem Waschbecken gab es in Thohoyandou. Und das war gut sechzig Kilometer entfernt.
Finn griff nach seiner neuen Canon EOS 5D Mark 3. Er stellte das Makroobjektiv scharf und fing eine Nahaufnahme der verkümmerten Ähren ein. Dann erhob er sich aus der Hocke.
»Au!«
Seine Beine waren eingeschlafen. Sie kribbelten. Er trat von einem Fuß auf den anderen und massierte seine Oberschenkel. Ein paar Schritte abseits der Straße zankten zwei Krähen um eine karge Mahlzeit. Die Farmer hatten das Getreide auf den Feldern verdorren lassen. Es gab keine Ernte, die sich einzubringen lohnte. Weder Weizen noch Roggen oder Hafer. Falls es stimmte, was er gehört hatte, war es in ganz Südafrika so. Und nicht nur dort.
Finn senkte die 5D und schnappte sich seine alte Spiegelreflexkamera. Er hatte sie zu seinem sechzehnten Geburtstag bekommen. Von seinem Pa, bevor der in den Sudan geflogen und dort entführt worden war. Das war über zehn Jahre her und seitdem war die Kamera Finns ständige Begleiterin. Wie ihre jüngere Schwester trug er sie an einem breiten Riemen um den Hals. Routiniert entfernte er den Deckel vom Weitwinkelobjektiv. Er verstaute ihn in der Brusttasche seiner Fotoweste, stellte die Brennweite ein und schoss zwei, drei Totalen des Feldes.
Eine dritte Krähe hatte sich zu den schwarzweißen Vögeln gesellt. Sie war noch zerrupfter als ihre beiden Kameraden. Soweit war es mit dem Land gekommen. Nicht nur die Menschen, selbst die Tiere hatte der Hunger gezeichnet.
Finn zog einen Müsliriegel aus der Brusttasche seiner Weste. Es war der vorletzte seiner eisernen Reserve. Die Vögel beobachteten, wie er das Papier entfernte.
»Der gesunde Energieschub für Zwischendurch«, las er laut. »Hochwertiges Getreide. Sonnengetrocknete Rosinen. Und gut für die Verdauung soll er auch sein. Na, wenn das nichts ist. Lasst es euch schmecken.«
Er warf den Riegel den Krähen zu. Sie flatterten auf und stürzten sich auf den süßen Snack. Sofort entbrannte ein wilder Kampf. Finn seufzte. Was war er doch für ein Idiot! Wieso hatte er nicht daran gedacht, ihn in drei Teile zu brechen?
Verärgert über sich selbst, wandte er sich seinem Fahrrad zu. Das vordere Schutzblech war verbogen, nachdem er in der gestrigen Abenddämmerung vom Weg abgekommen und über einen Stein gestürzt war. Zum Glück war er unverletzt geblieben und nach einiger Fummelei war es ihm schließlich gelungen, wenigstens zwei der gebrochenen Speichen zu ersetzen. Ohne Eile schob er das Rad über den staubigen Feldweg zu den Hütten, die am Rand des Weizenfeldes standen. Jede bestand nur aus einem einzigen Stockwerk. Manche waren weiß getüncht, mache gelb, manche rot. Die Dächer aus grauem Wellblech. Strom- und Telefonkabel hingen schlaff zwischen hölzernen Masten. Hier und da wuchsen struppige Büsche.
»Hello?«, rief er, als er sich den Hütten auf zwanzig Meter genähert hatte.
Niemand antwortete. Nirgends war eine Menschenseele zu sehen. Finn kickte eine rostige Cola-Dose beiseite. Ein Pick-up parkte neben der asphaltierten Hauptstraße. Die Motorhaube stand offen. Eine rote Sandschicht bedeckte die Windschutzscheibe. Sie hatte einen Sprung. Er ging um den Wagen herum. Jemand hatte einen Tisch, Stühle und eine Kommode auf der Ladefläche verzurrt. Sie waren nicht weniger dreckig als der Wagen.
Finn lehnte sein Rad gegen die Heckklappe. Er schoss ein paar Fotos, ehe er zu der nächstgelegenen Hütte ging.
Die Tür sah aus, als hätte jemand sie eingetreten. Das Holz war gesplittert. Sie hing schief in den Angeln. Obwohl sie nur angelehnt war, klopfte er. Er wartete einen Moment, dann klopfte er noch einmal.
»Ist hier jemand?«
Nichts.
Finn drückte die Tür auf. Sie schleifte über den Boden. Vorsichtig trat er über die Schwelle. Seine Sneaker hinterließen Abdrücke im roten Staub. Langsam ging er von Zimmer zu Zimmer. In der Küche gab es einen eisernen Herd, daneben lagen ein paar Holzscheite. Die Regale und der winzige Kühlschrank waren leer. Auch in der Speisekammer entdeckte er nichts außer einem Eimer, einem Besen und ausgetrunkenen Bierflaschen. In einem Zimmer stand ein rostiges Bettgestell. Die Matratzen waren verschwunden. Darüber hingen Poster, die verschiedene Fußballer beim Torschuss zeigten. Manche kannte er, manche nicht. In seiner Schulzeit hatte die Wand über seinem Bett nicht viel anders ausgesehen, nur war Basketball sein Ding gewesen. Finn schmunzelte, doch dann musste er daran denken, was wohl aus dem fußballbegeisterten Jungen geworden war, dem dieses Zimmer gehört hatte. Schlagartig wurde er wieder ernst. Er drehte sich um und machte, dass er aus dem Kinderzimmer kam.
Von den ehemaligen Bewohnern fehlte jede Spur. Finn war klar, dass es in den übrigen Hütten genauso aussah. Das Dorf war von seinen Bewohnern verlassen worden. Verlassen und anschließend von wem auch immer geplündert worden. Genauso wie alle Dörfer, durch die er in den letzten Tagen gefahren war.
Auf einmal hörte er von draußen ein aufgeregtes Krächzen.
Die Krähen!
Etwas hatte die Vögel aufgeschreckt.
Als er aus der Hütte rannte, sah er noch, wie sie sich in den Himmel erhoben. Mit hektischen Flügelschlägen flatterten sie davon. Finn blinzelte in die Mittagssonne. Seltsam. Weshalb waren sie so aufgeregt davongeflogen? Er drehte sich langsam im Kreis. Nach wie vor war nirgends eine Menschenseele zu sehen, nur im Westen glaubte er, etwas am Horizont zu erkennen. Es war – er kniff die Augen zusammen – ein seltsamer beigebrauner Streifen. Hm, was konnte das sein?
Das Schrillen seines Satellitentelefons riss Finn aus seinen Gedanken. Es steckte in der Seitentasche seines Rucksacks. Als er ihn sich vom Rücken zog, fiel es heraus. Fluchend hob er es auf. Hoffentlich war es nicht kaputtgegangen. Zurzeit war das Handy seine einzige Verbindung zur Zivilisation. Er wischte das Display und das Plastikgehäuse sauber. Auf den ersten Blick schien es in Ordnung zu sein. Ein Glück. Er klappte die Stummelantenne aus.
»Ja?«
»Wo steckst du?«, hörte er die Stimme seines Chefs.
In jungen Jahren war Friedrich Scherer als Kriegsfotograf um die halbe Welt gereist. In den Balkan, den Nahen und den Mittleren Osten. Er hatte vom Kosovokrieg und von Desert Storm, aus Afghanistan und Darfur berichtet. Er war eine lebende Legende und hatte Dutzende Preise für seine Fotos und Reportagen gewonnen. Eines Tages hatte er seine Kamera an den sprichwörtlichen Nagel gehängt. Seitdem leitete Scherer die Auslandsredaktion der International Pictures and News Agency. Ihm hatte Finn seine Stelle zu verdanken.
Finn fuhr sich mit der Hand über den Bart. »Ich bin in Kapstadt. Blouberg Beach. Bis vor ein paar Minuten war ich surfen, jetzt lasse ich mir die Sonne auf den Bauch brennen und in einer halben Stunde werde ich mit einer blonden Australierin Longdrinks schlürfen. Mal sehen, was sich sonst noch so ergibt.«
»Witzig, sehr witzig.«
»Ich versuche nur, den Humor nicht zu verlieren.« In dem Job als Sonderkorrespondent, der von Krise zu Krise zog, war das die einzige Chance, nicht den Verstand zu verlieren. Er kannte Kollegen, die mit dem Trinken angefangen oder sich eines Tages eine Kugel durch den Kopf gejagt hatten. »Also, was gibt’s, Chef?«
»Ich will wissen, ob es dir gut geht.«
Finn nahm das Telefon in die andere Hand. »Klar, was soll sein?«
»Stell dich nicht dümmer, als du bist. Warum hast du dich gestern nicht gemeldet?«
Wie das Zähneputzen gehörte es zu Finns täglicher Routine, jeden Abend mit dem Satellitenhandy in der Berliner Redaktion anzurufen, ein paar Worte mit Scherer zu wechseln und ihm eine Mail mit den Fotos des Tages zu schicken.
»Ich hatte einen kleinen Unfall und da habe ich das glatt vergessen.«
»Wie bitte? Einen Unfall? Was …«
Ein Rauschen unterbrach die Verbindung. Finn nahm das Handy vom Ohr und warf einen Blick auf das Display. Nein, die Akkus waren voll, aber die Empfangsanzeige zeigte nur einen einzigen Balken an. Komisch, in den letzten Wochen hatte er mit dem Telefon keinerlei Schwierigkeiten gehabt. War es beim Herunterfallen vielleicht doch beschädigt worden?
»Finn?«
Schnell presste er das Handy wieder ans Ohr. »Tut mir leid, du warst für einen Moment weg. Etwas ist mit dem Empfang.«
»Was ist mit diesem Unfall? Bist du verletzt?«
»Nein, nein«, erwiderte er schnell. Scherer hörte sich ernstlich besorgt an. »Ich musste ein paar gebrochene Speichen wechseln und danach war ich so fertig, dass ich den Anruf vergessen habe. Wird nicht wieder vorkommen, Chef.«
Die Reparatur war nur ein Provisorium. Ohne eine ordentliche Werkstatt war da nicht viel zu machen. Egal, wenn er vorsichtig fuhr, sollte es keine Probleme geben.
»Mir gefällt das nicht.«
»Wie gesagt, alles halb so schlimm.«
»Ich meine nicht diesen Unfall, Finn. Ich habe gehört, dass der Norden nicht sicher sein soll.«
»Das ist nichts Neues. Diese Gerüchte gibt es seit Wochen.«
»Gerüchte? Gestern wurden fünfzehn Leichen in einem Straßengraben gefunden. Die meisten waren Frauen und Kinder. Auf der Flucht vor dem Hunger. Sie wurden erst ausgeraubt und dann erschossen. Hast du davon nichts mitbekommen?«
Nein, hatte er nicht. »Wo?«
»In der Nähe …« Wieder verschluckte ein Rauschen die Worte seines Vorgesetzten.
»Wie bitte?«
Nichts, nur Rauschen. Ob die Störung etwas mit dem seltsamen Streifen im Westen zu tun hatte? Er konnte sich täuschen, aber er schien größer geworden zu sein.
»Kannst du das noch einmal wiederholen?«, fragte er, ohne den Blick vom Horizont zu nehmen. »Ich hab dich nicht verstanden.«
»… der Nähe von Alldays.«
Alldays? Finn biss sich auf die Lippe. Mit dem Fahrrad war der Ort nur drei oder vier Stunden entfernt.
»Hör zu«, sagte er, »mach dir um mich keine Sorgen. Ich will mich nur ein wenig in den Dörfern an der Grenze zu Zimbabwe umsehen und dann vielleicht nach Lephalale. Ich nehme an, das wird eine knappe Woche dauern, aber ich werde vorsichtig sein. Versprochen.«
»Es wäre mir lieber, wenn du nach Hause kämst.«
Das hatte er befürchtet. Obwohl sein Chef ihn nicht sehen konnte, schüttelte Finn den Kopf. »Zerbrich dir nicht den Kopf. Ich komme schon klar.«
»Sicher?«
»Ja, du weißt doch, dass ich das nicht zum ersten Mal mache.«
Im Westen sah es jetzt so aus, als würde sich dort ein Gebirge auftürmen. Nein, er musste sich täuschen. Das konnten keine Berge sein. Es waren … Wolken. Ein Sandsturm!
»Geht es darum, dass du mir etwas beweisen willst?«, hörte er Scherer fragen.
»Wie bitte?« Der aufgewirbelte Sand schien sich rasend schnell zu nähern. »Nein, ich will meinen Job machen, und zwar gut, das ist alles.«
»Indem du dich in Gefahr begibst?«
»Wenn es der Job erfordert. Meine Güte, Chef, du weißt doch, wie das ist.«
»Ja, und aus diesem Grund bitte ich dich, vorsichtig zu sein.«
»Friedrich …«, versuchte er es noch einmal, aber sein Chef ließ ihn nicht ausreden.
»Ich bin lange genug mit meiner Kamera um die Welt gezogen. Länger als du. Ich weiß, was in dir vorgeht. Als ich in deinem Alter war, da dachte ich, ich könnte die Welt mit meinen Fotos retten. Kriege beenden, den Hunger besiegen. Indem ich die Wahrheit berichtete. Ich habe mir eingeredet, das würde die Menschen aufrütteln.« Er lachte. Es klang nicht fröhlich, sondern bitter. »Lass es, hast du mich verstanden? Du bist Journalist, das ist alles. Der Job ist es nicht wert, dass du dein Leben riskierst, okay? Nicht für ein paar verdammte Fotos, die niemanden interessieren.«
Vor einem Jahr hatte sein Chef noch nicht so geredet. Doch dann waren zwei Kollegen, die Scherer in den Norden des Iraks geschickt hatte, entführt und wenige Tage später ermordet worden. Das Video war um die Welt gegangen. Und seitdem war er nicht mehr derselbe. Hinter vorgehaltener Hand hieß es, dass Scherer am Ende sei. Ausgebrannt. Nur noch eine Frage der Zeit, bis er gefeuert werden würde. Finn hoffte, dass sein Chef die Kurve bekam. Aber es sah nicht so aus. Er zögerte einen Moment, ehe ihm ein »In Ordnung« über die Lippen kam.
Er hörte Scherer erleichtert aufatmen. »Gut. Du tust das Richtige, glaub mir. Was meinst du, wann wirst du wieder in Berlin sein?«
»Am Wochenende, schätze ich.«
»Am Wochenende?«
»Spätestens am Freitagabend sitze ich im Flieger. Ehrenwort.«
»Ich verlasse mich auf dich.«
»Das kannst du, Chef« Er rieb sich mit der Hand den Nacken. »Ich habe einen Brief von Alisa bekommen.«
»Ich weiß. Sie hat mich gefragt, wie sie dich erreicht.«
»Sie heiratet in ein paar Tagen.«
Sein Chef schwieg.
»Was ist er für ein Kerl?«
»Willst du das wirklich wissen?«
»Ja.«
»Sein Name ist Paul. Alisa hat ihn vor einem Jahr in der Kanzlei kennengelernt. Zu ihrem Geburtstag hat sie ihn mir vorgestellt.«
»Und?«
Scherer seufzte. »Paul scheint ein netter Kerl zu sein. Er spielt Beachvolleyball. Interessiert sich für moderne Malerei und Comics. Die beiden denken daran, Kinder zu kriegen. Bist du jetzt zufrieden?«
Kinder? Alisa?
»Ich verstehe nur nicht, wieso sie …«
Er sprach nicht weiter. Es war so lange her. Er hatte gedacht, er wäre darüber hinweg, doch Friedrich Scherers Worte hatten alte Wunden aufgerissen. Wunden, die zu seinem Erstaunen noch immer nicht verheilt waren.
»Du verstehst es nicht?« Die Stimme seines Chefs war gleichzeitig belustigt und voller Mitleid. »Dann bist du ein Dummkopf, Finn. Ein Dummkopf, und es geschieht dir recht, dass meine Tochter mit dir Schluss gemacht hat. Komm schon, blick nach vorn. Und Finn …«
»Ja?«
»Vergiss nicht, dass du mir dein Ehrenwort gegeben hast. Am Freitag, spätestens.«
Finn beendete das Gespräch. Während er das Telefon in seinem Rucksack verstaute, ließ er den Sandsturm nicht aus den Augen. Jetzt sah er wie eine gigantische gelbe Wolkenwalze aus, die direkt auf ihn zurollte. Eine Wolkenwalze, höher als jeder Wolkenkratzer. Millionen Tonnen Sand. Zerstörerisch. Todbringend.
Er warf einen Blick zu den Hütten. Wahrscheinlich wäre es klüger, sich in einer von ihnen zu verkriechen und den Sandsturm abzuwarten. Aber in diesem Geisterdorf im Nirgendwo wollte er nicht festsitzen. Auf gar keinen Fall. Schnell verstaute er die empfindlichen Kameras in seinem Rucksack, dann atmete er tief durch und schwang sich auf sein Rad.
»Gut, dass du das nicht siehst, Scherer«, murmelte er und trat in die Pedale.
Hoffentlich machte das Vorderrad nicht schlapp.
2
Finn beugte sich tief über den Lenker des Crossrads. Die Nase und den Mund hatte er, so gut es ging, mit seinem Halstuch geschützt, sonst wäre er wahrscheinlich erstickt. Der Sturm kam von der Seite und jedes Mal, wenn er den Kopf hob, stachen die Sandkörner wie Stecknadeln in sein Gesicht.
Vor einer Weile war ihm ein Polizeiwagen mit flackerndem Blaulicht entgegengekommen. Die Polizisten hatten kugelsichere Westen getragen und der Beamte auf dem Beifahrersitz hatte ein Sturmgewehr vor der Brust gehabt. Wie ein Soldat, der in die Schlacht zieht. Ob etwas an den Gerüchten dran war, die er über die Lage im Norden des Landes gehört hatte?
»Warum bist du nicht in diesem Dorf geblieben?«, fragte er sich. Der Wind heulte, sodass er seine eigenen Worte kaum verstand. Zwischen seinen Zähnen knirschte Sand. Trotz des Halstuchs fanden einige feine Körner den Weg in seine Kehle und lösten einen Hustenanfall aus.
In der letzten Stunde war er keiner Menschenseele begegnet. Was bist du doch für ein Idiot, Finn! Hättest du dir nicht denken können, dass man einem Sandsturm nicht so einfach … nicht so …
Die Straße stieg steil an und er musste mit aller Kraft in die Pedale treten. Kurz hob er den Kopf, doch in dem orangeroten Dämmerlicht konnte er keine fünfzig Meter weit sehen. Unmöglich zu sagen, wie weit sich die Steigung hinzog. Die Milchsäure in seinen Oberschenkelmuskeln brannte wie Feuer. Zum tausendsten Mal überlegte er, aus dem Sattel zu steigen und sein Rad zu schieben. Aber bald würde es dunkel werden und die Nacht im Freien verbringen? Während ein Sandsturm tobte? Nein danke! Da war es besser, bis zum Umfallen zu strampeln. Nach Pretoria war es zu weit, aber vielleicht konnte er in Mokopane ein kleines Hotel finden. Mit einer Dusche. Einer Dusche und vor allen Dingen einem weichen Bett.
Durch das Wüten des Sturms hörte er hinter sich ein Motorengeräusch.
Ein Wagen!
Finn warf einen Blick über die Schulter. Hinter sich sah er ein Scheinwerferpaar, das sich näherte. Schnell streckte er den Arm zur Seite und hob den Daumen. War das seine Rettung? Gut möglich, dass der Fahrer auch auf dem Weg in den Süden war. Und wenn nicht, dann konnte er ihn wenigstens ein Stück mitnehmen.
Das Motorgeräusch wurde zu dem Dröhnen eines Dieselmotors. Finn blinzelte. Aus dem Sandvorhang schälten sich die Umrisse eines Lastwagens. Er war weiß, der rechte Kotflügel verbeult. Eine helle Plane überspannte die Ladefläche. Eine Ecke war nicht festgezurrt und flatterte im Sturm. Der Lkw näherte sich schnell. Viel zu schnell. Und viel zu nah am Seitenstreifen.
War der Fahrer denn wahnsinnig?
Die Scheibenwischer ruckten hin und her, aber wahrscheinlich konnte er in dem Sandsturm kaum etwas erkennen.
Warum fuhr er nicht langsamer?
Der Asphalt erbebte unter dem tonnenschweren Gefährt. Die Scheinwerfer blendeten Finn. Unwillkürlich hob er eine Hand vor die Augen. Der Wagen schien direkt auf ihn zuzuhalten.
Hey!
Im allerletzten Moment riss er den Lenker zur Seite und dann donnerte der Lastwagen vorbei. Knapp eine Armeslänge entfernt. Wie eine unsichtbare Hand zerrte der Luftsog an Finn. Er schlingerte und um ein Haar wäre er unter die mächtigen Räder geraten und zermalmt worden.
Wie durch ein Wunder brachte er sein Rad wieder unter Kontrolle.
»Blöder Idiot!«, schrie er dem Fahrer hinterher.
Sein Herz schlug wie verrückt, aber die roten Rücklichter des Lkws verschwanden bereits in der Ferne.
Eine Viertelstunde später erreichte er die Kuppe der Anhöhe, dahinter fiel die Straße steil ab. Finn betätigte die Gangschaltung. Durch den Metallrahmen spürte er, wie die Kette auf ein größeres Zahnrad sprang. Er trat jetzt nur noch langsam in die Pedale, dennoch wurde sein Rad schneller und schneller. Hoffentlich machten die zusammengeflickten Speichen das mit. Zu seiner Linken tauchte eine verlassene Hütte aus dem wirbelnden Sand auf und verschwand einen Herzschlag darauf wieder. Er raste an einem steinigen Hang, auf dem nur dorniges Gestrüpp wuchs, vorbei, dann kam eine scharfe Rechtskurve und da erblickte er den Lastwagen.
Finn bremste.
Es war derselbe Lkw, dem er vor ein paar Minuten begegnet war. Er erkannte den verbeulten Kotflügel. Die Plane flatterte noch immer im Wind. Der Wagen war von der Straße abgekommen, über den sandigen Seitenstreifen geschlittert und dann mit den Vorderrädern in einem trockenen Graben am Rand eines braunen Feldes stecken geblieben. Wieder und wieder gab der Fahrer Gas. Schwarz quoll Dieselruß aus dem Auspuff, doch die Räder drehten nur durch und der Lastwagen grub sich immer tiefer in den rötlichen Sand.
Geschieht dir recht!, dachte Finn.
Er wollte schon weiterfahren, doch dann schüttelte er den Kopf. Nein, er konnte den Fahrer nicht einfach seinem Schicksal überlassen. Vielleicht war er ja bei dem Unfall verletzt worden und brauchte Hilfe.
Er hielt an und stieg vom Rad. Sein Gesicht schützte er mit dem Unterarm. Gegen den wirbelnden Sand stapfte er zu dem Lkw hinüber.
»Hey!«, rief er, doch der Sturm riss seine Stimme fort.
Als Finn neben der Fahrerkabine stand, schlug er zweimal mit der flachen Hand gegen die Tür. Der Motor verstummte und einen Moment später wurde sie von innen aufgestoßen.
Hinter dem Lenkrad hockte eine zierliche Gestalt. Sie trug enge Bluejeans, die in abgetragenen Trekkingstiefeln steckten, ein khakifarbenes Hemd und darüber eine Armeejacke. Um den Hals hatte sie sich ein kariertes Tuch geschlungen. Es war eine Frau, eine Frau mit asiatischen Gesichtszügen. Nicht viel älter als er. Dreißig, höchstens. Eine Haarsträhne hing ihr ins Gesicht. Sie hatte dunkle, große Augen.
»Ist alles okay?«, fragte Finn auf Englisch.
»Das ist die dämlichste Frage, die man mir jemals gestellt hat«, antwortete die Asiatin. »Nein, nichts ist in Ordnung. Ich stecke mit dieser Rostlaube in einem beschissenen Graben fest, sehen Sie das nicht?«
»Kann ich Ihnen helfen?«
»Klar, wie wär’s, wenn Sie schieben würden? Ich meine, der Lkw wiegt ja nur um die zwanzig Tonnen.«
Finn atmete tief durch. Nur die Ruhe, sagte er sich. »Haben Sie vielleicht einen Spaten?«
»Einen Spaten? Sie wollen den Wagen ausgraben?« Die zierliche Asiatin musterte ihn einen Moment skeptisch, doch dann zuckte sie mit den Schultern. »Was soll’s? Versuchen können wir es ja.«
Sie löste ihren Gurt, zog das Tuch über die untere Hälfte ihres Gesichts, schwang sich aus der Fahrerkabine und landete neben Finn.
»Kommen Sie!«
Sie ging zum Heck des Wagens und winkte ihm, ihr zu folgen. Er legte sein Fahrrad auf den Boden und ging zu ihr.
»Ich heiße übrigens Finn. Finn Sadah.«
»Jin Mae.«
Sie schlug die Plane beiseite. Überrascht sah Finn einige Personen, die im Halbdunkel zwischen Dutzenden von Pappkartons hockten. Es waren Frauen, Kinder und ein weißhaariger Greis. Auf der Flucht vor dem Hunger, wie so viele andere auch.
»Keine Sorge«, sagte Jin Mae. Eine junge Frau hob den Kopf, die anderen blickten teilnahmslos drein. »Wir werden bald weiterfahren. Versprochen.«
Sie öffnete den Deckel einer Metallkiste, zog einen Klappspaten hervor und streckte ihn Finn entgegen.
»Hier.«
Der Spaten war gerade so lang wie sein Unterarm.
Er sah sie zweifelnd an. »Einen größeren haben Sie nicht vielleicht?«
»Es war Ihre Idee, nicht meine.«
»Versuchen Sie nur nicht, freundlich zu sein.«
Ehe sie etwas Schnippisches erwidern konnte, griff er nach dem Klappspaten. Die Vorderräder freizubekommen, würde kein Kinderspiel werden, aber je eher er mit der Arbeit begann, desto schneller war er die unfreundliche Asiatin wieder los.
Finn begann zu schaufeln.
Der Graben, in dem die Vorderräder des Lastwagens steckten, war etwa einen halben Meter tief. Vermutlich hatte es hier seit Wochen nicht mehr geregnet. Die rote Erde war staubtrocken, staubtrocken und so fest wie Beton. Schon nach ein paar Minuten lief ihm der Schweiß über das Gesicht und vermischte sich mit dem Sand zu einer ekligen Schmiere. Am liebsten hätte er den Spaten weggeworfen, doch Finn musste an die Menschen hinten auf dem Lastwagen denken und somit zwang er sich dazu, weiterzuschippen.
»Danke.«
Überrascht hielt er inne und sah sich um. Er hatte nicht bemerkt, dass Jin Mae hinter ihn getreten war. Mit vor der Brust verschränkten Armen musterte die Asiatin ihn.
»Ich habe mich wirklich widerlich aufgeführt«, sagte sie. »Tut mir leid.«
»Schon gut.« Finn stieß den Spaten in den Graben. Das Metall grub sich keinen halben Zentimeter in den harten Erdboden und traf dann auf einen Stein. »Darf ich fragen, wo Sie hinwollen?«
»Nach Makonde.«
»Makonde?«
»Ja, da gibt es ein Lager, in dem wir die Menschen mit dem Nötigsten versorgen. Ich habe eine Ladung mit Medikamenten und ein paar Lebensmitteln, die dringend benötigt wird. Eigentlich sollte ich vor drei Tagen dort sein, doch erst gab es Schwierigkeiten mit den Behörden wegen der Papiere, und als dann endlich alles geklärt war, sind meine Helfer abgehauen und schließlich gab es weit und breit keinen Diesel.«
»Haben Sie die Menschen auf Ihrem Wagen unterwegs aufgesammelt?«
»Ja, ich wollte sie vor dem Sandsturm in Sicherheit bringen, aber jetzt …« Sie deutete auf die Vorderräder, die noch immer im Graben steckten. »Ich kann ihnen nicht einmal Wasser oder was zum Essen geben. Und dann sind da noch die Medikamente. Sie werden im Lager benötigt. Dringend. Und ich? Ich sitze hier fest. Ich könnte ausflippen.«
Jetzt verstand er. Kein Wunder, dass die Asiatin so übel gelaunt war. Sie sorgte sich.
»Wir schaffen das«, versuchte er, sie zu beruhigen.
»Hoffentlich.« Sie nickte ihm zu. »Was ist? Sie sehen wie ausgekotzt aus. Soll ich Sie ablösen?«
»Nicht nötig.« Er richtete sich auf und streckte seinen schmerzenden Rücken. Etwas knackte. »Ich glaube, das könnte reichen.«
Jin Mae legte den Kopf schief. Sie betrachtete sein Werk. »Meinen Sie?«
»Nur nicht so pessimistisch. Hauptsache, Sie sind schön vorsichtig. Wenn die Aufhängung bricht oder der Lkw umkippt, war’s das.«
Sie wischte sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht. Ihre dunklen Augen funkelten. »Ich weiß, wie man einen Lastwagen fährt. Auch wenn ich nur eine Frau bin, keine Sorge.«
Jin Mae stiefelte zu der Kabine und zog sich zum Fahrersitz hinauf. Hinter dem riesigen Lenkrad sah sie noch zierlicher aus. Sie betätigte die Zündung. Der Anlasser jaulte auf, dann erwachte der Motor des Lastwagens stotternd zum Leben. Er sah, wie Jin Mae das Tuch vor ihrem Gesicht zurechtrückte und sich durch die offene Fahrertür nach draußen beugte. Sie blickte nach hinten und gab vorsichtig Gas, ohne die Räder des Lkws aus den Augen zu lassen.
Das schwere Gefährt bewegte sich ein paar Zentimeter, aber nicht mehr.
»Es geht nicht!«, rief Finn, obwohl sie selbst sehen musste, dass der Wagen noch immer in dem Graben steckte.
»Mist! Du blödes Ding!«
Sie ließ den Motor aufheulen. Die Räder drehten durch, Sand und Steine wirbelte auf, doch der Lastwagen kam nicht frei.
»Stopp, lassen Sie es gut sein. Ich werde lieber noch ein wenig graben.«
»Bleiben Sie zurück. Ich schaffe das.«
Finn wollte widersprechen, doch Jin Maes Gesichtsausdruck ließ ihn stumm bleiben. Die Asiatin bewegte den Hebel der Gangschaltung. Das Getriebe knirschte. Sie gab Gas und der Lastwagen rollte einen halben Meter zurück, ehe er erneut steckenblieb. Wieder fummelte sie an der Gangschaltung. Sie hatte die Lippen fest zusammengepresst. Ihr Gesicht verriet Entschlossenheit. Jin Mae rammte den Schaltknüppel nach vorn. Der Motor heulte auf, und dieses Mal machte der Lkw einen Satz nach vorn.
»Langsam!«, schrie Finn.
Ein Ruck ging durch den Wagen. Er schwankte.
»Mach schon, du dämliche Rostlaube!«
Es nützte nichts, auch dieses Mal schaffte es der Wagen nicht aus dem Graben.
»Jin Mae …«
Die junge Asiatin hieb mit der Faust auf das Lenkrad. Sie fluchte. Es klang wie Chinesisch. Finn verstand nicht ein einziges Wort.
Sie trat die Kupplung und ließ den Wagen ein Stück zurückrollen.
»Sie müssen den Wagen mit Gefühl …«
»Verdammt, können Sie nicht den Mund halten?«
Aus dem Auspuff stieß eine schwarze Rußwolke, als der Lkw erneut anfuhr. Wieder bewegte er sich nur einen knappen Meter vorwärts, doch Jin Mae gab nicht auf. Die Räder gruben sich in den Boden. Die Kupplung rauchte. Es stank nach verbranntem Gummi. Die Asiatin kurbelte am Lenkrad. Der Lkw bewegte sich noch ein paar Zentimeter vorwärts, gleichzeitig neigte er sich aber bedrohlich zur Seite.
»Vorsicht!«
Jeden Moment musste der Lastwagen kippen, doch Jin Mae gab nicht auf. Ganz im Gegenteil. Sie drückte das Gaspedal bis zum Boden durch und plötzlich machte das Gefährt einen Satz nach vorn. Aus dem Graben heraus.
Finn sprang einen Schritt zurück.
Der Lastwagen schwankte wie ein Schiff bei hohem Wellengang. Einen Augenblick sah es so aus, als würden statt der Vorder- die Hinterräder steckenbleiben, doch Jin Mae gab noch einmal ordentlich Gas und schließlich war es geschafft. Mit einem Schnaufen kam der Lastwagen ein paar Meter entfernt zum Stehen. Finn ging hinüber.
»Sehen Sie!«, rief Jin Mae. Sie sprang aus dem Fahrersitz und landete auf dem Boden. Ihre Augen funkelten. »Ich habe Ihnen ja gesagt, dass ich das schaffe.«
Er kratzte sich am Kopf. »Das war knapp.«
»Pah!« Sie stemmte die Hände in die Seite. »Gekonnt ist eben gekonnt. Trotzdem, vielen Dank, dass Sie mir geholfen haben, Finn.«
»Keine Ursache.«
Jin Mae wischte sich mit dem Handrücken den Sand von der Stirn. »Und, wo wollen Sie hin?«
»Erst einmal nach Pretoria.«
»Nach Pretoria?«
»Ja.«
»Mit dem Rad?«
»So ist es leichter, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen.«
»Sie sind verrückt.« Jin Mae verzog den Mund zu der Andeutung eines Grinsens. Sie schien etwas für Verrückte übrig zu haben. »Wo kommen Sie her?«
»Deutschland.«
»Ein Tourist?« Es klang, als ob er eine ansteckende Krankheit hätte.
Er schüttelte den Kopf. »Nein, ich bin Reporter. Für die International Pictures and News Agency. Ich arbeite an einer Reportage über den Schwarzen Rost.«
»Verstehe.« Schweigend musterte sie ihn. Ihr Unterkiefer mahlte, als würde sie angestrengt nachdenken. »Wissen Sie was? Ich nehme Sie mit. Wenn Sie von der Presse sind, müssen Sie über die Situation der Flüchtlinge in Makonde berichten. Unbedingt.«
»Das würde ich ja gern, aber mein Chef will, dass ich den nächsten Flieger nach Deutschland nehme. Er macht sich Sorgen, mir könnte etwas zustoßen.«
»Kommen Sie, Finn, das ist doch nur ein kleiner Umweg.«
»Ich würde ja wirklich gern, aber ich kann nicht.«
»Wie wollen Sie Ihre Reportage schreiben, wenn Sie nicht mit eigenen Augen gesehen haben, was die Menschen in den Lagern durchmachen?«
Im Pressekodex stand, dass die wahrhaftige Unterrichtung der Öffentlichkeit eines der wichtigsten Gebote jedes Journalisten sein solle. Während seines Journalismusstudiums hatte er die Worte auswendig gelernt und sich voller Idealismus vorgenommen, immer danach zu handeln. Dennoch, er hatte seinem Chef sein Wort gegeben. Und Friedrich Scherer verließ sich auf ihn. War das nicht wichtiger?
»Es tut mir leid. Ehrlich.«
»Sie wollen Ihre Augen vor der Wahrheit verschließen?« Sie schnaubte verächtlich. »Ich hätte nicht gedacht, dass Sie so einer sind.«
Ohne ein Wort des Abschieds drehte sie sich um.
Finn sah, wie sie zu dem Lastwagen stapfte.
Mit der Zunge fuhr er sich über die Lippen. Sie waren gesprungen und er spürte den allgegenwärtigen Sand. Unwillkürlich hob er plötzlich die Hand.
»Warten Sie, Jin Mae! Ich komme!«
Sie wandte sich um. Er sah, wie sich ihre Mundwinkel zu der Andeutung eines Lächelns verzogen. Jin Mae schien mit sich zufrieden zu sein. Ganz so, als hätte sie keine Sekunde daran gezweifelt, dass er nachgeben würde. War es möglich, dass sie ihn so gut kannte? Obwohl sie sich erst vor einer Stunde begegnet waren?
Er rannte zu seinem Fahrrad, um es aufzuheben und auf die Ladefläche des Lastwagens zu wuchten.
Hoffentlich sitze ich am Freitag in diesem Flieger, sagte er sich. Wenn nicht, wird Friedrich mich umbringen.
3
Coonts schreckte mit einem Schrei aus dem Schlaf auf. Er glaubte, den stechenden Geruch von Kerosin in der Nase zu haben. Von Kerosin und von verbranntem Fleisch. Nein, das konnte nicht sein! Panisch schlug er um sich und bekam irgendwie ein Handgelenk zu fassen. Er packte es und jemand schrie.
Wo war er?
Er schüttelte den Kopf, um die Bruchstücke des Albtraums aus seinem Kopf zu vertreiben, doch da gruben sich Zähne in seinen Handrücken. Coonts schrie auf, aber er ließ das Handgelenk nicht los. Die Sig Sauer. Wo war seine Knarre?
Das Kopfkissen, Dummkopf. Darunter hast du sie verstaut.
Schnell stieß er seine Linke unter den Stoff. Seine Fingerspitzen spürten kaltes Metall. Tatsächlich. Erleichtert stieß er den Atem aus. Er verzog die Mundwinkel zu einem bösen Grinsen, als sich seine Hand um den Griff schloss, dann riss er die Pistole aus dem Versteck hervor. Er schlug mit ihr zu. So fest, wie er konnte.
Es krachte, als der stählerne Lauf einen Kiefer traf. Endlich gaben die Zähne seinen Handrücken frei. Jemand stöhnte wie ein verwundetes Tier.
Jetzt!
Er rollte sich zur Seite und war mit einem Mal über seinem Gegner. Erst jetzt ließ er das fremde Handgelenk los.
Sein Herz wummerte wie wild und er brauchte einen Moment, ehe er begriff: Es war eine junge Frau, die unter ihm lag. Ihre braunen Augen waren weit aufgerissen. Blut rann aus einer Platzwunde auf ihrer Stirn, wo der Lauf seiner Sig Sauer sie verletzt hatte.
»Non!«, flüsterte sie und schüttelte dabei den Kopf.
Ungläubig kniff Coonts die Lider zusammen. Als er sie öffnete, erwartete er, flackernde Flammen und die verkohlten Leiber seiner Kameraden von der 11th Light Brigade vor sich zu sehen, doch stattdessen blickte er erneut in das angsterfüllte Frauengesicht. Wie alt die Kleine wohl war? Vielleicht zwanzig, nicht viel älter. Ihre Haut blass wie Milch. Sie war nackt, bis auf eine silberne Kette mit einem Herz, die sie um den Hals trug.
Genau so eine hatte seine Mutter besessen. Sie hatte in einem Tabakladen gearbeitet. Er war zwölf gewesen, als sie von einem Junkie, der die Tageseinnahmen gewollt hatte, erstochen worden war.
Coonts sah, wie sich der Brustkorb der jungen Frau hob und senkte. Die Warzen ihrer Brüste waren nicht viel größer als eine Zwei-Pfund-Münze.
Mit der einen Hand packte er sie an der Kehle, mit der anderen presste er ihr die Pistolenmündung gegen die Schläfe.
Eigentlich hat die Kleine ein schönes Gesicht.
Zumindest nahm er an, dass es schön wäre, wenn sie nur lächeln würde, doch das tat sie nicht. Stattdessen stand ihr Panik ins Antlitz geschrieben. Verzweifelt versuchte sie, sich von seinem Gewicht zu befreien. Offenkundig fürchtete sie um ihr Leben.
Coonts wusste nur zu gut, wie das war.
Es war auf dem Flug in die Provinz Helmand in Afghanistan gewesen. Eben noch hatte er einen Witz über McEvans kleine Schwester gerissen, als auf einmal Kugeln durch den Rumpf ihres CH-47D pfiffen. Sofort sackte Dickens in sich zusammen. Aus seiner Brust schoss eine Blutfontäne. Die Hälfte seines Gesichts war weg. Er wand sich auf dem Boden. Die Schreie des Piloten vermischten sich mit einem schrillen Warnton, dann kippte der Hubschrauber auch schon zur Seite ab. Coonts klammerte sich an seinen Sitz, aber McEvans verschwand mit einem panischen Schrei durch die Seitentür. Unmittelbar darauf fielen sie wie ein Stein vom Himmel. Irgendetwas mit dem Heckrotor, jedenfalls waren das die letzten Worte ihres Piloten gewesen, ehe der Hubschrauber zerschellte.
Eben diesen Piloten sowie seinen Co-Piloten musste es als Erste erwischt haben. Ob die beiden infolge des Aufpralls oder in den Flammen des brennenden Wracks umgekommen waren, wusste Coonts bis heute nicht. Er und Little John waren aus der Maschine geschleudert worden. Dabei war sein linkes Bein wie ein trockener Ast gebrochen. Little John hatte weniger Glück gehabt. Ein scharfkantiges Metallstück hatte seinen Leib zerfetzt. Eine halbe Stunde lang hatte er auf seine heraushängenden Gedärme gestarrt und abwechselnd geweint und geschrien, ehe auch er endlich verreckt war.
Hätte Coonts doch nur den Mumm aufgebracht und Little John eine Kugel durch den dämlichen Kopf gejagt. Das Gewinsel seines sterbenden Kameraden verfolgte ihn noch immer in seinen Albträumen. Doch er hatte zitternd zwischen den rauchenden Trümmern gelegen, sich an sein Sturmgewehr geklammert und gebetet, dass ihn eine Rettungsmannschaft und nicht die Taliban finden mochten. An diesem Nachmittag hatte er gelernt, was echte Angst war.
Die junge Frau presste ein paar Wörter hervor. Er verstand nur wenige Brocken Französisch und seine Hand an ihrem Hals machte es nicht besser.
»Ich versteh kein Wort, hörst du?«, sagte er grob.
Die Fahrt in einem klapprigen Geländewagen von Jaisalmer nach Mumbai und der stundenlange Flug steckten ihm noch in den Knochen. Seit Helmand hasste er das Fliegen, hasste es wirklich.
»Wenn du willst, dass ich dich loslasse, musst du die Klappe halten!«
Die Französin schien zu begreifen, was er wollte. Tränen liefen über ihr Gesicht. Ihr Mascara war zu zwei traurigen Bächen verlaufen, aber wenigstens zappelte sie nicht mehr.
»Gut«, sagte Coonts.
Langsam nahm er die Knarre von ihrer Schläfe. Er wartete einen Moment, um sicherzugehen, dass die Kleine keine Dummheiten machte, ehe er sich von ihr hinunterrollte. Coonts schwang die Beine aus dem Bett und setzte die Füße auf den flauschigen Teppichboden. Darauf lagen seine Klamotten und daneben die Whiskyflasche. Sie war leer. Kein Wunder, dass er weder wusste, wo er war, noch wie die Kleine hieß.
Er stemmte sich auf. Mit unsicheren Schritten schwankte er zum nächsten Fenster. Auf der Fensterbank saß ein Teddybär mit einem roten Herz in den Armen. Coonts schob die geblümten Vorhänge beiseite. Er blinzelte in die Morgensonne. Durch das Fenster sah er ein Meer von Dächern und dahinter die Silhouette des Eifelturms. Paris. So ein Scheiß! Er konnte die Stadt nicht leiden. Die Stadt nicht und die Franzosen erst recht nicht.
In seinem Kopf hämmerte es wie verrückt.
Coonts wandte sich um. Er ließ seine Pistole auf das zerwühlte Laken fallen und presste sich die Hände gegen die Schläfen. Es half nicht. Natürlich. Seit dem Absturz waren die Kopfschmerzen sein ständiger Begleiter. Genauso wie die unkontrollierten Wutausbrüche und Albträume. Was hatte der Psychologe gesagt? Damals, als er den Untauglich-Stempel auf seine Papiere gedrückt hatte? »Kein Grund, sich zu schämen, Coonts. Sie haben eine posttraumatische Belastungsstörung. Das ist schon besseren Männern als Ihnen passiert.« Na klar, was für ein Scheiß! Am liebsten hätte er dem glatzköpfigen Wichser dafür die Faust in die Fresse gerammt. Was wusste der schon?
Das Fenster war angelehnt. Von draußen hörte er das Rumpeln eines Müllwagens.
»Weißt du, wie spät es ist?«, fragte er.
»Pardon?«
»Wie spät?!« Er deutete auf sein linkes Handgelenk.
»Six heures.«
Sechs Uhr? So früh? Coonts spürte, wie die Kopfschmerzen schlimmer wurden. Nun, immerhin wusste er jetzt, dass das Mädchen ein paar Brocken Englisch verstand.
Auf der Straße hupte jemand. Er knallte das Fenster zu, damit es ein wenig leiser wurde.
»Pass auf, Kleine. Es tut mir leid, wie das mit uns gelaufen ist. Ich habe nur einen über den Durst getrunken, das ist alles. Es war der Whisky. Der Whisky, okay? Ich bin kein Irrer, dem es Spaß macht, Frauen zu schlagen.«
Sie schwieg.
Dann eben nicht. War ja auch egal, was sie von ihm dachte.
Coonts bückte sich nach seiner Hose und zog sie an. In der vorderen rechten Tasche entdeckte er die Schachtel mit seinen Tabletten. Er öffnete sie, drückte zwei in seine Handfläche und schluckte sie hinunter.
Wie viele von den Tabletten nehme ich inzwischen am Tag?
Er war dabei, den Überblick zu verlieren, aber sechs waren es bestimmt. Er hatte versucht, mit weniger klarzukommen, doch dann wurden die Kopfschmerzen unerträglich. Coonts zerbiss die Tabletten. So wirkten sie schneller, redete er sich ein, auch wenn das wahrscheinlich Quatsch war. Shit, an den bitteren Geschmack konnte er sich einfach nicht gewöhnen. Er verzog das Gesicht und würgte sie trocken hinunter. Was für ein Pech, dass er die Whiskyflasche geleert hatte.
»Wenn mein Arzt wüsste, dass ich die Dinger wie Bonbons schlucke … Du verrätst mich doch nicht, oder?« Er lachte. Die Kleine antwortete nicht, aber das hatte er auch nicht erwartet. »Sag mal, ich weiß nicht mehr, was gestern Abend war. Habe ich dir die Kohle gegeben oder bekommst du noch was?«
Als er sich umwandte, blickte er in die Mündung seiner Sig Sauer. Die Knarre war auf seinen Bauch gerichtet. Die junge Frau hielt sie mit beiden Händen umklammert. Wie hieß sie eigentlich? Jeanette? Jacqueline? Irgendetwas mit einem J oder nicht?
Mann, du hast sie gefickt und kannst dich nicht einmal an ihren Namen erinnern? Wie kaputt bist du eigentlich?
Coonts lachte. Die Situation war saukomisch, oder nicht?
Die Kleine sagte etwas. Sie tat entschlossen, aber er ließ sich nicht täuschen. Das Beben ihrer Unterlippe verriet sie.
Er sah ihr direkt in die Augen. »Und? Hast du den Mumm, abzudrücken?«
»Tu es fou!«
»Verrückt? Ich?« Coonts ballte die Hände zu Fäusten. Er spürte, wie sich sein Pulsschlag beschleunigte. »Ach ja? Bin ich das? Nun, wenn du das denkst, dann solltest du mich wie einen tollwütigen Köter abknallen. Na los!«
Er starrte ihr geradewegs in die Augen. Seine Fingernägel bohrten sich in seine Handflächen. »Mach schon, verdammt!«
Einen Moment hielt sie seinem Blick stand, dann blinzelte sie.
Schade.
Sie sagte etwas und nickte zur Tür. Er sah, wie ihr Zeigefinger den Abzug suchte.
»Ich wette, es ist das erste Mal, dass du eine Knarre in der Hand hältst«, sagte er. »Keine Sorge, das ist eine Sig Sauer, die musst du noch nicht einmal entsichern. Einfach nur abdrücken, das ist alles.«
Er hob die Hand und streckte sie nach der Pistole aus. Ihre Augen weiteten sich vor Schrecken.
»Weißt du, so ein Neun-Millimeter-Projektil ist eine hässliche Sache. Wenn du mir in den Bauch schießt, zerfetzt es mir die Gedärme.«
Coonts musste an Little John denken. Nein, so wollte er nicht abkratzen. Seine Finger schlossen sich um den Lauf. Die junge Frau schluckte, drückte aber nicht ab. Selbst dann nicht, als er die Mündung von seinem Bauch wegbewegte.
»Wenn du mich wirklich erledigen willst, musst du mir den Schädel wegblasen«, sagte er und führte die Mündung der Sig Sauer an seine Stirn. »So geht das. Die Kugel zerfetzt meinen Schädel und lässt nur Brei von meinem Hirn übrig, da kannst du dir sicher sein. Komm schon, bring es endlich zu Ende.« Sie rührte sich nicht. »Na los! Los!«
Sie erschrak. Ihr Zeigefinger berührte den Abzug.
Langsam atmete er ein. »Gut so.«
Die Mündung der Waffe war kühl. Sie fühlte sich nicht unangenehm an, im Gegenteil. »Und jetzt zählst du bis drei. Es ist ganz leicht, glaub mir. Du traust dich nicht? Pass auf, dann zähle ich. Wenn ich drei sage, musst du nur den Finger krümmen. Fest krümmen und dann ist es vorbei. Hab keine Angst, Mädchen, du tust mir damit einen Gefallen.«
Er sah sie an. Ihre Hände zitterten.
»Eins.«
Das Zittern wurde stärker. Es breitete sich von den Händen über den ganzen Körper aus. Selbst ihre Zähne schlugen aufeinander. Beinahe tat sie ihm leid. Beinahe.
»Zwei.«
Jetzt schaffte sie es noch nicht einmal mehr, den Lauf an seinen Kopf zu pressen. Coonts griff nach der Waffe und drückte die Mündung an die Mitte seiner Stirn. Als Krüppel wollte er auf keinen Fall enden. In einem Rollstuhl, lallend und mit weggeblasenem Unterkiefer. Er hatte genug Kameraden gesehen, denen man die Scheiße vom Hintern abwischen musste. Wie einem Baby. Nein, das war schlimmer als der Tod.
Coonts schloss die Augen.
Wenn, dann sollte es schnell vorbei sein. Ein für alle Mal.
»Drei«, flüsterte er.
Er lauschte in sich hinein. Sein Herzschlag war fest und gleichmäßig. Langsam atmete er aus. Er spürte keine Furcht, stattdessen erfüllte ihn eine tiefe Gelassenheit. So gut hatte er sich seit Jahren nicht gefühlt. Gleich … Wie würde es wohl sein? Würde er das Mündungsfeuer durch die Lider aufflammen sehen? Den Knall der Patrone hören? Etwas spüren? Er hielt die Luft an.
Nichts.
»Dumme Kuh!«
Coonts riss die Augen auf. Natürlich, die Kleine hatte nicht den Mumm.
»Du nutzloses, dummes Ding!«, schrie er sie an. Mit einem Ruck riss er ihr die Waffe aus der Hand. »Bist du denn nur zum Ficken zu gebrauchen?«
Sie öffnete den Mund, sagte aber kein Wort. Die Wut übermannte Coonts. Mit dem linken Handrücken versetzte er ihr eine schallende Ohrfeige. Rücklings stürzte sie zu Boden.
»Verdammt!«, schrie er. »Ich habe dir eine Chance gegeben. Eine Chance, mit heiler Haut davonzukommen. Aber du? Du bist zu feige, sie zu nutzen. Weißt du, was passiert, wenn man zögert? Weißt du es?«
Er richtete die Waffe auf die Frau vor seinen Füßen. Sie rührte sich nicht, doch das silberne Herz um ihren Hals blitzte im Schein der aufgehenden Sonne. Coonts wusste, dass er nicht abdrücken würde. Wütend über sich selbst schob er die Waffe in seinen Hosenbund. Schnell streifte er sich seinen Rollkragenpullover über und verdeckte mit ihm die Sig Sauer. Zum Schluss schlüpfte er in seine Sneaker und verstaute das verschlüsselte Smartphone in der Hosentasche. Es wäre besser gewesen, wenn die Kleine geheult hätte, doch die ganze Zeit über sagte sie kein Wort. Sie starrte ihn nur stumm an. Ihre Wange war rot.
Coonts zog ein Bündel gerollter Banknoten hervor.
»Hier«, sagte er und warf ihr ein paar Fünfzig-Euro-Scheine vor die Füße.
Wenn er etwas hatte, dann Geld. Er hasste seinen neuen Job. Hasste ihn, wie er sonst nur die Army und sich selbst hasste. Aber wenigstens brachte er mehr ein als der Dienst für Königin und Vaterland.
Er wandte sich um und stürzte aus dem Zimmer.
Mit einem Knall krachte die Tür ins Schloss. Wahrscheinlich dachte die Kleine, dass er durchgedreht war.
Scheiß drauf, sie ist eine Nutte, sonst nichts.
Er stürmte die schmale Treppe hinunter. Er nahm immer zwei Stufen auf einmal. Im Ersten starrte eine weißhaarige Frau aus ihrer Wohnungstür. Sie musste den Lärm gehört haben. Coonts stieß sie so grob beiseite, dass sie mit einem erschrockenen Schrei rückwärts über die Schwelle ihrer Wohnung stolperte und lang hinschlug. Es kümmerte ihn nicht, er eilte weiter. Erst als er in das Leder seines schwarzen BMWs fiel, den er vor dem Haus in der Rue de Renard geparkt hatte, atmete er aus.
Der Laptop lag auf dem Beifahrersitz. Er beugte sich hinüber, klappte den Computer auf und identifizierte sich mit seinem Daumenabdruck und Passwort. Auf einen Tastendruck hin startete das Mailprogramm. Automatisch baute die Software eine verschlüsselte Satellitenverbindung zu einem Hochsicherheitsserver in Brasilien auf. Zehn Sekunden vergingen, dann öffnete sich ein Fenster und Coonts sah das hochauflösende Farbfoto eines Mannes mit Halbglatze, Brille und sorgenvollem Gesichtsausdruck vor sich.
»Doktor Malraux, Jacques«, las er. »54 Jahre.«
Immerhin, jetzt kannte er den Grund, weshalb er in diese verschissene Stadt geschickt worden war.
4
Vor ein paar Stunden hatten sie die asphaltierte Straße verlassen. Jetzt waren sie auf einer holprigen Sandpiste unterwegs, die durchs Nirgendwo führte. Finn lehnte mit dem Rücken an der Heckklappe des Lastwagens. In der Hand hielt er Alisas Brief. Das Crossrad lag vor seinen Füßen. Die Reifen waren dreckverkrustet.
Als er mit einem »Hello!« auf die Ladefläche geklettert war, hatte der weißhaarige Greis kurz den Kopf gehoben und ihm zugelächelt. Seitdem starrte der Alte teilnahmslos vor sich hin. Die Frauen und kleinen Kinder, die zwischen den Kartonstapeln hockten, dösten. Nur ab und zu weinte eines der Babys.
Der Lkw rumpelte durch ein Schlagloch. So ging es schon seit Stunden. Finn unterdrückte einen Fluch. Jeder Knochen in seinem Körper schmerzte von der holprigen Fahrt und bei jeder Erschütterung knallte ihm die Heckklappe in den Rücken. Er wandte sich um und schob die Plane ein Stück beiseite. Vom Ziel ihrer Reise war noch immer nichts zu sehen, aber wenigstens hatte der Sandsturm nachgelassen.
Was sollte er die Einladung betreffend nur tun? Nachdenklich betrachtete er das cremefarbene Papier mit den ineinanderverschlungenen Goldringen.
Ein Wunder, dass ihn der Brief vor seinem Abflug aus den Vereinten Arabischen Emiraten erreicht hatte. In den letzten Jahren war er selten länger als ein paar Tage an einem Ort gewesen: Tripolis und Tel Aviv, dann Abuja, Mogadishu und schließlich Dubai. Der Job brachte es nun einmal mit sich, dass sein Leben ein einziges Durcheinander war. Er war kein Dummkopf, nur vielleicht nicht immer ganz ehrlich zu sich selbst: Seine ständige Abwesenheit war der Grund dafür gewesen, dass Alisa einen Schlussstrich gezogen hatte. Und jetzt sollte in ein paar Tagen ihre Hochzeit stattfinden. Eine standesamtliche, keine kirchliche Trauung. »Alles Gute, Finn«, hatte Alisa in ihrer geschwungenen Handschrift unter die gedruckten Zeilen geschrieben. Die drei Worte klangen wie ein Abschied.
»Ist wohl besser so«, sagte er zu sich.





























